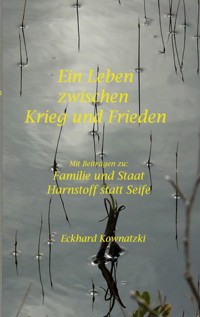
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Den Bericht über seine Erinnerungen, Interessen und Werte widmet Eckhard Kownatzki seinen Enkeln. Sie beginnen mit der Flucht 1945 aus dem damals deutschen Osten und enden mit dem Ruhestand im Schwarzwald in Sichtweite schneebedeckter Alpengipfel. Dazwischen liegen die Schulzeit, das Studium und die Tätigkeit als Arzt und Immunologe an deutschen und amerikanischen Kliniken und Instituten. Auf der Suche nach dem eigenen Weg kam er mit drei Arten der Wahrheitsfindung in Kontakt, der religiösen, der wissenschaftlichen und der intuitiven. Von der religiösen oder besser kirchlichen distanzierte er sich bereits als Jugendlicher. Um die wissenschaftliche bemühte er sich in seinem Beruf, sah aber auch hier Einschränkungen durch menschliche Unzulänglichkeiten. Intuition öffnete ihm den Zugang zu anderen Menschen. Seine Enkel ermuntert er, ihren eigenen Weg zu finden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich der Bevormundung durch Besserwisser, Bestimmer und Autoritäten zu widersetzen. Den Bericht ergänzen zwei Anhänge zu Themen, die ihn in seinem Ruhestand beschäftigten. "Familie und Staat" beklagt die staatliche Ehepolitik, die Verstöße gegen das kirchliche Lebenszeitgebot ahndet und damit den Zusammenhalt von Familien gefährdet. "Harnstoff statt Seife" kritisiert die Zerstörung von Schutzfunktionen der Haut durch synthetische Seifen und empfiehlt, Harnstoff statt Seife zur Hautreinigung zu verwenden. Die Texte von Internetauftritten zu beiden Themen sind hier für die Nachfahren erhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Den Bericht über seinen Werdegang, seine Interessen und Werte widmet Eckhard Kownatzki seinen Enkeln. Er beginnt mit der Flucht 1945 aus dem damals deutschen Osten und endet mit dem Ruhestand im Schwarzwald in Sichtweite schneebedeckter Alpengipfel. Dazwischen liegen die Schulzeit, das Studium und die Tätigkeit als Arzt und Immunologe an deutschen und amerikanischen Kliniken und Instituten. Auf der Suche nach dem eigenen Weg beschäftigte er sich mit religiöser, wissenschaftlicher und intuitiver Wahrheitsfindung. Um die wissenschaftliche bemühte er sich in seinem Beruf, sah aber auch hier Einschränkungen durch menschliche Unzulänglichkeiten. Seine Enkel ermuntert er, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen und die Entscheidung darüber nicht Besserwissern und Bestimmern zu überlassen.
Den Bericht ergänzen zwei Anhänge zu Aktivitäten im Ruhestand. "Familie und Staat" beklagt eine Ehepolitik, die zu viel für die Bewahrung der christlichen Lebenszeitehe und zu wenig für die Familien tut. "Harnstoff statt Seife" kritisiert die Zerstörung von Schutzfunktionen der Haut durch synthetische Seifen und empfiehlt, Harnstoff statt Seife zur Hautreinigung zu verwenden. Die Texte früherer Internetseiten zu beiden Themen sind hier für die Nachfahren erhalten.
Inhaltsverzeichnis
I Zwischen Krieg und Frieden
1 Krieg
1.1 Flucht
1.2 Kriegsende
2 Nachkriegszeit
2.1 Nahrungssuche
2.2 Hofleben
2.3 Schule
2.4 Neue Heimat
2.5 Nachwirkungen
3 Erwachsen werden
3.1 Sport
3.2 Gott und die Welt
3.3 Musik und Theater
3.4 Eltern
3.5 Geschwister
3.6 Licht und Schatten
4 Ausbildung und Beruf
4.1 Zwischen Klinik und Forschung
4.2 Harnstoff statt Seife
4.3 Wissenschaft und Wahrheit
5 Mein Weg
5.1 Erste Familie
5.2 Der Workshop
5.3 Neues Leben
5.4 In Bewegung
5.5 Familie und Staat
5.6 Rückblick und Ausblick
II Familie und Staat
Die Mitspieler
Die Rollen
1 Wertsache Familie
1.1 Partnerschaft
1.2 Reife Liebe
1.3 Liebesersatz
1.4 Leben mit Kindern
1.5 Eltern für Kinder
1.6 Kinder für Eltern
2 Freunde und Helfer
2.1 Familienfreund Kirche
2.2 Kirchenfreund Staat
2.3 Pseudo-Feminismus
2.4 Rechtswegweiser
3 Heiratsschwindler Staat
4 Selbstbestimmung
4.1 Ehe ja - nein
4.2 Kinder
4.3 Halbe-halbe
4.4 Familienzerstörung per Gericht
4,5 Ehe-Schrott
4.6 Vereinbarung
4.7 Muster
5 Kernsätze
III Harnstoff statt Seife
Das Problem
Die Lösung
Inhaltsstoffe
Gerätschaften
Herstellung
Rezepturen
I Zwischen Krieg und Frieden
1. Krieg
1.1 Flucht
"Habt ihr schon gehört? Wir müssen hier weg". Wir Kinder wussten noch nichts, als uns Gert darüber informierte, dass unser Ort in 24 Stunden geräumt werden musste. Dabei war der 14-jährige Schüler erst kürzlich aus Bochum zu uns gekommen, weil häufige Bombenangriffe das Leben in seiner Heimatstadt unsicher machten. Verglichen mit Bochum führten wir in Friedeberg/Neumark (heute: Strelcze), dem kleinen, von einer alten Stadtmauer rings umgebenen Kreisstädtchen 100 km östlich von Berlin und südöstlich von Stettin, auch Anfang 1945 noch ein friedliches Leben. Die Bochumer Schüler waren in diese Idylle evakuiert worden, gingen hier zur Schule und wohnten bei Friedeberger Familien, so auch bei uns. Nun war der Krieg auch bei uns angekommen. Die Bochumer mussten wieder zurück in den Westen, und dahin sollten auch wir.
Meine Eltern waren erst sechs Jahre zuvor (1939) mit ihren drei kleinen Kindern, ich als Jüngster noch Säugling, nach Friedeberg gezogen. Beide stammten aus dem Osten Deutschlands, der Vater aus Allenstein in Ostpreußen (Olcztyn), die Mutter aus der Nähe von Bromberg (Bydgocz) in der Provinz Posen. Beide wollten wieder in den Osten zurück und machten den ersten Schritt nach Friedeberg, wo mein Vater eine Stelle als Jurist in der Friedeberger Kreisverwaltung annahm.
Ein Jahr nach dem Umzug wurde mein Vater, 36 Jahre alt, zum Militär eingezogen. Die Nazis hatten inzwischen Polen angegriffen und brauchten für ihre völkischen Abenteuer Soldaten. Das galt besonders, als England und Frankreich ihrerseits Deutschland den Krieg erklärten. Mein Vater hatte seit seiner Studentenzeit an militärischen Übungen teilgenommen, weil er es für seine Pflicht hielt, seinem Land im Notfall auch mit der Waffe zu dienen. Die Vorstellung, dass in einer Regierung Verbrecher sitzen und dass ein von ihnen angezettelter Krieg nicht als Notfall zu werten ist und deswegen keine Unterstützung verdient, war in seiner Welt nicht vorgesehen.
An Friedeberg ging der Krieg zunächst weitgehend vorbei. Wir wohnten in einem aus Kindersicht geräumigen Haus mit großem Garten. Neben Gemüse- und Obstbeeten blieb für die Kinder genügend Platz zum Schaukeln, Spielen, Dreirad oder Ruderrenner fahren (ein Vierrad mit handgetriebenem Gurtantrieb und Steuerung mit Füßen über die Vorderradachse). Schneidiger ging es auf den Straßen zu, wo Hitlerjungen in schmucker Uniform und Lederriemen schräg über die Brust mit Fahnen, Trommeln und Pfeifen von irgendwoher nach irgendwohin marschierten.
Um Friedeberg herum gab es fünf Seen, einer davon gleich außerhalb des Driesener Tores. Ihn zu umschreiten dauerte eine Stunde. Das war ein beliebter Spaziergang für die Großen, für einen Sechsjährigen aber schon eine ermüdende Leistung. Zu einem entfernteren See fuhren wir 1944 zum Maifeiertag auf einem geschmückten Pferdewagen mit anderem Jungvolk. Die Gesänge begleitete ein Schifferklavier. Am Ziel wurde gepicknickt, und es wurden Wettkämpfe wie Sacklaufen und Eierlauf ausgetragen.
Ganz unbeeinträchtigt vom Krieg scheint aber unser Leben nicht gewesen zu sein. Auf einer Photographie der inzwischen fünf Kinder mit Mutter und deren Mutter sieht man keine fröhlichen, sondern eher bedrückte und sorgenvolle Gesichter.
Einmal rückte der Krieg etwas näher, als ein Flugzeug der Luftwaffe auf einem Acker nahe der Stadt notlanden musste. Die abgestellte Maschine durfte ich zwar ansehen, aber der Termin zur Besichtigung des Flugzeuginneren durch die Bevölkerung lag am Nachmittag zur Zeit meines Mittagschlafes. Während die beiden älteren Geschwister daran teilnehmen durften, ließ sich meine Mutter nicht erweichen, mir aus diesem wichtigen Grund die Pflicht zum Schlafen zu erlassen. Ich wollte manchmal heute, meine Nachmittagsruhe könnte jemandem so wichtig sein.
Unsere Familie wurde regelmäßig zu Freunden eingeladen, die 5 km von Friedeberg entfernt eine größere Landwirtschaft betrieben. Während man in der Stadt Nahrungsmittel nur noch mit Rationierungsmarken bekam, konnten wir uns dort an Braten und Torten satt essen. In der Regel wurden wir mit einer von Pferden gezogenen Kutsche abgeholt und abends wieder nach Hause gefahren.
Bei der letzten Heimfahrt in Dunkelheit beobachteten wir einen Luftangriff auf Stettin. Scheinwerfer der deutschen Flugabwehr tasteten über den Himmel. Angreifende Flugzeuge warfen Lichter zur Beleuchtung des Zielgebietes ab, die wie ein liegender Weihnachtsbaum aussahen. Es war ein schöner, aber mit dem Wissen des Anlasses zugleich schauriger Anblick. Später habe ich in Hamburg das Ergebnis solcher gegen die Zivilbevölkerung gerichteter Bombardierungen gesehen, ganze Viertel, in denen nicht ein Haus mehr stand.
Nach den Durchhalteparolen, die andernorts mit Terror-maßnahmen durchgesetzt wurden, musste plötzlich alles ganz schnell gehen. Innerhalb von 24 Stunden sollte Friedeberg geräumt sein. Es wurde ein Treck organisiert, der am Morgen des 15. Januars 1945 die Stadt in Richtung Westen verließ. Allerdings hatte man zu lange mit dieser Maßnahme gewartet, oder man war nicht schnell genug; denn die russische Armee war an der Ostsee nach Westen vorgestoßen, erreichte den hinteren Teil des Trecks durch eine Südwärtsbewegung und verhinderte die weitere Flucht der Langsameren.
Davon erfuhren wir erst später; denn meine Mutter hatte nach der Bekanntgabe des Evakuierungsbefehls in zähen Bemühungen schließlich die Genehmigung erwirkt, mit ihren fünf Kindern und der Großmutter die Stadt mit der Kleinbahn zu verlassen. Dabei war es hilfreich, dass einer lokalen Nazi-Größe gerade das gleiche zugestanden war. So geschah es am nächsten Morgen. Im Kinderwagen der noch nicht zweijährige Jüngste, in den Tiefen ein Paket Persil-Waschpulver als besonderer Schatz und über allem ein dickes Federbett. Wirkliche Wertsachen waren im Garten vergraben, wo sie allesamt leichte Beute russischer Soldaten wurden.
Die "kleine Frieda" dampfte zunächst in Richtung Osten. Dann stiegen wir in einen richtigen Zug mit normaler Spur-weite um. Mit dem ging es Richtung Schwerin. Soweit war die russische Armee noch nicht vorgedrungen, und so hatten wir eine unbeeinträchtigte Reise. An Einzelheiten kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern.
In Schwerin fanden wir irgendwo Aufnahme. An Kriegshandlungen oder Bombardierungen kann ich mich auch aus diesen Tagen nicht erinnern. Allerdings erinnere ich mich an die Straßenbahnen, die mit Geklingel durch die Straßen fuhren und deren Fahrerbereich vom Wageninne-ren durch eine leuchtend blaue Glasscheibe getrennt war. Wir besuchten den Schweriner Zoo, wo auf mich den stärksten Eindruck der Seeelefant Roland machte.
Wir reisten dann weiter nach Celle, wo uns Verwandte von mütterlicher Seite aufnahmen. Hier war es grimmig kalt. Der gefallene Schnee verschaffte uns wie vielen anderen Kindern ein unverhofftes Rodelvergnügen am Celler Schloss. In Celle trafen wir meinen Vater, der von seiner Truppe zu einem Lehrgang über Chemiewaffen abkommandiert worden war. Er brachte uns schließlich zur Weiterreise zum Bahnhof und verschaffte uns als Offizier lautstark Zugang zu einem Urlauberzug, der eigentlich für Zivilisten nicht zugelassen war.
Der Zugverkehr in jenen Tagen war chaotisch. Man fuhr mit allem, was sich bewegte und einen seinem Ziel näher brachte. Unser Ziel war das Dorf Gieboldehausen im Eichsfeld, 25 km östlich von Göttingen und 10 km westlich vom Harz. Wir mussten mehrfach umsteigen, was jedes-mal mit stundenlangem Warten verbunden war. Man war ständig auf einen Fliegerangriff gefasst; denn die Flugzeuge der Alliierten nahmen besonders gern die Transportwege unter Beschuss. Es konnte deswegen lebens-rettend sein, sich vorsorglich den Weg zum nächsten Luftschutzkeller einzuprägen. Wir waren bei Dunkelheit in Celle abgefahren und kamen bei Dunkelheit in Giebolde-hausen an, müssen also für die Strecke von 200 km mehr als 12 Stunden gebraucht haben.
1.2 Kriegsende
In Gieboldehausen hatte der Neffe meiner mütterlichen Großmutter, Martin Deetjen, die Pacht des Rittergutes der Familie von Miningerode von seinem Vater übernommen. In dem Verwalterhaus, in dem er mit seiner Frau Hilda im Erdgeschoss wohnte, wurden im Obergeschoss zwei Zimmer für uns und ein drittes für die Großmutter frei gemacht. Der eine Raum von ca 20 qm wurde als Wohnküche genutzt. Er hatte einen Herd, der mit Holz und Kohle betrieben wurde und der gleichzeitig zum Heizen und Kochen diente. Eine Eckbank und Stühle umstanden den Esstisch, an dem auch die Schularbeiten gemacht wurden. Der andere Raum war das Schlafzimmer für Mutter und fünf Kinder und, wenn der Vater zu Besuch kam, für alle sieben. Er war nicht heizbar, und deswegen bildeten sich im Winter an der nach Süden gerichteten feuchten Außenwand Eiskristalle. Jemand bezeichnete ihn deswegen scherzhaft als Kristallpalast.
Im selben Gebäude wohnten eine Schwester der Großmutter, mit ihrer Tochter Ina sowie die Schwester von Martin. Es war eine große Familie mit einem Überwiegen der Frauen. Jede Familie hatte Kriegstote zu beklagen: der Bruder meiner Mutter, Henner Hoyer; ein Verlobter von Ina; und so kurz vor Kriegsende kam die Nachricht vom Tod des Bruders von Hilda. Trösten in der Chaossituation stelle ich mir schwierig vor.
Die Verwandten gaben sich alle Mühe, meine Mutter bei der Erziehung ihrer fünf Kinder zu unterstützen, womit sie sie offensichtlich für überfordert hielten. Erziehung war nach ihrem Verständnis vor allem die Ermahnung, ruhig zu sein.
Im Obergeschoss gab es eine Toilette für alle diese Bewohner. Sie war modern, nämlich mit Wasserspülung. Das wurde ihr und uns in dem sehr kalten Winter von 1945/46 zum Verhängnis; denn sie fror ein. Dann mussten wir uns in der Kälte über den Hof zu dem kältesicheren Plumsklo neben der Scheune begeben. In der Situation wusste man einen Nachttopf für das kleine Geschäft zu schätzen. Wir lebten dort sechs Jahre, bis wir in den Rohbau eines eigenen Hauses in Maschen bei Hamburg einzogen. Zu der Zeit hatte Onkel Martin bereits die Pacht des Gutes in Gieboldehausen mit dem Hof seiner Schwiegereltern in Grupenhagen bei Hameln vertauscht.
Das Rittergut hatte all die Bestandteile, die ich später bei adligen Besitzungen in den ehemaligen deutschen Ostge-bieten fand: das Herrenhaus, in Gieboldehausen auch Schloss genannt, das Wohnhaus für den Verwalter bzw. Pächter, die Stallungen für Pferde, Kühe und Schweine und die Scheunen, in denen das Futter für die Tiere (Heu und Korn) und das Streugut (Stroh) lagerten. In der Schmiede wurden Hufeisen und Eisenteile für die Pferdefuhrwerke und Ackergeräte geschmiedet und die Pferde beschlagen. Es gab ferner einen großen Gemüsegarten und einen Park mit schönen alten Bäumen. Im Park war ein Karpfenteich. Hatte sich im Winter dickes Eis gebildet, so wurde es in Stücken herausgesägt und in einem in die Erde gelassenen Eishaus in Torf gelagert. Es hielt sich dort auch in der Sommerhitze und wurde zu Festlichkeiten und Kindergeburtstagen zur Herstellung von Speiseeis verwendet. Im Winter liefen wir auf dem Teich Schlittschuh.
Das Gut ist später in den Besitz der Gemeinde übergegangen. Das Verwalterhaus sowie alle Stallungen und Scheunen wurden abgerissen und mit ihnen auch das Tor, durch das man von der Straße auf den Hof gelangte. Stehen geblieben ist das immer noch sehr schöne Herrenhaus mit seinem sichtbaren Fachwerk. Erhalten geblieben ist auch der jetzt öffentliche Park mit dem Teich. Neben dem fand ich bei einem kürzlichen Besuch das steinerne Fundament des Eishauses, das aber im übrigen zugeschüttet war. Intakt fand ich ferner den metallenen Überbau eines Ziehbrunnens vor dem Herrenhaus. Ihn hatte ich als erstes gesehen, als ich am Morgen nach unserer Ankunft 1945 zum Fenster hinaus sah.
In den Wochen danach trafen noch weitere Flüchtlinge auf dem Gut ein, Adlige, die den langen Weg vom Baltikum mit Pferdewagen zurückgelegt hatten. Sie wurden im Herrenhaus einquartiert, wohnten aber auch dort ähnlich beengt wie wir. Das gleiche galt für einen Schuhmacher aus Ungarn, der mit seiner Familie im Verwaltergebäude wohnte. Auf dem Hof lebten anfangs ferner ca fünf Polen, Männer und Frauen, die offensichtlich von den deutschen Truppen aus Polen verschleppt worden waren und in der Landwirtschaft halfen.
Wir waren dank der Beharrlichkeit meiner Mutter und mit Glück gerade einem Krieg entkommen, den wir nicht recht wahrgenommen hatten. Am Ende unserer Flucht in Gieboldehausen kam nun der Krieg wahrnehmbar auf uns zu. Im Gegensatz zum Osten wurde hier auch in der Luft gekämpft. Das bedeutete, dass wir nachts das Verdunke-lungsgebot strikt zu befolgen hatten. Wenn bei Dunkelheit Innenräume beleuchtet waren, hatte man die Fenster mit Vorhängen, Kartons oder Decken lichtundurchlässig zu verschließen.
Helle Beleuchtung war jedoch kaum möglich, denn eine Stromversorgung gab es allenfalls sporadisch. Als Leuchten dienten Petroleumlampen. Bei ihnen tauchte das eine Ende eines Dochts in die Petroleumkammer ein und saugte den Brennstoff an, der am anderen Ende mit Luftzufuhr verbrannte. Durch einen Drehknopf ließ sich mehr oder weniger Docht freilegen und damit die Helligkeit regulieren; außerdem wurde abgebrannter Docht damit ersetzt. Das Brennen fand in einem Glaszylinder statt, der in eine Metallhalterung eingesetzt wurde. Die Petroleum-beleuchtung war eine komplizierte und frustrierende Angelegenheit. Oft rußte die Flamme und schwärzte den Zylinder von innen, was schwer zu säubern war. Das zarte Glas der Zylinder brach gern mit und ohne Grund, und an Ersatz war nur schwer heranzukommen.
Auch Petroleum war schwer zu ergattern. Das war mit einem Mal anders, als bekannt wurde, dass man sich an einem auf den Bahngleisen abgestellten Tankwagen bedienen konnte. Ganz Gieboldehausen pilgerte mit allen verfügbaren leeren Behältnissen zum Bahnhof und mit gefüllten wieder nach Hause. Dem machten plötzlich ohne erkennbaren Grund deutsche Soldaten ein Ende. Sie untersagten das Abfüllen, nur um am nächsten Tag die gesamte kostbare Flüssigkeit in Flammen aufgehen zu lassen, damit sie nicht den vorrückenden alliierten Truppen in die Hände fiel.





























