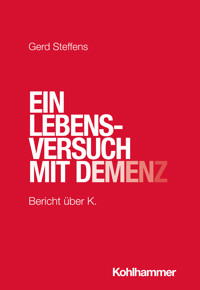
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Demenz ist eine neurologische Erkrankung mit einschneidenden sozialen Folgen. Denn sie trennt die Erkrankten nach und nach von den Gewissheiten, an denen unser Alltag und unser Leben mit den anderen hängt. Kann dennoch ein gemeinsames Leben gelingen? Der Autor, der seine Frau zehn Jahre lang durch ihr Leben mit Demenz begleitet hat, dokumentiert einen Weg, der von verstörender Entfremdung in einen gelingenden, wenn auch immer brüchigeren Alltag führt. Im nachdenkenden Umgang mit seiner erkrankten Frau lernte er, auch scheinbar unverständliche Äußerungen als Hilferufe eines Selbst zu vernehmen, das um sein Überleben kämpft. Das Buch bietet einen neuen und ungewöhnlichen Blick auf Demenz. Aus der Innensicht des alltäglichen Umgangs werden Möglichkeiten erkundet, Menschen mit Demenz besser zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort
Vorwort
Wie die Demenz in unser Leben kam
Rätselhafte Findlinge
Unbegriffene Entfremdungen
Zwei mächtige psychische Mechanismen
Umzug in den Norden
Andalusien
»Genießen Sie Ihr Leben, Frau S.!«
Die Ordnung des Alphabets und die Ordnung der Dinge
Zwischen Wollen und Können
Ein schreckliches Paar
Zwischenlagen und Selbstkonflikte
Schreiben als Rettungsversuch?
»Da gibt's ja noch ein frisches Licht!« – Tagebucheinträge 9/2017 bis 5/2020
»Vor zehn Jahren habe ich alles noch genau gewusst. Geht das so mit mir noch?«
»Ich bin so froh, dass meine Hände das mit meinen 77 Jahren noch so gut können«
»Ich muss meinem Kopf beibringen, dass Du derselbe bist«
»Die Frau freut sich doch, wenn ich sie so begrüße!«
»Ich fühle mich dann wie 17«
»Du hast mich schon immer intellektuell nicht ernst genommen!«
»Du bist mein Mann, ich bin deine Frau, ich freue mich so, dass ich mich wieder erinnere«
»Hilf meinem messrigen Gedächtnis!«
»Ich kann mich nicht erinnern. Aber du kannst das«
»Ist das frech?«
»In meinem Alter bin ich wie ein kleines Kind, finde ich«
»Das kommt so aus meiner Brust, dass ich fragen will«
»An meinem Fuß sind Süßigkeiten. Kannst du mal kratzen?
»Bleibe ich dann da?«
»Die Vögel sehen doch, dass ich ein Mensch bin. Trotzdem singen sie zu mir«
»Die Oma da!«
»Vielen Dank für die Tierchen!«
»Nimmst du mich wieder mit zu dir nach Hause?«
»Da stellt sich uns jetzt die Pflanze in den Weg!«
»Du bist so ein versorgender Mann. Bin ich eine unzulässige Frau? Was kann ich für Dich tun?«
»Früher konnte ich Spanisch, jetzt habe ich alles vergessen«
»Das ist ja noch nie passiert, dass ich nicht essen darf!«
»Da, da kannst du dich hinsetzen!«
»Nun machen wir doch die Erfahrung, dass morgens fast immer etwas im Briefkasten ist, aber mittags viel seltener«
»Tue ich genug zu deiner Achtung? Das wäre wichtig für mich!«
»Leg dich doch auch noch ins Bett, da werden wir nicht angegriffen«
»Wenn ich fitter bin, kann ich dir wieder länger vorspielen. Aber es ist spät in meinem Leben«
»Versprich mir, dass du mich nach Hause bringst«
»Es ist gut zu sterben«
Demenz und Menschen mit Demenz verstehen? – Ein Erfahrungsbericht
Von außen oder von innen auf Demenz blicken?
Wie denken Menschen mit Demenz? Und wie nicht mehr?
Das Geländer im Tag
Wie eine widersinnige Umerziehung meiner selbst
Die Rückkehr der Empathie
Im Abgrund der Zeit
Leseerfahrungen – Auf der Suche nach Informationen und Erklärungen
Ratgeber
Leitlinien und Handbücher
Einblicke in die Gedächtnisforschung
Denken, Bewusstsein, Kommunikation
Abschiede im Leben – erzählende Literatur
Der Autor
Gerd Steffens, Prof. Dr. phil., (geb. 1942), hat viele Jahre als Gymnasiallehrer (Deutsch, Geschichte, Politik) gearbeitet. Von 1998 bis 2007 war er Professor für politische Bildung und ihre Didaktik an der Universität Kassel und von 2001 bis 2021 Mitherausgeber des »Jahrbuchs für Pädagogik«. Seine Lehrtätigkeiten waren, ebenso wie seine wissenschaftlichen Publikationen, für ihn eine lebenslange Herausforderung des Verstehens und Interpretierens von Personen und Texten, von Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen, von Welt- und Selbstverständnissen. Gerd Steffens begleitete seine Frau K. zehn Jahre lang durch ihre Demenz. Darüber zu schreiben begann als ein Versuch der Selbstrettung und wurde zu einer besonderen Erfahrung der Aufarbeitung. Dieses Buch erzählt die Geschichte ihres gemeinsamen »Lebensversuchs mit Demenz«.
K.
K. (1941 – 2020) hat nach einer Ausbildung in einer Apotheke zunächst ein Studium in Spanisch und Englisch, dann ein Magister-Studium in Pädagogik abgeschlossen. Sie hat in der Erwachsenenbildung gearbeitet, hatte Lehraufträge an Hochschulen zu Sozialpädagogik und Migration, und sie war Leiterin eines regionalen Migrationsdienstes der Caritas. Die Arbeit mit Migranten war auch außerhalb des Berufes ihr wichtigstes Tätigkeitsfeld.
Gerd Steffens
Ein Lebensversuch mit Demenz
Bericht über K.
Mit einem Geleitwort von Thomas Fuchs
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043510-0
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-043511-7epub:ISBN 978-3-17-043512-4
Geleitwort
von Thomas Fuchs
Gerd Steffens’ »Lebensversuch mit Demenz« ist ein besonderes Buch, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Der Autor beschreibt nicht nur mit großer Feinfühligkeit das Zusammenleben mit seiner demenzkranken Frau über mehrere Jahre hinweg. Er gibt auch Einblicke in seine inneren Reaktionen, Hoffnungen und Ängste, in seine Versuche, sich der drohenden Entfremdung entgegenzustellen, die ihn schließlich zum Tagebuchschreiben als einer Form der Reflexion und Bewältigung veranlassen. Er verfolgt die zunehmenden Einschränkungen seiner Frau nicht nur mit liebevoller Anteilnahme, sondern analysiert sie auch mit philosophisch unterstützten Überlegungen und gelangt so zu der Auffassung, dass die kognitiven Veränderungen in der Demenz mit dem Schema des Gedächtnisverlusts nicht zureichend beschrieben sind. Er entdeckt hinter dem Verlust der autobiographisch begründeten Identität ein anderes, ein »dementes Selbst«, das verzweifelt um seine Erhaltung und Anerkennung kämpft. Und er erkennt die bis zuletzt alles überragende Rolle der Beziehung, in deren Rahmen auch rätselhaftes Verhalten der Kranken eine Erklärung finden kann, nämlich sofern man »auch im zunächst Unverstehbaren eine Mitteilung« zu erkennen sucht (▸ Vorwort).
Demenz wird zumeist als ein allmähliches Verlöschen des Gedächtnisses verstanden, dem immer mehr Details und Zusammenhänge verloren gehen. Steffens macht uns auf eine andere, oft früher auftretende, aber nicht leicht zu durchschauende Veränderung aufmerksam, die im Verlust der integrierenden und synthetisierenden Vermögen des menschlichen Geistes besteht. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit, Einzelnes in höherstufige Bezugssysteme einordnen und zwischen diesen flexibel wechseln zu können. Dass gerade der Test des Uhrenzeichnens so frühzeitig auf eine Demenz hinweist, hat mit der Fähigkeit zu tun, zwischen zwei Bezugsrahmen zu wechseln, die er prüft: Der Kreis des Zifferblatts zeigt einmal 60 Minuten, das andere Mal aber 12 Stunden an; wenn man also die beiden Zeiger so zeichnen soll, dass sie z. B. »10 nach 10« anzeigen, dann bedarf dies einer hohen kognitiven Umstellungsfähigkeit.
Das Gleiche gilt für die Perspektivenübernahme: Sich in den Standpunkt eines anderen hineinversetzen, also von der eigenen Zentralperspektive absehen zu können, kann für die Patienten bereits früh eine Überforderung bedeuten. Die Störung der örtlichen und zeitlichen Orientierung ist gleichfalls in dem Verlust der Fähigkeit begründet, die eigene Situation gleichsam aus der Vogelperspektive zu sehen und sie in einen übergeordneten räumlichen oder zeitlichen Rahmen einzuordnen. Daher ist im vorliegenden Buch die Erhaltung eines gemeinsamen Zeithorizonts eines der Leitmotive des Umgangs mit der Krankheit. Auch Ironie wird für die Patienten unverständlich, da diese mit verschiedenen Bedeutungsebenen spielt. Und wenn Steffens feststellt: »Demenz nicht wahrhaben zu wollen, gehört offenbar zum Wesen der Demenz«, dann erklärt sich auch dieses für die Angehörigen oft schwer begreifbare Fehlen der Krankheitseinsicht durch den Verlust der kritischen Reflexivität, der Fähigkeit, sich von außen zu sehen.
Es ist dieses zunehmende Unvermögen der Patienten, die sonst selbstverständlichen Perspektiven, Sichtweisen und Ordnungen unseres gemeinsamen Lebens zu erfassen, die sie früh eine tiefgreifende Verunsicherung und Entfremdung erfahren lässt. Umso eindrucksvoller ist es, wie es dem Autor gelingt, trotz des Fortschreitens der Krankheit einen »gemeinsamen Lebenshorizont« zu finden und zu bewahren. Dazu gehört vor allem, den »Rückzug der Zeit ins Jetzt« anzunehmen; den gemeinsamen Gewohnheiten, Wiederholungen und Routinen des Alltags Aufmerksamkeit zu schenken; und das Selbst der Partnerin nicht mehr in den kognitiven Vermögen zu suchen, die eine Person in unserem üblichen Verständnis auszeichnen, sondern in ihren Gefühlen, Gesten und Blicken, in der unermüdlichen Suche nach Beziehung und Anerkennung, in einem unendlichen Vertrauen. So kann sich die anfänglich verstörende Entfremdung nach und nach zu einer »Gewissheit von Nähe und Zusammensein« verwandeln; und in der Zwischenleiblichkeit der Berührung bleibt die personale Beziehung bis zuletzt erhalten.
Bei aller Reflexion vermittelt Gerd Steffens’ Tagebuch vor allem die gelebte Erfahrung einer elementaren und vielleicht darum oft so schwer zu erlangenden Mitmenschlichkeit. Mit Anteilnahme folgt der Leser den schweren ebenso wie den berührenden und beglückenden Momenten des Zusammenlebens, und sofern er in ähnlicher Lage ist, wird er diesen »Lebensversuch mit Demenz« als hilfreich und tröstlich empfinden. Denn die Demenz ist kein Verlöschen der Person, im Gegenteil: Sie kann uns zeigen, was uns im Kern als Personen ausmacht, nämlich die Fähigkeit, Wärme und Liebe zu geben und selbst zu empfinden.
Heidelberg, im Juni 2023
Prof. Dr. Dr. Thomas FuchsKarl-Jaspers-Professor für Philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg
Vorwort
Wir hatten schon etliche Jahre mit diesem ungebetenen Hausgast gelebt, bevor ich begann, über unser Leben mit der Demenz meiner Frau zu schreiben. Lange hatten wir ihn nicht zur Kenntnis genommen, als sei sein Räuspern nur ein Knarren der Tür, nichts Beunruhigendes in der fortdauernden Normalität unseres Lebens. Als er lauter wurde, entwickelten wir Techniken des Überspielens, jeder auf seine Weise. Doch wiesen K.s Versuche, zu verbergen, was ihr an ihr selbst fremd wurde, nur umso stärker auf das Befremdliche hin. Und mein Ausweg, mir als vorübergehend zu erklären, was mich doch immer wieder erschreckte, führte von Mal zu Mal ins Leere. Der ungebetene Hausgast hatte die Regie unseres Lebens übernommen.
Als ich mir das eingestand, wurde klar: Ich musste lernen, auf eine andere Weise mit K.s Demenz umzugehen, als sie mal genervt, mal gelassen zu ertragen. Ob Schreiben dabei helfen könnte, besser zu sehen, vielleicht zu verstehen, wie die Demenz unser Leben veränderte? Und welche Spielräume für einen Alltag blieben, in dem wir beide weiterleben könnten? Wenn ich nicht nur Mit-Leidender und Mit-Handelnder in einer unentrinnbaren Geschichte wäre, sondern zugleich deren Beobachter? Ich würde zumindest versuchen, auch von außen auf das zu blicken, was ihr, uns und mir geschah.
Was als ein verzweifelter Griff nach einem Haltepunkt begann, hat sich in zahlreichen Tagebucheinträgen niedergeschlagen. Ich lese sie heute als einen dokumentierenden Bericht über unseren »Lebensversuch mit Demenz«. Die Einträge gehen fast immer von konkreten Beobachtungen aus und versuchen, an ihnen etwas zu verstehen. Oft sind es rätselhafte Verhaltensweisen oder Reden, Verstörungen in Raum und Zeit, an denen sie anknüpfen. Oder Verwirrungen über Identitäten oder überschießende Gefühle und heftige Auftritte.
Nach und nach veränderte sich, so merkte ich bald, mein Blick. Zuerst hatte er auf K. wie auf ein Objekt geschaut, dessen rätselhafte Bewegungen es zu registrieren galt, damit ich besser auf sie reagieren könnte, ihnen vielleicht ausweichen oder sie einbeziehen könnte. Doch je deutlicher ich bemerkte, dass K.s rätselhafte Äußerungen und Verhaltensweisen, auch wenn sie wie Eruptionen einer unverstehbaren Welt wirkten, an mich gerichtet waren, K. mir also etwas sagen wollte, desto nachdrücklicher fragte ich mich: War da nicht doch – entgegen verbreiteten Meinungen über Demenz – ein Selbst, das sich erhalten wollte und um sein Überleben kämpfte? Eine Person, die sich gegen ihr Entschwinden stemmte? Ich begann, auf die Hilferufe dieses Selbst zu achten, verstand nun, dass ich es dort abholen sollte, wo es sich in Raum oder Zeit verloren hatte oder wo K. sich in der Geschichte ihres Lebens nicht mehr auskannte. Klar, ihre endlos sich wiederholenden Fragen dokumentierten einen erschreckenden Gedächtnisverlust – doch waren sie nicht auch der verzweifelte Versuch, sich selbst in der Welt festzuhalten, auch wenn es nur mehr die kleine Welt der unmittelbaren Umgebung war?
K.s »dementes Selbst«, wie ich es für mich nannte, wurde nach und nach, darüber berichten die Tagebucheinträge, zu einem Schlüssel. Durch ihn verstand ich sie selbst, ihre oft rätselhaften Aktionen, ihre Krankheit und deren Erscheinungsweisen besser. Aber auch mich selber und wie ich mit ihrer Krankheit und unserem Leben umgehen könnte. Und für K. muss meine Aufmerksamkeit auf ihr beschädigtes Selbst wie eine Befreiung gewirkt haben. Denn nun sprach sie wieder von sich und schaute auf uns. Sie lebte wieder in einem geteilten Horizont. Auch wenn es nur der Horizont einer schmalen Welt des Hier und Jetzt war, immer vom Zusammenbruch bedroht, doch immer wiederherstellbar, sogar noch in K.s letzten Tagen.
K.s unerwarteter Tod im Mai 2020 hat mich im Gefühl einer ungewöhnlichen Erfahrung zurückgelassen. Für uns beide hatte sich ein Stück geteilten Lebens wiederhergestellt, ein Winkel der Gemeinsamkeit, in den K. aus allen Turbulenzen und Verwirrungen zurückkehrte, in welche die Demenz sie und uns stürzte. Selbst bei einer so schweren Demenz konnte ein Lebensgleichgewicht gefunden werden, in dem beide sich spürten und gut fühlten. Wie war es dazu gekommen? Wie hatte nach hoffnungsloser Entfremdung ein wieder geteilter Horizont entstehen können, warum hatte sich der Vorhang, der unsere Welten getrennt hatte, wenigstens ein Stück weit wieder gehoben?
Als ich meine Notizen später im Zusammenhang las, sah ich die Spuren unseres Wegs deutlich. Trotz der abrupten Wendungen, totalen Orientierungsverluste, Stürzen in Abgründe des Vergessens, die die Demenz erzwang, kamen die beiden Spuren immer wieder zusammen. Und beide, die da gegangen waren, hatten dazu beigetragen. K. durch ihre Resonanzbedürfnisse, deren Anrufe ich zu vernehmen lernte. Ich selbst, indem ich beobachtete und nachdachte, um auch im zunächst Unverstehbaren eine Mitteilung, eine an mich gerichtete Botschaft zu finden und K.s Blick auf ein gemeinsames Sichtfeld zu erkennen.
Ob diese Erkundungen im unwegsamen Gelände der Demenz, die mir so sehr geholfen haben, auch anderen hilfreich sein könnten? Vertraute Menschen, die die Notizen lasen, sahen das so, und auch die, die von weiter her davon gehört hatten und aus Interesse am Umgang mit Demenz gelesen hatten. Dann aber, wenn sie auch für andere sein sollten, brauchten die Tagebucheinträge, die die letzten zweieinhalb Jahre unseres Lebens protokolliert hatten, eine Einbettung in die Geschichte unseres Lebens.
Deshalb erzählt das einleitende Kapitel, wie die Demenz in unser Leben kam und seine selbstverständlichen Gewissheiten nach und nach zerstörte. Demenz ist ja nicht nur eine neurologische Erscheinung, sondern auch eine soziale Krankheit. Sie trennt die Erkrankten Schritt für Schritt von den Gewissheiten, an denen unser Leben mit den anderen hängt. Und so wenig die Erkrankten durchschauen können, was da mit ihnen geschieht, so wenig können ihre Nächsten die Merkwürdigkeiten einordnen, die zunächst nur gelegentlich vorfallen. Wenn solche rätselhaften Findlinge in der Landschaft des normalen Lebens sich nach einiger Zeit zu unwegsamen Geröllfeldern gehäuft haben, kann auch bei den Angehörigen der Erkrankten eine Orientierungskrise ausbrechen, die durch Selbstbeschwichtigungen nicht mehr zu besänftigen ist. So ist es mir ergangen. Daher berichte ich davon, wie sich unser Leben unter der Hand veränderte, bis das verstörende Gefühl, im eigenen Leben nicht mehr zu Hause zu sein, auch mich ergriff und meine Suche auslöste, wie wir trotz Demenz und mit ihr weiterleben könnten.
Diese Suche ist in den Tagebucheinträgen dokumentiert, die den Hauptteil dieses Buches bilden. Sie sind authentisches, dokumentarisches Material des jeweiligen Tages. Ich habe sie gekürzt, manches leichter lesbar gemacht, Wiederholungen vermieden, wo das möglich war. Aber da Wiederholung eine bestimmende Eigenart der Demenz ist, kehren Themen und Verhaltensweisen unvermeidlich wieder, erzeugen eine eigentümliche Bewegtheit im Immergleichen. Diese eigenartige Dynamik ginge verloren, wenn die Einträge unter thematischen Gesichtspunkten zusammengefasst würden, z. B. den Raum- und Zeitverlusten, den Identitätshavarien, den Verlusten von Wörtern und Begriffen, K.s Teilhabebedürfnissen oder auch meinen Gewissens- und Selbstkonflikten. Statt die Texte nach solchen Gesichtspunkten meines Beobachtens und Nachdenkens zu ordnen, habe ich die ereignishafte, chronologische Folge der Notizen lieber durch Worte von K. rhythmisiert, mit denen sie sich selbst oder Situationen kommentiert hat oder die sich der rätselhaften Poesie der Demenz verdankten.
Einige Zeit nach K.s Tod konnte ich ein Stück weiter zurücktreten und neu auf unseren »Lebensversuch mit Demenz« blicken. Der Erfahrungsbericht, den ich nun schreiben konnte, bildet den dritten Teil dieser Publikation. Die Frage seiner Überschrift Demenz und Menschen mit Demenz verstehen? zielt auf die vielleicht größte Unsicherheit im alltäglichen Umgang mit Demenz. Die Frage wird ganz unterschiedlich, fast schroff gegensätzlich beantwortet. Indem ich meine Suche nach Sinnspuren in K.s Verhalten als einen Weg beschreibe, auf dem ich lerne, ihre Stimme als Stimme eines eigenen, sehr lebendigen Selbst wahrzunehmen, beantworte ich die umstrittene Frage mit einer klaren Ermutigung. Es lohnt sich, von einem – wenngleich beschädigten – Selbst der von Demenz Betroffenen auszugehen, statt sich hinter den Schutzwall der Unverstehbarkeit zurückzuziehen. Wie das jeweilige »demente Selbst« sich äußert und zur Geltung bringt, ist gewiss von Fall zu Fall verschieden und wird sehr stark von den Lebenseindrücken abhängen, die sich in ihm erhalten haben. Genauso wird der Zugang, den andere Menschen zum Selbst von Demenzkranken finden, sich von meinem Weg unterscheiden. Ehrlichkeit und Authentizität verlangen, meinen Weg konkret zu beschreiben. Doch verallgemeinerbar an ihm sind nicht die einzelnen Schritte, sondern das Ziel und die Aufmerksamkeit, die der Weg erfordert.
Die Dokumentation meiner Erfahrung wäre nicht vollständig, wenn ich nicht auf Literatur hinwiese, die mir geholfen hat. Daher beschreibe ich in einem kleinen Anhang Leseerfahrungen, was mir auf meiner Suche an Aufschlussreichem begegnet und worin es mir hilfreich gewesen ist.
Es bleibt eine Frage, die sich nicht stillstellen lässt. Weil mein Bericht über unseren »Lebensversuch mit Demenz« nur Sinn hat, wenn die Bewegungen beider Personen in ihren konkreten Lebensumständen anschaulich werden, bieten die Texte einen sehr direkten, fast intimen Einblick in unser Leben, auch wenn die Chiffrierung der Namen einen Anschein von Anonymität und Distanz schafft. Darf ich diesen Blick auf meine kranke Frau zulassen, ihn sogar durch eine Veröffentlichung herbeiführen? Zwei Wahrnehmungen helfen mir. Die eine betrifft den Umgang mit Demenz im Allgemeinen. Es ist richtig, so habe ich gelernt, sich nicht von diskretem Verschweigen und Verbergen leiten zu lassen. Wie froh war ich immer, wenn wir auf Menschen trafen, für die K.s Demenz eine selbstverständliche Gegebenheit des Lebens war. Der zweite helfende Impuls kommt aus der Geschichte selbst, die ich dokumentiert habe: Wie K. um ihr verlöschendes Selbst gekämpft hat, verdient eine Erinnerung.
Gleichwohl hätte ich die Hürde der Publikation kaum ohne die Ermutigung derjenigen aus Familie und Freundeskreis überschritten, die uns nah und vertraut begleitet haben. Sie haben in den Jahren der Demenz K.s desorientierte Zuwendung liebevoll beantwortet und mir mit aufrichtigen Gesprächen geholfen. Sie waren es auch, die als erste meine Texte lasen und sie an Menschen weitergaben, deren Leseinteresse sich aus eigenen, persönlichen oder professionellen, Erfahrungen im Umgang mit Demenzkranken oder mit Publikationen dazu ergab. Sie alle wissen, wie dankbar ich für ihre genaue Lektüre, ihr abwägendes Urteil und die kritische Ermutigung bin.
Ein glücklicher Umstand war, dass ich bald nach K.s Tod, auf der Suche, mein Verständnis von Demenz weiter zu klären, auf die Arbeiten von Thomas Fuchs gestoßen bin. In ihnen begegnete ich einer wissenschaftlichen Sicht, an die viele meiner Beobachtungen und Überlegungen sich anschließen und weiter klären konnten. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Thomas Fuchs meinen Texten einen fachlichen Rahmen gibt.
Sehr zu schätzen weiß ich, dass mein Projekt im Kohlhammer Verlag eine durch Professionalität, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit geprägte Umgebung gefunden hat, die zugleich fachlich und doch offen für den eigenen Blick reflektierter Erfahrung ist.
Dankbar und respektvoll denke ich an all diejenigen Menschen, die mit Gelassenheit und Einfühlungsvermögen mit den oft überraschenden Äußerungen der Demenz umgehen können. Dafür habe ich unsere Hausärztin und ihre Mitarbeiterinnen und K.s Neurologin bewundert wie auch die Mitarbeiterinnen der Tagespflege. Ebenso erstaunlich viele Menschen, die mit spontaner Empathie K. wie selbstverständlich einschlossen und Momente des Glücks spendeten.
Personen- und Ortsnamen habe ich in der Regel durch Buchstabenkürzel chiffriert, gelegentlich durch allgemeinere Bezeichnungen ersetzt. Davon erhoffe ich eine dezente Distanz, die gleichwohl den dokumentierenden Charakter der Texte erhält.
Wie die Demenz in unser Leben kam
Demenzen haben eine lange und schweigsame Vorgeschichte. Bei Alzheimer-Demenz können Jahrzehnte vergehen, bis toxische Veränderungen im Stoffwechsel der Nervenzellen zu Schädigungen werden, für die das erfindungsreiche Hirn keine Überbrückungen mehr findet. Wenn diese verborgene Vorgeschichte an die Oberfläche zu treten beginnt, setzt eine zweite Vorgeschichte ein. Gelegentliche Merkwürdigkeiten können die Umgebung irritieren oder verärgern. Doch eine bleibende Beunruhigung lösen sie nicht aus, weil die gewohnte Verlässlichkeit des Verhaltens sich gleich wieder einstellt. Auch diese zweite Vorgeschichte kann sich über Jahre hinziehen. Erst im Blick zurück lassen sich die Merkwürdigkeiten dieser Zeit, die wie Findlinge rätselhafter Herkunft in der Landschaft des gewohnten Lebens herumliegen, als Ausdruck eines verborgenen Zusammenhangs deuten, als Vorgeschichte einer Demenz.
Rätselhafte Findlinge
Wo in unserem Leben bin ich unvermutet solchen Merkwürdigkeiten begegnet und was habe ich mir dabei gedacht? Eine der ältesten Irritationen, an die ich mich erinnere, geschah so: Autofahren in einer beidseitig beparkten, nicht sehr breiten Straße. K. auf dem Beifahrersitz. Sie schreit entsetzt auf: »Du fährst zu dicht ran!« Ich ziehe den Wagen etwas nach links, weil ich glaube, sie meine ihre, die rechte Seite. Sie schreit erneut auf: »Du fährst ja noch dichter ran!« Sie hat offenbar meine Seite, die linke, gemeint und ich sage: »Aber ich habe hier noch ein bis eineinhalb Meter Platz.« Sie widerspricht, ist kaum zu beruhigen, ich sage, ich könne das nach links aus meiner Sicht doch genauer sehen als sie vom Beifahrersitz aus, doch das scheint gar nicht bei ihr anzukommen. Als die Enge vorbei ist, verschwindet ihre Aufregung, ebenso meine Irritation. Doch als in einer ähnlichen Fahrsituation Gleiches sich wiederholt, denke ich darüber nach. Nimmt sie den Unterschied der Perspektiven nicht mehr wahr? Kann nicht mehr wie selbstverständlich verstehen, dass aus meiner Sicht die Situation links etwas anders aussieht als vom Beifahrerplatz aus? Das wäre eine richtige Spur gewesen. Doch wusste ich auch, dass sie seit einem leichten Auffahrunfall, den sie einige Jahre vorher gehabt hatte, peinlich auf Abstände achtete, und ordnete ihren Aufschrei dem zu.
Etwas anderes fiel mir, wie ich meine, relativ früh, in der Veränderung unserer Frühstücksgewohnheiten auf. Wir hörten beim Frühstücken Radio, lasen Zeitung und unterhielten uns über das, was wir lasen oder hörten. Irgendwann bemerkte ich, dass das für K. nicht mehr funktionierte. Ich hatte etwas im Radio gehört, etwas Aufregendes oder was sie besonders interessieren musste, wollte mit ihr darüber reden, aber sie hatte das nicht mitbekommen. Als die Erfahrung sich wiederholte, ersetzten wir die Info-Sendung durch eine Musik-Sendung. K. war froh darüber, ich meine, sie hätte damals gesagt, beides zusammen, Zeitung lesen und Berichte aus dem Radio zu hören, sei ihr nun zu viel. Ich schrieb das, wie vermutlich sie selbst auch, unvermeidbaren Altersverlusten zu. Nicht im Entferntesten ahnte ich, dass mich bis zu ihrem Tod beschäftigen würde, wie die Zugänge zu ihrem Kopf sich regelten. Zuletzt konnte ich ihr ansehen, wann beides, Eingang und Ausgang, blockiert war oder wann die Ampel in ihrem Kopf eine der beiden Richtungen, hinein oder heraus, frei gab.
Eine andere Situation: Wir fuhren von F., unserem spanischen Wohnort, nach Granada, eine vertraute Strecke mit oft spektakulären Sichten. Von der Küste aus hat die Autobahn eine Höhendifferenz von 1.000 Metern zu überwinden. Als ich bei stärkerer Steigung einen Gang runterschalte, fährt K. mich an: Das sei umweltfeindlich, im niedrigeren Gang verbrauche das Auto mehr. Ich verweise auf mein Fahrgefühl, wenn der Motor hier auf niedrigeren Touren laufe, verringere das die Manövrierfähigkeit. Sie beharrt, ich versuche erneut zu erklären, eine Spirale, die sich verselbständigt, obwohl der Anlass der Szene längst vorbei ist. Mich trifft ein heftiger Fluchtimpuls: »Halt einfach auf dem Seitenstreifen an, steig aus, greif dir deinen Rucksack, sag: Du kannst jetzt allein weiterfahren, und mach dich querfeldein davon. Ruf sie heute Abend an, vielleicht hat ihr der Schock geholfen, zur Besinnung zu kommen.« Ich folge dem Fluchtimpuls nicht, einfach davonzulaufen bin ich nicht gewohnt, und eine so dramatische Geste wäre ganz außergewöhnlich in unserer Beziehung. Doch einige Jahre lang habe ich immer wieder gedacht: »Genau das hättest du damals tun sollen, das hätte ihr vielleicht zu Bewusstsein gebracht, wie total unangemessen es ist, wegen Kleinigkeiten, die man so oder so handhaben kann, einen Streit vom Zaun zu brechen, als ob es ums Ganze ginge.« Denn solche Situationen kehrten wieder und ich dachte bei mir: »Warum siehst du nicht, K., in welchem Missverhältnis dein Verhalten zu seinem unbedeutenden Anlass steht?«
Eine vielleicht unvermeidliche Folge des Alterns, sagte ich mir dann, man redet nicht umsonst von Altersstarrsinn. Das musst du als Gegebenheit hinnehmen, dich darauf einrichten. Und konnte es nicht sein, dass bei K, die immer schon sehr direkt gesagt hatte, was sie für richtig hielt, sich dieser Zug im Alter zuspitzte bis hin zur Rechthaberei in Kleinigkeiten? Das war eine Erklärungsweise, die sich in ein Gleichgewicht von Nähe und Distanz hineinnehmen ließ, wie es sich bei uns entwickelt hatte. Wie bei vielen miteinander vertrauten, aufeinander eingespielten Paaren. Wir beide hatten ja ausgeprägte Interessen- und Aktivitätsfelder, auf denen wir auch im Ruhestand unterwegs waren, Milieus von Kontakten, die oft zugleich professionell und freundschaftlich waren.
Wenn ich von heute auf diese Episode und meinen Fluchtimpuls zurückblicke, sehe ich: Es musste sich schon einiges an Leidenserfahrung in mir angesammelt haben, dass ein Fluchtwunsch wie ein Blitz in mir einschlagen und eine Spur hinterlassen konnte, die bei ähnlichen Erfahrungen immer wieder aufglomm. Solange jedenfalls, bis ich begriff, dass es die Anzeichen einer Demenzerkrankung waren, die mich verstört zurückgelassen hatten. Die Granada-Episode muss sich um 2010 zugetragen haben, erst im Sommer 2014 hatten sich meine Ahnungen so verdichtet, dass ich K. einen Termin mit einer Neurologin vorschlug.
Unbegriffene Entfremdungen
War ich besonders dickfellig, ein großer Verdränger? Wir hatten viele glückliche Tage, Zeiten entspannten Lebens in diesen Jahren. Es lohnte sich also, über die plötzlichen Einschläge rätselhaften Verhaltens hinwegzusehen und auf die eingespielte Vertrautheit unseres Lebens zu setzen, die sich nach jedem dieser Zwischenfälle problemlos wiederherstellte. Und unsere Lebensrhythmen blieben ja erhalten. Beide waren wir auf Feldern aktiv, die uns aus unseren beruflichen Tätigkeiten geblieben waren. K. führte ihre Orientierungskurse für Migranten bis 2013 fort, gab auch 2010 – 2012 noch Fortbildungskurse für Erzieherinnen in Kitas, war weiter in der Stadtteilarbeit aktiv oder im Vorstand des Halkevi, des türkischen Volkshauses, und engagierte sich nach dem Schock der NSU-Morde in einem Bündnis gegen Rechts, besuchte Fachtagungen, vor allem zur Migrationsgeschichte, und initiierte 2011 eine Ausstellung »50 Jahre türkische Einwanderung nach O.-R.«, die großen Anklang fand.
Doch hatte sich etwas an ihr verändert. Das merkten, wie ich heute weiß, viele, die mit ihr zu tun hatten. Während es ihr für das Ausstellungsprojekt 2011 noch gelungen war, ihr vertraute Menschen zu gewinnen, scheiterte sie im folgenden Jahr bei einem ähnlichen Projekt im größeren Nachbarort. K. bat mich dringend, mit ihr in die Besprechungen zu gehen, weil sie nicht vorankam. Tatsächlich erlebte ich dort 2012 in mehreren Sitzungen, wie die Vorschläge, die K. machte, ins Leere liefen, schon verabredete Arbeiten nicht aufgenommen wurden. Es war, als habe niemand außer K. Lust auf das Projekt, ohne zu sagen, warum. Damals bin ich zwei Erfahrungen, die mich in den kommenden Jahren begleiten würden, zum ersten Mal begegnet: Der Haltung teils abwehrender, teils fürsorglicher Distanz gegenüber einem Menschen, dem etwas Befremdliches schon anzuhaften scheint. Und – in mir selbst – dem Konflikt zwischen Stellvertretung und Selbstbewahrung. Denn Stellvertretung war es, worum K. mich fast flehend zu bitten schien. An ihrer Stelle sollte ich überzeugen, Motivation vermitteln, zupacken und praktische Schritte einleiten. Sie spürte, offenbar nicht zum ersten Mal, dass sie irgendwie nicht mehr ankam, sich nicht mehr wie selbstverständlich in einem gemeinsamen Raum des Vertrauens und Verstehens bewegen konnte.
Ich bin damals ihrem unausgesprochenen Wunsch nicht gefolgt. Das hätte den Verzicht auf einen guten Teil meiner eigenen Arbeitsprojekte und Interessen bedeutet. Ich brachte ihr nahe, dass doch all diese engagierten Menschen von ihren eigenen Arbeiten so beansprucht seien, dass kaum Kraft für ihr, K.s, Ausstellungsprojekt bliebe. Sie nahm es hin, ohne überzeugt zu sein, und legte es in jenem Innenraum für Unerledigtes und Unbegriffenes ab, in dem, wie ich später verstanden habe, etwas daran weiterarbeitete.
Bei ihrem eigenen Teilprojekt zur Migrationsgeschichte in D. ist K. übrigens geblieben. Mit großer Geduld erstellte sie im Archiv der Stadt an exemplarischen Gruppen eine Übersicht über Herkunft und Berufe von Zugewanderten und fügte sie einem Text an, der nach einer glättenden Bearbeitung durch den Redakteur in einer Zeitschrift für Regionalgeschichte erschien. Doch als sie einige Jahre später Exemplare dieser Publikation erhielt, legte sie sie beiseite, als sei es eine unwillkommene Botschaft aus einem früheren Leben.
In das Jahr 2012 führen auch die Erinnerungen von Freundinnen an befremdliche Erlebnisse mit K. zurück. K. war seit einigen Jahren Schriftführerin im Vorstand des Halkevi, des türkischen Volkshauses. Sie hatte diese Aufgabe gern übernommen, weil sie dabei mit ihren Kenntnissen hilfreich sein und ihre langjährigen Freunde aus der türkischen Migration unterstützen konnte. Wir beide waren oft im Halkevi, sei es zu Veranstaltungen, sei es zum Mittagessen oder weil wir dort mit Freunden verabredet waren. Deshalb konnte ich die Klagen, mit denen sie nun von Vorstandssitzungen zurückkam, gar nicht nachvollziehen. Dort werde häufig Türkisch gesprochen, so dass – oder damit? – sie nicht verstehe. Wie solle sie dann ihre Aufgabe als Protokollantin erfüllen? Außerdem: wenn sie sich integrieren wollen, sollen sie doch Deutsch sprechen! Das war gerade aus K.s Mund total befremdlich, und solche Äußerungen entsetzten ihre Freunde dort, die sich durch manche ihrer Bemerkungen an abschätzige Klischees erinnert fühlten, gegen die K. doch seit Jahren zu Felde gezogen war! Wie konnte sie die Leitmotive ihrer beharrlichen und mutigen Arbeit aus dem Auge verlieren? Gerade was die Sprache angeht: immer hatte die Vielfalt der Sprachen sie doch fasziniert, sie hatte die Bildungsanreize mehrsprachiger Milieus verteidigt, hatte noch bis vor kurzem die Kindergärtnerinnen in Kursen für Mehrsprachigkeit und deren aufschließende Signale sensibilisiert. Und hatte sie nicht seit Jahrzehnten zahllosen Menschen dabei geholfen, über die sprachlichen Barrieren hinweg mit hiesigen Verhältnissen und Behörden zurechtzukommen? Das war doch immer ihre besondere Stärke, nicht nur, weil sie selbst einige Sprachen sprach, sogar ein wenig Türkisch gelernt hatte, sondern auch, weil sie sich in die sprachliche Hilflosigkeit von Flüchtlingen einfühlen konnte. Sie selbst war ja als junge Frau ohne besondere Sprachkenntnisse nach Südamerika gegangen. Und sie hatte sich wie kaum jemand sonst aus ihrem Umfeld intensiv mit den vertrackten Haltungen der Überlegenheit auseinandergesetzt, auf die Zugewanderte in Behörden oder im gesellschaftlichen Umfeld treffen können. Und nun wiederholte sie Klischees, die sie früher als rassistisch gebrandmarkt hätte. K. sei, so erzählte mir eine Freundin später, wie ein anderer Mensch gewesen, sie hätten sie kaum wiedererkannt.
Sie selbst fühlte sich unverstanden, ja geradezu gemobbt. Es war, als hätte sich ein Vorhang zwischen sie und ihre Freunde gesenkt, durch den man sich noch wahrnehmen, aber nicht mehr verstehen konnte. Sie muss die Empfindung, irgendwie fremd geworden zu sein, nicht mehr zu passen, oft in diesem Jahr 2012 gehabt haben. Ihr Kalender ist voller Termine, sie hat versucht, alle ihre Tätigkeiten fortzuführen, viele Gelegenheiten für unbegreifliche Frustrationen. Unter ihren Dateien finde ich einen Brief an den Oberbürgermeister, zu dem sie aus früheren Arbeitsbegegnungen ein gutes Verhältnis hatte. Sie beklagt sich, dass alle ihre Versuche, die Stadt zur Unterstützung des Projekts zur Migrationsgeschichte zu gewinnen, unbeantwortet geblieben seien. Nun fordert sie per Einschreiben eine Stellungnahme. Eine Tür war zugefallen.
Zwei mächtige psychische Mechanismen
Ich hatte mir schon angewöhnt, aufmerksamer auf sie zu achten, wenn wir außerhalb des Hauses waren. Wenn es noch nötig gewesen wäre, trainierte mich darin eine dreiwöchige Chinareise im Herbst 2012, auf der ich sie kaum aus den Augen ließ, damit sie sich nicht irgendwo verlor. Ganz im Unterschied zu früher war nun nicht mehr sie es, die viel leichter als ich auf Menschen zuging und Kontakte knüpfte. Nun schien sie in der Gruppe, in der wir reisten, immer auf meine Vermittlung angewiesen, um sich zugehörig zu fühlen. Als eine Reiseteilnehmerin, mit der K. ein wenig in einer Stadt gegangen war, mir danach fast mit einem Unterton der Empörung sagte: »Ihre Frau versteht ja gar keine Ironie«, habe ich auch das unter der Rubrik »Flexibilitätsverluste im Alter« abgelegt. Doch hätte ich diese Bemerkung wohl nicht behalten, wenn nicht schon etwas in mir daran gearbeitet hätte, genauer wissen zu wollen, was da vor sich ging. Bei K. schienen Denkweisen, die mit Spiegelung von Perspektiven ineinander spielten und daraus ihren Witz zogen, nicht mehr zu funktionieren. Ich hatte das selbst ja auch erfahren, als ich ein gutes Jahr zuvor ihr Geschenk zum 70. Geburtstag, ein Spinett, mit etwas kalauernden Versen begleitet hatte. Ich hatte sie mir beim Joggen mit viel Vergnügen ausgedacht, weil ich mir dabei ihr Vergnügen vorstellte, wenn sie sie las. Doch als ich ihr meine witzige Sammlung überreicht hatte, hatte sie sie bald beiseitegelegt und war nie wieder darauf zurückgekommen.
So viele Anzeichen und doch kein Verdacht? Es gab zwei mächtige psychische Mechanismen, die gegen den Schrecken des Eingeständnisses lange erfolgreich anarbeiteten: in mir eine Normalisierungsmaschine, in K. eine Dissimulationsmaschine. Dissimulation, so lernte ich später, ist eine Haltung von Kranken, auch von Dementen, die Symptome und Auffälligkeiten verdecken möchten. K. wurde in den Jahren ihrer Demenz zu einer Meisterin der Dissimulation, des Überspielens, der Vorkehrungen und des Vermeidens. Seit Mitte der ›Nuller Jahre‹, so sah ich später in ihren zahlreichen Arbeitsordnern, hatte ihr Bedürfnis sprunghaft zugenommen, für ihre Lehrveranstaltungen und Kurse jeden der Vermittlungsschritte, oft auch recht kleine, auf Folien festzuhalten. Sie schaffte sich damals einen eigenen Projektor an, den sie immer mitnahm, falls in einem der Veranstaltungsräume ein Projektor fehlte. Was sie dazu trieb, war eine Panik vor dem Verlust des Zusammenhangs, die Angst davor, plötzlich nicht mehr weiter zu wissen in Gebieten, die ihr doch seit Jahren und Jahrzehnten vertraut waren. So minutiös mit Vortragsfolien und Arbeitsblättern vorbereitet, konnte sie ihre Kurse – zuletzt Fortbildungen und für Erzieherinnen und Deutsch- und Orientierungskurse für Einwanderer – bis in das Jahr 2013 fortsetzen. Und nach wie vor konnte sie auf ihre Erfolge dabei stolz sein. Von denen, die sie dafür vorbereitete, fielen nur sehr wenige bei dem berühmt-berüchtigten Test für Einwanderer durch, und es waren höchstens die, bei denen sie selbst das auch so erwartet hatte. K. hatte es gern, wenn ich sie am Ende ihrer Kurse in ihrem Raum schon abholte, bevor die Teilnehmer sich verabschiedeten. So spürte ich, wie sie sie mochten und wie wohl K. sich mit ihnen fühlte.
Ein glückliches Zusammentreffen: hier konnten sich K.s Fürsorge und Verantwortung für die Schwachen mit den peniblen Vorkehrungen verbinden, eigenen Schwächen durch Organisation zuvorzukommen. Das gelang, weil sie Situation und Abläufe aus ihrer Perspektive vorstrukturieren und beherrschen konnte. Ganz anders war es in offenen Situationen. Wie sollte sie reagieren, wenn sie den roten Faden eines Gesprächs verlor, nicht mehr wusste, um was es ging oder nicht verstand, was jemand wollte? Wie arbeitete die Dissimulationsmaschine da? Wenn andere Perspektiven ins Spiel kamen, hatte sie es offenbar viel schwerer. Einem Gespräch kann nur gefolgt werden, wenn sein Thema und die Äußerungen dazu auch aus den Augen der anderen wahrgenommen werden. Und der Verlust oder die Einschränkung dieser Fähigkeit ist durch Vorüberlegung und Organisation kaum zu ersetzen. Wo sie nicht mich als ein stellvertretendes Ich dabeihatte, das schon mal eine Lücke füllte, neigte K. zu Formen der Situationsbehauptung, die von sehr freundlich bis ziemlich herb oder gar aggressiv reichten. Begrüßungen und Verabschiedung wurden förmlicher und ausdrücklicher, kein Dankeschön wurde vergessen, lieber nochmal wiederholt. Später, mit zunehmender Demenz, verselbständigte sich dieser Zug, wurde fast zu einem Markenzeichen ihrer Krankheit. Ich habe in meinen Eintragungen häufig etwas dazu notiert. Doch damals, in der Latenzzeit der Demenz, waren andere Formen der Situationskontrolle und Selbstbehauptung auffälliger und für ihre Mitwelt verstörender. Wenn K. z. B. einen Vorschlag, den sie etwa zum Ausstellungsprojekt gemacht hatte, nach einem Gespräch darüber so wiederholte, als sei darüber nicht gesprochen, keine Einwände erhoben oder Veränderungen vorgeschlagen worden, dann musste das wie eine befremdliche Missachtung wirken, der man für die Zukunft lieber aus dem Weg ging.
Aus ihrer Sicht hatte K. dann ihr Gesicht gewahrt, hatte erfolgreich überspielt, dass sie die Einwände nicht hatte aufnehmen und zu ihrem Vorschlag in Beziehung setzen können. Die Dissimulation hatte also funktioniert, hatte aber für beide Seiten eine ungute, kaum korrigierbare Folge: für K. das Gefühl, dass die anderen ihren guten Vorschlag aus ihr undurchschaubaren Gründen ablehnten, ihr gegenüber sich unbegreiflich bösartig verhielten, für die anderen den Eindruck, dass man die Zusammenarbeit oder Begegnung mit K. besser meiden sollte. Und diese von beiden Seiten unbegriffene Situation konnte eskalieren. Auf K.s Seite als Hang zu falschen Verallgemeinerungen, Vergröberungen, Klischees, manchmal auch laut. Auf Seiten der anderen, ihrer Freunde und Milieus, ein zunehmendes Sich-aus-dem-Weg-gehen, das K. als unverstehbaren, kränkenden Entzug von Achtung und Freundschaft empfand.
Aber was habe ich damals davon verstanden und wie hat meine Normalisierungsmaschine gearbeitet? Einen merkwürdigen »Egozentrismus der Weltwahrnehmung« nannte ich bei mir damals das, was ich an K. und ihrem Umgang mit anderen, auch mit mir selber, beobachtete. Eine Formel, deren Großspurigkeit mir nicht gefiel, aber doch etwas zu erfassen schien, was mit dem Kern der Veränderung zu tun hatte. Denn immer wieder stieß ich darauf, dass es der Verlust der Fähigkeit war, eine gemeinsame Situation auch aus der Sicht der anderen wahrzunehmen, was die Befremdungen auslöste – und bleibende Entfremdung bewirkte. Wer seinen Blick nicht miteinander tauschen kann, ist einander fremd wie zwei Wesen unterschiedlicher Welten. Oder wird einander so fremd.
Als ich Anfang 2013 zu einer Operation für eine Woche in ein Krankenhaus ging, sprach ich nicht mit K., als ich mich selbst vor der OP über deren Sinn noch einmal beruhigen wollte. Sondern rief meinen Bruder an. Früher hätte ich selbstverständlich mit K. gesprochen, weil alle Unsicherheiten und Ängste im gemeinsamen Horizont gut aufgehoben waren. Doch hatte mich gewundert, dass sie offenbar gar nicht wissen wollte, was mit mir war, wie es mir ging und warum ich ins Krankenhaus ging. Meine Versuche, mit ihr darüber zu sprechen, schienen ins Leere einer höflichen Diskretion zu laufen, wie man sie gegenüber eher unvertrauten Menschen einhalten mag. Ihr Desinteresse kränkte mich, doch zugleich entlastete es mich. Denn es entsprach ja der Richtung, in die die Normalisierungsmaschine in mir arbeitete: ein Alltagsgleichgewicht eben in größerer Distanz zueinander zu finden, wenn die Horizonte sich nicht mehr wie selbstverständlich verschmelzen konnten. Weil ich nach wie vor interessante Arbeitsprojekte hatte, war mir auch lieb, wenn ich dafür mehr Zeit fand, und es tat mir gut, konzentriert in eine andere Welt einzutauchen. Wir lebten eher nebeneinander als miteinander.





























