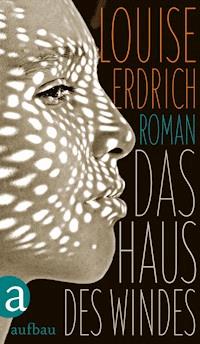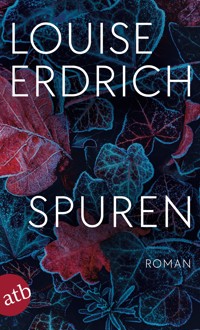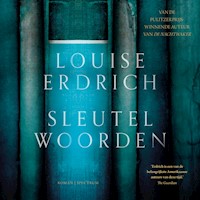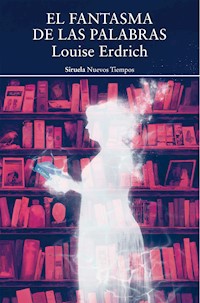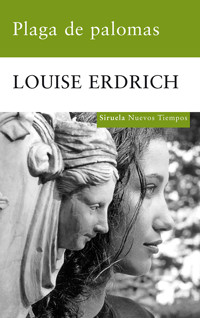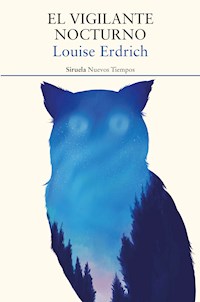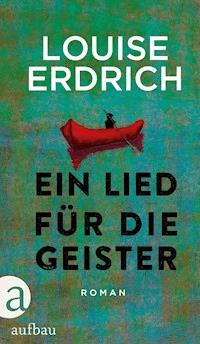
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Landreaux Iron bei einem tragischen Jagdunfall Dusty, den Sohn seiner Nachbarn, tötet, beschließen er und seine Frau, ihren jüngsten Sohn LaRose bei Dustys Familie aufwachsen zu lassen. Ergeben beugt sich LaRose dieser indianischen Tradition, die zu aller Überraschung ungeahnte, tröstliche Dinge bewirkt. Alles könnte sich zum Guten wenden, wäre da nicht einer, der mit Landreaux eine alte Rechnung offen hat und seine große Chance auf Rache wittert ...
„Ein Meisterwerk der amerikanischen Literatur, das bleiben wird.“ Booklist.
„Erdrich trägt, wie Faulkner, das dunkle Wissen ihres Landes in sich. Sie zählt zu den besten amerikanischen Schriftstellern.“ Philip Roth, New York Times.
„Wie Toni Morrison, Tolstoi oder Steinbeck zeichnet Erdrich ihre Charaktere voller Liebe und erzählt von ihnen, ohne je über sie zu richten.“ San Francisco Chronicle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Als Landreaux Iron bei einem tragischen Jagdunfall Dusty, den Sohn seiner Nachbarn, tötet, beschließen er und seine Frau, ihren jüngsten Sohn LaRose bei Dustys Familie aufwachsen zu lassen. Ergeben beugt sich LaRose dieser indianischen Tradition, die zu aller Überraschung ungeahnte, tröstliche Dinge bewirkt. Alles könnte sich zum Guten wenden, wäre da nicht einer, der mit Landreaux eine alte Rechnung offen hat und seine große Chance auf Rache wittert.
»Ein Meisterwerk der amerikanischen Literatur, das bleiben wird.« Booklist
»Erdrich trägt, wie Faulkner, das dunkle Wissen ihres Landes in sich. Sie zählt zu den besten amerikanischen Schriftstellern.« Philip Roth, New York Times
»Wie Toni Morrison, Tolstoi oder Steinbeck zeichnet Erdrich ihre Charaktere voller Liebe und erzählt von ihnen, ohne je über sie zu richten.« San Francisco Chronicle.
Louise Erdrich
Ein Lied für die Geister
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder
Persia
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Zwei Häuser 1999–2000
Die Tür
Das Tor
Der Durchgang
Hallo, du Schöne
Der Dachbalken
Wilde Kerle
Almond Joy
Die Schmerzskala
Endlose Reise
Nehmt alles 1967–1970
Romeo & Landreaux
Wolfred & LaRose
Die Uralte
Was LaRose lernte
Tausend Tode 2002–2003
Die Briefe
Der Küchenstuhl
Superkräfte
Alte Geschichten 1
Der Stoff der Zeit
Wünschelruten
Brüche
Alte Geschichten 2
Alte Geschichten 3
Kriege
Die Versammlung
Auf geht’s
Danksagungen
Über Louise Erdrich
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Zwei Häuser1999–2000
Die Tür
Wo die Reservatsgrenze unmerklich ein Dickicht zerteilte – aus Traubenkirschen, Pappeln, Krüppeleichen –, stand Landreaux und wartete. Er sagte später, er hätte nicht getrunken, und es wies auch nichts darauf hin. Landreaux war ein frommer Katholik, der zugleich den Anishinaabe-Traditionen folgte: Wenn er einen Hirsch erlegte, dankte er einem Gott auf Englisch und legte für einen anderen auf Ojibwe Tabak nieder. Er war mit einer noch frommeren Frau verheiratet und hatte fünf Kinder, die er nach Kräften versorgte und anständig erzog. Peter Ravich, sein Nachbar, betrieb eine große, aus ehemaligen Indianer-Parzellen zusammengeflickte Farm; er bestellte die Mais- und Sojafelder und die Heuwiesen gleich westlich des Reservats. Landreaux und er und ihre Ehefrauen, zwei Halbschwestern, teilten und tauschten miteinander: Eier gegen Munition, Fahrten in den Ort, Kinderkleider, Kartoffeln gegen Mehl. Ihre Kinder trafen sich zum Spielen, obwohl sie auf unterschiedliche Schulen gingen. Es war 1999, und Ravich redete viel vom Jahr-2000-Problem, von der Notstromversorgung, die er aufbauen wollte, der Spezialsoftware für seinen Computer, den Vorräten, die er anlegte; er hatte sogar hinter seinem Geräteschuppen einen alten Benzintank eingegraben und befüllt. Ravich rechnete mit allem Möglichen, aber nicht mit dem, was dann geschah.
Landreaux hatte den Hirsch den Sommer über im Auge behalten und gewartet, bis er fett war, bis kurz nach der Maisernte. Wie immer würde er Ravich etwas abgeben. Der Hirsch hatte feste Angewohnheiten und fühlte sich auf seinen Wegen sicher. Nachmittags blieb er meist im Unterholz verborgen. Zu Beginn der Dämmerung wagte er sich dann hervor, überquerte die Reservatsgrenze und äste auf Raviches Feldern. Jetzt kam er, schritt den Pfad entlang und hielt inne, um zu wittern. Der Wind stand günstig. Der Hirsch wandte den Kopf und spähte auf das Maisfeld hinaus; die perfekte Position für einen Schuss. Landreaux war sehr erfahren, hatte schon als Siebenjähriger mit seinem Großvater Kleinwild gejagt. Er drückte den Abzug ruhig und routiniert. Als der Hirsch davonsprang, wurde ihm klar, dass er etwas anderes getroffen hatte – beim Abdrücken hatte er eine Bewegung wahrgenommen. Erst als er loslief, um nachzusehen, und dabei zu Boden schaute, begriff er, dass er den Sohn seines Nachbarn getötet hatte.
Landreaux rührte den Jungen nicht an. Er ließ das Gewehr fallen und rannte durch das Waldstück zum Haus der Raviches, einem hellbraunen Ranchhaus mit Panoramafenster und Terrasse. Als Nola die Tür öffnete und Landreaux den Namen ihres Sohnes stammelte, sank sie in die Knie und zeigte die Treppe hoch, wo er hätte sein sollen – und nicht war. Sie hatte gerade nachgesehen, ihn nicht gefunden und draußen suchen wollen, als der Schuss fiel. Nola hielt sich mit Mühe auf allen vieren. Sie hörte Landreaux am Telefon erklären, was passiert war. Er ließ den Hörer fallen und packte sie, bevor sie zur Tür hinausstürzen konnte. Sie schlug um sich und kratzte und wehrte sich immer noch, als der Notarzt und die Stammespolizei eintrafen. Zur Tür raus kam sie nicht, sah aber kurz darauf die Sanitäter querfeldein zum Waldstück rennen und den Rettungswagen langsam auf dem Feldweg hinter ihnen herholpern.
Nola schrie Landreaux an, schreckliche Worte, an die sie sich später nicht erinnern konnte. Sie kannte die Leute von der Stammespolizei. Erschießt ihn!, schrie Nola. Bringt ihn um, den Scheißkerl! Als Peter kam und mit ihr redete, begriff sie es – die Sanitäter hatten getan, was sie konnten, aber es war vorbei. Peter erklärte weiter. Sein Mund bewegte sich, aber sie hörte kein Wort. Er war zu ruhig, dachte sie wutbebend, viel zu ruhig. Ihr Mann hätte Landreaux totschlagen sollen. Sie sah es genau vor sich. Nola war eine zierliche, verschlossene Frau, die nie jemandem etwas getan hatte, aber jetzt wollte sie Blut sehen. Ihre zehnjährige Tochter war an dem Tag krank zu Hause geblieben. Immer noch fiebernd, kam sie die Treppe herunter und stahl sich ins Zimmer. Ihre Mutter konnte es nicht leiden, wenn die Kinder Unordnung machten, wenn sie die Spielsachen überall verteilten, die ganze Kiste auskippten. Schweigend nahm die Tochter Sachen aus der Spielzeugkiste und breitete sie aus. Ihre Mutter bemerkte es, bückte sich und packte sie schimpfend wieder weg. Kannst du nicht ein Mal ordentlich sein? Kannst du nicht ein Mal kein Chaos veranstalten? Sobald sie aufgeräumt hatte, fing sie wieder an, herumzuschreien. Die Tochter holte die Sachen wieder raus. Die Mutter warf sie in die Kiste. Immer wenn sie sich hinhockte, um aufzuräumen, sahen die anderen Erwachsenen weg und sprachen lauter, um Nola zu übertönen.
Das Mädchen hieß Maggie nach ihrer Großtante Maggie Peace. Sie hatte blass schimmernde Haut und kastanienbraunes Haar, das ihr in einer frechen Welle über die Schultern fiel. Dustys Haar hatte die Sonne blond gebleicht, bis es so hell war wie das Fell des Hirsches. Er hatte ein braunes T-Shirt getragen, obwohl Jagdsaison war, was aber innerhalb des Reservats, wo Landreaux auf den Hirsch gezielt hatte, ohnehin keine Rolle spielte.
Zack Peace, der Chef der Stammespolizei, und die lokale Gerichtsmedizinerin, eine 82-jährige pensionierte Krankenschwester namens Georgie Mighty, waren ohnehin schon überfordert. Am Tag davor waren um halb drei Uhr nachts – kurz nachdem die Bars geschlossen hatten – zwei Autos frontal aufeinandergeprallt, und keines der Todesopfer in beiden Autos war angeschnallt gewesen. Sie hatten den State Coroner dazugebeten, der gerade die Gegend bereiste, um die Abläufe zu beschleunigen. Zack kämpfte sich noch durch seine Hälfte des Papierbergs, als der Anruf wegen Dusty kam. Er hielt inne, ließ die Stirn auf den Tisch sinken. Dann verständigte er Georgie: Sie sollte den State Coroner bitten, noch ein paar Stunden zu bleiben und den Jungen zu untersuchen, damit die Familie ihn beerdigen konnte. Danach musste er Emmaline anrufen. Sie waren als Cousin und Cousine zusammen aufgewachsen. Er hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Zack war zu jung für seine Aufgabe und ohnehin zu weichherzig für einen Polizisten. Er würde später vorbeikommen, sagte er. Daher wusste Emmaline Bescheid, bevor die Kinder aus der Schule kamen, und ging rechtzeitig vor ihnen heim.
Emmaline stellte sich an die Tür, als ihre Kinder aus dem Schulbus stiegen. Sie kamen mit gesenkten Köpfen herangeschlurft, ließen im Straßengraben die Hände durch die hohen Gräser schleifen. Also hatten sie es auch schon gehört. Hollis, der seit seiner frühen Kindheit bei ihnen lebte, Snow, Josette und Willard. Im Reservat kriegte jemand mit so einem Namen sofort einen Spitznamen verpasst. Coochy in diesem Fall. Jetzt lief der Jüngste den anderen entgegen. LaRose. Er war genauso alt wie Nolas Sohn. Sie waren zur selben Zeit schwanger gewesen, aber Emmaline hatte ihr Kind im Indian-Health-Service-Krankenhaus zur Welt gebracht. Nolas Baby hatte sie erst drei Monate darauf zu Gesicht bekommen. Später hatten die Cousins aber oft miteinander gespielt. Emmaline machte Sandwiches und wärmte die Fleischsuppe auf.
Was passiert jetzt?, fragte Snow, die ihr schweigend zugesehen hatte.
Emmaline kamen wieder die Tränen. Ihre Stirn war wund. Als sie auf den Knien betete, hatte sie unwillkürlich den Kopf auf den Boden geschlagen. Jetzt drang ihr die Angst aus allen Poren.
Ich weiß es nicht, sagte sie. Ich gehe zur Stammespolizei, zu eurem Dad. Es war so ein …
Ein schrecklicher Unfall, hatte Emmaline sagen wollen, aber sie schlug sich die Hand vor den Mund, und die Tränen liefen daran herunter. Denn was gab es zu dem zu sagen, was da passiert war? Es war unaussprechlich, und Emmaline wusste nicht mehr, wie sie, wie Landreaux und alle anderen, besonders Nola, überhaupt noch weiterleben sollten.
Minute für Minute verging ein Tag, vergingen zwei. Zack kam zu Emmaline, setzte sich auf die Couch und fuhr sich durch das borstige Haar.
Pass auf ihn auf, sagte er. Du musst auf ihn aufpassen, Emmaline.
Sie dachte, er halte Landreaux für selbstmordgefährdet, und schüttelte den Kopf. Landreaux liebte seine Familie, und um seine Patienten kümmerte er sich aufopferungsvoll. Er arbeitete als Physiotherapeut, ließ sich zum Dialysetechniker ausbilden und wurde vom Indian Health Service als Altenpfleger eingesetzt. Emmaline rief bei den Patienten an. Erst einmal bei Ottie und seiner Frau Baptiste. Als sie dann bei dem lieben, todkranken alten Awan anrief und seiner Tochter sagte, dass Landreaux nicht kommen könne, antwortete die Tochter, das sei kein Problem, sie werde freinehmen, bis Landreaux wiederkäme. Ihr Vater spielte immer so gern mit ihm Karten. Aber ihre Stimme klang matt und kein bisschen überrascht. Vielleicht wurde Emmaline schon paranoid, aber sie hatte das Gefühl, dass Awans Tochter zögerte und fast dasselbe gesagt hätte wie Zack: Du musst auf ihn aufpassen. Emmaline nahm an, sie sagten es aus Freundschaft zu Landreaux, und begriff erst später, dass dies nicht die ganze Wahrheit war.
Es gab kurze Ermittlungen, ein paar schlaflose Nächte, bis Landreaux freigelassen wurde. Zack nahm Emmalines Autoschlüssel und legte das Gewehr in ihren Kofferraum. Als Landreaux zu ihr in den Wagen stieg, fuhr Emmaline mit ihm geradewegs zum Priester.
Father Travis Wozniak nahm sie beide bei den Händen und betete für sie. Er glaubte, er werde keine Worte finden, aber dann kamen sie doch. Natürlich kamen sie. Unbegreiflich Seine Gerichte. Unerforschlich Seine Wege. Schon vor seiner Zeit als Priester hatte er darin zu viel Übung gehabt. Father Travis war ein ehemaliger US Marine. Oder auch nicht ehemalig. Als Soldat des ersten Bataillons des achten Regiments, 24.Marineexpeditionseinheit, hatte er den Bombenanschlag auf ihren Stützpunkt in Beirut 1983 überlebt. Dicke Narben, die sich in Schwüngen und Schlaufen von seinem Hals an abwärts wanden, zeugten nach außen hin davon, doch sie verliefen auch unter der Oberfläche.
Er schloss die Augen und umfasste ihre Hände fester. Kämpfte gegen ein plötzliches Schwindelgefühl. Er war es leid, für die Opfer von Autounfällen zu beten, war es leid, jede Predigt mit dem Hinweis zu beenden: und vergesst nicht, euch anzuschnallen. War sie leid, die vielen anderen frühen Tode; er hielt sich ja selbst kaum noch auf den Beinen. Wieder fragte er sich, jeden Tag mittlerweile, wie lange er seinen Nächsten noch etwas vormachen konnte. Versuchte seine Gefühle zu bezähmen. Weint mit den Weinenden. Emmaline liefen Tränen über die Wangen. Beim Sprechen wischten sich beide ungeduldig über die Gesichter. Sie brauchten Taschentücher. Father Travis hatte sie immer kistenweise vorrätig und dazu eine Rolle Küchenpapier. Davon riss er ihnen Stücke ab. Zwei Tage vorher hatte er dasselbe für Peter getan, für Nola nicht, deren Augen vor Hass trocken geblieben waren.
Was sollen wir tun?, fragte Emmaline. Wie geht es denn jetzt weiter?
Landreaux begann mit geschlossenen Augen den Rosenkranz zu beten. Emmaline sah ihn an, ließ sich von Father Travis auch eine Kette geben und stimmte mit ein. Father Travis weinte nicht, aber seine Augen waren gerötet, die Lider violett. Er hielt die Gebetsperlen locker umfasst. Seine Hände waren kräftig und schwielig, weil er Steine ausgrub, Hecken stutzte und schwere Gartenarbeit verrichtete – es beruhigte ihn. Hinter der Kirche lag jetzt ein großer Stapel Feuerholz. Der Priester war mit sechsundvierzig stärker, grüblerischer, trauriger denn je. Er unterrichtete Kampfsport, machte mit den Jugendgruppen Marines-Training. Oder auch für sich allein. Hinter dem Schreibtisch waren Hanteln ordentlich der Größe nach gestapelt, und ein Vorhang verdeckte eine Trainingsbank. Als sie fertig gebetet hatten, schwieg Landreaux. Father Travis hatte mit ihm schon so vieles durchgemacht – jahrelange Versuche, die Internatszeit zu bewältigen, dann Kuwait, dann die wilden Zeiten, den Alkohol und seine Rettung durch traditionelle Heilmethoden –, und jetzt kam so etwas. Der Priester erlebte nicht zum ersten Mal in seiner Zeit hier im Reservat, dass Leute ihr Bestes gaben und dann doch das Schlimmste passierte. Landreaux beugte sich vor und fasste Father Travis am Arm. Emmaline stützte Landreaux. Noch einmal sprachen sie leise das Ave Maria; die Wiederholung wirkte tröstlich auf sie. Als sie aufbrachen, hatte Father Travis das Gefühl, die zwei wollten ihn noch etwas fragen.
Landreaux und Emmaline Iron kamen zu der Beerdigung, setzten sich in die letzte Bank und verschwanden durch die Seitentür, bevor der kleine weiße Sarg hinausgetragen wurde.
Emmaline war eine schlaksige, eine angenehm eckige und kantige Frau. Stöckrige Arme, spitze Ellbogen, knochige Knie. Sie hatte eine leicht schiefe Nase und eindrucksvolle, trübgrüne Wolfsaugen. Ihre Tochter Josette hatte diese Augen von ihr geerbt, Snow, Coochy und LaRose die warmen, braunen ihres Vaters. Emmaline hatte helles Haar und helle Haut, die in der Sonne sofort dunkel wurde. Ihr Mann hatte den Kindern einen satten, gebräunten Hautton mitgegeben. Sie war eine leidenschaftliche Mutter. Landreaux hatte schnell begriffen, dass er nach der Geburt ihrer Kinder hintanstehen musste, bis eines Tages wieder seine Stunde käme. Auf der Heimfahrt legte sie ihm eine Hand aufs Knie, und wenn er zitterte, griff sie fest zu. In der Einfahrt ließ er den Motor laufen. Das schattige Licht zerteilte ihre Gesichter.
Ich kann noch nicht nach Hause, sagte er.
Sie warf ihm einen ihrer verstörenden Blicke zu. Landreaux dachte an damals, als sie achtzehn war, Emmaline Peace hieß, als dieser Blick und ihr Grinsen noch bedeutet hatten, dass sie zusammen ausrasten würden. Er war sechs Jahre älter als sie. Damals hatten sie eine ziemlich wilde Zeit. Hatten alles gebeichtet, aber nichts geändert. Gemeinsam folgten sie diesem Drang, und gemeinsam überwanden sie ihn wieder. Sie wusste also, wohin es ihn jetzt zog.
Ich kann dich nicht zwingen, reinzukommen, sagte sie. Ich kann dich nicht abhalten.
Aber sie beugte sich zu ihm hin, umfasste seinen Kopf und legte ihre Stirn an seine. Beide schlossen die Augen, als könnten ihre Gedanken sich vereinen. Erst dann stieg sie aus.
Landreaux fuhr nach Hoopdance, außerhalb des Reservats, und hielt vor dem Fenster des Drive-in-Getränkeladens. Die Flasche legte er in ihrer Papiertüte auf den Beifahrersitz. Kurvte über einsame Nebenstraßen, bis keine Lichter mehr zu sehen waren, und hielt am Straßenrand. Eine Stunde saß er reglos da, dann schnappte er sich die Flasche und lief auf das eiskalte Feld hinaus. Der Wind rauschte ihm um die Ohren. Er legte sich hin. Er versuchte, ein Bild von Dusty in den Himmel zu schicken. Mühte sich verzweifelt, die Zeit zurückzudrehen und zu sterben, bevor er in den Wald aufbrechen konnte. Aber jedes Mal, wenn er die Augen schloss, lag der Junge immer noch verkrümmt im Laub. Der Boden unter Landreaux war trocken, Sterne flammten jetzt dort oben auf. Flugzeuge und Satelliten blinkten. Der Mond stieg weiß glühend über den Horizont, und irgendwann kamen Wolken und verdeckten alles.
Nach ein paar Stunden stand Landreaux auf und fuhr nach Hause. Aus dem Schlafzimmerfenster drang gedämpftes Licht. Emmaline war noch wach und starrte an die Zimmerdecke. Als sie Reifen auf dem Kies der Einfahrt hörte, schloss sie die Augen, schlief ein und wachte vor den Kindern wieder auf. Sie ging raus und fand ihn in der Schwitzhütte, unter Planen zusammengerollt. Neben ihm die noch immer ungeöffnete Flasche. Er blinzelte ins Licht.
O Mann, sagte sie. Eine Magnumflasche Old Crow. Du hattest dir ja was vorgenommen.
Sie legte die Flasche in eine Ecke, ging ins Haus und brachte die Kinder zum Bus. Dann zog sie sich selbst und LaRose warm an und nahm für ihren Mann einen Schlafsack mit. Während er sich aufwärmte, machten sie und LaRose Feuer, warfen aus einem besonderen Beutel Tabak in die Flammen, legten Großvatersteine hinein, schürten es heißer und heißer. Sie holten den Kupferkessel und die Schöpfkelle, die Decken, die Medizin und was sie sonst noch brauchten. LaRose half mit – er kannte sich mit allem aus. Er war Landreaux’ kleiner Mann, sein Lieblingskind, auch wenn Landreaux es sich nicht anmerken ließ. Als LaRose so ernst auf seinen starken, dünnen O-Beinen am Feuer hockte und sorgsam sein eigenes kleines Medizinbündel in eine Reihe mit den Pfeifen legte, malte sich Verzweiflung auf Landreaux’ breitem Gesicht. Er sah zu Boden, sah weg, sah überall sonst hin, so sehr überwältigte ihn der Gedanke, der ihm gekommen war. Emmaline bemerkte es, nahm die Flasche und schüttete den Whiskey zwischen ihnen beiden aus. Während er im Boden versickerte, sang sie das alte Lied vom Bärenmarder Kwiingwa’aage, dem Schutzgeist der hoffnungslos Bezechten. Als die Flasche leer war, sah sie auf. Stellte sich Landreaux’ seltsam leerem Blick. Genau in dem Moment kam ihr auch ein Gedanke. Sie begriff, was in ihm vorging. Sie hielt inne, blickte blass ins Feuer, dann zu Boden. Sie flüsterte: Nein. Sie wollte gehen, konnte aber nicht weg, und als sie schließlich weitermachte, liefen ihr nasse Schlieren über das Gesicht.
* * *
Sie schürten das Feuer, legten acht und vier und acht Großvatersteine in die Glut. Es dauerte länger als gewöhnlich, die Steine heiß genug zu halten und dazu noch die Klappen der Hütte zu öffnen und zu schließen und die Steine hineinzutragen. Aber sie hatten nichts anderes zu tun. Sie konnten gar nichts anderes tun. Es sei denn, sie hätten sich betrunken, aber das hatten sie nicht vor. Das hatten sie erst mal hinter sich.
Emmaline kannte Lieder, mit denen sie die Medizin in die Hütte brachte, und Lieder, um die Manidoog und die Aadizookaanag, die Geister herbeizurufen. Landreaux kannte Lieder für die Tiere und die Winde aller Himmelsrichtungen. Als es in der Hütte heiß und dampfig wurde, rollte LaRose zur Seite, hob die Plane an und schnappte frische Luft. Er schlief auf dem Boden ein. Die Lieder wurden Teil seiner Träume. Seine Eltern besangen die Wesen, von denen sie Hilfe erhofften, und ihre Vorfahren – die uralten Vorfahren, deren Namen schon vergessen waren. Mit den jüngeren Vorfahren war es schwieriger, deren Namen sie noch kannten und mit Iban ergänzten, mit verstorben oder in der Geisterwelt. Ihretwegen klammerten sich Landreaux und Emmaline aneinander fest, als sie Medizin auf die glühenden Steine warfen, schrien auf und rangen nach Luft.
Nein, sagte Emmaline. Sie knurrte und bleckte die Zähne. Nein, eher bringe ich dich um.
Landreaux beruhigte sie, redete auf sie ein, betete mit ihr. Versuchte ihr Mut zu machen. Sie hatten zusammen den Sonnentanz getanzt und in Trance etwas gehört. Hatten etwas gesehen, als sie auf einer Klippe fasteten, und erzählten einander jetzt davon. Ihr Sohn war aus den Wolken herabgestiegen und hatte gefragt, warum er die Kleider eines anderen Jungen tragen müsse. Er war über dem Boden geschwebt. Hatte ihnen die Hände aufs Herz gelegt und geflüstert: Ihr werdet leben. Jetzt wussten sie, was diese Bilder bedeuteten.
Stück für Stück brach Emmaline zusammen. Ihr ging die Luft aus. Sie schmiegte sich an ihren Sohn. Sie hatten es vermieden, den Namen LaRose zu vergeben, bis ihr jüngstes Kind geboren wurde. Es war ein unschuldiger und doch machtvoller Name, den die Heiler in der Familie getragen hatten. Keins ihrer Kinder sollte so heißen, aber dann war es, als sei der Kleine als LaRose auf die Welt gekommen.
Seit über hundert Jahren gab es in jeder Generation der Familie eine LaRose. Emmalines Mutter und ihre Großmutter hießen so. Im Laufe der Zeit hatten sich Landreaux’ und Emmalines Stammbäume verflochten, so dass sie beide mit den LaRoses verwandt waren. Sie kannten beide die Geschichten, die Legenden.
* * *
Vor der Tür eines einsamen Handelspostens im Ojibwe-Territorium im Jahr 1839 schrie und zeterte Mink immer lauter. Sie wollte Händlermilch, Rum – eine Mischung aus verschiedenen Rohalkoholen, Tabak und Chilipulver. Ihr unaufhörliches Kreischen und Heulen hatte ihr schon einmal ein Fass davon eingebracht. Der Krach zerrte dem Händler an den Nerven, aber Mackinnon hütete sich, sie durch Schläge zum Schweigen zu bringen. Mink stammte aus einer geheimnisvollen, gewalttätigen Familie voller mächtiger Heiler. Früher war sie die bildschöne Tochter von Shingobii gewesen, der erstklassige Pelze machte. Dann die bildschöne Frau von Mashkiig, bis er ihr eines Tages das Gesicht entstellte und ihre jüngeren Brüder erstach. Ihre Tochter kauerte neben Mink unter der schmutzigen Decke und versuchte sich zu verstecken. Im Gebäude hatte Wolfred Roberts, Mackinnons Kontorist, sich einen Fuchspelz um den Kopf geschlungen, um den Lärm zumindest zu dämpfen. Die eingetrockneten Pfoten hatte er unter seinem Kinn verknotet. Wolfred schrieb in seiner eleganten, geneigten Handschrift drei Artikel in jede Zeile. Da draußen in der Wildnis hatte man immer Angst, dass einem das Papier ausgehen könnte.
Wolfred hatte sich von seiner Familie in Portsmouth, New Hampshire, verabschiedet, weil ihn als Jüngsten von vier Brüdern die Bäckerei seiner Eltern nicht ernähren konnte. Seine Mutter, Tochter eines Lehrers, hatte ihn unterrichtet. Er vermisste sie und vermisste die Bücher – nur zwei hatte er mitgenommen, als er die Stelle bei Mackinnon antrat: ein Taschenwörterbuch und eine Ausgabe von Xenophons Anabasis, die ihm sein Großvater hinterlassen hatte und von der seine Mutter nicht ahnte, was für unzüchtige Stellen sie enthielt. Wolfred war siebzehn Jahre alt.
Trotz des Fuchspelzes auf seinen Ohren erschütterte ihn Minks Gekreisch. Er versuchte sich abzulenken, indem er saubermachte, und warf den Hunden Essensreste vor die Tür. Als er wieder hineinging, brach die Hölle los. Mink und ihre Tochter kämpften mit den Hunden um die Reste. Es klang grauenhaft.
Untersteh dich, da rauszugehen, sagte Mackinnon. Wenn die Hunde sie erledigen, haben wir ein Problem weniger.
Die Menschen gewannen schließlich, aber ruhig wurde es bis zum späten Abend nicht.
Vor Sonnenaufgang schrie Mink wieder los. Ihr schrilles, langgezogenes Geheul war noch lauter als am Tag zuvor. Die Männer rieben sich die Augen nach der kurzen Nacht. Als sie das Haus verließen, versetzte Mackinnon ihr – oder einer der beiden – im Vorübergehen einen Tritt. Gegen Nachmittag wurde sie heiser, was ihre Stimme nur noch durchdringender machte. Etwas hatte sich im Tonfall geändert, stellte Wolfred fest. Er verstand ihre Sprache nicht besonders gut.
Die dreckige alte Hexe will mir ihre Tochter andrehen, brummte Mackinnon.
Minks grausige Stimme troff vor Schmutz, als sie Mackinnon ausmalte, was das Mädchen alles tun könne, wenn er ihr nur die Händlermilch überließe. Sie richtete die volle Wucht ihres Gekreischs auf die geschlossene Tür. Zu Wolfreds Aufgaben gehörte es, Fisch zu fangen und zu kochen. Er machte sich auf den Weg zum Fluss, wo er ein Loch in der Eisdecke offen hielt. Als er an Mink vorbeikam, bekreuzigte er sich. Natürlich war er nicht katholisch, aber wo immer die Jesuiten gewesen waren, hatte diese Geste sich durchgesetzt. Als er zurückkam, war Mink verschwunden, und das Mädchen war im Haus, hatte sich in einem Winkel unter einer neuen Decke verkrochen, ließ den Kopf hängen und hielt so still, als sei sie tot.
Ich hab’s nicht mehr länger ausgehalten, sagte Mackinnon zu ihm.
* * *
In jener Nacht schlief LaRose zwischen seinen beiden Eltern. Daran erinnerte er sich später. Und er erinnerte sich an die Nacht danach. An das dazwischen erinnerte er sich nicht.
Sie verbrannten das Gewehr, vergruben die Munition. Am nächsten Morgen nahmen sie den Weg, den der Hirsch genommen hatte. Im Gehölz zwischen den beiden Häusern gab es eine dicht von Himbeeren überwucherte Lichtung, wo der Blitz in eine Eiche eingeschlagen war. Die Hitze war unter die Rinde gefahren, hatte sich von den Zweigen und Ästen bis in die Wurzeln ausgebreitet, bis der Baum ihr nicht mehr standhielt und barst. Das Feuer in seinen Wurzeln hatte alle kleinen Bäume im Umkreis abgetötet, ehe ein Regenguss es wieder löschte. Etwa eine Meile von diesem Ort entfernt war Emmalines Mutter aufgewachsen. Zu ihrer Zeit hatte man sein Land verteidigt, indem man die Markierungen der Landvermesser entfernte. Auch einer der Vermesser war verschwunden und nie wieder aufgefunden worden, so sehr man auch den stillen, tiefen Seegrund nach ihm absuchte. Viele Stammesmitglieder bekamen Landstücke vererbt, die aber meist zu klein waren, um eine Existenz darauf zu gründen. Deshalb lagen etliche zerstückelte Ländereien brach. Diesen Wald fanden bis heute viele unheimlich. Außer Landreaux und Peter jagte fast niemand dort. Eine ganze Parzelle, 160 Morgen Stammesland, gehörte Emmalines Mutter, und die hatte ihren Besitz unzerteilt an die Tochter überschrieben.
Der Wald strahlte – die Essigbäume scharlachrot, die Birken hellgelb. Manchmal trug Landreaux seinen Sohn, manchmal gab er ihn Emmaline. Sie sprachen LaRose nicht an und antworteten ihm nicht in Worten. Sie hielten ihn, strichen ihm übers Haar, küssten ihn mit trockenen, bebenden Lippen.
Nola sah sie mit dem Jungen den Garten durchqueren.
Was machen die hier, was, warum, warum bringen sie …
Sie rannte aus der Küche und stieß Peter vor die Brust. Der Vormittag war ruhig gewesen. Damit war es jetzt vorbei. Sie sagte, er solle sie verdammt noch mal von ihrem Grund und Boden jagen, und er versprach es ihr und strich ihr über die Schultern. Sie riss sich heftig los. Die dunkle Kluft zwischen ihnen schien jetzt unendlich tief zu sein. Er hatte sie noch immer nicht ausgelotet. Es machte ihm Angst, was mit Nola passierte, aber er konnte einfach nicht wütend sein, als er jetzt zur Haustür ging – Wut war zu klein dafür. Außerdem waren Landreaux und er Freunde, besser befreundet als die beiden Halbschwestern, und instinktiv empfand er diese Freundschaft immer noch. Landreaux und Emmaline hatten ihren Jungen dabei, der völlig anders war als Dusty und doch so wie er, wie Fünfjährige eben sind – voller Neugier, Zuversicht, Vertrauen.
Landreaux setzte den Jungen langsam ab und fragte, ob sie hereinkommen könnten.
Nein, sagte Nola.
Aber Peter öffnete die Tür. Sofort sah LaRose zu Peter auf und blickte erwartungsvoll ins Wohnzimmer.
Wo ist Dusty?
Peters Gesicht war verquollen, von Erschöpfung gezeichnet, aber er brachte es fertig zu antworten: Dusty ist nicht mehr da.
LaRose wandte sich enttäuscht ab, dann zeigte er auf die in die Ecke geräumte Spielzeugkiste und fragte: Kann ich spielen?
Nola fand keine Worte. Sie setzte sich schwerfällig hin und sah erst stumpf, dann fasziniert zu, wie LaRose ein Spielzeug nach dem anderen aus der Kiste holte und intensiv damit spielte – ernst, eigen, witzig, ganz versunken in jeden einzelnen Gegenstand.
Vom Treppenabsatz sah Maggie, von allen vergessen, auf die anderen herab. Beide Jungen waren im Frühherbst auf die Welt gekommen. Beide Mütter hatten sie zu Hause behalten, sie für die Schule zu jung gefunden. Wenn sie miteinander spielten, hatte Maggie sie immer herumkommandiert, hatte sie Diener sein lassen, deren Herrscherin sie war, oder Hunde, wenn sie Königin der Tiere spielte. Jetzt wusste sie nicht mehr, was tun. Nicht nur im Spiel, sondern überhaupt im Leben. In die Schule durfte sie noch nicht wieder. Wenn sie weinte, weinte ihre Mutter lauter. Wenn sie nicht weinte, nannte ihre Mutter sie ein kaltherziges kleines Biest. Also beobachtete sie nur von der mit Teppich ausgelegten Treppe aus, wie LaRose mit Dustys Sachen spielte.
Je länger Maggie zusah, desto wütender wurde sie. Sie umklammerte das Geländer wie ein Gefängnisgitter. Dusty war nicht da, um seine Sachen zu verteidigen, sie nur abzugeben, wenn er es wollte, oder um mit dem schrill-orangefarbenen Dinosaurier, dem besten Hot Wheels mit den schwarzen Flammen, den Mini-Monstertrucks lieber selbst zu spielen. Sie wollte runterrennen und Sachen durch die Gegend schmeißen. Wollte LaRose treten. Aber sie hatte sowieso schon Ärger, weil sie in der Schule frech geworden war, und sollte eigentlich in ihrem Zimmer bleiben.
Landreaux und Emmaline Iron standen noch in der Tür. Es hatte sie niemand hereingebeten.
Was wollt ihr?, fragte Peter.
Er hätte sonst immer gefragt, wie es einem Besucher gehe, aber nur Nola begriff, dass er in dieser Unhöflichkeit seine ganze schockartige Trauer und das Durcheinander der Gefühle zum Ausdruck brachte.
Was wollt ihr?
Sie antworteten schlicht.
Unser Sohn soll jetzt euer Sohn sein.
Landreaux stellte den kleinen Koffer auf den Boden. Emmaline zerriss es. Sie legte die andere Tasche im Eingang ab und drehte den Kopf weg.
Sie mussten ihm erklären, wie sie es meinten – unser Sohn soll euer Sohn sein –, und es ihm gleich noch einmal erklären.
Peter klappte den Mund auf, starr, überwältigt.
Nein, sagte er, so was habe ich ja noch nie gehört.
Es ist die Tradition, sagte Landreaux. Er sagte es hastig, unter Mühen. Zu ihrer Entscheidung hatte viel mehr gehört, aber er konnte nicht weitersprechen.
Emmalines Blick fiel auf ihre Halbschwester, die sie so wenig leiden konnte. Sie verkniff sich jeden Laut, hob den Kopf und sah Maggie auf der Treppe kauern. Das zornige Püppchengesicht dieses Mädchens traf sie wie ein Hieb. Ich muss hier raus, dachte sie. Sie trat einen abrupten Schritt vor, legte ihrem Sohn die Hand auf den Kopf und küsste ihn. LaRose tätschelte ihr tief im Spiel versunken das Gesicht.
Bis später, Mom, sagte er, genau wie seine älteren Brüder.
Nein, sagte Peter noch einmal mit einer abwehrenden Geste, nein. Das geht nicht. Nehmt …
Da bemerkte er den Ausdruck auf Nolas eben noch so verschlossenem Gesicht. All ihre Zärtlichkeit floss jetzt daraus hervor. Und Gier – ein verzweifeltes Tasten, mit dem sich seine Frau dem Jungen schwankend entgegenneigte.
Das Tor
Gegen Abend kochte Nola Suppe und deckte den Abendbrottisch, alles mit größter Konzentration. Nach jedem Arbeitsschritt stockte sie, musste erst ihre Gedanken wieder sammeln und die Schüsseln suchen, die Butter, musste erst das Brot aufschneiden. LaRose löffelte langsam und bedächtig seine Suppe aus. Er schmierte unbeholfen selbst Butter auf sein Brot. Gute Tischmanieren hatte er, fand Nola. Seine Gegenwart war tröstlich und verstörend. Er war Dusty und zugleich sein Gegenteil. Peter fühlte sich von seiner Verwirrung hin und her geworfen. Der Schock, dachte er, ich stehe unter Schock. Der Junge rührte ihn mit seiner stillen Selbstbeherrschung, seiner Wissbegier, aber wenn Peter merkte, wie er darauf ansprach, fühlte er sich als Verräter. Dusty hätte ja, könnte ja nichts dagegen haben, sagte er sich dann. Und er begriff, dass Nola irgendwie dabei war, Hilfe anzunehmen, aber ob sie dies unaussprechliche Geschenk in seiner Schönheit akzeptierte oder ob sie hoffte, die Trennung von dem Kind würde Landreaux mit der Zeit das Herz ausbluten, hätte er nicht sagen können.
Geh du mit ihm ins Bad, sagte Nola.
Dann …
Ich weiß.
Sie sahen einander suchend an. Beide fanden, in Dustys Bett könne er nicht schlafen. Außerdem hatte LaRose zwei Mal nach seiner Mutter gefragt und ihre Erklärungen akzeptiert. Aber beim dritten Mal hatte er den Kopf hängenlassen und fassungslos geweint. Er war noch nie von seiner Mutter getrennt gewesen. Sein Befremden war herzzerreißend. Maggie hatte ihm den Kopf getätschelt, ihm Spielsachen gegeben, ihn abgelenkt. Maggies Gegenwart schien ihm gutzutun. Sie schlief in Großmutters altmodischem geschnitztem Doppelbett. Reichlich Platz. Ich werd heute nicht fertig mit ihr, sagte Nola. Also brachte Peter den Koffer und die Tasche voller Spielzeug und Kuscheltiere in Maggies Zimmer. Zu Maggie sagte er, sie habe Übernachtungsbesuch. Dann half er LaRose, seine winzigen Milchzähne zu putzen. Umziehen konnte sich der Junge selbst. Er war dünner als Dusty, geschmeidiger. Sein Haar, das ihm lang in die Stirn fiel, war nur eine Spur dunkler als Maggies. Peter brachte ihn ins Bett. Maggie blieb unschlüssig stehen. Ein langes weißes Flanellnachthemd hing ihr glockenförmig um die Knöchel. Sie schlug die Decken zurück und schlüpfte darunter. Peter gab beiden einen Kuss, murmelte etwas, löschte das Licht. Als er die Tür schloss, fürchtete er, verrückt zu werden, aber die Trauer war jetzt anders. Etwas mischte sich jetzt damit.
LaRose hielt eine tierähnliche Stoffpuppe umklammert, mit der er spielte wie sein älterer Bruder mit Actionfiguren. Emmaline hatte sie für ihn genäht. Das farblose Fell war hier und da schon blankgescheuert. Ein Knopfauge war abgesprungen, die rote Filzzunge bis auf ein Fädchen abgewetzt. Einmal war das Hinterteil gerissen, und Emmaline hatte es mit Rohrkolbenwatte aufgepolstert. Ein Zittern, das LaRose unterdrückte, drang erst kaum nach außen durch. Dann schüttelte es ihn plötzlich heftig, und Tränen flossen. Maggie lag neben ihm im Bett und spürte seinen Schmerz, dass der eigene Schmerz ihr fast den Atem nahm.
Sie drehte sich um und schubste LaRose von der Matratze. Er überschlug sich, riss die Decken mit sich runter. Maggie zog sie wieder hoch, und LaRose lag schluchzend am Boden.
Was heulst du, du Baby?, zischte sie.
LaRose weinte nur noch stärker. In Maggie stieg eine Schwärze hoch.
Willst du zu Mom-my? Zu deiner Mom-my? Die ist weg. Die und Daddy haben dich hiergelassen, damit du mein Bruder wirst wie Dusty. Aber ich will dich nicht haben.
Im nächsten Moment verflüssigte sich die Schwärze wieder. Maggie kletterte runter zu LaRose. Er kauerte schweigend in der Ecke, die abgeratzte Stoffpuppe im Arm. Maggie legte ihm die Hand auf den Rücken. Er war ganz kalt und steif. Sie holte ihren Schlafsack und zog ihn über sie beide. Kuschelte sich an ihn, wärmte ihn.
Ich will dich wohl haben, flüsterte sie ängstlich.
Jahre später wurde diese Nacht für LaRose zu einer Erinnerung. Er hegte sie in Gedanken als seine erste mit Maggie verbrachte Nacht. An das warme Flanell erinnerte er sich und wie sie sich an ihn schmiegte. Er hatte das Gefühl, sie seien im Schlaf Geschwister geworden. Dass sie ihn aus dem Bett gestoßen hatte, wusste er nicht mehr, und auch ihre Worte hatte er vergessen.
* * *
Wolfred starrte auf das hingekauerte Deckenbündel. Mackinnon war für einen Händler immer ehrbar gewesen. Immer anständig für einen Händler, nicht verkommener als andere – den Indianern Rum zu verkaufen war ungesetzlich. Wolfred konnte nicht fassen, was geschehen war, also ging er gleich noch einmal hinunter an den Fluss. Als er mit einem zweiten Fang Maränen zurückkehrte, war sein Kopf wieder klar. Mackinnon war ein Retter, sagte Wolfred sich. Er hatte das Mädchen vor Mink gerettet und vor einem Sklavenschicksal anderswo. Wolfred hackte Holz und fachte unter freiem Himmel ein Kochfeuer an. Er briet die Fische, die Mackinnon mit den wochenalten Brotresten verzehrte. Morgen würde Wolfred backen. Als er wieder hineinging, kauerte das Mädchen noch genauso da. Muckste und regte sich nicht. Mackinnon schien sie nicht angerührt zu haben.
Wolfred stellte einen Teller mit Fisch und Brot vor ihr auf den Boden. Sie verschlang alles und schnappte nach Luft. Er schob ihr einen Wasserkrug hin. Sie leerte ihn in einem Zug; ihre Kehle gluckste wie bei einem Säugling, als sie trank.
Als Mackinnon aufgegessen hatte, kroch er in sein Bett aus Latten und Bärenfell, um sich in den Schlaf zu saufen. Wolfred räumte noch auf. Dann erwärmte er einen Bottich Wasser und hockte sich zu dem Mädchen. Feuchtete ein Tuch an und betupfte ihr Gesicht. Als der verkrustete Schmutz sich löste, entdeckte er Stück für Stück, wie anmutig ihre Züge waren. Ihre Lippen waren zierlich und voll. Ihre Augen liebreizend. Ihre Brauen vollendet geschwungen. Als ihr Gesicht ganz zu sehen war, stahl sich Bestürzung in Wolfreds Blick. Sie war wunderschön. Wusste Mackinnon davon? Und wusste er, dass sein Fußtritt dem Mädchen ein Stück Zahn ausgeschlagen, ihre Wange mit einem Bluterguss verunziert hatte?
Giimiikawaadiz, flüsterte Wolfred. Diese Worte für das Aussehen des Mädchen kannte er immerhin.
Aus einer Handvoll Staub vom Lehmboden des Hauses mischte Wolfred ein wenig Schlamm. Er fasste ihr Kinn und bedeckte behutsam wieder ihre Züge: die verblüffende Kontur ihrer Brauen, die perfekte Symmetrie von Augen und Nase, den umwerfend geschwungenen Mund. Sie war ein anmutiges Kind von elf Jahren.
* * *
Sie haben wieder auf dem Boden geschlafen, sagte Nola. Ich habe Maggie gesagt, dass es so nicht weitergeht. Dass sie Stubenarrest kriegt, wenn sie nicht aufhört. Da ist sie frech geworden. Gut, das war’s, hab ich ihr gesagt. Den Rest des Tages bleibst du in deinem Zimmer. Und er weint schon wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Ihre Hände flatterten. Ihr Gesicht war grau und verkniffen; sie wirkte schwach. Nola hatte sich die Woche über gut gehalten, aber jetzt war Wochenende, und das bedeutete, dass Maggie den ganzen Tag zu Hause war.
Lass sie raus, sagte Peter.
Ha! Die ist längst draußen, glaubst du etwa, sie hört auf mich?, rief Nola. Sie sitzt in der Küche und frühstückt.
Lass die beiden doch spielen. Dann freuen sie sich.
Peter und Nola hatten sich einmal geeinigt, in Erziehungsfragen immer die Beschlüsse des anderen zu respektieren. Aber jetzt entglitt ihnen alles, dachte Peter. Kurz darauf ertappte er Nola dabei, dass sie Maggie den Kopf runterdrückte, bis sie fast die Haferbreischüssel berührte. Maggie sträubte sich. Als Nola Peters Blick bemerkte, zog sie die Hand weg, als sei nichts gewesen.
Maggie starrte schwer atmend in ihren Haferbrei. Er war kalt und fest geworden, und Nola erlaubte ihr weder Rosinen noch Zucker, damit sie keine Karies kriegte. Maggie sah zu ihrem Vater auf. Er setzte sich, und als Nola ihnen den Rücken zuwandte, schaufelte er den Großteil ihres Haferbreis in seine Schüssel und bedeutete ihr zu essen. Sie griff nach ihrem Löffel. Er tauchte seinen in den Brei, steckte ihn in den Mund und machte ein trauriges Clownsgesicht. Maggie tat es ihm nach. Sie folgten Nola wie gescholtene Hunde heimlich mit den Blicken. LaRose machte mit, obwohl er nichts von alledem begriff. Ohne sich umzudrehen, sagte Nola zu Peter: Lass die Scheiße.
Peter packte seinen Löffel fester und starrte auf ihren Hinterkopf.
Peter dachte, seine Frau würde sich erholen, wenn das hier erst vorüber war. Es wurde Zeit, LaRose wieder heimzubringen. Er wollte nur, dass Nola von selbst darauf kam. Stattdessen schmiedete sie Pläne.
Ich backe ihm einen Kuchen, sagte sie mit Tränen in den Augen. Mit Kerzen drauf, wie bei einem Geburtstagskuchen. Die darf er auspusten und kriegt immer wieder neue. Dann hat er hundert Wünsche frei.
Sie wandte sich ab. Der Arzt hatte ihr Clonazepam verschrieben. An Dustys Geburtstag wollte sie etwas davon nehmen. Ich backe LaRose jeden Tag einen Kuchen, dachte sie, wenn er nur aufhört zu weinen, wenn er sich an mich schmiegt wie Dusty, wenn er nur mein Sohn wird, der einzige Sohn, den ich je haben werde. Ein hartnäckiges altes Gefühl der Verbitterung hatte Nola davon abgehalten, Peter zu erzählen, dass sie seit Dustys Geburt keine Blutungen mehr hatte und dass der Arzt ihr nicht helfen konnte. Peter war die Veränderung nicht aufgefallen, schließlich hatte sie solche Dinge schon immer mit sich selbst ausgemacht. Nur Emmaline hatte sie davon erzählt. Unfassbar, dass sie ihr so etwas hatte anvertrauen können! Ihr zog sich das Herz zusammen. Das, dachte Nola, war der Grund, warum LaRose jetzt hier war. Weil Emmaline Bescheid wusste.
Weil ihre Halbschwester über sie Bescheid wusste, würde Nola sich von ihr abwenden – aus Angst – und das Herz vor ihr verschließen.
* * *
Schließlich wollte Peter mit Landreaux reden. Er hätte zu Fuß hingehen können, es waren nur ein paar hundert Meter. Richtung Westen ging es nach Hoopdance. Im Osten und Norden lagen der Ortskern und die ländlichen Bereiche des Reservats. Ein Stück südlich die schrumpfende Gemeinde Pluto, in der es immerhin noch eine Schule gab. Auf die ging Maggie, und auch LaRose würde sie besuchen, wenn er weiter bei ihnen blieb. Peter bog in die leere Einfahrt der Irons ein und parkte. In dem kleinen grauen Haus war alles dunkel. Vom Gerüst der Schwitzhütte im Garten waren die Stoffplanen abgenommen worden. Ein Milchkanister baumelte als Vogelhäuschen von einem Ast, in der Einfahrt stand ein Karton voller Einweckgläser, und ein paar Spielsachen lagen im Garten verstreut. Selbst der Hund, der sonst hier herumstreunte, war nicht zu sehen. Vermutlich besuchten die Irons ihre Verwandten in Kanada oder Randall, den Medizinmann des Reservats, um eine Familienzeremonie abzuhalten. Nach Jahren der Freundschaft mit Landreaux wusste Peter, dass er und seine Leute an religiösen Ritualen teilnahmen, deren Namen er sich nie merken konnte. Peter interessierte sich wenig für Landreaux’ Traditionen. Sie hatten zusammen geangelt und gejagt. Peter wusste, wie aufmerksam Landreaux war, und konnte nicht glauben, dass ihm so ein Fehler unterlaufen war. Er ließ das Auto in der Einfahrt stehen, ging hinters Haus und weiter in Richtung Wald.
Er folgte dem Fußweg, der zu der Stelle führte, wo Dusty gestorben war. Unterwegs begegnete ihm dieser Hund – mit kurzem, rostrotem Fell. Er wirkte, als hätte er Peter schon erwartet. Sein Kopf war heller, eher gelblichbraun. Er trat aus dem Unterholz, stellte die Ohren auf und sah Peter an. Peter blieb stehen. Ihn überraschte die Haltung des Hundes und wie durchdringend er ihn musterte. Als Peter sich wieder in Bewegung setzte, verschwand der Hund. Ohne ein Geräusch, als hätte der Wald ihn einfach so verschluckt.
Nächtliche Böen und ein Regenschauer hatten viel Laub von den Bäumen gefegt. Es lag schillernd am Boden, Schicht um Schicht geborstener Farben. Weiße Birken erglühten im morgendlichen Licht. Als er ein Waldstück voller Krüppeleichen durchquerte, wurde es dunkler. Schließlich stand er, wo Landreaux gestanden hatte, und sah zu der Stelle hinüber, wo der Hirsch innegehalten haben musste. Direkt dazwischen wuchs der Kletterbaum, von dem Maggie berichtet hatte. Peter hatte nicht gewusst, dass seine Kinder so tief im Wald spielten, so weit weg von zu Hause. Aber der Baum war mit seiner tiefen Gabelung und den gebogenen Ästen verführerisch. Von einem der Äste war etwas abgesplittert. Er ging hin und befühlte die langen, nadelspitz hervorstehenden Späne. Dann zwang ihn der Flecken Erde zu Füßen des Baums in die Knie. Er legte eine Hand darauf. Um die Stelle herum war der Boden zertrampelt und aufgewühlt. Peter legte sich auf den Rücken. Als er aufsah, reimte er sich zusammen, dass Dusty kurz vor seinem Tod auf diesen Baum geklettert war – auf einem dieser Äste hatte er gesessen. Er hatte den großen Hirsch bemerkt. Hatte sich erschreckt und war gestürzt, als Landreaux sein Gewehr abfeuerte. Peter hatte Landreaux’ Aussage gelesen, und es passte alles zusammen.
Jetzt lag er da, wo Dustys Leben im Erdreich versickert war, schloss die Augen, lauschte auf die Geräusche um ihn her. Er hörte eine Meise, einen Kleiber, eine heisere Krähe in der Ferne. Er hörte seine eigene Stimme, einen langen Schrei. Dann nur noch das Säuseln und Knacken der Blätter und Zweige. Das Rauschen der Nadelbäume. Bemerkte den Duft von Süßgras, Tabak, Kinnikinnick, von Opfergaben. Auch Landreaux war hier gewesen.
* * *
Landreaux hatte alle paar Wochen einen wiederkehrenden Termin: Er half Emmalines Mutter. Noch bevor sie seine Schwiegermutter wurde, hatte sie einen festen Platz in seinem Leben als seine Lieblingslehrerin. Und sie hatte ihn gerettet – ihn und viele andere. Seine Patientin war sie nicht, aber er besuchte sie trotzdem regelmäßig. Sie bewohnte ein kleines Apartment im Ältestenhaus, einem Backsteinbau, der die Form eines Donnervogels hatte; vom Flugzeug aus konnte man ihn erkennen. Emmalines Mutter lebte in seinem Schwanz. Sie wurde von niemandem Oma, Kookum oder Tantchen genannt. Mit Vornamen hieß sie LaRose, aber auch das sagte niemand zu ihr. Alle benutzten ihren Lehrerinnennamen: Mrs. Peace.
Dass Generationen von Schülern sie als Lehrerin verehrten, hieß nicht, dass sie in allem vorbildlich gewesen wäre. Sie hatte eine wechselvolle Vergangenheit, sagte sie gern, doch zuletzt war sie Emmalines Vater Billy Peace treu geblieben, sogar über seinen Tod hinaus. Man raunte, sie hätte versucht, sich zu ihm ins Grab zu stürzen. In Wahrheit war er eingeäschert worden, was nur niemand mehr wusste. Billy Peace war auch Nolas Vater. Niemand konnte rekonstruieren, wie viele Frauen Billy geheiratet hatten oder was vor Jahrzehnten in seiner Kultgemeinschaft vorgegangen war. Man wusste nur, dass immer noch Kinder und Enkel von ihm auftauchten und meist ins Stammesregister aufgenommen wurden.
In ihrer Jugend war Mrs. Peace eine melancholische Schönheit mit langem, seidigem braunen Haar. Jetzt war ihr langes Haar seidig und weiß. Statt in einer kurzen Dauerwelle, wie die meisten Frauen ihres Alters, trug sie es geflochten oder hochgesteckt, dazu jeden Tag andere aus Perlen gefertigte Ohrringe. Die Muster entwarf sie selbst – heute himmelblaue Scheiben mit Orange in der Mitte. Dieses Hobby hatte sie angefangen, als sie nach ihrer Pensionierung ins Reservat zurückkehrte, und seitdem auch Zigarillos geraucht. Inzwischen sah man sie seltener mit ihren stinkenden braunen Stangen. Perlenstickerei, sagte sie, sei eine gute Ablenkung vom Rauchen. Eine Stehlupe stand dafür immer auf dem Tisch bereit, weil die Augen nicht mehr so mitmachten, und eine flaschenbodendicke Brille verlieh ihr einen staunenden, weltfernen Blick, der ihre geheimnisvolle Aura noch verstärkte.
Als Landreaux klopfte, ließ sie ihn herein und umarmte ihn. Stumm hielten sie einander für einen Moment.
Er zog gleich hinter der Tür die Schuhe aus. Sie ging Teewasser aufsetzen. Landraux winkte mit Stethoskop und Blutdruckmanschette, aber sie sagte, er solle es bloß wegpacken, das Zeug. Ihr gehe es gut. Im Ältestenhaus gab es einen Waschsauger, und ein dicker, aschblonder Teppich, der den halben Fußboden bedeckte, brauchte viel eher als sie seine Aufmerksamkeit. Aber erst einmal ließ er die Maschine und die Reinigerflasche vor der Wohnungstür.
LaRoses rätselhafte Schmerzen hatten sich nach Billy Peaces Tod bis auf gelegentliche Anfälle abrupt gelegt. Neuralgie, Ganzkörpermigräne, Osteoporose, Wirbelsäulenschäden, Lupus, Ischias, Knochenkrebs, Phantomschmerz, obwohl ihre Glieder intakt waren – die Diagnosen waren gekommen und gegangen. Ihre Krankenakte war so dick wie hoch. Sie selbst wusste, warum die Schmerzen so plötzlich mehr oder weniger verschwanden. Billy war grausam gewesen, selbstverliebt und schlau. Seine Liebe war genauso eine Bürde gewesen wie der Hass. Manchmal pirschten seine Gemeinheiten sich noch aus der Geisterwelt an sie heran. Alle dachten, sie sei als Witwe allein geblieben, weil sie ihn so abgöttisch verehrte. Sie beließ sie in ihrem Glauben. In Wahrheit hatte er ihr alles beigebracht, was sie über Männer wissen musste. Sie hatte keinen Bedarf an weiteren Lektionen.
Landreaux glaubte als Mann natürlich an die Geschichte von der tragisch liebeskranken Lehrerin. Er sorgte sich um sie und dachte, sie spielte für den Rest der Welt die Tapfere. Heute bemerkte er mit Schrecken, dass ihr Blick erschöpft und leer wirkte und sie im Sessel nicht zur Ruhe fand. Vielleicht hatte sie seinetwegen wieder eine Schmerzattacke.
Um mich mach dir mal keine Sorgen, sagte sie. Aber für euch ist das ein ganz schöner Brocken, oder? Es ist lieb, dass du trotz allem herkommst und mir hilfst.
Ich kann nicht die ganze Zeit nur rumsitzen, sagte er und versuchte sie zu ein, zwei Schmerztabletten zu überreden.
Da werd ich blöd von.
Ihre Augen verschwammen hinter den dicken Brillengläsern.
Freust du dich schon auf die Teppichreinigung?, fragte er und merkte gleich, wie albern, wie armselig es klang. Aber sie glich seinen Patzer mühelos aus.
Es tut mir wirklich erstaunlich gut, antwortete sie. Fang ruhig an.
Er trank den Tee aus und holte die Maschine.
Landreaux räumte den Sessel, den Zeitungsständer und den Fernseher samt Fernsehtisch vom Teppich runter. Er füllte Wasser in den Tank, mischte den Reiniger darunter und fing an. Die Maschine gurgelte und blubberte, als er sie hin und her bewegte. Es war ein leises, einlullendes Geräusch. Und tatsächlich schloss Mrs. Peace in ihrem Sessel selig lächelnd die Augen. Als er fertig war, kam sie zu sich und begann eifrig um den nassen Teppich herumzuwuseln. Landreaux brachte die Maschine weg und aß ein Stück von dem Felsenbirnenkuchen, den sie für ihn hingestellt hatte. Dann klingelte das Telefon, und sie wurde zu ihrer Nachbarin Elka gerufen, die Hilfe mit den Augentropfen brauchte. Das Schlappen ihrer Hausschuhe verhallte im Flur.
Als sie weg war, ging Landreaux ins Badezimmer. Er sah wie immer ihre Hausapotheke durch, kontrollierte, ob etwas zur Neige ging oder abgelaufen war. Zwei Fläschchen, die fast leer waren, stellte er im Wohnzimmer auf den Tisch. Als sie zurückkam, bot er ihr an, sie in der Krankenhausapotheke aufzufüllen.
Warte, bevor du losgehst, sagte sie. Ich zeig dir was.
LaRose öffnete ihren Kleiderschrank. Dort sammelte sie Urkunden, rissige Zeugnisse, ausgeschnittene Gedichte und stapelweise vergilbte Briefe, lauter Unterlagen zur ersten LaRose. Emmaline nannte ihre Mutter den wandelnden Heimatverein. Zumindest die vielen Fotos hatte Snow für sie in Alben einsortiert. Mrs. Peace nahm eine große schwarze, runde Blechdose aus dem Schrank. Den Deckel zierten drei verblasste handgemalte Rosen. Sie bekam wegen ihres Vornamens alle möglichen mit Rosen verzierten Sachen, und vielleicht war es ihrer Mutter schon so gegangen, denn die Dose schien ziemlich alt zu sein. Sie war ein Sammelplatz für die unterschiedlichsten Papiere – Aphorismen, Zeitungsausschnitte, Bilder, kleine Geschichten über Hunde und viele eigene Notizen. Ihre Handschrift, diese sanft geschwungenen Buchstaben, erinnerten Landreaux an Emmaline als Kind.
Was willst du mir zeigen?, fragte er.
Sie drückte ihm eine Abschrift des Gedichts Invictus in die Hand. Alle ihre ehemaligen Schüler kannten dieses Gedicht.
Behalt es, sagte sie.
Das kann ich noch auswendig. Des Schicksals krause Hand trifft es ganz gut, sagte er.
Graus’ge Hand, sagte Mrs. Peace.
Sein Blick fiel auf ein faseriges Blatt Papier aus einem Big-Chief-Notizblock. Es war mit seiner eigenen Handschrift bedeckt, ohne dass er sich erinnerte, ihn beschrieben zu haben. Wieder und wieder stand darauf der Satz: Ich werde nicht weglaufen.
Davon habe ich dich zehn Seiten schreiben lassen, sagte sie, aber nur die eine aufbewahrt.
Sie legte ihm ihre schmale, zierliche Hand auf die Schulter. Sofort breitete sich Wärme darunter aus.
Ich werde nicht weglaufen, sagte Landreaux. Eine Weile saßen sie schweigend Hand in Hand auf der Couch.
Bevor er aufbrach, gab Landreaux Mrs. Peace die beiden Pillenfläschchen, und sie sagte der Apotheke die Kennnummern durch. Dann ließ sie ihn die Fläschchen ins Bad zurückbringen. Es waren nicht die, die ihn interessierten, das wusste sie. Und sie wusste, dass er von denen lange keine mehr genommen hatte. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen zählte sie ihre Pillen immer durch. Alte Leute waren eine beliebte Nachschubquelle.
Landreaux brauchte den Pick-up, wenn er Zeltstangen oder Heuballen transportierte. Wenn er Müll wegbrachte oder einfach für sein Ego. Trotzdem war ihm wohler, wenn Emmaline mit dem sichereren Pick-up zur Arbeit fuhr und er selbst den magischen Corolla nahm, das Auto, das nicht sterben wollte. Sie hatten es geerbt, als Emmalines Mutter in das Ältestenhaus umzog. Bis auf die Wartung, die Landreaux selbst hinbekam, brauchte dieser Wagen nie Reparaturen. Er war im Vergleich zu anderen Autos, die er im Laufe seines Lebens besessen hatte, einfach sagenhaft verlässlich. Die Karosserie war undefinierbar grau, die Sitze abgewetzt und durchgesessen. Der Fahrersitz ließ sich nicht weit genug zurückschieben, um seine langen Beine unterzubringen, und trotzdem fuhr er immer wieder gern damit. Besonders wenn er nach dem ersten Schnee die Winterreifen aufgezogen hatte, machte es ihm Spaß, über die stillen Nebenstraßen zu seinen Patienten zu knirschen.
Ottie Plume, den der Diabetes einen Fuß gekostet hatte, lebte mit seiner Frau Baptiste ein paar Meilen außerhalb der Stadt am Seeufer. Bap wollte ihren Mann nicht im Rehazentrum lassen, deshalb versorgte Landreaux ihn zu Hause mit Physiotherapie, half ihm in die Dusche und aufs Klo, passte auf, dass er seine Tabletten nahm, gab ihm Spritzen, half ihm essen, stutzte seine Ohr- und Nasenhaare, schnitt ihm die Nägel, massierte ihn und besprach mit beiden den neuesten Klatsch und Tratsch. Außerdem begleitete er Ottie zur Dialyse.
Bap öffnete Landreaux die Tür.
Hab mich schon gefragt, ob du aufkreuzt, sagte sie.
Das Leben geht weiter, sogar für einen wie mich, sagte Landreaux, und dass er so offen damit umging, beruhigte Bap.
Er ist da, Ottie!, rief sie über die Schulter.
Dann blieb sie im Zimmer, obwohl sie sich sonst immer um ihre eigenen Dinge kümmerte, wenn Landreaux mit Ottie beschäftigt war. Landreaux war klar, dass man über ihn tratschte und dass Bap blieb, um ihren Verwandten zu erzählen, wie er sich jetzt verhielt. Ob man ihm etwas anmerkte. Emmaline hatte ihm prophezeit, dass die Arbeit hart werden würde. Die Geschichte würde er den Rest seines Lebens nicht los. Er wäre immer Teil dieser Geschichte. Es sei nicht zu ändern. Selbst LaRose könne nichts daran ändern, sagte sie.
Aber Landreaux wusste, dass es so nicht stimmte. LaRose hatte die Geschichte sehr wohl verändert.
Ich freu mich, dass du kommst, sagte Ottie. Sein goldbraunes Kindergesicht, rund und von der Krankheit gezeichnet, strahlte dabei. Als ehemaliger Ringer war Ottie nie ganz aus dem Leim gegangen. Seine Pfunde lagen dicht an, wie die Speckschicht einer Robbe. Viele seiner Verwandten waren viel schneller an Diabetes gestorben.
Wie ich Bap schon sagte, das Leben geht weiter.
Jedenfalls bis es zu Ende ist, sagte Ottie. Ich hab gestern ohne Hilfe geschissen. Bin fast von der Schüssel gekippt.
Also echt, Ottie, sagte Bap.
Packen wir’s, sagte Landreaux und schob Ottie in den kurzen Flur.
Die Stammesverwaltung hatte ein barrierefreies Badezimmer springen lassen, mit Duschsitz und allem drum und dran. Landreaux half Ottie auf den Stuhl, schrubbte ihm den Rücken und duschte ihn ab. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Bap reichte saubere Kleidung ins Bad. Als die Männer in die Küche kamen, gab es Blaubeer-Pfannkuchen aus Eipulver mit gepanschtem Ahornsirup. Landreaux schmeckte gleich die leichte Chemienote im Teig und die Bitterkeit des Aspartams. Einfach köstlich.
Und, wie kommt ihr klar? Bap lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sie war eine schlanke, zierliche Person, die immer noch tat, als sei sie schreiend eifersüchtig und müsse ihren Ottie gegen andere Frauen verteidigen. Sie machte sich immer nett zurecht für ihn. An jedem Wochentag trug sie eine andere Lidschattenfarbe. Heute, am Dienstag, war es lila. Sie hatte ihr Haar zum Pferdeschwanz gebunden und den Pony über den gezupften Augenbrauen zu einer fluffigen Bugwelle gesprayt. Ihre Nägel waren mädchenhaft rosa. Sie tippte sich mit dem Finger an die Lippen.
Vielleicht sollte ich gar nicht fragen? Besser die Klappe halten, hm?
Ach was, sagte Landreaux.
Sie war eine von Emmalines Cousinen.
Du gehörst zur Familie, sagte er.
Emmaline ist echt tapfer, sagte Bap.
Das ist sie, sagte Landreaux. Ihm brummte plötzlich der Schädel. Ich will übrigens eine Stiftung gründen. Wenn’s ihnen besser geht, wenn unsere Familien sich erholen.
Bap und Ottie nickten zögernd, als befürchteten sie, selbst einzahlen zu müssen.
Das machen jetzt alle, diese Stiftungen, sagte Bap.
Also ich, sagte Ottie, ich weiß ja, dass das ’ne traurige Sache ist. Aber wenn ich abtrete, soll meine Gedenkstiftung Stöckelschuhe fördern. Mir gefällt’s jedenfalls, wenn Bappy sich für mich schick macht. Wir brauchen mehr Frauen hier im Reservat, die beim Gehen dieses Klickgeräusch machen. Mich macht das total rallig.
Bap nahm Otties Hand.
Du brauchst keine Stiftung, Süßer. Du stirbst doch nicht.
Nur so Stück für Stück, sagte Ottie.
Scheiß Diabetes, sagte Landreaux.
Ihr müsst gleich los zu dem Termin, sagte Bap. Du musst noch seinen Blutzucker messen.
Hat er schon, sagte Ottie.
Landreaux verschwieg, dass er gemessen hatte, als der Pfannkuchenduft durchs Zimmer wehte, weil die Kohlehydrate immer Otties Werte hochjagten, egal, wie viel Süßstoff Bap ihnen entgegensetzte. Von diesem Aspartam-Zeug kriegten die Leute nur Halluzinationen. Erst als er neben Ottie im Auto saß, den zusammengeklappten Rollstuhl im Kofferraum, merkte Landreaux, dass er um Baps Frage herumgekommen war. Ottie hatte sie mit seiner Stöckelschuh-Stiftung davon abgelenkt.
Danke, sagte er zu Ottie.
Wofür?
Ich hatte keine Ahnung, wie ich Bap antworten soll. Wie wir klarkommen. Wir sind noch in dieser Phase, wo du aufwachst, dich erinnerst und nur wieder einschlafen willst.
Jagen wirst du wohl nicht so bald wieder.
Hab die Büchse verbrannt. Soweit so ein Ding sich verbrennen lässt.
Hat doch auch keiner was von, sagte Ottie. Wo kriegen die Kinder jetzt ihr Eiweiß, damit sie groß und stark werden?
Ich kann ja Fallen stellen, sagte Landreaux. Dann gibt’s Karnickelbraten.
So was darf ich ja sogar essen, sagte Ottie. Ich geb dir dafür welche von den Pillen, die du so magst.
Landreaux schwieg.
Aber dein Hirschfleisch werd ich vermissen, fuhr Ottie fort. Schon klar, dass man damit nicht so schnell fertig wird. Das holt einen immer wieder ein.
Und wieder und wieder, sagte Landreaux. Lass mal das mit den Pillen. Ich brauch das Zeug nicht mehr.
Brauchte er aber doch, und wie.
* * *
In der Hot Bar in Whiteys Tanke gab es Chicken Wings, paniertes Hühnerklein, Pizza und Mikrowellen-Teigtaschen. Romeo Puyat sah Landreaux abbiegen und hinter der Tankstelle auf der Brache parken. Romeo war hager, hatte eng stehende, stechende Augen und einen versehrten, gebeugten Gang. Den rechten Arm hielt er immer dicht am Körper, weil er nach mehrfachen komplizierten Brüchen schief zusammengeflickt worden war, genauso wie sein zu kurzes rechtes Bein. Trotzdem kam er ziemlich flink voran. Weil er dachte, Landreaux würde drinnen zu Mittag essen, schnappte Romeo sich seinen Schlauch und den leuchtend roten, sicherheitsgeprüften Benzinkanister. Er humpelte krumm, aber zielgerichtet zu Landreaux’ Auto und machte sich ans Werk. Geübt, wie er war, floss Sekunden später Benzin aus dem Tank in den Behälter.
Landreaux kam mit einer kleinen Pappschachtel aus dem Laden. Er erkannte Romeo sofort, begrüßte ihn aber nicht wie einen alten Schulkameraden. Sie konnten sich nicht leiden, seit ihre Kindheit ein brutaltes Ende gefunden hatte. Schon im Internat hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen. Und dann war da diese unglückliche Geschichte, als Romeo versucht hatte, Landreaux im Schlaf zu erstechen. Da waren sie Anfang zwanzig, und Landreaux hatte an dem Abend eine größere Menge Geld bei sich gehabt. Weil dieses Geld die Hauptrolle spielte, kränkte es Romeo, dass Landreaux ihm den missglückten Anschlag noch immer übelnahm. In letzter Zeit trachtete er dem alten Schulfreund zumindest nicht mehr nach dem Leben.
Romeo hatte sich so ziemlich damit abgefunden, dass Landreaux ihm mit Emmaline seine erste große Liebe weggeschnappt hatte. Vielleicht hatte sie Romeo sowieso nicht besonders gemocht. Er kam auch widerstrebend damit klar, dass Landreaux und Emmaline seinen ungeplanten Sohn Hollis bei sich aufgenommen hatten und sich beispielhaft um ihn kümmerten. Romeo fand, sie seien dabei ziemlich gut weggekommen, weil Hollis so ein Prachtjunge war. Trotzdem musste er zugeben, dass sie Kosten mit ihm hatten. Jedenfalls kam es ihm inzwischen nur darauf an, dass Landreaux ihm auch mal was gönnte. Als bekannter und beliebter Pfleger hatte er es sicher leicht, an Verschreibungspflichtiges zu kommen. Warum sollte er seinem alten Freund nicht eine Freude machen? Ihm seine Qualen erleichtern? Romeo kriegte natürlich auch etwas verschrieben, aber Oxycodon war es nicht gerade, und manchmal musste er von dem laschen Zeug etwas verschachern, um an die echten Knaller ranzukommen. Fentanyl zum Beispiel. Davon versuchte er schon länger ein, zwei Pflaster aufzutreiben.
Landreaux ging zu seinem Auto.
Sieh an, sieh an, sagte Romeo und schielte auf den Schlauch runter, durch den das Benzin in den Kanister floss. Lang, lang ist’s her.
Landreaux rührte es beinahe, seinen früheren Schulfreund beim Benzinklauen zu erwischen. Er hatte schon vor Jahren beschlossen: Was auch immer ihm Romeo oder sonst wer wegen seiner schlimmen Zeiten antat, hatte er verdient. Also sagte er nur: Ich muss los. Die Mozzarella-Sticks werden kalt.
Mozzarella-Sticks, wiederholte Romeo angewidert.
Für die Kinder, sagte Landreaux.
Ahaaaaah, machte Romeo, als hätte er etwas Kluges, Überraschendes gehört. Er ruckte mit dem Kopf, runzelte konzentriert die Stirn und zog langsam den Schlauch aus dem Tank.
Hast du nicht was für mich, alter Niiji? Er klopfte das Schlauchende sorgsam ab. Dann schraubte er den luftdichten Verschluss auf den Kanister, schloss den Tankdeckel und gab der Klappe einen Schubs.
Nein, sagte Landreaux.
Tja, ich bin hier fertig, sagte Romeo.
Er nahm seinen roten Kanister, salutierte affektiert mit zwei Fingern und machte sich auf den Weg zu seinem Auto mit dem leeren Tank.
Grüß Emmaline von mir, rief er noch über die Schulter.
Landreaux starrte ihm nach, stellte den Karton aufs Autodach und öffnete die Tür. Wie Romeo zum Abschied salutiert hatte, löste Erinnerungen bei ihm aus. Es gab auch reichlich Stoff für Erinnerungen, aber die sichtbaren Narben hatte Romeos Messer hinterlassen, als er es Landreaux in den Unterarm und dann in den Bizeps rammte. Es war ein kleines Wunder gewesen, dass Landreaux sich damals im entscheidenden Moment im Schlaf umgedreht und an der Nase gekratzt hatte. In Gedanken versunken, vergaß Landreaux den Karton mit den Mozzarella-Sticks und fuhr an Romeo vorbei, der gerade seinen Tank befüllte. Beim Abbiegen geriet die Box ins Rutschen und landete auf Romeos Motorhaube. Als der Benzinkanister leer war, nahm Romeo einen Mozzarella-Stick aus dem Karton. Er biss nur ein Mal ab – die Sticks waren jetzt schon kalt und gummiartig. Er ging zur Hot Bar und beschwerte sich.
Ich kann sie Ihnen aufwärmen, sagte das Mädchen am Tresen.
Ich will lieber mein Geld zurück, sagte Romeo.
* * *