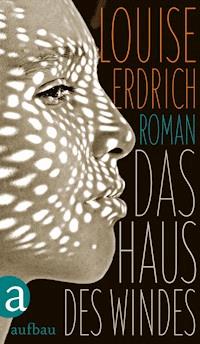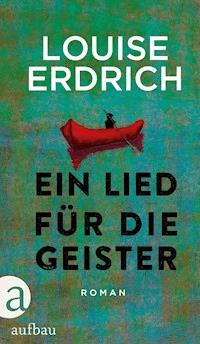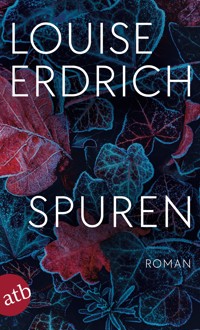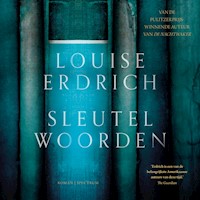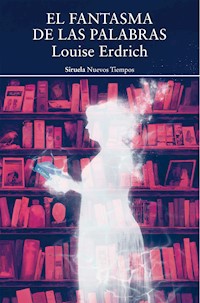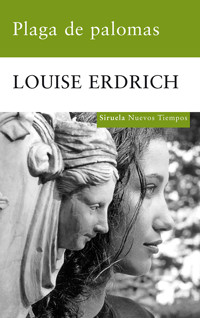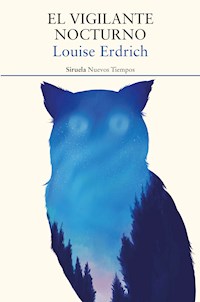8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Metzgern, die wie Engel singen.
Anfang der zwanziger Jahre wandert ein junger Metzgermeister aus der süddeutschen Heimat nach Amerika aus. Ein Koffer voller Würste finanziert die Reise über den Ozean bis nach North Dakota. Gemeinsam mit seiner Frau Eva fasst Fidelis Waldvogel Fuß, gründet eine Metzgerei und einen Gesangsverein. Das Geschäft floriert, auch dank der jungen Artistin Delphine, die bei dem Paar eine Anstellung findet – und ganz nebenbei deren Leben aus den Angeln hebt ...
»Eine Liebes- und Lebensgeschichte voll eigenwiller Figuren, poetisch und fesselnd.« Elle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag ist ihr Roman »Der Gott am Ende der Straße« und im Aufbau Taschenbuch ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
Informationen zum Buch
Von Metzgern, die wie Engel singen
Anfang der zwanziger Jahre wandert ein junger Metzgermeister aus der süddeutschen Heimat nach Amerika aus. Ein Koffer voller Würste finanziert die Reise über den Ozean bis nach North Dakota. Gemeinsam mit seiner Frau Eva fasst Fidelis Waldvogel Fuß, gründet eine Metzgerei und einen Gesangsverein. Das Geschäft floriert, auch dank der jungen Artistin Delphine, die bei dem Paar eine Anstellung findet – und ganz nebenbei deren Leben aus den Angeln hebt.
»Eine Liebes- und Lebensgeschichte voll eigenwiller Figuren, poetisch und fesselnd.« Elle
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Der Club der singenden Metzger
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Renate Orth-Guttmann
Inhaltsübersicht
Über Louise Erdrich
Informationen zum Buch
Newsletter
1 Das letzte Glied der Kette
2 Der Balancekünstler
3 Die Knochen
4 Der Keller
5 Die Frau des Metzgers
6 Der Nachtgarten
7 Das Herz aus Papier
8 Köterdämmerung
9 Die Erdkammer
10 Die Erdkrankheit
11 Weihnachtssonne
12 Traumfeuer
13 Die Schlangenmenschen
14 Stacheldraht und Silbertannen
15 Der Metzgermeister-Gesangverein
16 Step-and-a-Half
Danksagungen
Impressum
Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie erraten,
Sie fliehen vorbei,
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger erschießen
Mit Pulver und Blei.
Die Gedanken sind frei!
Aus den »Fliegenden Blättern« um 1780
meinem Vater,der für mich gesungen hat
1 Das letzte Glied der Kette
Fidelis kam nach zwölf Tagen Fußmarsch aus dem großen Krieg nach Hause, kroch in sein Bett im Kinderzimmer und schlief sechsunddreißig Stunden fest durch. Als er Ende November 1918 aufwachte, war er nur wenige Zentimeter davon entfernt, auf der von Clemenceau und Wilson umgezeichneten Landkarte Franzose zu werden, was ihm in diesem Moment weniger wichtig war als die Frage, was es wohl zu essen geben würde. Er schob das weiße Federbett zur Seite, das seine Mutter, seit er sechs war, jedes Jahr im Frühling lüftete und neu füllte. Obwohl sie immer wieder versuchte, durch kräftiges Schrubben die Spuren einer blutigen Nase zu tilgen, die er sich mit dreizehn geholt hatte, war der Fleck noch da, zu einem hellen Teebraun verblaßt und anzusehen wie ein ausgefranstes Nest. Fidelis roch Essen, einen leichten Hauch zwar nur, der ihn aber hoffnungsvoll stimmte. Kartoffeln vielleicht. Ein bißchen Quark. Ein Ei? Ein Ei wäre nicht schlecht. Das Bett war breit, weich und nach den vielen elenden Lagerstätten der letzten drei Jahre ein so unglaublicher Luxus, daß ihn beim Hinlegen eine Gänsehaut überlief. Das leise, glückliche Weinen seiner Mutter hatte ihn in den Schlaf begleitet. Auch jetzt noch meinte er sie weinen zu hören, aber es war das Sonnenlicht, das mit perlendem Laut, einer weiblich-gefühlvollen Melodie über die elfenbeinfarbenen Wände wanderte.
Nach einer Weile kam er zu dem Schluß, daß er das Licht singen hörte, weil er sauber war. Irritierend sauber. Vor zwei Tagen hatte er nicht gleich ins Haus kommen wollen, sondern darum gebeten, in einem Waschzuber auf dem kleinen überdachten Hof unter der Weinlaube zu baden. Man schürte ein Feuer und machte Wasser heiß. Seine Schwester Maria Theresa las ihm die Läuse aus dem Haar, und sein Vater brachte sauberes Zeug. Um auszuhalten, was der Krieg mit sich brachte, auch den eigenen Schmutz, hatte Fidelis seine Sinne abgeschaltet. Als er sich jetzt der Welt wieder öffnete, empfand er alles, was um ihn herum vorging, beängstigend intensiv, alle Gegenstände waren voller Gefühl und Leben – wie in einem sehr lebhaften Traum.
Die Stille in seinem Kopf dröhnte. Ganz gewöhnliche Geräusche, Passanten draußen auf der Straße, kamen ihm wundersam vor wie das Schnattern seltener Affen. Ein Glücksschauer überlief ihn. Schon das Anziehen der sauberen, ungezieferfreien Sachen war etwas so Großartiges, daß ihm fast die Tränen kamen, als er die goldenen Manschettenknöpfe mit dem Eberkopf schloß, die seinem Großvater gehört hatten. Flach atmend sammelte er sich und brachte kraft seiner Ruhe die Tränen zum Versiegen. Seit der Kinderzeit hatte er, wenn er traurig war, flach geatmet und war in Reglosigkeit verfallen. Als Rekrut hatte er von Anfang an gewußt, daß diese Begabung, völlig zur Ruhe zu kommen, der Schlüssel zu seinem Überleben war. Sie hatte denn auch den unerfahrenen jungen Soldaten durch den Krieg gebracht, weil sich sehr schnell herausstellte, daß er von einer Scharfschützenstellung aus auf hundert Meter Entfernung einem Mann ein Auge durchbohren und mit fünf Schuß drei Treffer landen konnte. Auch jetzt noch würde er wachsam sein müssen. Erinnerungen würden sich anschleichen, Emotionen sein Denken sabotieren. Es war nicht ungefährlich, wieder ins Leben zurückzukehren, nachdem man innerlich fast gestorben war. Ein Übermaß an Gefühlen stürmte auf ihn ein, deshalb beschloß er, zunächst nur oberflächliche Eindrücke zuzulassen, versuchte sich zurechtzufinden. Selbst an sein Kinderzimmer, das er so gut kannte, mußte er sich erst wieder gewöhnen.
Er setzte sich auf die Bettkante. Auf einem dicken, in die Wand eingelassenen Bord standen – unberührt seit seinem Weggang – seine Bücher ordentlich aufgereiht oder gestapelt, mit schmalen Papierstreifen als Lesezeichen. Eine Weile hatte er sich, obgleich sein Beruf feststand, der Illusion hingegeben, er könne vielleicht Dichter werden. Deshalb standen dort die Werke seiner Helden – Goethe, Heine, Rilke, ganz hinten versteckt sogar Trakl –, die er jetzt fast unbeteiligt musterte. Wieso war ihm jemals wichtig gewesen, was diese Männer schrieben? Was gingen ihn ihre Worte an? Auch die Geschichte seiner Kindheit war in diesem Zimmer vertreten durch die Zinnsoldaten, die auf dem Fensterbrett aufgestellt waren, der Stolz seiner ersten Mannesjahre durch die gerahmten Diplome und den Meisterbrief an der Wand. Die waren wichtig, sie waren seine Zukunft. Sein Überleben. Im Schrank hingen die Hemden – gebleicht, gestärkt und gebügelt, bereit zum Hineinschlüpfen, auf dem Brett darunter warteten die blank geputzten Schuhe auf den alten Fidelis. Vorsichtig versuchte er, in das aufgesperrte Ledermaul zu fahren, aber es ging nicht. Seine Füße waren geschwollen, voller Frostbeulen, rissig, schmerzten. Nur die Nagelstiefel paßten, und die waren innen grün und stanken nach Moder.
Langsam wandte er sich um und betrachtete den Tag. Das Schlafzimmerfenster war ein langgezogenes goldenes Rechteck. Er stand auf und öffnete den Fensterflügel mit dem Widderhorngriff und sah hinaus über den trägen braunen Fluß von Ludwigsruhe, über die Dächer und die toten spätherbstlichen Gärten am anderen Ufer und einen Flickenteppich blaßgrauer Felder zu der kleinen Ansammlung von Dächern und Schornsteinen dahinter. Irgendwo im Straßengewirr der Nachbarstadt wohnte die Unbekannte, die er versprochen hatte aufzusuchen. Er ertappte sich dabei, daß er sich Gedanken über sie machte, komplizierte, intensive Gedanken. Die Gedanken wurden zu Fragen. Was machte sie gerade? Hatte sie einen Garten? Klaubte sie die letzten erdigen Kartoffeln aus einer kleinen strohbedeckten Miete? Hängte sie die Wäsche, frisch und weiß, an eine vereiste Leine? Unterhielt sie sich bei einer Tasse Tee mit ihrer Schwester, ihrer Mutter? Sang sie vor sich hin? Dann dachte er an sich und an das, was er versprochen hatte, ihr zu sagen. Wie sollte das gehen? Aber es mußte gehen. Irgendwie.
Eva Kalb, Eulenstraße 17. Fidelis war vor dem Fußweg aus hellem Backstein stehengeblieben und betrachtete mit gerunzelter Stirn den grazilen gußeisernen Bogen über dem Eingang. Um das Ziergitter herum wanden sich die kräftigen Ranken einer Kletterrose, blattlos und fast schwarz, riesige Dornen mit weißer Spitze. Der Fußweg war nicht gefegt, vor der Haustür lag Papier. Die anderen Häuser der Straße verrieten fanatische Ordnungsliebe noch im Chaos der Niederlage. Daß Eva Kalbs Haus so vernachlässigt war, beunruhigte Fidelis; hatte die Familie vielleicht vorher schon einen Trauerfall gehabt? Tränen stiegen ihm in die Augen, und er kniff sich in den Nasenrücken. Die Heftigkeit seiner Emotionen, sogar in der Öffentlichkeit, erschreckte ihn. Hinter einer dünnen Gardine bewegte sich etwas. Man hatte ihn gesehen. Mit einem tiefen Atemzug und mit einem Ruck gleichsam in eine dickere Haut schlüpfend ging er den Fußweg entlang zum Haus.
Sie öffnete sofort, also war sie es gewesen, die am Fenster gestanden und ihn beobachtet hatte. Er wußte, daß es Eva war, weil sein Freund ihr Bild in einem Medaillon immer bei sich gehabt hatte. Fidelis hatte das Medaillon als Andenken behalten, und jetzt war ihm, als brenne das kleine Oval aus billiger Goldbronze ein Loch in seine Brusttasche. In dem Rähmchen steckte das handkolorierte Bild einer Frau, die ebenso tatkräftig wie zart wirkte. Der sensible Mund verriet Klugheit und Sinnlichkeit zugleich, die schrägen, tiefgrün-unergründlichen ungarischen Augen verunsicherten Fidelis mit ihrem geraden, forschenden Blick. Die antrainierte Reglosigkeit, die ihm geholfen hatte, die letzten Jahre zu überstehen, war dahin. Schnell, die Wahrheit, sagte sie mit einer Feindseligkeit, die wohl Selbstschutz war und ihn auf der Stelle gehorchen und das sagen ließ, was gesagt werden mußte: Ihr Liebster, ihr Bräutigam und künftiger Ehemann, Johannes, mit dem Fidelis durchgemacht hatte, was ein Mensch nur durchmachen konnte, war tot.
Unmittelbar danach war sich Fidelis nicht sicher, ob er diese Worte nur gedacht oder tatsächlich ausgesprochen hatte, aber ihm schien, als seien Töne aus seinem Mund gekommen, die er zwar nicht hören konnte, die aber Eva mit einem tiefen, zitternden Atemzug in sich aufnahm, von dem ihr die Sinne schwanden. Das schöne, kluge Gesicht wurde ganz leer, und einen Augenblick sah Fidelis in ihr nur die nackte, gequälte Kreatur. Dann sank Eva Kalb, die Hände wie betend gefaltet, Fidelis in die Arme. Als er sie auffing und behutsam an sich zog, spürte er mit einer Überraschung, die ihm durch und durch ging, daß sie schwanger war. Später war ihm, als habe das Kind aus ihrem Leib heraus seine helfende Hand berührt.
Fidelis blieb, die Verlobte seines besten Freundes in den Armen haltend wie ein schlafendes Kind, unter der Tür stehen. Stundenlang hätte er dort stehen können. Die Kraft, die er brauchte, um sie zu halten, war nur ein winziger Bruchteil der Kraft, die er besaß, denn er gehörte zu den Menschen, die stark geboren werden und deren Stärke von Jahr zu Jahr wächst.
Es heißt, daß manche Menschen – und vielleicht gehörte Fidelis zu ihnen – im Mutterleib die Zellstruktur eines möglichen Zwillings in sich aufnehmen. Oder er stammte von jenen alten Germanen ab, die durch die Wälder streiften und ihren Gott an den Lebensbaum hängten. In einigen Gegenden Deutschlands glaubte man auch, daß in einen Menschen, der getötet hat, das Wesen des Opfers eingeht. Das wäre eine Erklärung für das Leichte und das Schwere, das sich in Fidelis’ Wesen mischte. Er hatte Sekundenbruchteile, ehe seine Scharfschützenkugel das ferne Gesicht zerschmettert hatte, im Zielfernrohr ein Lächeln aufblitzen sehen. Er hatte erlebt, wie ein Mann, dessen Hals er durchschossen hatte, die Hand auf die Wunde preßte und wie das Blut durch seine Finger quoll. Er teilte aus seinem mit Sandsäcken geschützten und verstärkten Posten heraus den Tod so zielgenau aus, daß die Engländer und Franzosen sich bemühten herauszubringen, wann er Wache hatte. Sie haßten ihn und versuchten – was ihnen auch fast gelungen wäre –, ihn zu fangen, denn sie wußten schon ganz genau, wie sie ihn langsam töten würden. Es war auf beiden Seiten ein sehr persönlicher Krieg. Fidelis nahm es hin, er drückte sich nicht und fuhr fort, beharrlich und mühelos wie ein Raubtier, seine Opfer aus den zu flachen Gräben zu holen.
Sie gruben sich tiefer ein, um ihm zu entkommen, aber in einem Augenblick törichten Leichtsinns, schierer Erschöpfung oder todbringenden Überschwangs erwischte er sie doch. Vielleicht war es wirklich so, daß ihre Seelen über den blutgetränkten Schlamm hinweg geradewegs in ihn eingingen, denn seine innere Ruhe wurde zu einer gelassenen Gewalttätigkeit, ungestört vom Gebrüll des schweren nächtlichen Geschützfeuers. Seine Kameraden begannen ihn zu fürchten und dann, als die Lage immer schlechter wurde, ihn zu hassen. Er zog den Beschuß des Feindes auf sich, deshalb mied man ihn. Er schlief und schlief. Granaten schlugen um ihn herum ein, Kameraden schrieen ihn an, Fidelis runzelte nur leicht die Stirn, seufzte wie ein Kind und schlief weiter. Er träumte schwarze Träume, an die er sich beim Erwachen nicht mehr erinnerte. Gewissenhaft ölte und säuberte er sein Gewehr. Er aß das Brot und die Wurst, die getrockneten Pfirsiche und Äpfel, die er von daheim mitgebracht hatte, und jeden Morgen tunkte er den Finger, mit dem er den Abzug drückte, in einen kleinen Topf mit Honig von seiner Mutter, leckte den Finger ab und schmeckte die Bienensüße voller Waldbitternis – ein Geschmack aus der Kindheit, gesaugt aus den verborgenen Blüten der Silbertannen, dort, wo sie am dichtesten standen. Er leckte nie den ganzen Honig ab, und wenn er zur Waffe griff, rutschte sein Finger nie weg.
Jetzt wartete Fidelis in der Tür, bis Evas Mutter kam. Als er Eva ins Haus brachte und sie auf ein verschossenes rosafarbenes Sofa legte, wurde ihm das, was er bereits gewußt und seinem Freund Johannes versprochen hatte, der auf dem Rückzug unter den Klängen zart schwirrender Musik gestorben war, zur Gewißheit: Er würde Eva heiraten. Später, als sie ihm ihr Jawort gab und ihn küßte, schmeckte er auf ihrer Zunge und an ihrem Hals verschiedene Bedeutungsschichten. Er schmeckte Johannes, dem er im Tod die Stirn geküßt hatte wie einem kleinen Bruder, den man gerade zu Bett gebracht hat. Das war der salzige Geschmack des Kummers. Eva schmeckte anders und vertraut. Sie schmeckte nach der Bitternis in der Süße des Waldhonigs, und als er sein Gesicht von dem ihren hob, verströmte sie den intensiven Duft der heimlichen Schwarzkieferblüte kurz vor dem Welken.
Die Hochzeit war eine armselige Angelegenheit, die Braut hochschwanger mit dem Kind, das in Irrsinn und Verzweiflung des letzten Kriegshalbjahres gezeugt worden war. Doch der Priester wußte Bescheid, er gab ihnen seinen Segen, und sie verbrachten die erste gemeinsame Nacht in Fidelis’ Kammer, wo noch immer die Zinnsoldaten über das Fensterbrett marschierten. Sie lag nackt im flackernden Licht einer Kerze, und ihr Körper verdeckte den Fleck aus Kindheitstagen auf dem Federbett. Das goldene Haar, das den gleichen rötlichen Schimmer hatte wie das seine, war über das Kissen gebreitet, die Brüste waren blau geädert wie von Flammen, die Brustwarzen rissig und dunkel. Er kniete vor ihr, zwischen ihren Beinen, legte die Hände auf ihren Leib und spürte die kräftigen Bewegungen des Kindes. Die Empfindungen, die ihn bei seiner Heimkehr so aufgewühlt hatten, waren allmählich abgeflacht zu einem Gefühl der Scham darüber, daß er überlebt hatte. Er wußte nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte, aber als er, Evas Hüften umklammernd und ihre Beine hinter seinem Rücken verschlingend, in ihren Körper eindrang, trat er aus der gefährlichen Ruhe heraus, in der er gelebt hatte, und erkannte bewegt, daß es ihm – trotz der Last getöteter Seelen, trotz seiner Erfahrungen mit dem schwarzen Urgrund des Seins und seiner eigenen mörderischen Fähigkeiten – bestimmt war zu lieben.
Bald stellte sich heraus, daß es ihm auch bestimmt war zu reisen. Für ihn stand fest, daß er nach Amerika gehen mußte, weil er eine Scheibe Brot von dort zu Gesicht bekommen hatte. Als er kurz vor der Hochzeit mit Eva über den Marktplatz von Ludwigsruhe ging, sah er eine kleine Menschenmenge, die sich um einen Nachbarn und guten Bekannten seiner Eltern geschart hatte. Dieser Mann hatte etwas Weißes, Quadratisches in der Hand, was Fidelis zunächst für ein Bild hielt, doch die weiße Fläche war leer. Als er erkannte, daß es Brot war, mit geradezu fanatischer Präzision geformtes Brot, trat Fidelis in den Kreis, um das Wunderding in Augenschein zu nehmen. Verwandte aus einer fernen Küstenstadt hatten es in einem Paket in die Heimat geschickt als Beweis dafür, was in den Händen erfindungsreicher Menschen aus einem so alltäglichen Gegenstand wie einem Laib Brot werden konnte. Maschinen hatten es geknetet und gebacken und in Scheiben geschnitten. Sollte es tatsächlich das Werk amerikanischer Wald- und Wiesenbäcker sein? Darum drehten sich die Gespräche. Fidelis prüfte die Scheibe Brot, als sie, von Hand zu Hand weitergereicht, bei ihm ankam. Er registrierte die feine Krume und staunte über die Verarbeitung der Hefe, bemerkte den präzisen Schnitt, wunderte sich kopfschüttelnd über das merkwürdig gleichmäßige Goldbraun der Kruste. Ihm kam dieses Ding ganz und gar unglaublich vor, ein Artefakt aus einem Ort, wo man offenbar einer unglaublich starren Ordnung anhing. Am gleichen Tag noch nannte ihm der Nachbar den Namen des Ortes, aus dem das Brot gekommen war, und er hielt ihn sorgsam, Buchstabe für Buchstabe, auf einem Zettel fest, den er in den nächsten Monaten mit sich herumtrug, bis aus dem Entstehungsort eines kleines Wunders ein konkretes Reiseziel geworden war.
Als er mit einem Koffer, gefüllt mit den wunderbaren Rauchwürsten seines Vaters, von Bord der RMS Mauretania ging und in das quirlige Chaos des Hafens von New York City eintauchte, half ihm die Kraft seiner Ruhe durch die wirbelnde Ankunft der Massen. Man schrieb das Jahr 1922, und Evas Sohn war drei Jahre alt. Seiner inneren Ruhe hatte Fidelis es zu verdanken, daß er die Nachwehen des Kriegs mit ihrem Mangel überstanden hatte, in denen er sich auf tückische Schwarzmarktgeschäfte hatte einlassen müssen. Sein Koffer barg den Wohlstand seiner ganzen Familie. Alles, was sie an Schmuck noch besaßen, auch die Manschettenknöpfe, hatten sie hergegeben, damit er die Schiffskarte erstehen konnte, ohne seine Messer zu verkaufen. Mit gehorteten Kugeln aus der sorgsam versteckten Flinte hatte er das Wildschwein gewildert, aus dem die Würste gemacht waren, die ihm die Reise quer durch dieses neue Land ermöglichen sollten. Englisch sprach er nur so viel, wie er auf dem Schiff gelernt hatte, Wörter, die er für seine Zwecke brauchte – Zug, Bahnhof, Westen, beste Wurst, Metzgermeister, Arbeit, Geld, Land. Das Schicksal seiner Familie hing jetzt allein von ihm ab und – so sah er es – von seiner Fähigkeit, sich still und wachsam zu verhalten.
Gewiß, in seiner gelassenen Reglosigkeit lag Kraft, doch die wurde relativiert durch seine rastlos hin und her wandernden Augen, die so hell waren, daß es schien, als leuchte ein Licht in seinem Schädel. Das dichte rötlichblonde Haar, unter dem Vorkriegshut seines Vaters zerdrückt, war zu lang, aber er war glatt rasiert und trug saubere Unterwäsche. In den Innentaschen des väterlichen Anzugs steckte alles, was er brauchte. Der Anzug war von der gleichen bayrisch-soliden Qualität wie der Hut. Seine Angehörigen, die stolz darauf waren, keine Bayern zu sein, mißtrauten den Süddeutschen, die, wie sie fanden, von gröberer Machart waren als ihre Wollstoffe.
Obwohl seit Generationen Handwerker und Metzger, taten sie sich einiges auf ihre Bildung zugute und sehr viel auf die besonders schönen Männerstimmen in der Familie, die meist einen Sohn übersprangen. So war es mit der Singstimme seines älteren Bruders nicht weit her, Fidelis aber besaß einen Tenor von so natürlicher Klarheit und Frische, daß man hätte denken können, sein Nachname – Waldvogel – sei eigens für ihn erfunden worden. Der Name Waldvogel war in seiner Stadt so häufig, daß er sich darüber nie Gedanken gemacht hatte, aber in diesem neuen Land, wo ein Deutscher einfach ein Deutscher war, egal, aus welchem Teil des Landes er kam, sollte später immer wieder jemand darauf hinweisen und anfügen, Waldvogel sei ein erstaunlich sanftmütiger Name für einen Mann, der von der Schlachterei lebte.
Seine Familie sah das natürlich anders; das ordentliche Töten war eine Kunst. Der Beruf, der gewissenhaftes Lernen und zahlreiche Prüfungen erforderte, verlangte auch außergewöhnliche Präzision und ein sicheres Timing. Wer den Meisterbrief als Metzger erwerben wollte, mußte sich in sämtlichen Gewürzen dieser Welt auskennen, die geheimnisvolle Herstellung Hunderter von Wurstsorten beherrschen und bei dem geschlachteten Tier das Messer mit traumwandlerischer Sicherheit ansetzen können. Sein Vater, der sich darin ein Leben lang geübt hatte, schien kaum die Hände zu bewegen, wenn er das Tier in zunehmend manierlichere und überschaubarere Teile zerlegte. Auf dem Block verlor es seine Kreatürlichkeit und ging – so sah Fidelis das – in eine höhere und befriedigendere Daseinsform über.
Fidelis erinnerte sich der eleganten Bewegungen seines Vaters bei der Arbeit, während er selbst stundenlang Schlange stand, Untersuchungen über sich ergehen ließ, sich mit Stempeln und Schriftstücken herumärgerte, das Gedränge ungeduldiger Mitmenschen und den eigenen Hunger ertrug. Auch das schaffte er mit jener inneren Disziplin, die er am Visier seiner Waffe gelernt hatte. Denn die Rauchwürste in seinem Koffer waren keine Wegzehrung, sie waren seine Fahrkarte Richtung Westen.
Während er durch das Gedränge all jener, die hier schon Fuß gefaßt hatten, zum Bahnhof ging, überkam Fidelis ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit. Passanten, die an ihm vorübergingen, sahen einen aufrechten, kräftig gebauten Mann mit hohen Wangenknochen, blondem Haar, gerader, kühn vorspringender Nase und einem Mund, der so schön war wie die Stimme, die ihm entströmen konnte. Daß ihn die Stürme einer jungen und überraschenden Liebe umtrieben, sahen sie natürlich nicht. Er griff sich ans Herz, das unter den Aufschlägen seines Jacketts hin und wieder allzu unruhig pochte. Das Medaillon, das Eva ihrem Johannes geschenkt und das Fidelis heimlich behalten hatte, steckte dort, denn Fidelis hatte – beglückt und verstört zugleich – erleben müssen, daß er zwar durch die Ehe mit Eva das dem sterbenden Freund gegebene Versprechen gehalten hatte, dabei aber wie durch eine Falltür in die Schwärze einer Liebe gestürzt war, die wie eine Laube aus tintenschwarzen Zweigen die wehrlose Schönheit des Kindes, Evas Liebreiz, ihre Seelenstärke, ihre dickschädelige, geradlinige, störrische Anmut überwölbte.
Der Bahnhof mit seinen schweren, messingbeschlagenen Toren verschluckte Fidelis und alle anderen. In dem Menschenstrom ließ er sich bis zu den Fahrkartenschaltern treiben. Wieder wartete er in einer Schlange, bis er vor einer jungen Frau mit schmalen Lippen stand, deren Kiefer in einem den Menschen dieser Stadt eigentümlichen Rhythmus mahlten. Fidelis kannte noch keinen Kaugummi, und die Bewegung so vieler Kinnladen machte ihn nervös. Doch ihre Augen blitzten in jäher Gier, und die Kaubewegung hörte auf, als sie ihn sah.
»Ich wünsche, nach Seattle«, sagte er, die Wörter im Mund zusammenklaubend, »zu gehen.«
Sie nannte ihm den Fahrpreis. Er verstand die Zahlen nicht, die ihr von der Zunge klickerten, und gestikulierte, sie möge die Zahl aufschreiben. Sie tat es, warf ihm einen Seitenblick zu, fügte ihren Namen an und den Satz Komm mich besuchen, wenn du wieder da bist. Die Finger mit den rot lackierten Nägeln reichten ihm den Zettel und hielten ihn noch ein bißchen fest, so daß er zerren mußte, damit sie ihn freigab. Er bedankte sich auf deutsch, und sie zog eine geübt bekümmerte Schnute, die er, weil er todmüde war, nicht bemerkte. Immerhin, der Betrag war leserlich. Er wußte nun, um wie viel er die bescheidene Summe würde aufstocken müssen, die er noch besaß. Er steckte den Zettel in die Tasche und fand eine Säule, an die er sich lehnen konnte.
Dort stellte er sich so, daß der hintere Rand des väterlichen Hutes die kannelierte Säule berührte, hob den Koffer, öffnete den Deckel und senkte ihn so weit, daß er knapp über den Rand sehen konnte. So blieb er stehen bis zur Dämmerung, als der durch die hohen Fenster fallende rauchige Glanz sich vertiefte und schließlich zu einem matten Grau verblaßte. In seiner Reglosigkeit schien er – nein, nicht wie angewurzelt, er schien in der Luft zu hängen wie an Fäden, die ihn noch in der Schwebe hielten. Das mochte die wahrnehmbare Auswirkung des Hungers sein, der in ihm wühlte, ihn leichter machte, sein Inneres aufriß, dennoch verharrte er unbewegt und guten Mutes in der Dunkelheit. Auf der Überfahrt hatte er den Preis geübt, den er für die Würste verlangen wollte, und auf einen Schlag verkaufte er sieben, vielleicht nicht deshalb, weil sie so unwiderstehlich waren, sondern weil selbst in dieser Stadt, die so reich an Sehenswertem war, der Anblick dieses Mannes, der den geöffneten – und offenkundig schweren – Koffer voller Würste auf unermüdlichen Armen hielt, so manchen stehenbleiben ließ. Hin und wieder holte das verdämmernde Licht sein ruhiges, gleichsam verklärtes Gesicht aus der Dunkelheit. Sein Verkaufserfolg verdankte sich – und das war ihm von Anfang an klar gewesen – ebenso sehr der Ruhe, die er ausstrahlte, wie der Qualität seiner Ware, auch wenn er felsenfest davon überzeugt war, daß die Würste seines Vaters die besten der Welt waren.
Was ja vielleicht auch stimmte. Am nächsten Morgen kamen manche Kunden, die am Vortag eine gekauft hatten, und verlangten zwei, und nachmittags setzte sich das fort. Fidelis hatte, den geschlossenen Koffer im Schoß, auf einer Bahnsteigbank geschlafen, war im Waschraum gewesen, hatte etwas von dem überraschend süßen und kalten Wasser dieser Stadt getrunken, ansonsten aber seinen Posten nicht verlassen. Wem das auffiel – und es waren doch einige in der wirbelnden Menge –, staunte über seine Ausdauer. Wie hielten seine Arme so viele Stunden das Gewicht des geöffneten Koffers aus? Der Koffer, in dem auch seine geliebten Messer lagen, war schwerer, als er aussah, aber Fidelis hielt ihn mühelos. Der Tag verging, und seine Reglosigkeit erschien den Betrachtern wie Selbstquälerei. Fidelis empfand es nicht so. So zu stehen war nicht schwer, es tat ihm fast wohl nach der unablässigen Bewegung des Ozeans. Und die Kraft, die er brauchte, um die ganze Zeit den Koffer in einer Stellung zu halten, war ein Klacks für ihn, auch wenn er geschwächt war, weil er nichts gegessen hatte.
Der Hunger war seit langem sein ständiger Begleiter, so auch jetzt. Er wußte, wie er ihn zu nehmen hatte, und am zweiten Tag auf seinem Posten – zum letzten Mal hatte er auf dem Schiff eine kärgliche Mahlzeit eingenommen – wußte er, daß er etwas essen mußte. So schwer es ihm auch fiel, etwas von seinem Geld herzugeben – es war an der Zeit.
Fidelis klappte den Koffer zu, in dem der Wurstvorrat merklich abgenommen hatte, und ging durch die Bahnhofshalle, das vertraute Summen des Hungers im Ohr, zu einer kleinen Imbißbude in einer Nische. Dort setzte er sich auf einen Hocker, klemmte den Koffer zwischen die Füße, bestellte drei Portionen des billigsten Eintopfgerichtes – zähes Rindfleisch, Kartoffeln, Möhren, Soße – und aß mit der geduldigen Konzentration, die er sich angewöhnt hatte, wenn er nach langer Zeit des Hungers wieder Nahrung zu sich nahm. Die Kellnerin brachte zusätzliches Brot, und als er ihr zu verstehen gab, daß er es nicht bezahlen konnte und sie es ihm trotzdem aufdrängte, bedankte er sich und spürte dabei zu seiner Überraschung ein Würgen in der Kehle. Er staunte immer wieder, wie freundlich fast alle Leute hier waren, aber schließlich waren die meist nicht am Verhungern und hatten in jüngster Zeit weder eine vernichtende Niederlage erlitten noch erleben müssen, daß man ihnen außerhalb ihrer enger gewordenen Landesgrenzen nur Verachtung entgegenbrachte. Deshalb, fand Fidelis, konnten sie sich kleine Wohltaten wie ein geschenktes Stück Brot wohl leisten.
Er zahlte, berechnete die geringfügige Verminderung der Summe, die ihn an sein Ziel bringen sollte, und ging in den öffentlichen Waschraum, um sich wie jeden Morgen zu rasieren. Er wickelte ein inzwischen fast durchsichtiges Stückchen gestohlene Seife aus und wusch sich unauffällig mit Hilfe eines seiner beiden Taschentücher. Er hätte gern die zweite Unterhose ausgewaschen, die in der Gesäßtasche seiner Hose steckte, aber er genierte sich, weil noch andere Männer da waren. Der Brusttasche entnahm er eine Zahnbürste aus geschnitztem Elfenbein, deren Schweinsborsten durch langen Gebrauch schlaff und weich geworden waren. Er hatte sie den ganzen Krieg über mitgeschleppt, ebenso wie das vom ständigen Abziehen hauchdünne Rasiermesser, den winzigen Kamm, den raffinierten silbernen Ohrreiniger. All das verstaute er, als er fertig war, wieder ordentlich in seinen Taschen, nahm den Koffer und kehrte an seinen Posten zurück.
Als die Dämmerung wieder zu den Fenstern hereinkam, hatte er über die Hälfte von dem verdient, was er brauchte. Beim Geldzählen kam ihm eine Idee. Warum sollte er nicht mit dem, was er hatte, in den Zug steigen, so weit fahren, wie er kam, und die Würste den in den Waggons eingesperrten Mitreisenden verkaufen? Er ging wieder zum Schalter, geriet diesmal an einen ungeduldigen älteren Herrn und erstand eine Fahrkarte, die ihn bis zum Anfang des Mittleren Westens bringen würde. Dann stellte er sich wieder an seine Säule, verkaufte noch eine Wurst, klappte den Koffer zu und marschierte, die Fahrkarte in der inneren Brusttasche, zu dem numerierten Bahnsteig. Zusammen mit anderen Fahrgästen, die in Abschiedsschmerz schwelgten oder die Reise in Begleitung antraten, bestieg er den Waggon, suchte sich einen Platz und wartete geduldig, bis der Zug sich ruckelnd in Bewegung setzte und den verhaßten Ozean und New York hinter sich ließ.
Die Würste reichten bis Minneapolis und durch hügelige Prärien bis in das unvermittelt einsetzende Flachland und den hohen Himmel von North Dakota, wo er das letzte Glied der letzten Wurstkette an den Mann brachte. Er stieg aus und ging einen schmalen Kleinstadtbahnsteig entlang. Die Stadt war ein Gewirr freundlicher niedriger Häuser. Manche hatten falsche Halbgeschoßfassaden über den Markisen und Schaufenstern, ein oder zwei waren aus Kalkstein und mindestens drei aus robusten Backsteinen. Vor der beängstigend flachen Landschaft, mit dem Rücken zum Fluß und ohne jede Fluchtmöglichkeit wirkte der Ort wehrlos und läppisch, fand Fidelis, sah aus wie ein Provisorium, fast wie ein Camp, das ein heftiger Sturm oder ein Krieg wegfegen konnte. Argus … er las den Ortsnamen auf dem Schild und prägte ihn sich ein.
Er drehte eine Orientierungsrunde, staubte den väterlichen Anzug ab, machte sich klar, daß er mit 35 Cents dastand und einem Koffer, in dem keine Würste mehr waren, sondern nur noch seine sechs Messer, ein Wetzstahl und Schleifsteine in verschiedenen Größen. Im Westen und im Süden sah man nichts als Horizont. In nördlicher Richtung gab es Straßen mit halbhohen Bäumen und Häusern, die einen soliden Eindruck machten. Die Hauptstraße mit einem neuen Bankgebäude aus Kalkstein und einer Ladenzeile mit dekorativen Backsteinfassaden führte nach Osten. Der Wind umtoste Fidelis, ohne ihn zu beachten, was der als unerträglich und tröstlich zugleich empfand.
Fidelis wußte noch nicht, daß er nie weiterfahren würde. Er hatte so lange hierbleiben und sein Handwerkszeug einsetzen wollen, bis er genug Geld verdient hatte, um an jenen Ort zu reisen, für den er sich wegen der Perfektion seines Brotes entschieden hatte. Jetzt überlegte er, wo wohl in dieser Stadt das Brot gebacken wurde, woher das Bier kommen mochte, wo sie Milch und Butter kühlten, wo die Würste gestopft und die Schweineschnitzel geschnitten und zerhackt, wo das Vieh geschlachtet wurde, aber nirgends fand sich ein Hinweis. Wohin er auch blickte – alles sah gleich aus. Fidelis rückte den Hut seines Vaters gerade, schlenkerte die Aufschläge der Hosenbeine nach unten und nahm seinen Koffer.
2 Der Balancekünstler
In einer Kleinstadt am Oberlauf des Mississippi, in einem nur zur Liebe angemieteten Zimmer, hielten ein Mann und eine Frau, die unbekleidet im Bett lagen, in leiser Angst inne. Seit einigen Monaten waren sie gut miteinander bekannt, ja befreundet. Kennengelernt hatten sie sich beim Theaterspielen in Argus, North Dakota. Es blieb nicht aus, daß sie beide wissen wollten, ob mehr daraus werden konnte, und so hatten sie sich zusammengetan und waren losgezogen. Würden sie sich mit einer akrobatischen Nummer ihr Brot verdienen, würden sie ein Liebespaar werden? Der Mann streckte die Hand aus und ließ sie kreisen, und die Frau, Delphine Watzka, zog wie abwägend die schmal gestrichelten Augenbrauen hoch. »Du hast sehr kräftige Bauchmuskeln«, sagte er und strich leicht mit den Fingerknöcheln, dann mit den Fingerspitzen über ihren Körper. Delphine drehte sich mit einem Ruck auf den Rücken, warf die Bettdecke ab und klopfte sich auf den Leib. »Ich habe starke Arme, starke Beine und einen strammen Bauch. Ist ja auch kein Wunder. Verdammt, ich schäme mich nicht dafür, daß ich auf einer Farm aufgewachsen bin. Ich habe jede Menge Kraft. Nicht, daß ich damit was anfangen könnte.«
»Ich wüßte da was«, sagte der Mann.
Im ersten Moment dachte sie, der Mann, der Cyprian Lazarre hieß, unglaublich gelenkig und unglaublich stark war, würde sofort zur Tat schreiten, und hoffte, daß er sich, sein Ziel vor Augen, über all seine Bedenken hinwegsetzen würde, doch es kam anders. Sie merkte, daß er sich zunehmend für seinen Plan begeisterte, aber statt Delphine leidenschaftlich zu bespringen, kniete er sich auf die durchhängende Matratze und betrachtete sie nachdenklich. Narbenwülste zogen sich fächerförmig über seine Schultern. Er war zweiunddreißig Jahre alt, und sein Körper war durch das ständige Training steinhart und muskulös. Er sah aus wie eine dieser Skulpturen aus dem zerstörten Troja, fand Delphine, auch was die Schäden betraf, die der Krieg und die Zeit ihnen wie ihm zugefügt hatte.
Zusammen mit einem Vetter und einem Freund hatte sich Cyprian freiwillig für das US Marine Corps gemeldet, hatte die Ausbildung und die vielleicht gefährlichste Phase des Krieges, die Ansteckungsgefahr durch die Spanische Grippe, überlebt und war in der vierten Angriffswelle der Schlacht am Bois de Belleau eingesetzt worden. Im letzten Kriegsjahr hatte er durch Chlorgas vorübergehend das Augenlicht und durch den absplitternden Lauf eines MG fast die Hand verloren, die Ruhr hatte ihm alle Kraft geraubt, sein Humor ließ ihn im Stich, und er bereute seinen patriotischen Überschwang. Er war schon wieder in der Heimat, bevor ihm klar wurde, daß er als Ojibwa noch kein amerikanischer Staatsbürger war. An der Wahl, die während seiner langwierigen Rekonvaleszenz stattfand, durfte er nicht teilnehmen.
Mit einem leichten Schwung richtete er sich auf und sprang vom Bett. In dem winzigen Zimmer stand ein Stuhl. Seine Augen glänzten mit der Begeisterung des wahren Künstlers, als er die Lehne packte, die Fußballen anspannte, um auf dem Holzfußboden nicht auszurutschen, und sich dann zu einem Handstand hochschwang. »Bravo«, lobte er sich leise selbst. Der Stuhl schwankte ein wenig und kam wieder zur Ruhe. Mit dem kerzengeraden Rücken, dem straffen Gesäß und den hochgereckten Zehen war er ein Idealbild der Männlichkeit. Delphine war froh, daß sie ihn nicht von vorn sah, und hoffte sehr, daß gegenüber ihrer Pension niemand zufällig zu dem vorhanglosen Fenster im Obergeschoß hochsah. Doch da hörte sie schon von draußen einen Aufschrei, den Cyprian souverän mißachtete.
»Das ist dann das Finale«, sagte er. »Ich schwebe drei Meter hoch in der Luft, und du hältst mich allein durch die Kraft deiner Bauchmuskeln.«
Wieder schrie draußen jemand, dann hörte man aufgeregtes Stimmengewirr.
»Ach ja?« klang es dumpf aus Delphines Blusenausschnitt. Zu ihren Talenten gehörte es, daß sie sich blitzschnell ankleiden konnte. Das hatte sie beim Umziehen im Theater gelernt, wo alle Ensemblemitglieder in einem Stück zwei oder drei Rollen übernehmen mußten. Sie war vollständig angezogen, bis hin zu Strümpfen und Schuhen, ehe Cyprian erfaßt hatte, was sich unten auf der Straße tat. Er war, während er seinen Handstand übte, noch immer beim Reden und Planen, als sie leise das Zimmer verließ und die Treppe hinunterrannte. Unten blieb sie stehen und sammelte sich. Dann verließ sie gelassen das Haus und ging geradewegs auf die bereits dunkelrot angelaufene Vermieterin zu.
»Mrs. Watzka!«
»Tut mir leid«, seufzte Delphine und setzte eine resignierte Miene auf. »Er hatte im Krieg eine Gasvergiftung.« Sie tippte sich an die Schläfe, und während die Vermieterin sie noch mit offenem Mund anstarrte, ging Delphine resolut auf die Gaffer zu, die sich auf dem Gehsteig versammelt hatten. »Ich muß doch sehr bitten! Haben Sie keine Achtung vor einem Mann, der den Hunnen bekämpft hat?« Sie verscheuchte die Menge mit raschen, entschiedenen Handbewegungen, so wie sie früher ihre Hühner gescheucht hatte. Die Zuschauer, die eben noch nach oben gestarrt hatten, schlugen die Augen nieder und taten, als begutachteten sie ihre Einkäufe. Eine ältere Dame mit Knitterfältchen in den Wangen, runden Kulleraugen und fleischigen Lippen flüsterte Delphine ins Ohr: »Sehen Sie zu, daß er sich ausruht, liebes Kind. Er ist in einer für einen Mann höchst undelikaten Verfassung.«
Daß Delphine sich nicht zu dem bewußten Fenster umdrehte, sprach für ihr schnelles Denken und ihre Selbstdisziplin, allerdings beschloß sie, schleunigst wieder nach oben zu gehen. »Ja, wissen Sie«, seufzte sie, ganz leidgeprüfte Ehefrau, »er kann’s nur, wenn er vorher einen Handstand macht. Immerhin haben wir so zwei entzückende Kinder zustande gebracht.«
Schon im Gehen sagte sie freundlich, als sei nichts Besonderes vorgefallen, als habe sie die Gaffer nicht soeben dazu verführt, die wildesten Spekulationen anzustellen: »Und nicht vergessen: Die Vorstellung beginnt um fünf. Auf dem Festplatz, gleich die zweite Bühne.«
An der Art des Schweigens hinter sich merkte sie, daß sie ein volles Haus erwarten durften.
Abends ließ Cyprian Teller auf Stangen kreisen, balancierte zwei auf jedem Arm, eine auf jeder Schulter, eine auf der Stirn und eine zwischen den Zähnen. Er stellte weitere Stangen in einer langen Reihe auf, versetzte die Teller in wirbelnde Bewegung und lief an der Reihe hin und her, während Delphine die Zuschauer wetten ließ, wie lange er es schaffen würde, die Teller kreiseln zu lassen. Das brachte ihnen das meiste Geld. Er stapelte Gegenstände auf dem Kopf, die ihnen die Zuschauer brachten – Kisten mit Hühnern, Geschirr. Die Waschmaschine lehnte er ab. Während der Stapel wuchs, tänzelte er auf der Stelle. Er rollte mit einem Fahrrad über Drahtseile, die quer über den Festplatz gespannt waren. Als Krönung kletterte er, weil es ein windstiller Tag war, an der Fahnenstange hoch, balancierte dort und machte zum Schluß einen Handstand auf dem Knauf an der Spitze. Als Delphine ihn dort sah – eine menschliche Stecknadel vor dem wilden schwarzen Himmel von Minnesota –, schlug ihr Herz für ihn. In diesem Moment verzieh sie Cyprian den Mangel an Leidenschaft. Daß er sie dringend brauchte, sagte sie sich, mußte genügen.
Eine gedrungene junge Polin von einer ärmlichen Farm ist normalerweise nicht allzu attraktiv für Männer, aber Delphine konnte keiner widerstehen. Sie war schlagfertig – vielleicht zu schlagfertig. Was ihr über die Lippen kam, überraschte sie oft selbst, aber der häufige Kontakt mit unberechenbaren Alkoholikern hatte ihre Reflexe geschärft. Sie hatte kleine, regelmäßige, sehr weiße Zähne und ein raffiniertes Grübchen in einem Mundwinkel, hellbraune Augen, die schmal und keck in einem bräunlichen Gesicht standen und bei Sonne honiggelb leuchteten. Die Nase war kräftig und gerade, die Ohren aber saßen verwegen schief. Häufig trug sie die Haare so, wie sie sich die Frisur einer spanischen Contessa vorstellte – eine Schmachtlocke in die Stirn gekringelt, je eine vor den unsymmetrischen Ohren, das übrige Haar zu einem kunstvollen Knoten geschlungen. Wenn sie einen Mann scharf ansah, wurde er unruhig und wandte den Blick ab, um ihn gleich darauf wieder auf Delphine zu richten. Ihre bezwingende Anziehungskraft machte ihr das Leben nicht unbedingt leichter.
Mit drei oder vier Monaten hatte sie die Mutter verloren. Die maßlose Liebe, die sie ihrem trunksüchtigen Vater entgegenbrachte, wurde nicht erwidert oder sogar verschmäht, trotzdem war sie seinen Anfällen von Selbstmitleid hilflos ausgeliefert. Sie hätten selbst das winzige Stück Land und ihr Häuschen verloren, wenn der Farmer, an den ihr Vater es verpachtet hatte, sich nicht kategorisch geweigert hätte, es zu kaufen. Vorsichtshalber hatte er diese Entscheidung auch vertraglich festlegen lassen, so daß sie jeden Monat ein sehr bescheidenes Einkommen hatten, das prompt in Schnaps umgesetzt wurde, wenn Delphine es nicht gleich an sich nahm. Um aus dem häuslichen Elend herauszukommen, hatte sie sich farbenprächtige Kostüme genäht, die hehren Reden tragischer Heldinnen memoriert und mit Hingabe bei Aufführungen im Stadttheater mitgespielt. Dort hatte sie auch Cyprian kennengelernt, der mit Hilfe des städtischen Ensembles seine Nummer auf Hochglanz brachte. Zusammen hatten sie North Dakota verlassen und waren in die Berge und Wälder von Minnesota gefahren, wo die Städte dichter beieinander lagen und weniger auf die notleidenden Farmer angewiesen waren. Er hatte ihr aufregende Erlebnisse versprochen, und der Anfang war eben jener alles enthüllende Handstand vor dem Fenster gewesen. Auch Geld hatte er ihr versprochen; von dem sie allerdings bislang noch nicht viel gesehen hatte. Delphine hatte mitgemacht in der Hoffnung, sich in Cyprian, dieses Bild von einem Mann, zu verlieben, dessen Schönheit aber, wie sich später herausstellte, bei weitem nicht das Wichtigste war.
Cyprian bezeichnete sich als Balancekünstler. Delphine merkte bald, daß Balancieren das einzige, buchstäblich das einzige war, was er konnte. Er konnte keine Socken waschen, konnte keiner geregelten Arbeit nachgehen, keine geplatzte Naht nachnähen, sich keine Zigarette rollen, nicht singen, vertrug keinen Alkohol. Er konnte nicht lange genug stillsitzen, um einen Zeitungsartikel von Anfang bis Ende zu lesen. Er konnte kein richtiges Gespräch führen, keine Geschichte erzählen, allenfalls einen kurzen Witz. Er konnte sich nicht auf lange Kartenspiele wie Cribbage oder Pinochle konzentrieren. Er würde – falls sie irgendwann einmal seßhaft werden sollten – vermutlich nichts anbauen können. Trotzdem gewann sie ihn lieb, und das aus drei Gründen: Erstens behauptete er, verrückt nach ihr zu sein, zweitens war er, auch wenn sie sich noch nicht mit wirklicher Leidenschaft geliebt hatten, sehr sanft und zärtlich, und drittens war er leicht verletzbar. Delphine war es schrecklich, die Gefühle eines Mannes zu verletzen, weil sie so sehr an ihrem Vater hing. Trotz seiner zerstörerischen Raserei im Rausch war sie Roy Watzka in unerschütterlicher Liebe zugetan, und das hatte sie wohl geprägt.
So verlangte sie auch von Cyprian nicht viel mehr, als daß er nicht vom Stuhl fiel. Cyprian seinerseits fand es nach einer Woche einfach schön, zu Delphine zu gehören. Er rollte sich in den Betten der billigen Pensionen unter Decken zusammen, die auf Delphines Wunsch immer frisch gewaschen werden mußten, weil sie heikel in punkto Ungeziefer war. Während er seine schmerzenden Muskeln pflegte, kümmerte sich Delphine ums Überleben. Sie flickte, was bei ihren Auftritten zerrissen war, legte fest, wie lange sie in jedem Ort bleiben und wohin sie danach gehen würden, zählte Geld, wenn welches da war, schickte Annoncen und Briefe an die Zeitung und bestimmte, was es zu essen gab.
Am Tag nach dem Balanceakt auf der Fahnenstange verkündete sie, daß sie genug Geld hatten, um sich zu Eiern und Haferbrei auch Würstchen zu leisten. Außerdem standen lange Übungsstunden auf einer Kuhweide an, dafür mußten sie sich stärken. Sie aßen, langsam und mit Genuß, von dicken, verkratzten Tellern. Der Wirt, der sie inzwischen kannte, brachte noch Zucker und einen übriggebliebenen Pfannkuchen. Cyprian kritzelte auf einem Stück Papier herum. Das Ergebnis war ein Strichmännchen, das Handstand auf einem Stuhl machte oder vielmehr einem scheinbar zufällig aufeinander getürmten, in Wirklichkeit sehr sorgfältig ausbalancierten Stapel von Stühlen, wobei der unterste auf dem Bauch einer Frau mit Stricharmen und Strichbeinen und einem lächelnden Mondgesicht stand.
»Damit verdienen wir ein Vermögen«, sagte Cyprian feierlich.
Delphine besah sich den Turm aus Stühlen, den Strich, der ihren Bauch darunter darstellte, und angelte nach dem nächsten Würstchen.
Es war – an diesem Tag jedenfalls – eine Weide ohne Kühe, und die Kuhfladen waren getrocknet. Delphine schleuderte sie hoch wie Teller, machte ein paar Streckübungen und zwei Dutzend Rumpfbeugen, ließ die Muskeln spielen. Ihre Bauchmuskeln wurden immer kräftiger. Cyprian hatte ihr gezeigt, wie sie mit Hilfe wissenschaftlich erarbeiteter Übungen die Muskeln weiter stärken konnte. Da er Hunderte von Malen fallen mußte, ehe eine Nummer perfekt war, öffnete Delphine den Mund zu einem wohligen Gähnen, wenn das Gewicht von ihrem Bauch wich. Sekundenbruchteile später schlug dann Cyprian neben ihr auf. Sie regte sich nicht, bis alle Stühle auf die Weide gepoltert und ihm blaue Flecke beschert hatten. Er stellte die Stühle so, daß ihr nichts passieren konnte, wenn sie in der einmal gewählten Stellung verharrte. Immer wieder spürte sie seinen Sturz, spürte, wie sich sein Körper im Fallen jede Phase des Balanceaktes einprägte, wie der Turmbau zusammenbrach und um sie herum zu Boden fiel. Sie rührte kein Glied. Ein paarmal kam ihr ein Stuhlbein so nah, daß ihre Frisur ein wenig in Unordnung geriet, mehr passierte ihr nie.
Es war ein strahlender Tag, und Delphine trug einen eleganten langen Rock, der um sie herumwirbelte, als sie vor das Publikum trat. Mit vier Flipflops sprang sie auf einen breiten niedrigen Tisch, kreuzte die Beine, faltete die Hände und meditierte, um die Spannung zu erhöhen. Als die Zuschauer anfingen, ungeduldig herumzurutschen, verwandelte sie sich mit einem Salto rückwärts in einen menschlichen Tisch. Jetzt trat Cyprian auf. Er hatte ein großes Holztablett mit Teegeschirr in der Hand, auf Kopf und Schultern trug er eine Anordnung von sechs Stühlen, die er nacheinander zu Boden gleiten ließ. Auf dem letzten Stuhl nahm er Platz, stellte das Tablett auf Delphines Körper und nickte ihr freundlich zu. Aus einem Ärmel zog er eine Gabel, ein Messer und einen Hering. Den Hering legte er auf den Teller, schnitt ihn in kleine Stücke und verzehrte ihn rasch. Als er fertig war, wischte er sich den Mund und reckte sich wie jemand, der jetzt bereit ist, mit einer Zigarette und einem guten Buch zu entspannen. Dann aber umwölkte sich seine Miene – offenbar war nicht alles so, wie er es haben wollte. Er setzte sich nacheinander auf jeden der Stühle, und seine Miene wurde immer sorgenvoller. Schließlich kam er zum letzten Stuhl. »Du hast doch nichts dagegen?« fragte er Delphine höflich. »Aber nein«, gab sie zurück. Er räumte das Teegeschirr ab und stellte den ersten Stuhl auf das Tablett, das auf ihrem Bauch lag. Jetzt brauchten sie einen hilfsbereiten Zuschauer, der ihnen die Stühle heraufreichte. Einen nach dem anderen balancierte Cyprian sie aus, kletterte höher und höher, schließlich war der letzte Stuhl an Ort und Stelle. Cyprian nahm darauf Platz und holte eine Zigarette aus der Tasche.
Wenn sie mit ihrer Nummer so weit gekommen waren, merkte er jedesmal, daß er die Streichhölzer auf dem Tisch oder vielmehr auf Delphine vergessen hatte. (Immer war es ein Zuschauer, der ihn, stolz auf seinen Scharfblick, darauf aufmerksam machte). Irgend jemand war dann stets bereit, ihm die Streichhölzer hochzuwerfen, aber Cyprian hatte schon, jede Hilfe höflich ablehnend, eine zusammenlegbare kleine Angelrute hervorgeholt und wickelte die Schnur ab. An ihrem Ende waren ein Schwimmer, ein pompöser Haken und ein Senkblei befestigt, das in Wirklichkeit ein Magnet war und sich mühelos die präparierte Streichholzschachtel angelte.
Sowie Cyprian die Streichhölzer hatte, zündete er langsam und genüßlich seine Zigarette an. Dann holte er mit schwungvollen Bewegungen ein Buch hervor, erfreute die Menge mit einer Lesung mehr oder weniger schlüpfriger Witze, über die er selbst, vor Vergnügen mit den Beinen strampelnd, herzhaft lachte, so daß die Stühle beängstigend ins Wanken kamen und die Zuschauer – was ja Sinn der Sache war – angstvolle Schreie ausstießen. Natürlich stürzte Cyprian nicht, sondern warf, als er mit Lesen fertig war, das Buch weg und machte auf dem obersten Stuhl einen Handstand. Es gab viel Beifall, und dann kam der Höhepunkt der Nummer, für die sich Delphine einen Trommelwirbel gewünscht hätte: Cyprian kletterte kopfüber an den Stühlen herunter, dabei den Turm abbauend, indem er sich einen Stuhl nach dem anderen auf die Füße stellte, bis er mit sämtlichen Stühlen einen Handstand auf dem Bauch seiner Partnerin machte.
Auf Delphines Oberkörper balancierend, die Stühle auf den Füßen, reckte Cyprian den Hals vor, bis sich ihre Lippen trafen. Der Kuss war voll gespielter Leidenschaft, so daß die Zuschauer johlten und sich in Delphine leiser Groll regte. Noch immer waren die Stühle über ihnen in der Schwebe. Sie sahen sich in die Augen. Zuerst hatte Delphine das aufregend gefunden. Aber was sieht man schon in den Augen eines Mannes, der einen Handstand macht und dabei sechs Stühle auf den Füßen balanciert? Man sieht seine Angst, er könnte die Stühle fallen lassen.
In Shotwell an der Grenze zu North Dakota schlossen sie sich einem Wanderzirkus an. »Die Gegend hier ist schon mehr mein Fall«, sagte Delphine zu Cyprian und freute sich über den Anblick von so viel Horizont. Wo die Straßen zu Ende gingen, türmte sich Himmel. Die Städte, die sie bisher besucht hatten, waren zu sehr von Bäumen umzingelt gewesen. Der weite Himmel weckte Heimatgefühle. Hier trafen sie auf ein trinkfreudiges Völkchen. Cyprian kannte einige dieser Leute von Rummelplätzen und anderen Veranstaltungen her, und am ersten Tag nahm er Delphine mit in den Saloon, eine klamme, schmuddelige Bruchbude mit niedriger Decke. Sie zwängten sich mit drei anderen Paaren in eine Nische, und sofort kamen harte Getränke auf den Tisch. Delphine hatte Cyprian noch nie trinken sehen, nur hin und wieder war er mit einer leichten Fahne zu ihr gekommen. Als die Gläser vor ihnen standen, versuchte er, den Schnaps auf ex zu trinken, und würgte. Delphine trank ihr Bier in kleinen vorsichtigen Schlucken und schüttete den Schnaps unauffällig auf den Fußboden. Sie genierte sich fast, daß sie auf Alkohol mit so heftigem Widerwillen reagierte. Nach der ersten Runde standen zwei Paare auf und tanzten, Delphine und Cyprian blieben mit dem anderen Paar am Tisch sitzen. Die Männer waren in ein tiefsinniges Gespräch vertieft, und da Delphine und die andere junge Frau links von ihren Männern saßen, konnten sie sich nicht an deren Gespräch beteiligen und sich auch nicht miteinander unterhalten. Delphine sah eine Weile, Interesse heuchelnd, den tanzenden Paaren zu, und als das langweilig wurde, ging sie zunächst ihre Nase pudern – wozu der entsprechende Raum allerdings kaum einlud – und trat dann vor die Tür, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Der Himmel war in Aufruhr, die Wolkenränder leuchteten in spektakulärem Grün, dahinter stand das Licht in giftig-bedrohlichem Gelb. Ein Passant meinte, es sähe verflixt nach einem Gewitter aus.
»Stört Sie das?« fragte Delphine und lächelte, weil sie jeden Mann anlächelte und weil sie sich über einen Himmel freute, der sie an ihre Heimat erinnerte.
»Klar stört mich das. Ich bin schließlich Farmer.«
»Kommen Sie doch zu unserer Vorstellung«, warb Delphine. »Und bringen Sie Ihre ganze Familie mit.«
»Zieht sich da wer aus?«
»Wir ziehen uns alle aus«, sagte Delphine.
»Mann o Mann«, sagte der Farmer.
Als Delphine in den Saloon zurückkam, saß die andere junge Frau verdrossen rauchend in der Nische, die Männer waren weg.
»Wo stecken sie denn?« fragte Delphine.
»Weiß ich doch nicht, verdammt noch mal!« Die violett leuchtenden Lippen der jungen Frau bewegten sich beim Trinken und Rauchen nervös wie zwei schlaffe Seile. Delphine bekam eine Gänsehaut, wenn sie diese Lippen ansah. Die Frau war häßlich und vielleicht deshalb so aggressiv. Sie hatte noch zwei Drinks bestellt, und Delphine dachte zunächst, ein Glas wäre für sie, aber die andere leerte beide hintereinander vor ihrer Nase.
»Was ist denn dir über die Leber gelaufen?« fragte Delphine.
»Weiß ich doch nicht, verdammt noch mal.«
Delphine trat wieder vor die Tür, wo der Himmel und die Wolken so schnell ihr Aussehen wechselten wie Delphine am Theater ihre Kostüme. Nicht zum ersten Mal, seit sie ihren Vater verlassen hatte, plagten sie Einsamkeit und schlechte Laune. Vielleicht hatte so viel leerer Raum um sie her das Heimweh geweckt, vielleicht lag es am Bier, aber sicher hatte auch Cyprians Abwesenheit etwas damit zu tun. Er zeigte immer viel Verständnis für ihre Stimmungen. Wenn sie traurig war, sagte sie es ihm, und meist schaffte er es auf die eine oder andere Weise, sie aufzuheitern. Bei ihrem letzten Tief hatte er bei ihr Taschendieb gespielt (sie hatte immer ein bißchen Geld in der Jackentasche, die sich leicht aufknöpfen ließ) und ihr einen Strauß roter Gewächshausrosen gekauft. Noch nie hatte ihr jemand Rosen geschenkt. Sie hatte die Blüten getrocknet und bewahrte sie zur Erinnerung in einem Taschentuch auf. Ein andermal hatte er ihr ein Gläschen Erdnußbutter zum Auslöffeln gekauft, ein Luxus, den sie sich sonst nicht gönnte. Er hatte ihr Eis am Stiel gebracht und Kleinigkeiten, die kein Geld kosteten, schöne Steine vom Seeufer und einmal eine kleine Pfeilspitze, mit der in grauer Vorzeit ein Ojibwa einen Vogel geschossen haben mochte. Delphine trug sie an einer dünnen Schnur um den Hals. Jetzt war Cyprian vermutlich losgegangen, um ihr ein Geschenk zu kaufen. Als sie merkte, daß zwei Dollar aus der Jacke fehlten, wurde ihr gleich besser.
Sie schliefen diesmal in einem Zelt. Delphine legte sich auf das Feldbett, rollte sich in ihre Decke und wachte noch vor dem Morgengrauen auf, weil das Gewitter tatsächlich gekommen war. Der Regen war durch die ungewachsten Zeltwände eingedrungen und hatte sie bis auf die Haut durchnäßt. Zum Glück war ihr Zeug, das in der Mitte gelegen hatte, nur ein wenig feucht geworden, und sie spannte eine Leine zwischen zwei Bäumen und hängte alles zum Trocknen auf. Cyprian hatte nicht im Zelt geschlafen. Der Ärger brodelte in ihr, aber als Cyprian dann auftauchte, war er lieb und zärtlich, bettelte um Zuwendung und hatte ihr tatsächlich etwas mitgebracht, eine Margerite aus massiver Schokolade, so daß ihre Verstimmung verflog. Sie lächelte ihn an, und er drückte sie an seine Brust, die hart wie eine Ritterrüstung war.
»Ich liebe dich«, sagte Delphine. Sie sagte es nicht zum ersten Mal, aber die Worte lösten den Kloß, der in ihrer Kehle gesteckt hatte, die Tränen flossen, und daraus erwuchs ihr neue Kraft.
»Wo zum Teufel warst du?« fuhr sie ihn an.
»Nirgends.« Das kam nicht aalglatt oder abwiegelnd, sondern klang so schmerzerfüllt, als sei er wirklich im Nirgendwo gewesen. Er strich ihr die Haare aus dem Gesicht und gab ihr einen Kuß auf die Stirn, direkt unter dem Mittelscheitel. Ihr Haar war rechts und links zu Zöpfen geflochten, sie sah aus wie ein Kind und fühlte sich auch so. Cyprian schien so bedrückt, daß sie vergaß, was sie eigentlich hatte wissen wollen, und sich zärtlich an ihn schmiegte. Seine Umarmung war so fest, daß sie nur noch kurz und flach atmen konnte, aber das machte nichts. Sie saßen unter einem Baum. Delphine sollte das nie vergessen. Sie wußte nicht, was geschehen war, aber sie waren einander sehr nah, und sie spürte, wie seine unbedingte Liebe zu ihr in ihm sang, in seinem Denken, unter seiner Haut. Sie fühlte sich zutiefst geborgen und regte sich nicht. Er schlief ein dort unter dem Baum, aber sein Arm ließ sie nicht los. Zufrieden sah Delphine zu, wie die Welt um sie her erwachte, die Erde heller wurde, wie mit dem Licht des neuen Tages wogendes Leben in die grünen Weizenfelder kam.
Erst in Gorefield, Manitoba, erfuhr sie, was es mit diesem Nirgendwo auf sich hatte und warum ihm das Antworten so schwer gefallen war. Sie waren in einem noblen Hotel abgestiegen, in der Hochzeitssuite. Die Möbel waren reich mit Spindeln und Schnörkeln verziert, und die Bezüge der Polstermöbel sahen aus wie Gobelins aus dem Museum. Die Teppiche waren dick und weich und mochten aus Persien kommen, Delphine kannte sich da nicht aus. Sie hatte sich den Luxus dieses Zimmer geleistet, weil sie ein für allemal wissen wollte, wie es bei ihnen mit der Liebe stand. Er hatte die Augen geschlossen, während sie sich auf dem Bett herumrollten, und schien sich mit aller Kraft zu konzentrieren. Sie fand, daß er sich reichlich mechanisch bewegte, mochte ihn aber nicht aus dem Konzept bringen. Sie war hellwach und fand die ganze Sache ziemlich langweilig. Er ließ die Hände auf ihren Brüsten tanzen oder kniff ihr gedankenlos, ja schmerzhaft in die Brustwarzen. Es juckte sie, ihm eine Kopfnuß zu verpassen, und sie wollte schon die Hoffnung aufgeben, als er mit einem beglückten Stöhnen zum Höhepunkt kam oder zumindest so tat und sie ansah wie ein Hund, der seine Streicheleinheiten einfordert.
Sie tätschelte ihn anerkennend und drehte seinen Kopf so, daß er sie ansehen mußte. Dann trafen sich ihre Blicke, und das schaffte eine geheimnisvolle Verbindung, wie sie Delphine noch nie zuvor erfahren hatte. Beide ließen Zeit und Raum hinter sich und spürten sich nur noch in der ruhigen Kraft ihrer Augen, die einander nicht losließen. Delphine fühlte, wie ihr liebende Energie zuwuchs, und Cyprian wurde mühelos hart. Sie rollte sich auf ihn. Je tiefer sie einander in die Augen sahen, desto mehr begehrte einer des anderen Körper, desto mehr liebten sie sich – bis zur völligen Erschöpfung. Dann sahen sie sich wieder an und konnten nicht aufhören, probierten die nächste Sache, machten die nächste Entdeckung. Es war eine eigenartige Erfahrung, über die sie nie sprachen und die sie leider nie wiederholen konnten.
Zwei Tage später ging Delphine zum Fluß hinunter. Cyprian hatte sich nach der Vorstellung abgesetzt, ohne ihr zu sagen, wohin er wollte. Sie mußte sich also allein vergnügen, und weil sie sich darauf gut verstand, wanderte sie ohne Groll oder Bedauern zur einzigen Sehenswürdigkeit der Stadt. Sie setzte sich auf eine kleine Bank und sah dem Fluß beim Fließen zu. Er bewegte sich rasch in Richtung Norden, sie hörte, wie die Strömung kleine Zweige mitriß, Schlamm und Blätter und Fische.
Es war eine friedliche Nacht. In dem Licht, das hier und da vom gegenüberliegenden Ufer zu ihr drang, konnte sie ein Stück des Uferweges erkennen. Wie ärgerlich, dachte Delphine, als sie Stimmen und Schritte hörte, und zog sich in das dichte Buschwerk neben der Bank zurück. Sie wollte ihre Bank zurückhaben, sie mochte mit niemandem sprechen. Da erschienen zwei Männer auf der Lichtung. Als sie zu der Bank kamen, verstummten sie, der eine setzte sich, und der andere kniete sich vor ihm hin. Delphine war neugierig geworden, konnte aber nicht erkennen, was hier vorging. Später, als sie in Ruhe alles noch einmal überdachte, fand sie es gut, daß sie nicht gleich alles gesehen hatte. Der Schock wäre zu groß gewesen. Sie hatte nicht gewußt, daß Männer auf diese Art zusammensein konnten.
»O du mein guter Gott!« ächzte der Mann auf der Bank, zwischen jedes Wort einen Punkt setzend. Das letzte geriet zu einem lauten Stöhnen. Er breitete die Arme aus und spreizte die Beine. Der Mann, der vor ihm kniete, gab keinen Laut von sich. Dann bewegten sich die beiden. Delphine sah, daß der Mann auf der Bank einen Anzug trug, denn jetzt drehte er sich um, packte mit beiden Händen die Lehne der Bank und beugte sich vor. Der Mann, der vor ihm gekniet hatte, stand nun hinter ihm. Sein weißes Hemd leuchtete. Delphine starrte auf den hellen Fleck, bis das Hemd plötzlich verschwand. Die Männer waren jetzt halb nackt und bewegten sich begierig aufeinander zu.
Immer wieder kamen sie zusammen, lösten sich, rollten übereinander wie Fische. Manchmal bewegten sie sich hektisch wie zappelnde kleine Tiere, dann wieder wurden ihre Bewegungen langsamer, sanfter. Delphine konnte jetzt unmöglich ihr Versteck verlassen und wollte es auch nicht mehr. Einzelheiten konnte sie nicht erkennen, aber allmählich reimte sie sich alles zusammen. Sie begriff auch, daß es Cyprian gewesen war, der das blendendweiße Hemd von sich geworfen hatte, und dann tat sie etwas, was sie – wie so häufig – selbst überraschte. Sie trat aus dem Buschwerk hervor und begrüßte die beiden Männer mit einem munteren »Guten Abend!«.
In panischem Schrecken fuhren die beiden auseinander. Ihr stummer Schockzustand machte Delphine gehässig. Sie setzte sich auf die Bank.
»Ich habe dich gesucht, Liebling«, sagte sie.
»Delphine, ich weiß nicht, was …«
»Himmelherrgottnochmal!« Der andere Mann suchte nervös seine Sachen zusammen.
Delphine schlug die Beine übereinander, zündete sich eine Zigarette an und stieß sacht den Rauch aus. Mit fast träumerischer Heiterkeit sprach sie weiter, entlockte den Männern höfliche Antworten, schnitt unverfängliche Themen an. Sie machte einen kleinen Scherz, die Männer lachten – und die Wirklichkeit geriet in Schieflage. Keine Frage war mehr sinnvoll, Delphines Verstand arbeitete auf zu vielen Ebenen, zu vielschichtig war die dunkle Neugier. Sie kam nicht auf das zu sprechen, was sie mit angesehen hatte, sondern machte, belustigt und ihrer Macht bewußt, weiter unwiderstehliche Konversation. Das Geplänkel zwischen ihr und den beiden Männern ging hin und her, während sie vom Flußufer landeinwärts gingen. Die Männer schüttelten sich zum Abschied die Hand. Seite an Seite, ernst und nachdenklich, kehrten Delphine und Cyprian ins Hotel zurück.
Wie wird es jetzt weitergehen, dachte Delphine. Eigensinnig hielt sie an der naiven Vorstellung fest, sie und Cyprian könnten nun, da alles klar war, endlich ein richtiges Liebespaar werden, zugleich aber war sie vernünftig genug, um zu erkennen, wie töricht diese Erwartung war. Als sie glücklich auf ihrem Zimmer waren, passierte überhaupt nichts. Es war einfach zu anstrengend, darüber nachzudenken. Sie zogen sich aus bis auf die Unterwäsche, schlüpften unter die Decke und hielten sich bei der Hand wie Trauernde, wachsam, hilflos, sprachlos.