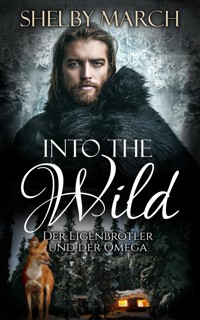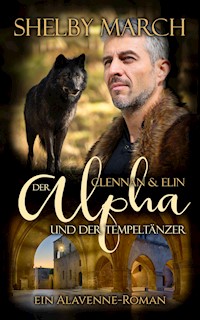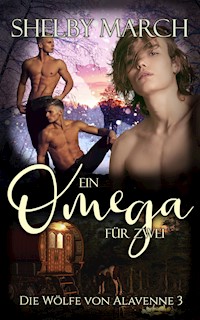5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Während in Alavenne eine Revolte tobt, fällt Farin in die Hände von Plünderern. Die Bande von Menschen und Wandlern unter der Führung eines skrupellosen Alphas hat die besondere Heilergabe des jungen Omegas erkannt und will ihn für ihre eigenen Zwecke nutzen. Doch keiner rechnet mit der feinen Nase des unherziehenden Barden Remi, der in Farins Duft sofort den des Gefährten erkennt. Um Farin zu befreien, schleicht Remi sich in das Lager der Plünderer ein - und verliebt sich Hals über Kopf in den mutigen Omega mit dem Wildrosenduft. Doch selbst falls die Flucht gelingt - wird der Alpha seine Beute so einfach aufgeben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein Omega mit heilenden Händen
Shelby March
Remi & Farin
Ein Alavenne-Roman
Inhaltswarnungen
Inhaltswarnungen zu den Büchern von Shelby March und Tina Alba findest Du auf meiner Homepage: www.tina-alba.de.
Kapitel 1
Farin
Herbstlaub unter den Pfoten. Der Geruch nach Moos und Erde in der Nase. Abendwind, der sein Fell streichelte. Rascheln und Knistern, die Geräusche des Waldes in der Dämmerung.
Farin rannte, bis er das Dorf weit hinter sich gelassen hatte und das sanfte Plätschern des Baches hören konnte, den er bei einem seiner letzten Ausflüge entdeckt hatte.
Es tat gut, das Dorf für eine Weile nicht sehen zu müssen und Abstand zu gewinnen von all dem Leid, dem Dreck und dem Gestank. Eine Weile keine Schreie zu hören, kein gequältes Stöhnen oder den verwehenden Atem auf blassblauen Lippen.
Inzwischen wusste Farin, wie der Tod roch. Sobald ihm eine Kranke oder ein Verwundeter ins Gesicht atmete, konnte er sicher sagen, ob das Leben näher war oder der Tod; und er wusste, wann seine Berührung noch helfen konnte und wann selbst seine Gabe an ihre Grenzen stieß.
Du wirst sie nicht alle retten können, Sohn.
Die Worte seines Vaters und Alphas hatten sich in sein Gedächtnis gebrannt.
Aber du kannst es versuchen. Damit hatte sein Da von ihm Abschied genommen. Damit, und mit einer festen Umarmung und einem Kuss auf die Stirn, für den er sich in diesem Augenblick einmal nicht schon zu alt gefühlt hatte.
Sie hatten recht behalten, beide. Sein Vater und Alpha, der ihn gelehrt hatte, dass auch ein Omega stark sein und kämpfen konnte, und sein sanfter Da, der ihm die Heilergabe vererbt und der ihm das wohl Wichtigste beigebracht hatte, was ein Heiler und Arzt wissen musste: Dass es zuweilen notwendig, ja lebensrettend war, loslassen zu können.
Farin vergrub die Wolfsnase im Moos und sog tief das torfige Aroma in seine Lungen. Ein wenig half es, den Gestank nach Blut, Eiter, Krankheit und Exkrementen loszuwerden, der sich in seinen Atemwegen festgesetzt hatte wie eine Zecke im Pelz. Er hatte so oft losgelassen in den vergangenen Wochen.
Er schüttelte den Kopf und riss sich zusammen. Immerhin war er nicht nur in den Wald gekommen, um sich abzulenken, sondern, um zu jagen. Bron, Rian und Nis, drei junge Betas, die ebenfalls in Mhaz geblieben waren, um das Dorf so gut wie möglich vor Marodeuren und Plünderern zu schützen, waren irgendwo hinter ihm, ebenfalls auf der Suche nach Beute und einem kurzen Augenblick der Freiheit, die die Wolfsgestalt ihnen gab.
Als der Geruch nach Reh in seine Nase stieg, duckte Farin sich ins Unterholz und folgte der Fährte dicht am Boden, bis er auf die kleine Lichtung stieß, auf der sich die Gruppe Rotwild versammelt hatte. Sein menschlicher Teil grinste, als er Brons Witterung neben sich aufnahm. Er wartete, bis der Beta sich auf die Beute stürzte – obwohl seine Väter immer darauf bestanden hatten, dass er jagen lernte, waren doch Heilkunst und Musik die Dinge, für die er geboren war.
Neben Bron brachen Nis und Rian aus den Büschen hervor, und dann hielt auch Farin nichts mehr. Aufgestachelt vom Jagdgeheul der Betas, vom Furchtgeruch der Beute und dem Duft des ersten frischen Blutes stürzte er sich ins Getümmel.
In dieser Nacht würde es Fleisch für alle geben. Und auch morgen würde niemand hungern müssen. Ein geretteter Tag. Wieder einer.
Farin wagte nicht, weiter als von heute auf morgen Pläne zu schmieden. Zu unsicher war die Welt in diesen Tagen. Zu viel konnte geschehen.
Farin erwachte im Morgengrauen, als die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster der Halle fielen, in der er sich mit Bron, Nis und Rian niedergelassen hatte. Einst hatte das Haus, das die Halle beherbergte, dem Bürgermeister gehört, doch der war mitsamt seiner Familie nach Daronne gezogen, wie so viele andere, die die neuen Fürsten unterstützten. In Daronne hatte ihr Anführer seinen provisorischen Hof eingerichtet. Dorthin würden wohl auch bald die Betas ziehen.
Farin seufzte und wickelte sich aus seiner fadenscheinigen Wolldecke. Sobald es noch kälter wurde, würde er auf alle Konventionen pfeifen und als Wolf schlafen. Pelz war einfach wärmer als abgetragene Klamotten und dünne Decken. Er streckte sich, gähnte und blickte sich um.
Neben ihm grummelte Nis etwas Unverständliches und zog sich die Decke über die Ohren. Rian und Bron waren, wie sie es in der Nacht eingeteilt hatten, noch auf ihren Rundgängen. Es war Farins Idee gewesen, dass immer auch mindestens ein Wandler die Nachtwachen begleitete. Ihre Sinne waren in jeder Gestalt schärfer als die der Menschen – sie würden eine nahende Gefahr früher entdecken.
Farin stupste Nis sanft an der Schulter. »Nis, aufwachen!«
Der Beta grummelte Unverständliches und kroch erneut tiefer unter die Decke.
»Du solltest da rauskommen, wenn du noch was von den Resten von gestern Abend willst.« Farin stupste seinen Rudelbruder noch einmal sacht mit der Fußspitze an, bevor er sich vollständig anzog und zur Feuerstelle tappte, um die Glut erneut anzufachen. »Ich gehe schon mal zur Bäckerfamilie. Adele sagte gestern, ich müsste mir Juliots Hand noch mal ansehen. Die will einfach nicht heilen.«
»Bring mir einfach was mit, ich bin immer noch hundemüde.«
»Bist du nicht. Du bist ein Faultier, Nis. Die Tagwache wartet bestimmt schon auf dich, also sieh zu, dass du aus dem Bett kommst, und iss was!«
»Du bist nicht mein Alpha!« Nis maulte, schälte sich dennoch aus den Decken und zog sich ebenfalls an.
»Geht doch.« Farin grinste, winkte Nis zu und verließ das Bürgermeisterhaus. Die kleine Behausung der Bäckerfamilie lag nur eine Straße weiter. Sie wirkte traurig mit dem leeren Verkaufsstand und den dunklen Fenstern. Immerhin rauchte der Schornstein der Backstube, und als Farin an die Tür klopfte, stieg ihm der Duft nach frischem Brot in die Nase.
Die Bäckersfrau öffnete. Sie lächelte, doch Farin sah ihr an, dass sie wieder schlecht geschlafen hatte. Sie war blass, hatte dunkle Ringe unter den Augen, das lange blonde Haar hatte sie zu losen Zöpfen geflochten, aus denen überall Strähnen heraushingen. »Farin, gut, dass du kommst, der Kleine hat schon wieder Fieber. Mutter ist in der Backstube. Sie hat die letzten Vorräte zusammengekratzt. Nimm dir nachher für dich und die Jungs etwas mit. Ihr helft uns so sehr.« Sie schluckte, wandte sich an, und Farin sah, dass sie sich mit der Hand über die Augen rieb.
Er folgte ihr in die winzige Wohnstube, in der sie mit ihrer alten Mutter, ihrem kleinen Sohn und dessen älterer Schwester hauste, seit ihr Gefährte dem Bürgermeister nach Daronne gefolgt war. Dicht aufeinander zu hocken, verbrauchte weniger Heizmaterial.
Juliot kauerte in Decken gewickelt auf dem Sofa und sah elend aus. »Linette soll wiederkommen.«
»Linette ist losgegangen zum Ährenlesen, damit wir weiter backen können, das weißt du doch, Schatz.« Adele setzte sich zu Juliot auf das Sofa. »Sieh mal, wer gekommen ist, um sich deine dumme Hand noch einmal anzusehen.«
Der Kleine weitete die fiebrig glänzenden Augen. »Onkel Farin!«
Farin musste grinsen. »He, so alt bin ich noch nicht! Ich könnte dein großer Bruder sein, weißt du?« Er beugte sich über den Jungen. »Lass mal sehen.«
Zögernd reichte Juliot Farin seine verbundene Hand.
Farin nahm sie und wickelte behutsam die Leinenstreifen ab, mit denen er zwei Tage zuvor die Wunde verbunden hatte, die der Junge sich beim Spielen in den Trümmern eines Stallgebäudes zugezogen hatte. Er hatte eine alte Mistforke gefunden und sich an den rostigen Zinken den Handballen aufgerissen. Farin hatte die Wunde mit hochprozentigem Schnaps gereinigt und mit Kräutern verbunden – doch das schien nicht gereicht zu haben. Ein brandiger Geruch stieg ihm in die Nase, als er den Verband löste, und er erkannte geschwollene Wundränder und Eiter. Ein dunkler Streifen zog von der Hand den Arm hinauf.
»Das ist nicht gut, nicht wahr?« Adeles Stimme zitterte. »Kannst du … wirst du …?«
Farin nickte. »Ich kann, und ich werde.« Er sah Juliot an. »Deine Mama wird dich jetzt ganz fest in den Arm nehmen. Ich muss das noch einmal sauber machen, und das wird ein bisschen wehtun. Aber wenn ich das nicht mache, wirst du die Hand verlieren, und das willst du doch nicht.«
»Nein, On … Farin. Bitte nicht. Bitte mach, dass das weggeht! Ich habe Angst! Linette hat gesagt, dass du den alten Ziegen-Gernot gesund gezaubert hast. Zauber mich auch wieder gesund, ja?«
Farin strich dem kleinen Mann durch das schweißfeuchte Haar. »Ich kann nicht zaubern, Ju. Aber ich kann deinem Körper sagen, wie er gegen die Krankheit in der Wunde kämpfen kann. Und das werde ich gleich tun.« Er nickte Adele zu, die Juliot fest in die Arme schloss.
»Mach die Augen zu.« Farin strich ihm über das Gesicht. Dann drückte er mit festem Griff den Eiter aus der Wunde und legte beide Hände darüber.
Juliot stöhnte und wimmerte leise, aber er schrie nicht.
»Du bist tapfer. Halt durch.« Farin schloss die Augen, konzentrierte sich, bis er Juliots Herzschlag spüren konnte. Fühlte, wie das Blut durch den kleinen Körper pulsierte. Wie dieses Blut in die Wunde strömte und aus ihr heraus, und wie das Blut all den Dreck mitnahm, der verhinderte, dass die Verletzung heilen konnte. Erst, als er sicher war, dass nichts von dem Gift zurückgeblieben war, lenkte er seine Gabe darauf, die Wunde zu schließen.
Neben sich hörte Farin Adele nach Luft schnappen.
Es faszinierte ihn noch immer selbst, dass von seinen Händen sanft goldenes Glühen ausging, wenn er seine Gabe benutzte. Unter dem weichen Licht schloss sich die Wunde, das Leuchten sickerte in Juliots Haut hinein, und mit einem leisen Seufzen entspannte der Junge sich.
Farin atmete tief durch und öffnete die Augen. Er wischte sich feuchte Haarsträhnen aus dem Gesicht und nickte Adele zu. »Er wird jetzt eine Weile schlafen. Das Fieber wird sinken, und wenn er aufwacht, wird es ihm besser gehen.«
Adele ließ ihren Sohn vorsichtig zurück auf das Sofa gleiten, dann umarmte sie Farin fest. »Danke. Ich danke dir. Er und Linette sind alles, was Mutter und ich noch haben. Ich will sie nicht verlieren, keinen von ihnen. Wenn ich doch schon nicht weiß, ob ich meinen Mann jemals wiedersehen werde …« Sie schluchzte rau.
Farin hielt sie fest. »Ich weiß«, sagte er leise. Er vermisste seine Väter ebenfalls, und er wusste schon jetzt, dass er vor Sorge umkommen würde, sobald sich seine Freunde, die Letzten seines Rudels, die noch nah bei ihm waren, dem Heer anschließen würden.
Adele machte sich sanft los. »Du vermisst deine Familie auch.«
»Und wie. Pass auf deine auf, so gut du kannst.«
»Das mache ich. Geh in die Backstube. Lass dir etwas mitgeben, ja?«
»Danke.« Farin umarmte Adele noch einmal, dann verließ er das Wohnzimmer und ging in die Backstube, aus der ihm wohlige Wärme und der wunderbare Duft nach frisch Gebackenem entgegenschlug.
»Farin?«, erklang Mutter Margos altersbrüchige Stimme, »bist du das?«
»Ja.«
»Komm her, mein Junge, nimm dir Brot. Du konntest Ju doch helfen?« Sie drückte Farin einen noch warmen Laib in die Hand.
»Ja, Margo. Alles wird gut werden. Er wird wieder …« Farin hielt inne, als von draußen Gebrüll und schnelle Schritte erklangen. »Bleib hier. Sag den anderen, dass sie drinnen bleiben sollen.« Er schob Margo in die Backstube zurück und schloss die Tür hinter sich, bevor er auf die Straße trat.
Das warme Brot an sich gedrückt verharrte er im Schatten der Bäckerhütte. Wieder erklang ein Schrei, hell und schrill wie der eines Kindes. Stimmen brüllten durcheinander, auf der Straße wirbelte Staub auf. Und dann entdeckte Farin den Wolf, der sich in den Eingang eines verlassenen Hauses kauerte, die Lefzen hochgezogen und alle Muskeln gespannt zum Sprung. Das nebelgraue Fell erkannte er sofort. Das war Rian, der mit der Nachtwache unterwegs gewesen war.
Farin hielt den Atem an. Suchend blickte er sich nach Nis und Bron um, doch er entdeckte die Betas nicht. Stattdessen schälte sich aus dem Straßenstaub langsam eine Gruppe Menschen heraus. Große Männer allesamt, und gekleidet in eine wilde Mischung aus Uniformteilen und Alltagskleidung. Wieder brüllten Stimmen, und immer mehr Menschen schoben sich vorsichtig aus Türen, bewaffnet mit Mistgabeln und Dreschflegeln.
Farins Magen zog sich zusammen. Plünderer. Verdammt.
Er nickte dem alten Thom mit seiner Forke zu, der mit festem Schritt sein Haus verließ und sich mitten auf die Straße stellte, und gesellte sich zu ihm, die Hand am Dolch.
»Erkennst du, wie viele es sind?« Thoms Stimme klang gepresst, aber er stand aufrecht und stolz. Bereit, sein Dorf zu schützen. Die Menschen von Mhaz hatten ihn zu ihrem Sprecher gewählt, und er würde dieser Pflicht nachkommen.
»Zehn vielleicht.« Farin kniff die Augen zusammen.
Weitere Dörfler gesellten sich zu ihnen auf die Straße. Frauen, alte Männer, halbwüchsige Jungen. Aus den Augenwinkeln erkannte Farin, dass sich Rian aus seiner Deckung bewegte und hinter der Gruppe herschlich. Wieder erklang ein heller Schrei. Ein einziges Wort nur: »Nein!«
»Linette!« Adeles Stimme. Die Bäckerin eilte herbei.
Farin fasste ihre Hand, bevor sie auf die Truppe zu rennen konnte, die in einiger Entfernung vor den zusammenstehenden Dörflern innegehalten hatte. »Nicht, Adele. Warte ab, was sie wollen. Solange Linette noch schreien kann, ist sie am Leben.«
Adele presste die Hände vor den Mund und wimmerte leise.
»Sei still, Frau.« Thom blickte sich kurz nach Adele um, dann löste er sich aus der Gruppe und trat dem Anführer der Truppe entgegen. »Was wollt ihr? Hier gibt es nichts mehr zu holen, bedankt euch dafür bei euren Vorgängern, die letzte Woche schon hier waren. Wir nagen selbst am Hungertuch.«
Der Anführer, ein großer bärtiger Kerl in Wappenrock, lachte rau. Er hielt einen Säbel in der Hand, dessen Spitze er allerdings zu Boden gerichtet hatte. »Wir wollen eure kargen Vorräte nicht.« Er winkte mit dem Säbel, und einer seiner Gefolgsleute trat vor. Ein Glatzkopf mit Augenklappe, der ein zappelndes Bündel in den Armen hielt. »Sieh hin, Mädchen. Da sind sie, deine Leute. Sieh ganz genau hin und sag mir, ob er dabei ist.«
»Linette!«, hauchte Adele wieder.
Der Glatzkopf hielt einen ihrer Arme auf den Rücken gedreht, mit der anderen Hand hatte er ihr Kinn gepackt und zwang sie, die Gruppe der Dörfler anzusehen.
»Ist er nicht«, keuchte Linette. »Lass mich los, ich will zu meiner Familie!« Sie quiekte, offensichtlich packte der Mann sie fester. »Lügst du auch nicht, hübsches Kind? Dir wird nichts passieren, dir nicht und deinen Leuten nicht, wenn du uns sagst, wer von diesen Leuten da der Heiler ist.«
Farin schluckte. Er umklammerte das Brot so fest, dass seine Finger sich durch die Kruste in das noch warme Innere bohrten.
Thom trat einen Schritt zur Seite und schirmte Farin damit von den Blicken der Männer ab. »Wir haben hier keinen Heiler«, rief er. »Lass das Mädchen gehen. Sie ist noch ein Kind. Ihr macht ihr Angst.«
Der Mann lachte. »Ein Kind, das auf den Feldern Ähren liest und einen halb toten Vogel findet, dem sie von einem Mann erzählt, der ihn wieder gesund machen kann mit seinen heilenden Händen. Dem sie erzählt, wie der Mann mit den heilenden Händen ihren kleinen Bruder wieder zusammenflickt, und wie er den Dorfältesten dem Tod von der Schippe gekratzt hat? Und damit die Gerüchte bestätigt, die über diesen Ort im Umlauf sind?« Er nickte knapp, und der Glatzkopf umfasste Linettes Hals. »Ihr wollt das Mädchen lebend wiederhaben? Dann rückt uns diesen Wunderknaben heraus!«
Farin zitterte. Sein Herz klopfte heftig, er spürte Schweiß auf der Stirn. Sein Wolf rebellierte. »Thom«, murmelte er.
»Ich will mein Kind! Götter, er bringt meine Kleine um!«
Thom packte Farins Hand. »Wir brauchen dich, Junge.«
»Überlegt nicht zu lange! Die Kleine hier wird nicht ewig, ohne zu atmen, überleben!«
Ein grauer Schemen flog aus den Schatten einer Gasse, prallte gegen den Glatzkopf, schnappte nach seiner Hand. Der Mann schrie auf und ließ Linette los, die wie eine Lumpenpuppe zu Boden sank. Keuchend und hustend blieb sie liegen.
Zwei weitere Wölfe stürzten sich in das Getümmel, und nun gab es auch für die Dörfler kein Halten mehr. Brüllend und ihre improvisierten Waffen schwingend stürzten sie sich auf die ungebetenen Gäste. Auch Adele rannte los.
Farin sah nur noch ein wildes Durcheinander aus Armen, Beinen und aufgewirbeltem Staub, er hörte Schreie, hörte Thom neben sich fluchen. Wildes Knurren und Grollen erklang aus dem Getümmel. Dann ein ersticktes Heulen, gurgelnde Laute.
Eisige Kälte durchströmte Farins Adern, als er Blut aufspritzen sah und den leblosen, graubraun bepelzten Körper, der still auf der Straße liegen blieb. »Aufhören!«, brüllte er. »Bron! Aufhören, bitte! Ich bin es! Ich bin der, den ihr haben wollt! Bitte hört auf! Niemand soll meinetwegen sterben!« Er stolperte beinahe über seine Füße, um in Brons Nähe zu kommen, und wusste doch, dass er dem Beta nicht mehr würde helfen können. Sein Gesichtsfeld schrumpfte zusammen – da war nur noch der graubraune Wolf, der Bron war, einer seiner Freunde. Bron, dessen ansteckendes Lachen er nie wieder hören würde. Der nie wieder prahlen würde, dass er als gefeierter Kriegsheld nach Hause zurückkehren würde und dass ihm die Omegas schmachtend zu Füßen liegen würden.
Bron war tot.
Wie durch dichte Schichten nebelgrauer Watte drangen Stimmen und Schritte, dumpfe Laute und Fluchen an Farins Ohren. Eine schwere Pranke landete auf seiner Schulter, packte zu und riss ihn auf die Füße.
Farin taumelte. Seine Beine waren wie taub und wollten ihn nicht tragen, also griff der Kerl, der ihn hielt, wieder zu und hielt ihn aufrecht. Scharfer Geruch nach ungewaschenem Körper und noch etwas anderem, das Farins Sinne nicht erkennen wollten, drang ihm in die Nase. Er blinzelte.
Das Gerangel war so schnell beendet, wie es begonnen hatte. Bron lag am Boden, eine klaffende, blutende Wunde in der Seite. Farin kämpfte gegen Übelkeit, als er die frei liegenden Rippen erkannte. Rian und Nis kauerten neben ihrem Rudelbruder, ebenfalls in Wolfsgestalt. Klein und winselnd wie die halben Welpen, die sie noch waren. Um sie herum scharten sich die Dörfler. Adele hielt Linette im Arm, die haltlos schluchzte und weinte.
Farin spürte Thoms Blick auf sich. Er erkannte, dass der alte Anführer etwas sagen wollte, und schüttelte den Kopf. Er wand sich im Griff des Mannes, der ihn hielt, und erkannte den Kahlköpfigen. »Ich bin der, den ihr sucht«, stieß er hervor. »Kämpft nicht mehr. Wenn ich mit euch komme, lasst ihr dann meine Freunde in Frieden? Einer von ihnen ist tot. Ich will nicht, dass noch mehr Blut vergossen wird.«
Der Glatzkopf lächelte und entblößte erstaunlich weiße und kräftige Zähne dabei. »Braver kleiner Omega«, zischte er und stieß Farin zu Boden. Dann wandte er sich Thom zu. »Du hast gehört, was dieser Mann gesagt hat. Er wird mit uns kommen. Dafür mein Wort, dass wir dieses Dorf … oder das, was davon noch übrig ist, nie wieder betreten werden. Passt in Zukunft besser auf, was für Gerüchte durch die Luft schwirren. Und lasst besser so kleine süße Plappermäulchen wie die da«, er deutete auf Linette, die sich noch immer an ihre Mutter klammerte, »nicht allein zum Ährenlesen gehen.« Wieder packte er Farins Schulter. »Steh auf, kleiner Omega. Und komm mit.«
Farin riss sich zusammen, wischte die Hand von seiner Schulter und kam zitternd auf die Beine. »Darf ich noch Abschied nehmen?«
Der Glatzkopf knurrte. »Mach schnell.« Er zog ein Messer. »Wenn du irgendwelche Mätzchen versuchst, stirbt die Kleine doch noch. Oder einer deiner beiden Wolfsfreunde.«
Farin presste die Lippen zusammen, nickte und ging zu den Betas. Er musste sich zwingen, Brons Leichnam anzusehen, zwingen, Rian und Nis zu umarmen. »Passt auf euch und auf Mhaz auf. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Vielleicht soll ich nur einem ihrer Leute helfen, und sie lassen mich dann wieder ziehen. Sucht nicht nach mir hört ihr? Ich will nicht, dass einer von euch nach mir sucht. Auch von den Menschen nicht. Ich komme zurecht. Begrabt Bron und schenkt ihm weiße Blumen von mir.« Noch einmal drückte er die Wölfe an sich, dann ging er auf Thom zu.
»Es tut mir leid«, murmelte er Alte.
»Pass auf sie auf. Und wenn es zu gefährlich wird, dann verlasst diesen Ort. Geht nach Daronne wie die anderen. Oder sucht euer Glück in Neira. Schlimmer als die Revolte können die verzauberten Wälder auch nicht sein.« Er schaffte es zu lächeln.
Thom zog ihn in eine kurze, stumme Umarmung.
»Ich wollte das nicht, Farin.« Linette sah ihn an, das Gesicht rot und verquollen vom Weinen.
»Ich weiß, Kleines. Ich weiß das. Ich bin dir nicht böse, versprochen. Pass auf deine Familie auf, ja? Und sag Ju, dass er nicht mehr in alten Scheunen spielen soll. Hör auf Thom, und hör auf Nis und Rian. Ich versuche, wiederzukommen.«
»Mach endlich.«
»Ich muss gehen.« Farin wandte sich ab und kehrte zu dem Glatzkopf zurück, der mit einem grimmigen Lächeln das Messer wegsteckte. Unsanft stieß er Farin in den Rücken, und umringt von zehn Männern in zusammengewürfelten Uniformen stolperte Farin Richtung Fluss, und dann flussaufwärts an seinem Ufer entlang. Die Lorne hinauf. Auf die Wälder zu.
Der Glatzkopf hielt ihn am Arm gepackt. »Hat dir eigentlich schon einmal jemand gesagt, wie gut du riechst, kleiner Omega? Ich kann es gar nicht erwarten, wie es erst sein wird, wenn deine Hitze kommt.«
Brennende Übelkeit stieg in Farin auf, als ihm klar wurde, was er kurz nach dem Kampf gerochen und nicht hatte wahrhaben wollen: Der Kerl war ein Wandler. So scharf und dominant, wie ihn dessen Geruch in die Nase stach, ein Alpha. Und er war nicht der einzige Wandler in der plündernden Truppe.
Kapitel 2
Remi
Er hatte nicht vor, sich unterkriegen zu lassen. Schon gar nicht von der verdammten Revolte. Erst recht nicht von dem ebenso verdammten Wetter oder der Tatsache, dass er seit Tagen in keinem vernünftigen Bett mehr geschlafen hatte. Auch nicht davon, dass in diesen Zeiten jeder gefühlt sich selbst am nächsten war und nur wenige sich überhaupt Zeit nahmen, einem herumziehenden Barden zuzuhören. Oder ihm für sein Lied einen Schlafplatz oder ein warmes Essen zu geben.
Seit Remi am frühen Nachmittag durch mehrere verlassene Lorne-Dörfchen gezogen war, regnete es. Zuerst nur fein, dann immer heftiger, inzwischen goss es wie aus Kannen. Zum wiederholten Mal prüfte Remi das lederne Futteral seiner Laute.
Das Instrument hatte seinem Da gehört. Ein letztes Geschenk. Als sich vor gut einem Jahr Fürst und aufstrebende Gegenfürsten wie kämpfende Alphas anzuknurren begonnen hatten, war auch in Remis Rudel die Stimmung immer angespannter geworden. Er hatte zugesehen, sich seine eigene Meinung gebildet. Bis sich eines Tages das Machtgerangel auch auf ihn ausgedehnt hatte. Remi knurrte. »Bei den haarigen Eiern des Weltenwolfs, nur, weil ich der Sohn eines Alphas bin, heißt das noch lange nicht, dass ich danach strebe, selbst einer zu werden!« Nur die leere Straße, geplünderte Felder am Waldrand und der stetig rieselnde Regen hörten seinen Fluch.
Remi hatte nie nach Macht gestrebt. Er hielt sich im Hintergrund, wenn es um Politik und Hierarchien ging. An dir ist ein Omega verloren gegangen. Die Worte seines Vaters und Alphas klangen ihm noch immer in den Ohren. Als der Rudelführer mitbekommen hatte, dass Remi sich von einem seiner Omegas im Lautenspiel unterweisen ließ, war ihm der Kragen geplatzt. Ich sollte im nächsten Winter vielleicht prüfen, ob mein Herr Sohn, der sich für einen Beta hält, nicht vielleicht doch in Hitze gerät! Remi knurrte. Immerhin hatte sein Vater sich darauf eingelassen, ihm das Lautenspiel zu erlauben, wenn er dafür auch eine vernünftige Kämpferausbildung genoss.
Genoss, ha. Remi schnaubte. Er wollte diese Erinnerungen nicht, aber sie kamen wieder und wieder hoch – je mehr er versuchte, sie zu verdrängen, umso häufiger kehrten sie zurück, um ihn zu quälen.
Es gab nur eines, was er wirklich genoss, und das war die Musik. Auf einer Bühne wurde er zum Alpha, der die mitgrölende, klatschende und tanzende Menge beherrschte wie ein Fürst seinen Hofstaat. Er war der Meister der Saiten, der Herr der Töne. Er wollte singen.
Als sein Rudel im Streit zerfiel, hatte er nicht lange gebraucht, um den Entschluss zu fassen, auf eigene Faust loszuziehen. Wohl wissend, dass es in diesen aufgewühlten Zeiten nicht leicht sein würde, ein Rudel zu finden, dem er sich anschließen konnte. An den Gedanken, ein eigenes Rudel zu gründen und als Alpha anzuführen, hatte er sich nie gewöhnen können. Ihm war es genug, der Alpha seiner Musik zu sein.
Musik. Remi grinste schief und begann, eine kleine Melodie vor sich hinzusummen, die ihn schon seit einiger Zeit begleitete. Irgendwann war er morgens erwacht, und sie war da gewesen und hatte ihn nicht mehr losgelassen. Remi hatte begonnen, nach Worten zu suchen, die zu der Tonfolge passten, und hatte sich schließlich dabei ertappt, dass er ein Liebeslied dichtete. Er lachte bitter. Wenn es zu diesen Zeiten schon schwierig war, ein Rudel zu finden, das ihn aufnehmen würde, wie unwahrscheinlich mochte es dann sein, einen Gefährten zu finden?
Remi richtete frustriert den Blick zum Himmel, der sich wie ein bleigraues Leichentuch über das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land spannte. Es nieselte inzwischen nur noch, aber damit schien es auch nicht aufhören zu wollen.
Jeder Flecken, jeder Hof, den er in den letzten Stunden passiert hatte, war verlassen gewesen. Hier und da hatte er einige nützliche Dinge eingesteckt, hatte mitgenommen, was er Essbares hatte finden können, und war weitergezogen.
In den verlassenen Gebäuden für die Nacht unterkriechen wollte Remi nicht, dafür war er in den vergangenen Tagen zu oft Plünderern begegnet, die mit dem, was sie vorfanden, nicht eben pfleglich umgingen. Zudem war es wärmer, sich ein gemütliches Plätzchen im Wald zu suchen und in Wolfsgestalt in einen hohlen Baum zu kriechen, in dessen Zweigen er zuvor seine Habseligkeiten aufgehängt hatte. Remi seufzte, blickte noch einmal in die grauen Wolken und verließ die Straße, um im Wald nach einem Lagerplatz zu suchen. Es ging auf den Herbst zu, die Dämmerung brach täglich früher herein. Am nächsten Abend würde er Mhaz erreichen – vielleicht würde er dort auf Menschen, vielleicht sogar Wandler stoßen, die noch nicht fortgezogen waren. Und wenn die Leute dort ihm nichts für seine Lieder geben konnten, dann würde er zumindest diesen Menschen mit der Musik vielleicht für einen Moment die Herzen leichter machen können. Der Gedanke bescherte Remi ein warmes, weiches Bauchgefühl. Einigermaßen mit sich und der Welt wieder versöhnt stapfte er tiefer in den Wald hinein.
Nach einer Weile stieß er auf einen Trampelpfad, der wiederum auf einen etwas breiteren Weg führte. Baumstümpfe und überwucherte Schneisen in der Nähe deuteten darauf hin, dass die Menschen der umliegenden Gehöfte und Dörfer hier zu friedlicheren Zeiten Holz geschlagen haben mochten.
Remi folgte dem Weg, bis er auf eine Gabelung und jede Menge Spuren im weichen, teilweise matschigen Untergrund stieß. Fährten von Waldtieren, auch Wölfen und Füchsen erkannte er – und die Abdrücke von Schuhwerk.
Hier waren Menschen gewesen!
Remi bückte sich, um die Spuren genauer zu betrachten. Jetzt fielen ihm auch die wenigen Abdrücke auf, die aus der Richtung kamen, die ihn an die Gabelung geführt hatte, die meisten jedoch folgten dem kreuzenden Weg tiefer in den Wald hinein.
Remi schnupperte. Seine menschliche Nase war um Längen schlechter als die seines Wolfes, dennoch war er sicher, über den vielschichtigen Aromen des Waldes auch menschliche Gerüche wahrzunehmen. Eine beinahe schon beißend scharfe Note ließ seinen Wolf leise aufjaulen. Tief zog Remi noch einmal die Luft in die Nase und schüttelte sich. Er mochte sich irren, doch er wurde das Gefühl nicht los, dass der scharfe Geruch zu einem Wandler gehörte. Vorsichtig und dennoch entschlossen folgte Remi der Spur, immer auf der Suche nach einem Baum, in oder auf dem er seine Sachen verbergen konnte. Alles in ihm wollte sich wandeln und der Spur in Wolfsform weiter nachgehen.
Die kleine Lichtung mit der Felsformation, auf die Remi einige Schritte weiter stieß, erschien ihm wie die Antwort auf seine Gebete. Umgeben von hohen, alten Bäumen bildeten die Steine beinahe eine natürliche Höhle. Ein die Öffnung überhängender Felsen hielt alles Darunterliegende trocken, und es lagen genug flache Steine herum, die Remi vor die Öffnung schieben und seine Sachen so sicher verbergen konnte. Zumindest so lange, wie er brauchte, um dem seltsamen Geruch auf den Grund zu gehen und wieder hierher zurückzukommen und alles zu holen.
Remi schüttelte Feuchtigkeit von dem gut gefetteten Lautenfutteral, schob das Instrument in den Hohlraum und nahm seinen Rucksack von den Schultern. Rasch schlüpfte er aus Kleidung und Schuhen, verstaute das Bündel in seinen Umhang gewickelt im Rucksack und stopfte auch diesen unter den Felsen. Mit Steinen und Pflanzen verschloss und verbarg er die Öffnung und verwischte mit einem Tannenzweig seine Spuren. Als er sich einige Schritte entfernt von dem Versteck endlich wandelte, bibberte er bereits vor Kälte. Der Nieselregen fiel nicht bis auf den Waldgrund, dennoch machte die Feuchtigkeit alles klamm und kalt.
Remi jaulte erleichtert auf, als seine dicht behaarten Wolfspfoten den Saum des Weges berührten. Sein hell goldbrauner Pelz mit den vereinzelten silbernen Haaren darin würde ihn im dämmrigen Spätsommerwald mit der Umgebung beinahe verschmelzen lassen, und Pfoten verursachten weit weniger Geräusche als Füße in Lederstiefeln.
Remi nahm erneut Witterung auf – und schnaubte, als ihm nun deutlich durchdringender der scharfe Geruch in die Nase stieg, den er zuvor schon wahrgenommen hatte. Wolf. Wandler. Und zwar einer, der glaubt, hier das Sagen zu haben. Remi trabte weiter und stieß immer wieder auf die in der Nase beißenden Duftmarken. Meine Güte, da hat es aber einer nötig. Was für ein Angeber. Immerhin, die Witterung eines offensichtlichen Alpha-Wolfes in der Nase zu haben, sagte Remi, dass er in diesem Wald früher oder später auf ein Rudel oder zumindest eben diesen Alpha stoßen würde. Was er tun würde, konnte er immer noch dann entscheiden, wenn er ihn tatsächlich gefunden hatte. Die Nase dicht am Boden bewegte Remi sich langsam weiter von Markierung zu Markierung. Dabei hielt er immer wieder inne und lauschte auf Stimmen, Wolfsheulen, leises Jaulen und Kläffen, irgendetwas, das ihm sagte, dass er sich seinem Ziel näherte.
Noch bevor er Stimmen vernahm, gesellten sich immer mehr weitere Düfte zu der markanten Spur des Alphas. Menschen, Remi erkannte mindestens sieben verschiedene Gerüche. Wölfe. Betas. Es mochten drei sein, vielleicht auch vier. Und darüber, zart wie ein Hauch, auch für Remis Nase beinahe unbemerkbar, noch ein weiterer Duft, der ihn mit einem leisen Japsen innehalten und auf die Hinterläufe sinken ließ.
Was bei den haarigen Eiern des Weltenwolfs …? Remi bohrte die Nase in den Boden, dort, wo ihm dieser neue Duft zum ersten Mal wirklich aufgefallen war.
Sanft. Blumig.
Remi schnaubte und witterte erneut.
Omega.
Kein Zweifel, bei der zusammengewürfelten Menschen- und Wandlertruppe hielt sich auch ein Omega auf. Und der roch verdammt gut. Remi schloss für einen Moment die Augen, konzentrierte sich auf den zarten Duft nach wilden Rosen, der sich, so schwach er auch war, noch mehr in seiner Nase festsetzte, als der scharfe Gestank des Alphas es tat. Und, Remi spürte es in jeder Faser seines Körpers, dieser Wildrosenhauch berührte nicht nur seinen Geruchssinn. Er wollte diesen Omega sehen. Jetzt. Sofort. Musste versuchen, ihn zu treffen.
Remi setzte sich auf die Hinterläufe und schüttelte sich. Behalte den Kopf klar und benimm dich nicht wie ein dummer Junge, dem zum ersten Mal in seinem Leben ein Duft den Kopf verdreht. Er durfte jetzt nichts überstürzen, durfte nicht wie von wilden Bienen gejagt in den Unterschlupf dieser Fremden stürmen und sich nach diesem Omega umsehen. Erst einmal herausfinden, was das überhaupt für Gestalten sind. Genau. Remi riss sich zusammen, senkte die Nase wieder zu Boden und konzentrierte sich auf die Fährte des Alpha-Wolfes und die verschiedenen Menschenspuren.
Doch immer, immer wieder schlich sich diese hauchzarte Wildrosen-Note in seine Nase und sorgte für seltsamen rosafarbenen Nebel in seinem Kopf. Verdammt. Je heftiger Remi versuchte, den Duft nicht wahrzunehmen, umso fester klammerte dieser sich in seiner Nase fest. Remi tappte weiter den Wegesrand entlang, folgte den Spuren der Fremden und verlor dabei jedes Zeitgefühl.
Die Dämmerung war bereits tief und nah am Nachtdunkel, als Remi in einiger Entfernung tanzenden Feuerschein und das schummrige Licht einiger Laternen erkannte. Gesprächsfetzen drangen an seine Ohren, Worte, die der Abendwind verwehte und zu kaum verständlichem Murmeln zerzauste. Dummerweise trug ihm der Wind auch Gerüche zu. Nach Feuer, nach etwas, das darüber briet. Dazu den Brodem ungewaschener Körper, den scharfen Alpha-Gestank und wieder, ganz nah jetzt, den zarten Wildrosenduft, der Remi zittern ließ.
Niedergekauert im Buschwerk unterdrückte Remi den Impuls, mitten in das Lager zu stürmen, und nach dem Omega zu suchen. Er prüfte den Wind, sorgte dafür, dass er sich so dem Lager näherte, dass die Wölfe dort ihn nicht sofort riechen konnten, und robbte auf dem Bauch Schritt für Schritt näher. Die Fährte führte ihn immer weiter vom Weg fort, bis er durch dichtes Unterholz kriechen musste. Nur hin und wieder stieß er auf schmale Wildpfade, die offensichtlich auch von den Menschen und Wandlern benutzt wurden. Immer wieder stieß er auf die Duftmarke des Alpha-Wolfes.
Es war tatsächlich ein Lager, das die Männer auf einer kleinen Lichtung zwischen hohen Bäumen errichtet hatten. Anscheinend hatten sie sogar in einige der Bäume kleine Baumhütten gebaut. Zwischen den Stämmen waren Stoffbahnen gespannt und mit Ästen und anderem Pflanzenmaterial bestückt. Wer auch immer dort hauste, hatte dafür gesorgt, dass das Lager gut getarnt war.
Straßenräuber. Diebe. Plünderer. Leute, die für sich das Beste aus der Revolte machten und alles, was noch einigermaßen niet- und nagelfest aussah, überfielen. Und unschuldige Menschen ausraubten, denen das Schicksal genau so übel mitgespielt hatte wie vermutlich den Dieben selbst. Remi schnaubte. Er hasste dieses Pack, das aus dem Leid der armen Bevölkerung noch die eigenen Taschen füllte.
Langsam kroch er näher und spitzte die Ohren, als ein schmerzerfülltes Keuchen an seine Ohren drang. Er schob sich unter seinen dornigen Busch, dessen Ranken nach seinem Fell griffen, und drückte sich platt an den feuchten Boden. Von hier hatte er fast freien Blick auf das Feuer. Zwischen den beiden dicht beieinanderstehenden Bäumen direkt vor ihm war keine Plane gespannt, stattdessen lungerte ein abgerissener Kerl mit einem Speer in der Hand dort herum, beobachtete den Wald und nagte an irgendetwas.
Um das Feuer herum hatten sich mehrere Gestalten versammelt, saßen auf Baumstämmen und Holzkisten, aßen und schöpften mit Bechern etwas aus einem Fass, das Rum oder Wasser sein mochte. Die Stimmung schien ausgelassen. Ganz besonders zwei Männer wirkten fröhlich und zufrieden – ein großer, breitschultriger Kerl mit Vollbart und langem Haar, neben ihm ein weiterer, ebenfalls kräftig gebauter, aber schlankerer Mann, der anscheinend sein Haar dem Bären neben sich abgetreten hatte, denn er hatte eine Glatze und war bartlos. Im Feuerschein erkannte Remi, dass er eine Augenklappe trug.
Neben dem Glatzkopf kauerte auf Knien ein weiterer Mann. Schmal, schlank und deutlich kleiner, mit langen, dunklen Locken, die er sich mit einem Band aus dem Gesicht gebunden zu haben schien. Im Feuerschein leuchtete dieses Gesicht kreidebleich. Große Augen schimmerten wie tiefe Seen.
Krachend ließ der Glatzkopf die Hand auf die Schulter des Zierlichen fallen. »Nimm dir auch einen Becher, Kleiner, du hast ihn dir verdient!