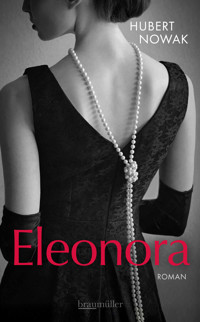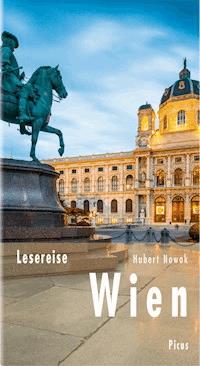Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 12. November 2018 jährt sich zum hundertsten Mal die Ausrufung der Republik. Eines Staates, der zum Zeitpunkt seiner Gründung noch „Deutschösterreich“ heißt und von dem viele glauben, dass er nicht überleben wird. Doch der deutschsprachige „Rest“ des zerbrochenen Habsburgerreiches beweist Lebenswillen und Tatkraft. Mit dem „Anschluss“ an Nazideutschland verschwindet Österreich von den Landkarten, aber nicht aus den Köpfen und Herzen seiner Menschen. Die Wiedergeburt der Republik 1945 vereint sie als Österreicherinnen und Österreicher zu gemeinsamer Anstrengung für eine bessere Zukunft. Hubert Nowak zeigt die markanten Eckpunkte und entscheidenden Veränderungen dieses Weges auf und zeichnet das ebenso lebendige wie differenzierte Bild eines Staates, der in zwei Anläufen aus den Katastrophen eines „Zeitalters der Extreme“ zu sich selbst findet. Aus dem Inhalt: November 1918: Am Anfang war das Ende | Die ersten Schritte ohne Kaiser | Ein Gerüst für zwei Republiken: die Verfassung | Das Lagerdenken: Parteien und Parlamentarismus | Föderalismus – Segen oder Fluch | Ins Sozialparadies und wieder zurück | Feindbilder: Juden, Muslime, Eliten | Ein katholisches Land: Werte und Prägungen | „Insel der Seligen“ - Österreichs Rolle in der Welt | Die Zukunft der Republik | Die großen Gestalten: Hans Kelsen, Ignaz Seipel, Engelbert Dollfuß, Leopold Figl, Julius Raab, Bruno Kreisky u. a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine neue Zeit beginnt: die Ausrufung der Republik am 12. November 1918.
Geschichte ist das kollektive Gedächtnis.
Wie das menschliche verblasst es mit der Zeit und sollte doch lebendig gehalten werden für die nächsten Generationen.
Für Mariana, Clemens, Emma und Zita
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Vorwort
Anmerkungen
1. Am Anfang war das Ende
Anmerkungen
2. Mit Anlauf in die Katastrophe
Anmerkungen
3. Der Abschied von der Monarchie
Anmerkungen
4. Übungsschritte der Demokratie
Anmerkungen
5. Wie sich die Muster gleichen – gleichen sich die Muster?
Interview mit Karl Habsburg
Anmerkungen
6. Kraftloser Lebenshunger
Anmerkungen
7. Zur Kleinheit gezwungen
Anmerkungen
8. Ein Gerüst für zwei Republiken
Interview mit Franz Fiedler
Anmerkungen
9. Der Föderalismus – Segen und Fluch
Anmerkungen
10. Lagerdenken
Anmerkungen
11. Szenen einer Ehe: Streit, Skandale und Affären
Anmerkungen
12. Zur eigenen Verteidigung gezwungen
Anmerkungen
13. Symbole braucht das Volk
Anmerkungen
14. … und auf jedem Gipfel steht ein Kreuz
Interview mit Christoph Kardinal Schönborn
Anmerkungen
15. Über Männer, Frauen und andere Ungerechtigkeiten
Anmerkungen
16. Einmal Sozialparadies und zurück
Anmerkungen
17. Drehbühne des Weltgeschehens
Interview mit Heinz Fischer
Anmerkungen
18. Hoffnungen und Ängste
Anmerkungen
Literaturhinweise
Personenregister
Bildnachweis
Impressum
Fußnoten
Vorwort
Die Gegenwart versteht man nur aus der Geschichte. Jede Entwicklung versteht man nur aus ihren Wurzeln. So trivial dies erscheint, so schwierig kann es sein. Alles hängt mit allem zusammen. Die Gegenwart, in der wir unsere Zukunft planen, fußt in der Geschichte. Jede Analyse der Säulen unserer politischen Identität erfordert den historischen Kontext. Unser heutiges Verständnis von Föderalismus, unsere Wertordnung, unser Verständnis von Gleichberechtigung, unsere Haltung zu den Religionen bzw. die Position der Religionsgemeinschaften zur Politik, unser kulturelles Leben und unser Zukunftsglaube – all das wurzelt in der Gedankenwelt früherer Generationen.
Deshalb will dieses Buch versuchen, die tragenden Elemente unseres heutigen Staatsgefüges nicht allein im Ist-Zustand oder der jüngeren Zeitgeschichte zu beschreiben, sondern in Bezug zu setzen zu ihrer historischen Entwicklung.
Veritas temporis filia. Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit, wussten schon die alten Römer.1 Sie ist auch eine Tochter der Perspektive. Oder, um es mit Franz Kafka zu sagen, „Es gibt zwar nur eine [Wahrheit], aber sie hat […] ein lebendig wechselndes Gesicht“2. Wer diesen wechselnden Gesichtern auf die Spur zu kommen will, muss in der Geschichte bisweilen weit zurückgehen. Um es an einem völlig fremden Thema zu illustrieren: Um den Atombombenabwurf der USA auf Hiroshima und Nagasaki 1945 zu verstehen, muss man den Überraschungsangriff Japans auf Pearl Harbor 1941 bedenken. Dieser war aber eine Reaktion auf das US-Handelsembargo gegen Japan, dieses wiederum hatte seinen Grund in der japanischen Expansion im Südpazifik und im 1937 begonnenen Krieg gegen China. Immer fußt eines auf dem anderen, immer ergibt eines das andere. Natürlich kann man nicht immer nur noch weiter zurückliegende Ursachen ausgraben, noch weniger ist es zulässig, weder im Alltagsleben noch in der Politik, mit altem Fehlverhalten neues zu rechtfertigen. Aber Zusammenhänge zu kennen ist immer hilfreich für eine Standortbestimmung.
Historiker haben vor allem die vergangenen Handlungsstränge im Blickfeld, Politiker oft nur ihre Zielvorstellungen (und die nächste Wahl), Journalisten versuchen, die Gegenwart zu sezieren. Und schon zeigen sich wechselnde Gesichter. Alle drei Perspektiven zu vereinen, gelingt selten. Aber es ist wert, einen solchen Brückenschlag zu versuchen zwischen historischen Fakten und deren Wurzeln zu dem, was daraus geworden ist – und die Erkenntnisse daraus einer aktuellen journalistischen Analyse zu unterziehen.
Ein solcher Bogen kann nur unvollständig sein. Man verzeihe dem Autor daher schon jetzt die Lücken, die dabei nur teilweise dem sprichwörtlichen Mut, viel mehr aber schlicht der Überschaubarkeit geschuldet sind. An der Geschichte ist ohnedies nicht so sehr die Perlenkette der Ereignisse von Interesse, sondern die Entwicklung der hinter diesen Marksteinen liegenden Gedanken, Ideologien und Werthaltungen. Exemplarisch werden daher diese Veränderungen in einigen ganz speziellen und zugleich höchst typischen und wichtigen Teilgebieten des jüngeren Wesens Österreichs zu analysieren sein, wie etwa beim Föderalismus, beim politischen Katholizismus, der Gleichberechtigung, unserem Wertesystem und der Haltung gegenüber den Habsburgern und der eigenen Geschichte im Allgemeinen.
Da die Wurzeln der Ereignisse rund um die Gründung dieser Republik zum Teil weit zurückreichen, erhält auch diese Vorgeschichte entsprechend Raum. Die Betrachtung des Jahres 1918 kann nicht erst bei 1918 ansetzen. Zugleich kann die Entwicklung nur anhand einiger Eckpunkte skizziert werden. Das Beleuchten einzelner herausragender Persönlichkeiten aus der Frühphase dieser Republik und das Reflektieren der wesentlichen Säulen des großen Bogens mit aktuellen Interviews mag den Blick auf das Ganze erleichtern. Auch an Details lässt sich der Horizont markieren und der Blick für unsere gesamte Situation von heute schärfen. Das ist die Idee, die diesem Buch zugrunde liegt.
Die wechselhaften politischen Entwicklungen der letzten Jahre lassen keine gesicherte Vision mehr zu, in welche Zukunft wir gehen. Das gilt prinzipiell immer, aber noch vor ein, zwei Jahrzehnten waren die Erwartungen der Menschen hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung vergleichsweise stabil und unaufgeregt. Strömungen in ganz Europa, Russland, der Türkei und den USA lassen jetzt Wolken aufziehen über dem, was bisher als sicher und von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen galt. Selbst unsere Republik wurde im Gewirr der Bundespräsidentschaftswahlgänge 2016 als „ablösereif“ bezeichnet, die Idee einer Dritten Republik, eines radikalen Neustarts, tauchte, wenngleich auch nicht mehr ganz neu, aus der Verunsicherung auf. Vieles liegt im Nebel. Damals, als die Republik gegründet war, war das noch viel mehr der Fall.
Der Zeitraum von 100 Jahren kann nur ein äußerer Anlass für die Analyse sein. Zumal die Tatsache, dass in Österreich vor 100 Jahren die Republik ausgerufen wurde, ja nicht bedeutet, dass wir genau 100 Jahre Republik hinter uns hätten. Das dramatische Intermezzo mit dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass vieles eines zweiten Anlaufs bedurfte, um zu einer Erfolgsgeschichte in diesem österreichischen Jahrhundert zu werden. Aber nichts davon ist abgeschlossen. Geschichte ist immer in Bewegung.
Aulus Gellius, ca. 130–180n.Chr., zitierte damit ca. 170n.Chr. bereits einen anderen, unbekannten Dichter (Noctes Atticae 12,11,7). Der Wahlspruch der englischen Königin MariaI. wurde in Österreich durch den ehemaligen ÖVP-Klubobmann Andreas Khol populär.
zit. n. https://www.aphorismen.de/zitat/183671
Am Anfang war das Ende
Jene verwichene Zeit, die golden wir pflegen zu nennen, …
befleckte noch nicht mit Blute die Lippen.
Ovid, Metamorphosen1
Am Anfang war das Ende. Das Ende einer jahrhundertelangen Geschichte, einer, die weitgehend eine Erfolgsgeschichte war, bis zum unrühmlichen Ende. Diese Monarchie hatte mehr geprägt als nur dieses Land. Sie hat Europa mitgeprägt, war einer der Big Player des Weltgeschehens, des damaligen Weltgeschehens. Damit war auf einen Schlag Schluss.
Es war das Ende jeglicher Form von vermeintlicher Sicherheit, in der man sich bis zum Kriegsausbruch noch wähnen konnte. Da war eine lange Friedensperiode zu Ende gegangen, gestützt auf den Wiener Kongress von 1815. Es war das Ende jeglicher Anerkennung in Europa. „Der Rest ist Österreich“,2 war so demütigend wie nur irgendwie vorstellbar. Rest, Überbleibsel. Ob es überleben könne? Wen interessierte das. Der Respekt vor einem großen Mitglied der Staatengemeinschaft war weg. Verspielt, gelöscht.
Es war das Ende einer selbständigen Lebensfähigkeit, einer wirtschaftlichen Autonomie. Es war der Schlussstrich unter einen Vielvölkerstaat und damit das Ende der gewohnten Ordnung, aller gültigen politischen und staatsrechtlichen Strukturen. Aus diesem Ende eines geschlagenen, gedemütigten, ausgebluteten und fast gänzlich vernichteten Landes sollte ein neuer Staat entstehen. Eine Republik.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Nie war dieser Satz, für sich allein genommen, so falsch wie 1918. Was für jeden Sonnenaufgang, für junge Verliebtheit oder das Beziehen einer neuen Wohnung gelten mag, für die neue Republik galt es so simpel nicht. Wiewohl das ganze Zitat schon eher zutrifft:
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Ja, am Anfang war vor allem wichtig zu leben. Weiterzuleben, wieder zu leben. Das vermittelte irgendwie fast einen Schutz, nach dem Großen Krieg mit Millionen Toten, zerstörten Städten, verwüsteten Landstrichen.
Hermann Hesse hat das Gedicht Stufen 1941 geschrieben, nach langer Krankheit, während des Zweiten Weltkriegs, des noch grausameren Krieges. In der Erkenntnis, dass das Leben eben aus Veränderung besteht und bisweilen in Stufen verläuft. Nach jedem Lebensabschnitt kommt ein neuer. Die Stufe von 1918 war der wohl heftigste Bruch in der bisherigen Geschichte Österreichs.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne
heißt es in dem Gedicht auch. Der Abschied von der Monarchie war den geschlagenen Österreichern gar nicht so schwergefallen. Dieses feudale System hatte sich überlebt, nicht nur deshalb, weil es den Krieg angezettelt und dann nicht gewonnen hatte. Der Neubeginn war das viel Schwierigere. Hatte man doch schon viel bessere Zeiten erlebt. An deren Qualität wollte man wieder anschließen, nur eben in einer neuen Ordnung.
Denn dieses Jahrhundert hatte als Goldenes Zeitalter begonnen. Kaum eine Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte war derart von Aufschwung, Innovationen, Kreativität und Lebensfreude geprägt wie die Zeit der Jahrhundertwende. Die industrielle Revolution ermöglichte einen Höhenflug nach dem anderen. Gewiss, es gab auch Modernisierungsverlierer, wie man das heute nennt. Nicht wenige sogar. Die vielen ungelernten Taglöhner, Hilfsarbeiter, die Migranten. Die „Ziegelböhm“ und viele andere, die in Baracken hausten, in Lagern, wie Flüchtlinge heute, abseits jeglicher Bildungschance, abgeschnitten von jenen, die den Aufstieg lebten und erlebten. Aber, mein Gott, das galt als Randerscheinung, als Kollateralschaden des neuen Lebens, des Aufschwungs, des Glaubens an eine positive Zukunft.
Das Proletariat in den Städten und die beträchtlich große arme Landarbeiterschicht bemühten sich um eine Verbesserung ihrer Lage, viel ertrugen sie aus der Hoffnung heraus, dass es auch für sie bald besser werden würde, dass auch sie bald ein Stück des neuen, schönen Lebens ergattern würden. Die Hoffnung machte sie leidensfähig, die Euphorie war der Treiber des Alltags in dieser „atemlosen Zeit“.3
Der Mensch hatte zu fliegen begonnen. Noch nie zuvor war so klar, dass man es schaffen würde, den Luftraum in großem Stil zu erobern. Noch hatte man wohl keine Vorstellung von einem Airbus A 380 und der Selbstverständlichkeit, in einem Flugzeug gleich Hunderte Menschen auf einmal von einem Kontinent auf den anderen zu schubsen. Aber sehr wohl träumte man schon von der Eroberung des Weltalls, jedenfalls von einem Flug zum Mond, man hatte die Vision einer weltumspannenden Kommunikation in Echtzeit.
Die Telegraphie war längst erfunden, das Telefon war drauf und dran, den Alltag der Menschen zu erobern und zu beschleunigen. Vorerst einmal den des wohlhabenden Bürgertums. Schon 1863 hatte der deutsche Physiker und Erfinder Philipp Reis dem österreichischen Kaiser Franz JosephI. in Frankfurt am Main einen Apparat vorgestellt, mit dem man Töne übertragen konnte. Der Sprechtelegraph folgte alsbald. Der Schotte Alexander Graham Bell hatte sich das Patent gesichert, kurz nach der Weltausstellung von Philadelphia 1876 begann der Aufbau von Telefonnetzen. Überschaubar noch, aber immerhin. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass diese ersten Telefonnetze natürlich von privaten Investoren und Gesellschaften errichtet und betrieben wurden. 1895 waren alle Privatnetze an den Staat übergeben, um von der österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung (ÖPTV) vereinheitlicht und weiter ausgebaut zu werden. Erst knapp hundert Jahre später ging die Telefonie in Österreich wieder den Weg vom Staatsbetrieb zurück in die Privatisierung. In Wien waren 1901 bereits 34.651 Abonnenten bei der Telefonzentrale registriert, überwiegend Unternehmer, die damit ihr Geschäftsleben rasant in Fahrt brachten.
Apropos Fahrt: Die Mobilität war ein weiterer Ausdruck des neuen Lebensgefühls. Die Eisenbahnen florierten, auch sie waren zunächst private Einrichtungen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts investierte die Monarchie große Summen in den Ausbau des k.k. Staatsbahnnetzes. Natürlich auch aus strategischen Gründen. Der neue Hauptkriegshafen in Pola wurde damit an das Kernland angeschlossen, die Dalmatinische Küstenbahn errichtet. Auch der Arlbergtunnel wurde 1880 beschlossen. Das 1896 gegründete k.k. Eisenbahnministerium hatte nicht zuletzt die Aufgabe, die technischen Systeme und Investitionen in der gesamten Doppelmonarchie zu koordinieren.
Zwar gab es noch immer diejenigen, die davor warnten, den menschlichen Organismus einer höheren Geschwindigkeit als 16km/h auszusetzen. Der Mensch sei nicht dazu geeignet, sich schneller zu bewegen als ein Pferd. Aber die Euphorie des neuen Tempos ließ sie bald als Außenseiter erscheinen. Gab es doch schon etwas, das selbst die gewaltigen Investitionen in die Eisenbahnen als veraltet erscheinen ließ. Das Automobil sollte alles ablösen. Carl Benz konstruierte 1886 ein Gefährt mit einem Verbrennungsmotor, der Zweite Wagen von Siegfried Marcus war ein paar Jahre später fahrbereit und steht heute im Technischen Museum in Wien (sein erster ist nicht mehr erhalten). Wer auch immer das Verdienst des größeren Erfinders haben mag, Innovationen haben oft viele Väter, sie lösten jedenfalls eine Lawine der Mobilität für die ganze Welt aus. Das Auto hat das Leben im 20. Jahrhundert geprägt wie keine andere Erfindung. Es hat auch den Verlauf der Kriege und damit die Geschichte maßgeblich mitgeschrieben. Aber damals, als dieser Kontinent von einer Euphorie in die nächste taumelte, begann man, Geschwindigkeitsrekorde für Autos zu messen und purzeln zu lassen. Österreich, die Monarchie, das große Reich, war in all diesen Entwicklungen ganz vorne mit dabei.
Die „Welt von gestern“: Wien um 1900, pulsierendes Zentrum einer europäischen Großmacht. Blick auf den Graben mit der Pestsäule.
1901 entstand in Österreich die erste Fahrschule. In Wien gab es handfeste Überlegungen zum Bau einer U-Bahn. Für Anfang 1914 war schon konkret geplant, das Zentrum der wachsenden Millionenstadt mit drei Linien in Form eines Ypsilons zu untertunneln. Tatsächlich in Betrieb genommen wurde die erste Wiener U-Bahn-Linie erst 64 Jahre später.4
Auch abseits all dessen, was sich technischer Fortschritt nannte, war das Leben zur Jahrhundertwende, jedenfalls in den Metropolen, von einer Opulenz, die man bis dahin nicht gekannt hatte. Nach dem Wiener Kongress genossen große Teile Europas eine ungewohnt lange Friedensperiode. Und der Untergang der Titanic 1912 versetzte der Begeisterung nur einen kurzen Dämpfer.
Anbruch des Informationszeitalters: die Telefonzentrale in der Wiener Friedrichstraße, um 1885.
In Wien traf sich die Welt. In einer kuriosen Mischung. Ein gewisser Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili war im Jänner 1913, getarnt als Stavros Papadopoulos, in der Schönbrunner Schlossstraße 30 eingezogen und arbeitete hier an seiner Schrift Der Marxismus und die nationale Frage – als Josef Stalin sollte er zu einem der Mächtigen dieser Erde aufsteigen. Zugleich befanden sich ein erfolgloser Aquarellmaler namens Adolf Hitler und ein verliebter junger Kroate namens Josip Broz in der Stadt. Später nannte er sich Josip Broz Tito. Ob sich die zwei größten Tyrannen des 20. Jahrhunderts und einer der übelsten Diktatoren auch persönlich über den Weg gelaufen sind, ist nicht überliefert.5
Wie Übermut mag es erscheinen, was man sich heute an Ausgelassenheit über die Zeit der Jahrhundertwende erzählt. Was man als Fin de Siècle bezeichnet, hatte den Keim von Endzeitstimmung in sich. Der in Frankreich geprägte Begriff wurde von Hermann Bahr aufgegriffen, um in seinen Novellen den Konflikt zwischen Ordnung und Chaos zu beschreiben. Dekadentismus war schon mehrfach in der Menschheitsgeschichte ein Anzeichen für den bevorstehenden Untergang. Die Römer, die Griechen, ägyptische Pharaonen und chinesische Kaiser haben solche Erfahrungen gemacht. Im Mitteleuropa des noch jungen 20. Jahrhunderts wollte man davon nichts spüren. Obwohl der Begriff Fin de Siècle ja das Ende schon in sich trägt. Man lebte, als wäre es nur das Abschiednehmen von Veraltetem, von Überkommenem. Der Duft des Fortschritts übertönte alles.
Philosophie und Naturwissenschaften hatten sich in der Gedankenwelt des Positivismus dem Machbaren verschrieben. Und (fast) alles galt als machbar oder demnächst machbar. Eine ungeheure Technikgläubigkeit wandte sich gegen alles Transzendente. Auch der Blick auf die Religion musste sich dem unterordnen, die „positivistische Weltreligion“ suchte eine Alternative zu den zu Riten und Strukturen der traditionellen Glaubensgemeinschaften, jedenfalls aber einen Humanismus, der sich unabhängig von den großen Religionslehren verstand. Wahrscheinlich war der starke Katholizismus mit seiner Verschränkung zwischen geistlicher und weltlicher Macht in der österreichischen Zwischenkriegszeit eine Reaktion auf diesen Positivismus. Dass sich die Macht auf eine göttliche Legitimation stützte, war ja nicht neu. Kaiser (wie Karl der Große) hatten sich vom Papst krönen oder zumindest legitimieren lassen, die römisch-deutschen Kaiser des Mittelalters waren jeweils nach Rom gepilgert, in Salzburg waren die Fürsterzbischöfe das diktatorische geistliche und weltliche Maß aller Dinge, bis hin zum Despotismus. Bis 1806 waren die Habsburger die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Aber auch Napoleon war die Symbolik des Gottgewollten wichtig, indem er sich 1804 in Notre-Dame vom Papst salben ließ. Die Krone setzte er sich danach freilich selbst aufs Haupt. Natürlich galten die Habsburger auch in der politischen Realität des noch jungen 20. Jahrhunderts als im weitesten Sinne von Gott legitimiert, auch wenn schon JosephII. wesentliche Schritte zur wechselseitigen Emanzipierung gesetzt hatte. Zwar hatte die Aufklärung eine vorher nie dagewesene religiösen Toleranz implementiert, aber das Primat der katholischen Kirche wurde in der Welt der Habsburger nie in Frage gestellt. Vor 70 Bischöfen und Prälaten heiratete der junge Kaiser Franz Joseph 1854 seine erst 16-jährige Sisi.
Im Fin de Siècle war die offen zur Schau getragene Gottgläubigkeit in den Hintergrund getreten. Die katholische Kirche hatte an Einfluss verloren, Kunst, Kultur und Wissenschaft wollten sich darüber erheben. Die Literatur führte den Adel als überholt und überkommen vor, Arthur Schnitzler zeichnete in seinen Werken wiederholt das Bild eines dekadenten, weltfremden Standes. Auch das Militär musste sich zunehmend in Frage stellen lassen. Nicht hinsichtlich seiner Bedeutung als Träger der staatlichen Macht. Diese Funktion war angesichts des aufkeimenden Nationalismus absolut unbestritten. Aber die Rolle als moralische Elite geriet ins Wanken. Der aus dem Formalismus des Soldatischen entstandene Ehrbegriff, der seinen Gipfel nicht selten in Duellen im Prater erlebte, wurde zunehmend hinterfragt. Als Arthur Schnitzler, selbst Leutnant der Reserve, 1901 in seiner Novelle vom Leutnant Gustl6 den Ehrenkodex des Militärs scharf kritisierte, wurde ihm von einem Ehrengericht prompt der Offiziersrang als Oberarzt der Reserve aberkannt. Das öffentliche Nachdenken über Standesdünkel, Ansehen und Offiziersehre erzeugte ein Erdbeben. Mit einem Rechtsanwalt durfte sich ein Leutnant duellieren, aber nicht mit einem Bäckermeister. Da blieb nur der Selbstmord, der Gustl zum Glück durch den Schlaganfall des Bäckers erspart bleibt.
Der Arzt Arthur Schnitzler war überhaupt der Inbegriff der kritischen Literatur im Fin de Siècle. Messerscharf legte er die Abgründe der menschlichen Seele frei, nicht selten wird er als schreibendes Pendant von Sigmund Freud bezeichnet. Da war einerseits die militärische Elite, deren oberflächlichen Glanz er in Frage stellte und als oft vordergründigen Aufputz des Bürgertums decouvrierte, und andererseits die Moral der Zeit schlechthin. Fragwürdige Ehrenkodizes, sexuelle Tabus, vor allem aber die vordergründigen Lebensregeln, das gesellschaftliche Konstrukt aus ungeschriebenen Vorschriften, aus Verboten und angeblich Unabänderlichem legte er schonungslos frei, nicht selten anhand der Rolle der Frauen und des Antisemitismus.
Schnitzler war zu Anfang des 20. Jahrhunderts einer der meistgespielten Dramatiker im deutschen Sprachraum. Heute ist er es wieder. Aber mit Beginn des Ersten Weltkrieges hatte man sich von seinen Werken abgewandt. Manche vermuten, weil er nicht, wie viele andere österreichische Intellektuelle, in die allgemeine Kriegseuphorie miteinstimmte.
Die allgemeine Lebensfreude, der Fortschritt, die wirtschaftliche Entwicklung, all das ließ in jenen Jahren das Gefühl der Unbesiegbarkeit entstehen. Übermut könnte man es auch nennen. Die Kunst blühte. Die Romantik deckte manches zu. Gustav Mahler und Richard Strauss feierten Erfolg um Erfolg. Ihre Kompositionen strotzen vor Buntheit und Farbenreichtum. Weitschweifig und monumental sind sie ein Spiegel des Zeitgeists, auch Groteskes und Dekadentes kommen nicht zu kurz, wie man am Rosenkavalier nachvollziehen kann. Die Wiener Schule wurde zum Stilbegriff.
In der Malerei hat man sich von der romantischen Opulenz eines Hans Makart befreit. Dieser hatte einen starken Hang zum Theatralischen, zur Farbigkeit und Opulenz eines Rubens oder Tizian. Er war stilbildend für das Bürgertum der Gründerzeit gewesen. Der „Makartstil“ hatte ideal in die Ringstraßenzeit gepasst. Selten war ein Maler in der Gesellschaft so anerkannt wie Hans Makart, dem zu Ehren man in seiner Heimatstadt Salzburg noch zu Lebzeiten den früheren Hannibalplatz in Makartplatz umbenannte. Als sich die Bürger aber von dieser Gründerzeit emanzipierten und deren Errungenschaften als selbstverständlich betrachteten, kehrte man auch Makarts überladenem Pomp und Plüsch den Rücken. Kunsthistoriker sehen dennoch einen großen Einfluss Makarts auf die jungen Maler der Jahrhundertwende wie Gustav Klimt, der Makarts Arbeiten im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums in Wien weiterführte. Bedeutsamer ist aber wohl sein Einfluss durch die Allegorien, die in den Arbeiten der Jugendstilkünstler eine besondere Bedeutung bekommen sollten. Wenngleich das Ornamentale, das Symbolhafte, das Geordnete in Dominanz treten sollte.
Die politische Dimension des neuen Stils wird klarer durch den damals auch gelegentlich verwendeten Begriff des „Reformstils“. Bezeichnungen wie Art nouveau oder Modern Style verdeutlich noch heute die dahinterliegenden Absichten – sich abzusetzen vom Bisherigen, sich Neuem zuzuwenden. Für diese neue Zeit eine neue, eigene Formensprache zu entwickeln. Das erfolgte bisweilen mit einem ziemlichen Bruch. So erregte das schnörkellose Looshaus am Wiener Michaelerplatz, noch dazu so unmittelbar vor oder neben der Hofburg, das allerhöchste Missfallen des Kaisers. Was den Siegeszug des Jugendstils in ganz Europa nicht im mindesten bremsen konnte. Der in Wien so stark ausgeprägte Historismus wurde über Bord geworfen und der Jugendstil verstand sich als übergreifende Kunstrichtung. Architektur, Innenausstattung, Dekoration, Malerei, alles wurde von seiner Formensprache erfasst und stilistisch neu definiert. Auch Alltagsgegenstände konnten sich dieser neuen Ästhetik nicht mehr entziehen, vom Teeservice bis zum Schuhlöffel. Selbst schwere Maschinen und Industriehallen wurden mit den dekorativ geschwungenen Linien oder floralen Ornamenten verziert. Die heutige Nüchternheit im Maschinenbau hätte man sich damals nicht vorstellen können. Zu sehr war alles von der Freude am Neuen, am Besseren, am Moderneren getragen.
Rendezvousplatz der bürgerlichen Gesellschaft: die „Sirkecke“ Ecke Kärntner Straße/Kärntner Ring. Gemälde von Maximilian Lenz, um 1900.
In der Bildenden Kunst zeigt sich, wie sehr diese Zeit von schnellem Wandel und Umbrüchen gekennzeichnet war. Der Jugendstil war eigentlich nur eine kurze Periode, er galt schon vor dem Ersten Weltkrieg als überwunden. Gustav Klimts von Goldtönen durchwirkte Bilder, voll mit Ornamenten, sind heute der Inbegriff dieser Kunstrichtung. Der Sohn eines böhmischen Goldgraveurs widmete sich dem Symbolischen und Erhabenen. Aber er versuchte auch schon hinter den Vorhang der Oberflächlichkeit zu schauen, wie in seinem monumentalen Beethovenfries, der keineswegs nur einer plakativen Ästhetik zuzuordnen ist. Da thematisierte er das Feindliche, das Abgründige und bildet damit eine nahtlose Brücke zum Expressionismus mit seinen weiteren berühmten Vertretern Egon Schiele oder Oskar Kokoschka. Rasch begann sich dieser Expressionismus durchzusetzen. Und wieder sprach man von der „Wiener Moderne“. Wieder war es das Neue, das Über-Bord-Werfen des Bisherigen, das einigte, das zählte.
Gustav Klimt, Beethovenfries: Chor der Paradiesengel (Ausschnitt).
Die Damenmode war noch auf lange Kleider eingestellt, aber von Bequemlichkeit war keine Rede. Der sogenannte Humpelrock verurteilte die Frauen durch innenliegende Passen zu Trippelschritten. Im Gegensatz zu diesen Fußfesseln hatte der französische Modemacher Paul Poiret begonnen, den weiblichen Oberkörper aus dem Korsett zu holen. Aber das Wahlrecht sollten die Frauen in Österreich erst 1918 bekommen (damit aber immerhin noch vor den USA, Großbritannien, Frankreich oder der Schweiz).
Egon Schiele durchbrach mit seiner offenherzigen Malerei die sexuellen Tabus und kratzte, wie die Literatur, am traditionellen Frauenbild. Offen wurde ihm Pornografie vorgeworfen. Wenn man seine Blätter heute betrachtet, spürt man, wie fragil seine von ihm gezeichneten Wesen waren. So fragil, wie die Zeit wohl gewesen sein mag?
Damals spürte man das offenbar nicht.
Europa war im jungen neuen Jahrhundert in Ekstase. Atemlos hetzte man in den Jahren vor dem Großen Krieg von einem Neuen zum nächsten, von einem Rekord zum nächsten, von einer Erfindung zur nächsten. Wie in Ekstase stolperte man auch in die militärische Eskalation. Viele wollten den Krieg. Deutschland, Österreich-Ungarn, man erwartete ihn als einen kleinen Sidestep, als einen Befreiungsschlag gegenüber den Aufmüpfigen am Balkan. Verlieren? Undenkbar. Ein Weltenbrand? Unvorstellbar!
Wer nicht in der Welle der Kriegseuphorie mitschwang, war schon verdächtig. Mit dem damals modernen Dixieland-Jazz und seinem expressiven Vibrato fieberte man dem Waffengang entgegen, im Glauben, danach werde alles so weitergehen wie bisher, nur noch schneller, noch bunter, noch erfolgreicher. Aber bis dorthin sollte es noch sehr, sehr lange dauern und war zuerst die Überwindung einer weiteren Weltkatastrophe erforderlich.
Ovid, Metamorphosen, Fünfzehntes Buch, vermutlich 8n.Chr.
Frankreichs Premier Georges Clemenceau bei der Pariser Friedenskonferenz. Am 10. September 1919 unterzeichneten Österreich und die Alliierten den Vertrag von Saint-Germain.
Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent, Europa 1900–1914. München 2009
Gerhard Jelinek, Schöne Tage 1914. Wien 2013, S.34f.
Florian Illies, 1913, Der Sommer des Jahrhunderts. Frankfurt am Main 2012, S.11ff.
Arthur Schnitzler, Lieutenant Gustl (später: Leutnant Gustl), Erstausgabe Berlin 1901
2
Mit Anlauf in die Katastrophe
Die Monarchie ist tot, sie ist tot!
Joseph Roth, Radetzkymarsch
Es war schon bezeichnend, dass der 84-jährige österreichisch-ungarische Herrscher Kaiser Franz JosephI. den Feldzug gegen die Serben von seinem Urlaubsdomizil aus anordnete. Dafür musste er doch nicht im Juli in die heiße Hauptstadt fahren! In seinem Arbeitszimmer in der kaiserlichen Villa in Bad Ischl unterschrieb er die Kriegserklärung an Serbien. Mit einem Federkiel.
Auf dem Schreibtisch vor ihm standen eine Büste seiner 1898 ermordeten Frau Elisabeth aus weißem Marmor und ein elektrischer Zigarrenanzünder. Die unhandliche Apparatur aus Bronze war ein Geschenk des russischen Zaren und entsprach dem allerneuesten Stand der damaligen Technik: Sie war mit einem geflochtenen Kabel an das Stromnetz angeschlossen. Ob er gerade genüsslich gepafft hat, ist nicht überliefert. Aber viele Zigarren hat der greise Monarch nicht entflammt, bis eine Woche später schon die halbe Welt in Vollbrand stand.
Rund zehn Millionen Soldaten verloren auf zahlreichen Schlachtfeldern ihr Leben. So genau weiß man das nicht. Noch weniger genau kennt man die zivilen Opfer. Insgesamt etwa 15 bis 21 Millionen.
Immer entwickeln Kriege eine unvorhergesehene Dynamik der Gewalt. Aber das Tempo, in dem sich diesmal die ethischen, technischen und wirtschaftlichen Normen der Vorkriegswelt auflösten, überraschte alle. Selbst die für gewöhnlich feinsinnigen und friedliebenden Künstler und Literaten hatten nicht davor gewarnt. Nicht Hermann Bahr, nicht Carl Zuckmayer, nicht Robert Musil. Am Tag der Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo hatte Arthur Schnitzler nach einer Landpartie auf die Sophienalpe lapidar in sein Tagebuch geschrieben, es sei „ein schöner Sommertag“1 gewesen. In dem Waffengang hatte man eine Befreiung aus bürgerlicher Enge erwartet, einen feierlichen Volkskrieg, heroisch und kurz.
Von einer „notwendigen, reinigenden Katastrophe“ sprach immerhin Thomas Mann. „Es muss einen für immer stolz und glücklich machen, diesem Volk anzugehören. Ein solches Volk kann auch nicht besiegt werden“, meinte etwa Hugo von Hofmannsthal. Welch ein Irrtum.
In Joseph Roths Roman Radetzkymarsch schreit der junge Leutnant Carl Joseph Trotta schon bei der Nachricht vom Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand: „Die Monarchie ist tot, sie ist tot!“2 Er sollte Recht behalten. Mehr noch. Nicht nur die Staatsform war tot, mit ihr ein ganzes Reich. Mehrere Reiche. Und ganz Europa lag am Boden. Einige Länder, die Sieger, erholten sich etwas schneller, Österreich sollte Jahrzehnte brauchen. Letztlich verschlang der Große Krieg vier große Reiche – Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich, das russische Zarenreich und das Osmanische Vielvölkerreich. Er schuf damit eine neue Wirklichkeit.
Die Unmoral der Vernichtung hat dabei ungeahnte neue Dimensionen erreicht. Schon oft davor hatte man sich mit religiöser Verklärung in einen Krieg gestürzt. Ebenso hatte man sich schon oft davor in Größenwahn und Männlichkeitskult für unbesiegbar gehalten und hat ein Krieg ein Zeitalter verändert. Aber erstmals hat ein Krieg so tief das Moralgefühl der Menschheit erschüttert. Mit dem erstmaligen Einsatz von Massenvernichtungswaffen.
Auch da ist man hineingeschlittert. Der aus Breslau stammende deutsche Chemiker Fritz Haber hat den Kunstdünger entwickelt und dafür 1918 den Nobelpreis erhalten. Aber seine Forschungen haben auch den Einsatz von Giftgas ermöglicht. Im Siegeswillen und in höchster Bedrängnis hat es auch die österreichisch-ungarische Armee eingesetzt. Kriegsethik hin oder her, und zudem vergeblich, wie man weiß. Aber die Unschuld gegenüber Massenvernichtungswaffen war für die Menschheit ein für alle Mal verloren. Wie sehr das auch zu inneren Konflikten geführt hat, zeigte sich am Selbstmord von Habers Ehefrau Klara Immerwahr, die sich zerrissen fühlte zwischen ihrem humanitären Gewissen und der Solidarität zu ihrem Mann, mit dessen Dienstwaffe sie sich schließlich im Sommer 1915 erschoss.
Noch ahnte man nicht, dass dieser Tabubruch in der Kriegsführung 30 Jahre später noch übertroffen werden sollte. Mit zwei Atombomben.
Angesichts der Katastrophen des Zweiten Weltkriegs war man häufig geneigt, und ist es bis heute, jene des Ersten Krieges entweder zu verdrängen oder zu vergessen. Die unvorhergesehene Gewaltspirale war keine Strategie der Nazis gewesen. Schon im Ersten Weltkrieg wurden zivile Wohngebiete bombardiert, Linienschiffe versenkt, Hungerblockaden verhängt und Zivilisten ermordet. Zu Tausenden, in Galizien, in Ostpreußen, in Serbien oder Belgien.
Der Auftakt zum Großen Krieg, der „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts: die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.
Die Gedenkfeiern im Jahr 2014 zum 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs zeigten, dass man sich an diesen Ersten Weltkrieg in Europa durchaus unterschiedlich erinnert. Dass Geschichte eine jeweils unterschiedliche Wahrnehmung aufweist, ist ja nicht neu. Aber dass die Intensität des Erinnerns in keinem Verhältnis steht zur Radikalität der Veränderungen, die dieser Krieg nach sich gezogen hat, das war schon erstaunlich. In Österreich passierte zu diesem Anlass eher wenig, im Vergleich jedenfalls zu Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Dort ist der Einschnitt offenbar bis heute als besonders gravierend im kollektiven Gedächtnis verhaftet geblieben, wiewohl er in Österreich, einem Verliererland, ja wohl de facto wesentlich schwerwiegender war als in den Siegerländern. Fast könnte man glauben, Österreich hätte sich leichtfüßig von der Geschichte der großen Monarchie getrennt. Vielleicht aber sitzt der Schock doch nur tiefer, als man vermuten würde.
Schützengraben im Karst: österreichische Stellung am Isonzo. Foto: k.u.k. Kriegspressequartier.
Nach Kriegsende ließ das durch die Erlebnisse der Gewalt und der Niederlage in den Grundfesten erschütterte Moralgefühl die Menschen allerorten zweifeln, ob es überhaupt noch möglich sei, eine neue Ordnung aufzubauen, ohne Traumata der Vergangenheit. Das machte es zusätzlich – nicht nur in Österreich – so schwer, eine neue Normalität des europäischen Zusammenlebens zu organisieren.
Es ist, wie man weiß, auch nicht gleich gelungen. Da die Konstruktion einer europäischen Nachkriegsordnung vom Gedanken einer Bestrafung und Demütigung der Verlierer geprägt war, trug das schon den Keim in sich, abermals mit Gewalt einzugreifen, zu rächen und zurückzuholen, was dieser Erste Weltkrieg an Gebietsverlusten gebracht hatte.
Bertha von Suttner, die wenige Tage vor dem Attentat in Sarajevo starb, soll einmal den Vergleich angestellt haben, dass es keinem Menschen einfallen würde, Tintenflecken mit Tinte und Ölflecken mit Öl wegzuwaschen. Nur das Blut, das sollte immer wieder unsinnigerweise mit Blut ausgewaschen werden.
Aber erst musste man dafür wieder Kräfte sammeln.
Wenn man sich heute in Europa und der gesamten westlichen Welt sicher fühlt, dass die enge wirtschaftliche Verflechtung der Staaten, mit wechselseitigen finanziellen Abhängigkeiten ein Garant gegen einen Krieg sei, dann muss man an den Sommer 1914 erinnern. Auch damals hielt man es wegen der schon engen Handelsbeziehungen für absurd, dass man sich postwendend die Schädel einschlagen könnte. Wirtschaftliche Verflechtungen sind aber kein Schutz vor Krisen. Das musste die EU in diesem Jahrhundert angesichts einer Finanz- und Eurokrise und einer Flüchtlingskrise schon dramatisch erleben. Sehr schnell ist es mit einer Gemeinsamkeit und einer Solidarität dahin, wenn es um Eigeninteressen geht, wie bereits Marx und Engels wussten: „Die ‚Idee‘ blamierte sich immer, soweit sie von dem ‚Interesse‘ unterschieden war.“3 Und jede Krise, die überstanden ist, erzeugt das Gefühl, auch die nächste meistern zu können.
So war es auch 1914. Deutschland hatte sich seit 1870 zu einem selbstbewussten Nationalstaat entwickelt. Auch mit Albanien war ein neuer Nationalstaat entstanden. Am Balkan hatten zwei Kriege die regionalen Machtverhältnisse verschoben, Russland hat sich am Schwarzen Meer mit der Türkei in ein Wettrüsten eingelassen, Deutschland und Großbritannien standen einander zunehmend misstrauisch gegenüber.4 Vieles war im Umbruch, aber man war sich sicher, diese Umbrüche stemmen zu können. Die wesentlichen Mächte waren hochgerüstet bis zur Halskrause und hatten auch jeweils eigene Motive für einen Waffengang. Einen großen Krieg erwartete niemand. Auch nicht nach dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 2014. Und auch nicht mit der Kriegserklärung von Kaiser Franz Joseph in Bad Ischl, genau einen Monat später. Der Krieg sollte bloß ein reinigendes Gewitter sein. Umso dramatischer war das, was dann daraus erwuchs. Die Staaten in Europa waren allesamt, jeweils mit eigenen Motiven und einem Rucksack unterschiedlicher historischer Erfahrungen, wie „Schlafwandler“ in diese Katastrophe getaumelt, schreibt Christopher Clark in seinem mittlerweile als Standardwerk gepriesenen gleichnamigen Buch.5
Feldbahn mit Verpflegung für die Isonzofront. Foto: k.u.k. Kriegspressequartier.
Zwei Kaiser „in Treue fest“ verbunden: WilhelmII. und Franz JosephI. Deutsche Postkarte, vor 1914.
Man kann allerdings die Vorgänge und das Denken von 1914 nicht verstehen, wenn man sich nicht mit der Entwicklung davor auseinandersetzt. Schon mit der Französischen Revolution hatte sich gezeigt, dass Untertanen nicht alles schlucken und Widerspruch anmelden. Dieses Aufbegehren gegen den monarchistischen Absolutismus und die Privilegien des Adels in Frankreich hatte Folgen für ganz Europa. Viele Rechtsnormen, etwa der uneingeschränkte Anspruch auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz, gehen auf diese Revolution zurück (wenngleich die Fundamente der europäischen Rechtstheorie für freie Bürger schon von den Römern gelegt worden sind).
Natürlich war zwischen dem Anspruch der Revolutionäre von Paris und dessen wirklich demokratischer Implementierung ein weiter Weg, mit abstrusen Auswüchsen. Das ursprüngliche Ziel einer Mitbestimmung des Bürgertums durch Errichtung einer konstitutionellen Monarchie wurde bald eingeholt von radikalen, terroristischen Zügen, mit der Guillotine als einprägsamstem Werkzeug. Die Angst vor einer Gegenrevolution hatte sehr radikaldemokratische Ansichten erzeugt. Und dass fundamentale Änderungen der politischen Strukturen, wie der Wandel von der Monarchie zur Republik, selbst nicht in zehn blutigen Revolutionsjahren alle Köpfe und Gedanken durchdringen konnten, zeigt die Tatsache, dass Napoleon Bonaparte, ein Emporkömmling durch die Französische Revolution in der Armee, sich später paradoxerweise selbst zum Kaiser krönen ließ, mit durchaus diktatorischen Zügen. Jedenfalls ist der Wandel von einer absolutistischen Monarchie zu einer Republik heutigen Zuschnitts beileibe nicht in einem Zug gelungen. Auch in Österreich, ein Jahrhundert später, war der erste Anlauf ja kein durchschlagender Erfolg.
Das „reinigende Gewitter“ verwandelte sich in einen langen Stellungskrieg: Feldtelefon-Station am Rombon. Foto: k.u.k. Kriegspressequartier.
Frankreich war während der Revolution von missionarischem Eifer getragen, den Gedanken der Freiheit der Bürger auch zu den anderen Völkern Europas zu tragen. Die Kriegserklärung an Österreich von 1792 führte zum Ersten Koalitionskrieg von Österreich und Preußen gegen Frankreich. Viele Schlachten sollten noch kommen. Eine Folge davon war, dass die Achse zwischen Österreich und Preußen immer enger wurde. Schon in dieser Zeit liegen die Wurzeln dafür, dass sich das nach dem Ende seiner Monarchie so kleine Österreich stark an Deutschland anlehnen wollte (siehe auch Kap. 7, „Zur Kleinheit gezwungen“, S.82).
Nach den blutigen Turbulenzen der Napoleonischen Kriege wurde auf dem Wiener Kongress eine Neuordnung Europas besiegelt, die dem Kontinent ein sogenanntes Friedensjahrhundert bescherte. Napoleon war verbannt auf Elba und in Europa herrschte Frieden, wenn auch ein sehr fragiler. Doch selbst das ist nur die halbe Wahrheit. Denn außerhalb Europas, in Afrika, Asien oder Lateinamerika, war von diesem Frieden nichts zu spüren. In China tobte im 19. Jahrhundert ein fürchterlicher Bürgerkrieg mit mindestens zwei Millionen Toten, der Amerikanische Bürgerkrieg hinterließ mehr als 200.000 Tote und wirkt in der amerikanischen Gesellschaft bis heute nach. Aber für Europa gilt der Wiener Kongress als Auftakt für ein Friedensjahrhundert – dessen Ruhe sich freilich als trügerisch herausstellen sollte.
Aber immerhin war das Jahr 1815 die Geburtsstunde eines politischen, zentral geordneten Europa, wenngleich das Abschlussdokument des Wiener Kongresses nur von wenigen Ländern offen gestützt wurde. Repräsentanten von 30 Staaten waren in Wien dabei gewesen, aber nur acht davon haben das Dokument unterzeichnet, nämlich jene Mächte, die die neue Ordnung garantierten. Das heißt also, dass nur eine kleine Elite Europa neu geregelt hat. Was prompt zu einer Reihe von Revolutionen führte.
Diese durchzogen 1848/49 alle Länder des Deutschen Bundes. Dieser bis 1866 bestehende Staatenbund war als Dach für zahlreiche Länder Europas konstruiert worden und umfasste allen voran die großen Rivalen Österreich und Preußen sowie viele kleinere Länder wie die Königreiche Dänemark und die Niederlande, aber auch die Großherzogtümer Baden und Hessen sowie die Königreiche Württemberg, Sachsen und nicht zuletzt Bayern. Österreich und Preußen brachten dann auch gemeinsam mit heftigem, ja sogar militärisch geführtem Vorgehen die Anliegen der Revolutionswelle Mitte des 19. Jahrhunderts, von einer Aufhebung der Zensur bis zur Schaffung eines demokratischen, alle deutschen Gebiete umfassenden Nationalstaates, zu Fall.
Im Kaiserreich Österreich brachte das Revolutionsjahr 1848 zahlreiche zentrifugale Kräfte zutage. Die Slowaken lehnten sich in offenen Feldzügen gegen die Magyaren auf, es brodelte in Oberitalien, in Prag wurde der Pfingstaufstand gegen die österreichische Herrschaft gewaltsam niedergeschlagen, nachdem Autonomieforderungen aus Prag von der Wiener Zentralregierung abgeschmettert worden waren. Und Ungarn hat sich 1849 gar von den Habsburgern für unabhängig erklärt und die Republik ausgerufen. Diese Unabhängigkeitserklärung wurde aber von den anderen Staaten Europas nicht anerkannt, zu sehr fürchteten die Herrschenden die Vorbildwirkung für einen Zerfall auch in ihren Reichen. Letztlich wurde die ungarische Revolution von der kaiserlichen Armee mit Unterstützung russischer Truppen niedergeschlagen.
Aber der Widerstand der Ungarn gegen einen Einheitsstaat unter Wiener Führung war damit nicht gebrochen. 1867, knapp 20 Jahre später, lenkte das Kaiserhaus ein und Ungarn erhielt eine weitgehende innenpolitische Autonomie mit eigenem Reichstag. Das Kaiserreich Österreich wurde zur österreich-ungarischen Doppelmonarchie, Kaiser Franz Joseph wurde auch zum König von Ungarn gekrönt. „Es entstand ein einzigartiges Staatswesen, wie ein Ei mit zwei Dottern […] innerhalb der dünnen Hülle der Habsburgischen Doppelmonarchie.“6 Der Vielvölkerstaat unter Habsburgischer Führung war noch einmal gerettet. Bis 1918.
Der Wiener Kongress hat letztlich nur in Zentraleuropa mit einem Interessenausgleich die Kriegsgefahren gedämpft. Der große Blick war im Verhandlungssaal am Wiener Ballhausplatz nicht zugegen, die außereuropäische Dimension hat weitestgehend gefehlt (abgesehen von Beschlüssen wie der Abschaffung der Sklaverei), die Ränder Europas waren ausgeblendet. In den Kolonien gab es zahlreiche Kolonialkriege, die Briten hatten alles andere als ein Ruhekissen, und der belgische König konnte im Kongo später ein unglaublich blutiges Terrorregime führen. Beileibe kein Ruhmesblatt des 19. Jahrhunderts. Und das Osmanische Reich blieb unbeachtet, was sich durch die spätere Entwicklung am Balkan oder in Griechenland rächte.
Trotz der Fragilität und Unvollkommenheit der Beschlüsse von 1815 wird der Wiener Kongress 2015 bisweilen sogar als Vorläufer der Ideen für eine Europäische Union bezeichnet. Das mag kühn sein, sollte aber auch die Instabilität solch großer Gefüge aufzeigen – und die Tatsache, dass das, was einmal ordnungspolitisch angestrebt wird, ein andermal auch wieder verworfen wird. So hat Napoleon zunächst auch außerhalb Frankreichs den Nationalstaatsgedanken verbreitet, dann aber wieder verworfen, weil das die Durchsetzung einer napoleonischen Ordnung für ganz Europa behinderte. Aber insbesondere Spanien, Deutschland und Russland konnten seinen Vorstellungen von einer Gestaltung Mitteleuropas nichts abgewinnen. Die Konflikte waren also nicht beigelegt, nur ruhiggestellt.
Der Wiener Kongress setzte auf ein Miteinander der Staaten, allerdings unter Einräumung von Dominanzen durch die großen Player der damaligen Zeit. Die sollten ihre Einflusssphären behalten können. Die EU hat dagegen zumindest formal mit einem Modell der Gleichberechtigung aller Mitglieder, unabhängig von ihrer Größe, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Die Idee war, alle in den politischen, sozialen und ökonomischen Interessenausgleich einzubinden. Der Erfolg war nachhaltiger. Dennoch haben die Erweiterungen der EU zu ihrer jetzigen Größe letztlich mehr Schwerfälligkeit erzeugt und ihre Handlungsfähigkeit minimiert, wie sich später in ihrer Ohnmacht gegenüber großen Wirtschaftskrisen (2008) oder Migrationsströmen (2015) zeigte.
Die Gesteinbohranlage E8 104 im Probebetrieb, Isonzofront, 1916. Foto: k.u.k. Kriegspressequartier.
Der Wiener Kongress hatte speziell auf Österreich noch eine besondere Auswirkung. Er hatte das Selbstbewusstsein der Monarchie gestärkt und die Stadt Wien durch die lange Anwesenheit internationaler Delegationen urbanisiert. Diese Internationalisierung gab der Stadt einen Schub, der später zur schon beschriebenen Blüte von Kunst, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft führte. Und zu einem blinden Selbstvertrauen, mit dem die Fragilität, die sich zwischenzeitlich in der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 gezeigt hatte, schnell wieder vergessen und verdrängt wurde.
Danach war der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn nicht mehr in der Lage, die rasant wechselnden Strömungen in sich abzufangen. Es ist zu einfach, den Zerfall des Habsburgerreiches nur einer vergleichsweise leichtfertig unterzeichneten Kriegserklärung an Serbien anzulasten oder der blinden Kriegseuphorie von 1914 oder den Interessen der Wirtschaft, mit einem kontrollierten Waffengang Freiraum für neue Entwicklungen zu schaffen.
Die Nachkriegsordnung durch den Friedensvertrag von Saint-Germain war noch ganz im Geiste des 19. Jahrhunderts entstanden. Mit der Festschreibung, dass der Sieger der Stärkere und der Besiegte der Schwächere bleiben müsse. Es war die niedergeschriebene Bankrotterklärung gegenüber einer wirklichen Friedensvision. Sie war daher auch nur eine Zwischenkriegsordnung.
Gerhard Jelinek, Schöne Tage 1914. A. a. O., S.221
Joseph Roth, Radetzkymarsch. Berlin 1932 (München 1981, S.165)
Karl Marx/Friedrich Engels, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. In: Marx-Engels-Werke, Bd.2, S.85, Berlin 1956ff.
Vgl. Christopher Clark, Festrede Eröffnung der Salzburger Festspiele 2014. Salzburg 2014
Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013
Christopher Clark, Die Schlafwandler. A. a. O., S.100
3
Der Abschied von der Monarchie
Seit Menschengedenken ging so dilettantisch keine Schlacht,
keine Macht, keine Ehre verloren.
Karl Kraus1
Kaiser Franz Joseph hatte das Ende schon früh geahnt. Zu Beginn des Großen Krieges äußerte er den Gedanken: „Wenn die Monarchie schon zugrunde gehen muss, soll sie wenigstens anständig zugrunde gehen.“2 Er selbst musste diesen Anstand nicht mehr aufbringen. Das war Kaiser Karl vorbehalten. Dieser versuchte, das Heft noch in der Hand zu halten, als der Krieg schon verloren war.
Am 16. Oktober 1918 erließ er das kaiserliche Manifest, mit dem er die Donaumonarchie noch retten wollte. „Österreich als Bundesstaat“, titelte am Tag darauf die Sonderausgabe der Wiener Zeitung.3An Meine getreuen österreichischen Völker!, richtete KarlI. seinen Wunsch … Österreich soll … zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiet sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet. An die Völker, auf deren Selbstbestimmung das neue Reich sich gründen wird, ergeht Mein Ruf, an dem großen Werke durch Nationalräte mitzuwirken, die, gebildet aus den Reichstagsabgeordneten jeder Nation, die Interessen der Völker zueinander sowie im Verkehr mit Meiner Regierung zur Geltung bringen sollen …
Es sollte nicht mehr seine Regierung sein, und von Völkern sollte schon gar keine Rede mehr sein. Jedenfalls nicht mehr lange:
– Am 21. Oktober traten die deutschen Abgeordneten zu einer eigenen Provisorischen Nationalversammlung zusammen.
– Sechs Tage später berief Kaiser Karl den Völkerrechtler und Pazifisten Heinrich Lammasch zum Ministerpräsidenten seines letzten Kabinetts.
– Am Tag darauf, am 28. Oktober, lehnte die Entente einen vom neuen Außenminister Graf Andrássy (d. J.) erbetenen Sonderfrieden ab.
– Am 3. November musste die österreichisch-ungarische Delegation in der Villa Giusti in Padua den Waffenstillstand mit Italien unterzeichnen, nachdem die Alliierten in der „Schlacht von Vittorio-Veneto“ die Frontlinie an der Piave überrannt hatten. Die Waffenruhe trat am 4. November 1918, 15 Uhr, in Kraft. Bereits vor der Unterzeichnung des Waffenstillstands hatte die österreichisch-ungarische Armeeführung die Feuereinstellung veranlasst, ein Umstand, der zur Folge hatte, dass noch zahlreiche Soldaten von den alliierten Truppen gefangen genommen wurden.
– Am 11. November verzichtete Kaiser Karl für Österreich auf die Ausübung der Regierungsgeschäfte, zugleich trat sein machtloses Kabinett Lammasch zurück. Noch am Abend des 11. November übersiedelte die kaiserliche Familie von Schönbrunn nach Schloss Eckartsau im Marchfeld.
– 12. November: Ausrufung der „Republik Deutschösterreich“
– Am 13. November erfolgte auch der Regierungsverzicht für Ungarn, in Belgrad schlossen die Magyaren einen Waffenstillstand mit der Entente. Damit war die Großmacht Österreich-Ungarn zu Ende.
– Am 24. März 1919 verließ Kaiser Karl mit seiner Familie Österreich und reiste in die Schweiz.
– Am 3. April 1919 wurde das Habsburgergesetz4 beschlossen, das den Landesverweis des „ehemaligen Trägers der Krone“ und die Beschlagnahmung des habsburgischen Vermögens festschrieb.
– Nach zwei gescheiterten Restaurationsversuchen in Ungarn 1921 wurden Karl und seine Frau Zita nach kurzer Internierung in der Abtei Tihany am Balaton von der Entente auf die portugiesische Insel Madeira verbannt.
Und schon war das Habsburgerreich Geschichte. Schluss, aus, vorbei. Karl verstarb am 1. April 1922 an einer Lungenentzündung, die er sich in seiner feuchten Villa in Monte bei Funchal zugezogen hatte, im Alter von nur 34 Jahren. 2004 wurde er für seine Friedensbemühungen von Papst Johannes PaulII. seliggesprochen. Sein Herz, das bei der Einbalsamierung des Leichnams 1922 entnommen wurde, wird in der Loretokapelle im Schweizer Kloster Muri aufbewahrt.
Noch bevor der Kaiser gänzlich resigniert und das Land verlassen hatte, wurde also die Republik ausgerufen. „Wenn der alte Kaiser noch gelebt hätte, hätten wir uns das nicht getraut“5, soll Karl Renner später einmal rückblickend erzählt haben. Der „Alte“ war halt doch eine absolute Respektsperson gewesen. Den jungen Kaiser Karl konnte man jetzt verjagen.
Den Österreichern war der Abschied von der Monarchie nicht so schwer gefallen wie dem Kaiser selbst – Karl betonte immer wieder, dass er so wie der deutsche Kaiser WilhelmII. nie wirklich abgedankt hätte.6 Auch Wilhelm wollte zunächst nur als Kaiser gehen und nicht auch als preußischer König.7 Beide hatten also ihre Pläne ohne die erstarkten republikanischen Bestrebungen gemacht. In Deutschland hat die kaisertreue Schicht das kampflose Aufgeben Wilhelms lange nicht verkraftet, als „Fahnenflucht“ und „Kaiserflucht“ wurde seine Übersiedlung ins niederländische Schloss Amerongen bezeichnet, aber der Legitimismus hatte, anders als etwa in Frankreich, auch in Deutschland keinen langen Atem. Sehr bald hat man sich dort einer neuen Führerfigur zugewandt.8
Das Osmanische Reich hatte sich vor dem Krieg Deutschland als Vorbild und als Bündnispartner genommen. Es galt als so schwach, dass Briten und Franzosen schon 1916 das Land in einem Geheimpakt unter sich aufgeteilt hatten, mit Grenzen, die bis heute den Nahen Osten und seine Konflikte bestimmen. Dass die heutige Türkei im aktuellen Syrienkonflikt als Regionalmacht stark mitmischt, geht auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Sultan MehmedV. starb noch vor Kriegsende, in der Konferenz von Sanremo 1920 wurde das Riesenreich endgültig filetiert. Die kurze Freundschaft der Osmanen mit Deutschland und auch mit Österreich war wieder vorbei.
Und der russische Zar NikolausII. war mit seiner Familie schon am 17. Juli 1918 in Jekaterinburg von den Bolschewiki ermordet worden. Der Hass der Kommunisten unter Lenin und die Angst vor einer Restauration waren so groß, dass in den Monaten darauf viele weitere Angehörige und Vertraute der Romanows umgebracht wurden.
Ein solches Schicksal sollte der österreichischen Herrscherfamilie erspart bleiben, weshalb der britische König GeorgV. höchstselbst seine schützende (und militärische) Hand über Karl und Zita hielt. Aber so radikal antimonarchistisch war das Klima hierzulande ohnedies bei weitem nicht, weder in Deutschland noch in Österreich.
Das Volk war längst auf Republikkurs. Die großen Herrscherhäuser waren gescheitert, es musste etwas anderes her.
Von Hass auf das Kaiserhaus oder auf den Adel generell, so wie bei den Bolschewiki in Russland, kann man in Österreich nicht sprechen, aber von Unerbittlichkeit. So war die Ausweisung durch die Nationalversammlung von Deutschösterreich schon sehr klar und hart formuliert. Nachdem der abgetretene Kaiser Karl vor seiner Ausreise in die Schweiz noch einmal gegen seine Absetzung protestiert und seine Amtsverzichtserklärung widerrufen hatte, wurde das Parlament unmissverständlich: „Im Interesse der Sicherheit der Republik werden der ehemalige Träger der Krone und die sonstigen Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen, diese, soweit sie nicht auf ihre Mitgliedschaft zu diesem Hause und auf alle aus ihr gefolgerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich verzichtet und sich als getreue Staatsbürger der Republik bekannt haben, des Landes verwiesen.“ Mit radikaler Konsequenz wurde zugleich auch der Adel im Lande aufgehoben.9 Alle Adelszeichen, alle adeligen Würdentitel sowie Standesbezeichnungen wie Fürst, Graf oder Freiherr waren ab sofort ebenso verboten wie das Führen entsprechender Familienwappen oder selbst Anreden wie „Durchlaucht“ oder „Hoheit“. Verboten wurden auch alle weltlichen Ritter- und Damenorden. Diese Strenge bis ins kleinste Detail hielt man im titelverliebten Österreich offenbar für notwendig, um Schlupflöcher zu stopfen. Leicht kurios mutet an, dass etwa die damals auch verbotene Anrede „Exzellenz“ im nichtadeligen Umfeld bis heute weiterbesteht, z.B. im kirchlichen Bereich (für einen Bischof) oder, schon weniger gebräuchlich, im diplomatischen Verkehr (für einen Botschafter). Auch in Deutschland wurden 1919 die Privilegien des Adels abgeschafft, nicht aber die Adelsprädikate. Im Gegensatz zu Österreich gelten in Deutschland die alten Titel und Anreden als Bestandteil des Namens.
Letzter Glanz des Hauses Habsburg: die Hochzeit von Erzherzog Karl mit Prinzessin Zita von Bourbon-Parma am 21. Oktober 1911 in Schloss Schwarzau am Steinfeld.
Dass man in Österreich auch in den folgenden Jahrzehnten im Adel keine potentielle Gefahr für eine Restauration sah, zeigt die Tatsache, dass der Strafsatz für entsprechende Vergehen seit damals unverändert ist. „Übertretungen werden von den politischen Behörden mit Geld bis zu 20.000 K oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft,“10 hieß es im Gesetz. Die 20.000 Kronen wurden aber bis heute nicht wertangepasst, was somit heute einer Höhe von rund 14 Cent entspricht. 2015 veranlasste das die Grünen im Parlament, die Regierung zu einer Novellierung aufzufordern.11 Ein paar Wortmeldungen aus anderen Parteien gab es kurz dazu, dann auch aus Adelskreisen. „Die Republik Österreich sollte doch mehr Selbstvertrauen haben“, beschied der in der Schweiz lebende Erbprinz Johannes Schwarzenberg, und Ulrich Habsburg, ehemaliger Grün-Politiker in Kärnten, er wäre heute Erzherzog, sagte: „Europa hat eine gemeinsame Geschichte, und uns hat man die Titel genommen. Jetzt sollen die Strafen noch erhöht werden. Hat die Politik nichts Wichtigeres zu tun?“12
Noch mit den sudetendeutschen Bezirken: das Staatsgebiet Deutschösterreichs nach den „Vollzugsanweisungen“ des deutschösterreichischen Staatsrates vom 3. Januar 1919.
Sie hat. Die kleine Aufregung hat sich bald wieder gelegt.
Konsequenter war die Republik schon, wenn es darum ging, die materiellen Güter der Hocharistokratie zu beschlagnahmen – und gegenüber Rückgabeforderungen zu verteidigen. Das private Vermögen des Kaiserhauses blieb zunächst weitgehend unangetastet in den Händen der Familie Habsburg. Ausgenommen davon waren aber schon damals zum Beispiel die Hofbibliothek (die heutige Nationalbibliothek) und die Albertina.
Der junge Staat erklärte sich auch sofort zum Eigentümer des „gebundenen Vermögens“ und der ganz großen Brocken im sogenannten „hofärarischen Vermögen“, darunter waren die Hofburg in Wien, ebenso jene in Innsbruck, das Schloss Schönbrunn, das Belvedere, die Salzburger Residenz und ein Großteil der Kronjuwelen. Aber auch die Prager Burg oder Schloss Miramare bei Triest. Diese nicht in Österreich befindlichen Güter gingen freilich an die jeweiligen Nachfolgestaaten.
Zum gebundenen Vermögen zählten der Familienversorgungsfonds und alle Güter, die der Familie als Herrscherhaus zur Verfügung standen. Dazu gehörten neben diversen Ländereien die Kaiservilla in Bad Ischl, Jagdschlösser wie jenes am Offensee oder die Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. Aus diesem Vermögensteil, der auf den geschäftstüchtigen Kaiser FranzI. Stephan (1708–1765) zurückgeht, wurden die Apanagen und Unterstützungsgelder für bedürftige Familienangehörige bezahlt. Durch dessen Konfiszierung und die Tatsache, dass etwa die verwitwete Exkaiserin Zita von Österreich auch keine Rente bekam, wuchsen deren acht Kinder in Madeira vergleichsweise verarmt auf. „Wir Kinder sind sehr oft barfuß gelaufen, weil wir zu wenig Schuhe besaßen“, erzählt Zitas ältester Sohn Otto über seine beschwerlichen Jugendjahre im deutschen Magazin Der Spiegel 1986, das die Enteignung der Habsburger überhaupt als „Raub des Jahrhunderts“ bezeichnete.13
Im „Ständestaat“ wurden die Aufhebung aller Herrscherrechte und die Landesverweisung der Familie Habsburg außer Kraft gesetzt, der älteste Sohn von Kaiser Karl, Otto Habsburg, forderte von Kurt Schuschnigg, ihm die Kanzlerschaft zu übertragen. „Lieber Herr von Schuschnigg!“, schrieb er in seinem Brief vom 17. Februar 1938, „Sollten Sie einem Druck von deutscher und betont nationaler Seite nicht mehr widerstehen zu können glauben, bitte ich Sie, mir, wie immer die Lage auch sei, das Amt des Kanzlers zu übergeben.“14 Das war zwar naiv, aber insofern bemerkenswert, als der 26-Jährige