
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Juliska lebt im Wendejahr 1989 in Dresden. Eigentlich wäre alles bestens, würden ihr nicht Paps und vor allem Oma aus Westberlin verbieten, Pionier zu werden. Dabei wünscht sie sich Pionier zu sein mehr als alles andere. Also verbündet sie sich mit der Pionierleiterin, Genossin Graaf, die auch in ihrem Haus wohnt und von allen Gräfin genannt wird. Sie wird der Gräfin helfen, dass die Straße nach ihrem Vater umbenannt wird, und die Gräfin hilft ihr, Pionier zu werden. Bis Juliska merkt, dass die Gräfin einen ganz eigenen Plan verfolgt, ist sie schon mittendrin in einem Strudel von Lügen und perfiden Machenschaften. Ob ihr die seltsame Nachbarin Frau Pfefferstein, die mehr weiß und mitbekommt, als es den Anschein hat, helfen kann? Als Juliska und ihre Freundin im Keller der Gräfin merkwürdige Akten über Frau Pfefferstein finden, beginnt eine wilde Jagd, denn was darin steht, darf niemand wissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marianne Kopp hat vier erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Sie ist in der DDR geboren und aufgewachsen. Sie lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Ulm.
Die hier beschriebenen Personen sind alle fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Mittwoch, 8. Februar 1989
Donnerstag, 9. Februar 1989
Freitag, 10. Februar 1989
Montag, 13. Februar 1989
Dienstag, 14. Februar 1989
Mittwoch, 15. Februar 1989
Donnerstag, 16. Februar 1989
Freitag, 17. Februar 1989
Donnerstag, 23. Februar 1989
Montag, 1. Mai 1989
Dienstag, 2. Mai 1989
Mittwoch, 3. Mai 1989
Donnerstag, 4. Mai 1989
Dienstag, 9. Mai 1989
Donnerstag, 11. Mai 1989
Dienstag, 30. Mai 1989
Samstag, 8. Juli 1989
Montag, 10. Juli 1989
Mittwoch, 12. Juli 1989
Freitag, 14. Juli 1989
Montag, 17. Juli 1989
Dienstag, 18. Juli 1989
Montag, 24. Juli 1989
Teil 2
Mittwoch, 26. Juli 1989
Donnerstag, 27. Juli 1989
Freitag, 28. Juli, 1989
Montag, 31. Juli 1989
Montag, 7. August 1989
Dienstag, 8. August 1989
Dienstag, 15. August 1989
Donnerstag, 17. August 1989
Sonntag, 20. August 1989
Montag, 21. August 1989
Freitag, 1. September 1989
Dienstag, 5. September 1989
Mittwoch, 6. September 1989
Sonntag, 10. September 1989
Donnerstag, 14. September 1989
Mittwoch, 20. September 1989
Montag, 25. September 1989
Mittwoch, 27. September 1989
Sonntag, 1. Oktober 1989
Freitag, 6. Oktober
Montag, 30. Oktober 1989
Dienstag, 31. Oktober 1989
Mittwoch, 1. November 1989
Donnerstag, 2. November 1989
Sonntag, 5. November 1989
Donnerstag, 9. November 1989
Freitag, 10. November 1989
Teil 3
Freitag, 10. November 1989
Samstag, 11. November 1989
Montag, 13. November 1989
Dienstag, 14. November 1989
Mittwoch, 29. November 1989
Montag, 11. Dezember 1989
Mittwoch, 21. Dezember 1989
Sonntag, 24. Dezember 1989
Samstag, 21. April 1990
Donnerstag, 26. April 1990
Montag, 30. April 1990
Mittwoch, 2. Mai 1990
Montag, 28. Mai 1990
Dienstag, 29. Mai 1990
Sonntag, 17. Juni 1990
Dienstag, 19. Juni 1990
Freitag, 22. Juni 1990
Juni 1995
FEUER, GLAS UND EINE SCHNEEKUGEL
Wort- und Begriffserklärung
Teil 1
Weil ich nicht Pionier werden darf, bin ich gezwungen, mich mit der Gräfin zu verbünden und soll deswegen auf meine Lackschuhe verzichten.
Der „Neiße“dienst. Was sonst noch daheim passiert.
Mittwoch, 8. Februar 1989
Vor Graafs Wohnungstür steht ein Eimer mit Wasser und Scheuerhader, daneben der Schrubber, ein Besen, Handfeger und Schaufel. Die Gräfin ist dabei, zwei Flaschen Mandora und atri, gute Limonade, die es nicht so ohne weiteres im Konsum zu kaufen gibt, auf die Fußmatte zu stellen.
„Ach, du bist’s, ich dachte schon …“
Ich weiß, was sie denkt. Sie erwartet jeden Moment wiedermal zwei arme Würstchen, denen sie eine Strafarbeit aufgebrummt hat. Die Gräfin ist berüchtigt dafür. Wer in der Schule in ihrer Gegenwart tobt, sich prügelt, Papier liegen lässt oder sie nicht mit „Genossin Graaf“ anspricht, etwas in der Art, ist fällig.
„Und, was sollen wir nun tun?“, fragt sie, während sie ihr Opfer festhält, „willst du zu mir zur Agitationsnachhilfe oder –?“ Alle antworten sofort ja. Immer wollen alle oder.
Oder bedeutet, bei der Gräfin daheim eine Strafe abzuarbeiten. Meistens ist unser Treppenhaus zu putzen. Manchmal müssen die Erwischten auch den Bürgersteig kehren oder zwischen den Gehwegplatten, mit denen unser Hof gepflastert ist, das Unkraut ziehen. Die ganze Aktion heißt unter uns Schülern Neißedienst, weil der Fluss Neiße in die Oder fließt. Wer keinen Neißedienst will, muss bei ihr eine Selbstkritik schreiben. Das Schreiben kann dauern, denn die Gräfin ist nie mit dem Ergebnis zufrieden. Beim Putzen aber drückt sie oft ein Auge zu und verpflegt die Gestraften recht ordentlich. Sie bestraft aber nur Pioniere, denn sie ist keine Lehrerin, nur Pionierleiterin. Also habe ich nichts zu befürchten.
„Wieso kommst du schon aus der Schule, habt ihr keinen Gruppennachmittag?“
Wäre ich Pionier, hätte sie mich jetzt erwischt, aber ich bin kein Pionier, deshalb kann sie mir nichts.
***
Manchmal finde ich Mittwoch den scheußlichsten Tag der Woche, obwohl er, schulisch gesehen, hausaufgabenfrei ist. Doch ist ein freier Mittwochnachmittag keine geschenkte Zeit wie ein Sonntag, denn mittwochs ist Pioniernachmittag. Was meine Person betrifft, bin ich ein Grenzfall. Obwohl kein Pionier, nehme ich trotzdem daran teil, es sei denn, alle haben in Pionierkluft zu erscheinen, um auf eine Veranstaltung zu gehen. Treffen mit der Patenbrigade, Freundschaftstreffen mit Sowjetsoldaten, Besuch bei der Volkssolidarität und so etwas. Bei solchen Anlässen bin ich nicht erwünscht, weil ich das Gesamtbild störe.
Deswegen ist so ein Mittwoch scheußlich!
Nicht, weil mir unsere Deutschlehrerin eine Extrahausaufgabe verpasst hat. Ein Wandzeitungsartikel über den Namensgeber unserer Schule sei längst überfällig, war ihr spontan eingefallen. Die alte Ziege hoffte natürlich, mich damit zu ärgern. War ihr bestimmt im Eifer des Gefechtes entgangen, dass ich druckreife Aufsätze schreibe. So erkundigte ich mich scheinheilig, worauf sie bei diesem Artikel besonderen Wert lege.
„Auf seinen Klassenkampf natürlich.“
Klar worauf sonst?
„Kann es auch über Georgi Dimitroff sein?“
Ich wollte die Alte ärgern, denn ich kannte die Antwort.
Unsere Schule besteht aus zwei Schulgebäuden, die durch einen Querbau verbunden sind. Daraus hat man zwei Schulen gemacht, die 5. POS Kurt Schlosser, meine Schule und die 31.
POS Georgi Dimitroff. Georgi Dimitroff war ein bulgarischer Antifaschist, dem die Nazis den Berliner Reichstagsbrand 1933 in die Schuhe geschoben hatten, obwohl er es gar nicht war. Die Brücke, die von der Dresdner Kathedrale über die Elbe in die Neustadt zum Goldenen Reiter führt, trägt auch seinen Namen: Georgi-Dimitroff-Brücke.
Nöller drehte sich zu uns um. „Wisst ihr, warum die Dimitroff-Brücke so heißt?“ Wir schüttelten die Köpfe und schielten kurz nach vorne. Unsere Deutschlehrerin war glücklicherweise ins Klassenbuch vertieft. „Na, ganz einfach. Als August der Starke immer wieder Ausschau nach schönen Frauen hielt, ließ er sich in seiner Kutsche über diese Brücke fahren. Sah er eine Schöne, so befahl er: Die mit troff, und die mit troff, und die mit …“ Das ist sächsischer Dialekt und bedeutet: „Die mit drauf und die mit drauf.“ Nöller kam nicht weiter. Unsere Deutschlehrerin zerrte ihn am Kragen und wütete: „Das melde ich deinem Vater!“
Nöller reagierte gelassen. „Der ist heute gar nicht in der Schule.“
Nöller hat überhaupt ein loses Mundwerk. Neulich erzählte uns der Physiklehrer was von Kybernetik und den Sowjetgenossen, die ja führend auf diesem Gebiet sind. Nöller drehte sich um und raunte: „Was heißt Kybernetik auf Deutsch? Russenkunde, Iwanetik.“
Auch wenn man über Sinn und Unsinn von Zusatzaufgaben streiten mag, was mir in diesem Fall den Tag vermiest ist das immer wiederkehrende Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Aus solcher Perspektive betrachtet, ist die Zusatzaufgabe quasi eine Strafarbeit. Strafe dafür, dass ich kein Pionier bin.
***
Noch bevor ich in die Schule kam, bestand Oma darauf, dass meine Eltern mich nicht Pionier werden ließen, obwohl Pionier zu werden bei uns in der DDR üblich ist. Gleich am ersten Schultag, wenn du mächtig zu tun hattest, die Zuckertüte zu stemmen, gab es noch ein paar Anmeldeformulare: für die Pioniere, die Schulspeisung und die Pausenmilch. Für Pausenmilch trugen mich meine Eltern ein, für Schulspeisung auch. Die Pionieranmeldung aber ließ mein Paps wortlos in seiner Jackentasche verschwinden, bis sie schließlich zerknüllt im Papierkorb landete. Alles gegen meinen Willen.
Auf Schulspeisung hätte ich gerne verzichtet, denn ich esse kein Fleisch, ebenso auf Pausenmilch, ich bin doch kein Baby! Aber nicht auf die Pioniere. Seit dem Kindergarten hatte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als Pionier zu werden. Auf Pioniernachmittage hatte ich mich gefreut und das Gefühl, zu einer republikübergreifenden Gemeinschaft zu gehören. Alle wurden Pioniere. Wer nicht Pionier wurde, war nicht normal. Nicht richtig in der Gesellschaft, wie das hieß.
Dass mein Paps die Pionieranmeldung entsorgt hatte, enttäuschte mich schwer. Blieb nur zu hoffen, andere Väter handelten genauso. Als einzige kein Pionier zu sein – nicht auszudenken!
Wenigstens sieben von siebenundzwanzig Klassenvätern wären ein annehmbarer Prozentsatz gewesen. In diesem Fall wäre nicht nur ein Kind, nämlich ich, ständig bloßgestellt und attackiert worden, sondern hätte sich diese Last auf mehrere Schultern verteilt. Doch meine Hoffnungen schlugen bereits nach zwei Wochen in schlimme Befürchtungen, meine Schulzeit betreffend, um. Bis dahin hatte unsere Lehrerin auch die letzten, es waren keine sieben gewesen, breit geschlagen, überzeugt, unter Druck gesetzt, freundlich gebeten.
Alle, außer meinem Paps.
Ich war übrig geblieben.
„Wenn Sie Julina unbedingt zur Außenseiterin machen wollen“, hatte sie versucht, ihm mein weiteres Leben schwarz zu malen und Paps mit so vorwurfsvoller Miene angeschaut, als sei er ein Kinderschänder. Paps blubberte, ich sei zum Lernen in der Schule und nicht wegen der Politik.
Beim ersten Elternabend gab sich das frisch gewählte Elternaktiv alle Mühe, ihn von der Notwendigkeit des Beitritts zur Pionierorganisation zu überzeugen. Pinselchens Mama versuchte es mit Logik: Auch sie wären nicht politisch, in einer Partei und so. Genau genommen wäre der Beitritt zu den Pionieren reine Formsache.
Paps blieb stur.
Der Vater von Rainer Nölder kam ihm da schon konkreter. Genosse Nölder ist unser Schuldirektor. Er nahm Paps beiseite und raunte ihm vertraulich zu, an seiner Stelle würde er mir nicht alle Wege verbauen. Ohne Mitgliedschaft bei den Pionieren oder später in der FDJ, hätte ich mit Sicherheit keine Chance auf ein Studium oder eine leitende Funktion.
Paps ignorierte den Hinweis.
Auch als ihn unsere Klassenlehrerin freundlich darauf hinwies, eigentlich sei ich ja bei den Pionieren – bis auf das Halstuch unterschiede mich kaum davon – ich käme zum Gruppennachmittag und wäre auch sonst vorbildlich aktiv, schluckte Paps diesen Köder nicht. Sie könne doch zufrieden sein, entgegnete er.
***
Alle Kinder aus unserm Haus sind Pioniere. Unter uns wohnt Torsten Graaf. Jetzt ist Torsten zwar bei der Armee, aber früher war er Pionier. Ging ja auch nicht anders, denn sein Vater ist ein hohes Tier in der Partei und hat einen Dienstwagen.
Nur wer in der Partei ist, muss die Graafs mögen. Wir Hausbewohner meiden sie, die Nachbarn aus andern Häusern tuscheln und lauern hinter den Gardinen, wenn der schwarze Dienstwolga vorfährt.
In unserer Hausgemeinschaft bin ich leider die einzige, die um Frau bzw. Genossin Graaf, keinen Bogen machen kann.
Nicht nur, dass wir uns manchmal im Treppenhaus begegnen, wir laufen uns auch in der Schule über den Weg.
Sie ist unsere Pionierleiterin. Sie bildet sich voll ein, jeder müsste sie kennen. Wenn sie zu Fuß unterwegs ist, schaut sie alle Entgegenkommenden streng und fordernd an: Grüß mich!, soll das heißen. Doch bis auf uns Schulkinder nimmt kaum einer Notiz von ihr. Bei uns aber begnügt sie sich nicht mit: „Guten Tag“, sondern wir müssen sie „Guten Tag, Genossin Graaf“, grüßen. Wenn es irgendwie geht, vermeidet man also außerhalb der Schule ein Zusammentreffen mit ihr.
Sogar bevor ich daheim in den Keller gehe, horche ich erstmal, ob im Treppenhaus alles ruhig ist. Wenn meine Eltern hören würden, dass ich „Genossin Graaf“ sage, würde es Ärger geben, und zwar für mich!
Keiner mag die Graafs, obwohl die fast jeden Tag in der Zeitung zu sehen sind. Man erzählt sich, die Angestellte in der Reinigungsannahmestelle habe Graf mit nur einem a auf den Abholschein geschrieben. Da hätte die Gräfin sich mokiert, sie solle das bitte verbessern, „schließlich sind wir nicht alter Adel“, und jemand aus der Warteschlange hätte gerufen:
„Aber roter!“ Da wäre die Gräfin knallrot angelaufen und schnell verschwunden.
***
Gegenüber von Graafs wohnt Familie Hagenbach mit Anne und Jakob. Ihre Mutter hat sie ebenfalls Pioniere werden lassen, obwohl sie, politisch gesehen, das krasse Gegenteil von Graafs sind. Jakob ist so alt wie Torsten und heißt mit Nachnamen Würfel. Herrn Hagenbach, den Mann seiner Mutter, könnte man für seinen älteren Bruder halten. Er ist viel jünger als Frau Hagenbach. Herr Hagenbach ist Annes Papa. Jakob und Anne gehen sich nicht nur wegen ihres Altersunterschiedes aus dem Weg. Jemanden wie Jakob zum Bruder bzw.
Halbbruder zu haben, ist schwierig. Mit verkniffenen Augen schleicht er durch die Gegend und grüßt nicht. Die Genossin Graaf gleich dreimal nicht. Anfangs hat sie sich darüber aufgeregt, doch lässt sie es mittlerweile sein. Sind Anne und ihre Mutter außer Haus, gibt es zwischen ihm und Herrn Hagenbach ständig Streit. Anne sagt „Papa“ zu Herrn Hagenbach, aber Jakob nennt ihn den „Lover von meiner Mutter“. Als ich klein war, verstand ich das mit dem Lover nicht, aber inzwischen weiß ich, dass das ein fieser Spruch ist.
Herr Hagenbach ist Chorsänger in der Semperoper, weshalb er vorwiegend abends arbeitet. Seine Frau leitet den Kindergarten Pittiplatsch. Anne besucht die Kinder- und Jugendsportschule, wo sie Fechten trainiert. Anne ist die Einzige, die mich nicht Juli nennt. Anne sagt Auguste zu mir, weil nach dem Monat Juli August kommt.
Hagenbachs fallen schon äußerlich auf. Herr Hagenbach trägt seine lockigen Haare hinten zusammengebunden, hat einen Bart, läuft meistens in olivgrüner Studentenkutte. Dazu trägt er Jeans. Nur wenn er in der Semperoper Vorstellung hat, zieht er was anderes an. Im Oberhemd, gar mit Krawatte, habe ich ihn noch nie gesehen.
Meistens trägt er Pullover, die Frau Hagenbach ihm strickt. Frau Hagenbach strickt alles: Strümpfe, Socken, Kleider, Pullover. Was sie nicht strickt, näht sie. Oft kauft sie Bettwäsche und färbt die ein. Daraus werden dann lange Röcke oder Kleider, Jacken oder Westen oder Blusen. Frau Hagenbach und Anne tragen meistens lange, weite, Röcke, darüber ebenfalls eine Studentenkutte. Während ich nur in Jeans rumrenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass Anne überhaupt eine besitzt.
Zwar waren Anne und ich früher im selben Kindergarten, aber seitdem sie die Kinder- und Jugendsportschule besucht, sehen wir uns kaum. Auf Anne bin ich ein kleines bisschen neidisch. Nicht wegen ihres Sports, sondern, weil sie ein Pionierhalstuch trägt.
Was könnte ich nicht alles aus mir machen, wenn ich Pionier wäre! Wäre ich Pionier, ich würde meine Klasse bei allem, das Pionierleben betreffend, total rausreißen. Wäre ich Pionier, hätte man mich bestimmt zur Schriftführerin gemacht. Pioniere sind nämlich gut organisiert. Die Pioniere meiner Klasse bilden eine Pioniergruppe. Die Leitung dieser Gruppe heißt Gruppenrat. Gruppenratsvorsitzende ist Pinselchen. Nöller macht den Kassierer. Jeden Monat bezahlen die Pioniere zehn Pfennig Mitgliedsbeitrag bei ihm.
Lutter ist Schriftführer. Er führt das Gruppenbuch, schreibt über alles, was die Pioniergruppe unternimmt, Berichte. Leider kann er das nicht gut. Bei der jährlichen Ausstellung der Gruppenbücher bekommen wir nie eine Belobigung. Das ärgert mich, denn ich hätte es viel besser gekonnt als Lutter. Die aus der Parallelklasse beispielsweise, haben ein Supergruppenbuch. Die erste Seite ziert der Pionierauftrag in dicken, bunten Buchstaben: Vorwärts mit guten Leistungen zum 40. Jahrestag der DDR! Auf der nächsten Seite steht ihr Gruppenplan in Schönschrift. Was die alles vorhaben: gute Lernergebnisse, Subbotnik, Altstoffsammlung. Wogegen Lutter nicht mal unsern Besuch bei der Patenbrigade richtig aufgeschrieben hat.
Da steht nur 19.10.88: Besuch bei der Patenbrigade im Sachsenwerk. Na, gute Nacht Marie, mit so einem Gruppenbuch kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Weder unsere Klassenfahrt nach Ottendorf-Okrilla, noch den Theaterbesuch im Theater Junge Generation hat der Dödel vermerkt.
Lutters Mutter ist Reinemachefrau, einen Vater gibt es nicht, aber viele Kinder daheim. Gegen das, was Lutter immer anhat, ist Pinselchen direkt exquisit gekleidet. Lutter trägt manchmal sogar Mädchenpullover und immer Trauerränder unter den Fingernägeln.
Sie wohnen unterm Dach in einer viel zu kleinen Wohnung.
Das Dach ist undicht. Wenn es regnet, müssen sie in den Zimmern Schüsseln aufstellen. Die Zimmerdecken sehen aus wie utopische Landkarten. Lutters Mutter hat Angst, dass irgendwann der Putz runterkommt. Bad haben sie auch keines und das Klo ist eine halbe Treppe tiefer. Die Öfen sind Schrott. Im Winter frieren sie und mit dem Wasserdruck haut es auch nicht hin. Tagsüber tröpfelt es nur aus dem Hahn, weshalb seine Mutter und er den Abwasch immer erst spät abends oder in der Nacht erledigen können. Dann, wenn die anderen Mieter unter ihnen kein Wasser mehr zapfen, reicht der Druck endlich für ihre Etage.
Lutter muss nachmittags seine jüngeren Geschwister vom Kindergarten und der Krippe abholen. Ihn trifft man nach der Schule nur mit Kinderwagen oder Sportkarre. Lutter muss daheim viel helfen. Ich glaube, der kann sogar schon kochen.
Nur waschen kann er nicht. Seine Sachen riechen immer alt und mufflig. Schulisch ist er eher als Schlussläufer einzuordnen. Hat es bisher nur so la, la von einem Schuljahr zum nächsten geschafft. Aber er ist Pionier.
Darum drücken die Lehrer schon mal ein Auge zu und üben Nachsicht mit ihm. Denn er stört das kollektive Klassenbild nicht, macht die Gruppe nicht kaputt als Außenseiter. Ich mag Lutter, finde es aber total verfehlt, dass er das Gruppenbuch führt. Nichts gegen Nöller, Lutter und Pinselchen, im Prinzip verstehen wir uns prima. Aber vom Organisieren des Pionierlebens haben sie keinen Schimmer. Oder haben sie keine Lust?
Scheint so. Denn niemand hat sie gefragt, ob sie Pioniere werden wollten.
Bei Nöller, ganz klar, hatte der Papa das Antragsformular bestimmt schon mit der Geburtsurkunde zusammen in der Schublade liegen. „Rainer Nölder, geboren am soundsovielten, Anschrift, wird Pionier.“ Für Nöller und die andern hatte nie zur Debatte gestanden, kein Pionier zu werden. So wie keiner über das Tageslicht nachdenkt, dachte kaum einer darüber nach, kein Pionier zu werden. Nöller ist das völlig schnuppe. Aber wenn dein Vater Direktor ausgerechnet der Schule ist, in die du gehst, musst du Pionier werden, das geht gar nicht anders. Er aber gibt nichts auf diesen Vorzug, schon fast als Pionier geboren zu sein. Er steigt durch die Gegend, verzaubert alle mit seinem hübschen Grinsen und die können gar nicht anders, als auf seiner Seite zu sein.
Mich erstaunt, dass Nöller sein Herz an Pinselchen verloren hat. Pinselchen sieht mit ihrer mausbraunen Igelfrisur wie ein Rasierpinsel aus, hat einen Speckbauch und viele Pickel im Gesicht. Sie hört auf den furchtbar altmodischen Vornamen:
Roselind. Ihre Eltern rufen sie Rosi.
Wer will schon eine Freundin, die Rosi heißt? Peinlich ist so ein Name. Niemand heißt heutzutage Rosi, nicht mal meine Mutter oder meine Oma. Ich kann mir die Ehre anheften, als Erste auf den Namen Pinselchen gekommen zu sein. Was Nöller aber ausgerechnet an ihr findet, mir bleibt es rätselhaft.
In ihren glänzenden Leggins und den engen Pullovern hat sie Ähnlichkeit mit einer Wurst in der Pelle. Pinselchen kann nichts Außergewöhnliches, die ist einfach nur normal, stinknormal. Keine besonderen Leistungen in der Schule, kein besonderes Aussehen, nichts, aber auch gar nichts.
Und Nöller sucht sich so eine Null aus! Ich versteh die Welt nicht mehr! Allerdings, eines neide ich ihr: den Gruppenratsvorsitz. Auch wenn sie für diese Funktion überhaupt kein Format hat. Aber sie hat diese Funktion! Eine, die ich ebenso gerne hätte wie Schriftführerin, wenn ich Pionier wäre …
***
Die Gräfin ist elegant gekleidet wie immer. Alles aus dem Exquisit. Sie trägt eine beige Hose, zu der die blaue FDJ-Bluse perfekt passt. Mit Sicherheit hat sie es eilig und muss gleich, wie jeden Mittwoch, zum Pioniernachmittag. Zum Friseur muss sie auch mal wieder, ihr Wasserstoffblond ist von hässlichen mausbraunen Strähnen durchzogen. Ihr Mund ist ein einziger, energischer Strich, ihre stahlgrauen Augen mustern mich streng.
„Klar ist Pioniernachmittag, aber ich darf wieder mal nicht mit. Die gehen in ein Altenheim. Pionierkluft ist Pflicht.“
Weil ich kein Pionier bin, trage ich keine Pionierkluft. Um nicht gleich aufzufallen, ziehe ich meistens eine weiße Bluse an, aber das genügt heute nicht. Das Altenheim ist von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Diese betagten Kämpfer haben es verdient, dass sie ausschließlich von Pionieren besungen werden.
Ein klein wenig hoffe ich auf das Mitgefühl der Gräfin, leider vergebens.
„Da bist du schon selbst schuld. Es tut mir nicht Leid für dich, sondern für dein Klassenkollektiv. Überleg doch mal, was du ihnen antust mit deinen ständigen Extratouren! Niemals kann deine Klasse vollzählig und hundertprozentig auf unseren sozialistischen Veranstaltungen anwesend sein. Nur wegen dir.“
Immer dasselbe. Warum hält sie diese Gardinenpredigt nicht meinem Paps? Wenn es nach mir ginge, wäre die Lage von Anfang an eine andere, was der Gräfin plötzlich wieder einfällt.
„Wärst wohl gerne mitgegangen?“
Ich nicke.
„Papa bleibt stur, oder?“
Ich nicke wiederum.
„Dabei stünde dir die Pionierkluft besonders gut.“
Findet sie? Ich werde nicht fertig mit Nicken. Die Frau hat ihren Finger voll in die Wunde gelegt.
„Auch wenn diese gelben Schuhe natürlich nicht zu einer Pionierkluft passen würden“, fügt sie spitz hinzu.
Gelbe Lackschuhe aus dem Westen, klar, dass ihr die nicht gefallen.
Doch überhöre ich diese Bemerkung und heule mich bei ihr aus. Dass ich es gemein fände von Paps, wo ich doch so gerne bei den Pionieren wäre. Und dass unser Staat solche Väter zwingen müsste, den Willen der Kinder zu respektieren. Doch dann schränke ich ein. Zwar ist es Paps, der seine Unterschrift auf dem Beitrittsformular verweigert, aber letztendlich ist es Oma aus Westberlin.
„Oma behauptet, Pionier zu sein ist nicht nötig für eine Glasbläserlehre.“
„Wer wird Glasbläser, du etwa?“
„Ich will ja nicht, aber Oma und meine Eltern.“
„Das ist doch Quatsch“, die Gräfin ist empört, „dabei bist du so talentiert. Aus dir könnte mal eine Schriftstellerin werden, weißt du das?“
Klar weiß ich das.
„Am liebsten würde ich Journalistin werden, aber ohne Pionierkluft?“
„Du musst deine Eltern überzeugen, Julina, auch gegen deine Oma.“
Meine Eltern und gegen Oma, die Gräfin glaubt wohl an den Weihnachtsmann? Die fressen Oma doch aus der Hand, damit sie uns immer brav versorgt mit allem Westzeug! Als Gegenleistung verlangt sie Respekt und Achtung, weil sie Paps allein großgezogen hat.
„Oma kommt im August wieder zu Besuch. Vielleicht reden Sie mal mit ihr und verklickern ihr, dass es vergebliche Liebesmüh wäre, mich zur Glasbläserin machen zu wollen.“
Als hätte ihr der Zahnarzt auf den Nerv gebohrt, zuckt die Gräfin zusammen. „Naja“, murmelt sie verlegen, „ich weiß nicht, in Familienangelegenheiten einmischen, also …“ Für einen Moment schweigen wir beide. Dann kneift sie ihre Augen zusammen, als hätte sie einen Geistesblitz und murmelt was von Einreise verbieten.
„Ja!“, juble ich. Genau das scheint die Lösung zu sein und sie ist ganz nah! „Mir würde es nichts ausmachen“, versichere ich übereifrig, „ich kann gerne auf Omas Besuche verzichten.“
Statt dieses Opfer freudig zu begrüßen, will sie wissen: „Worüber sprecht ihr denn so, wenn deine Oma zu Besuch ist?“
Ich muss kurz überlegen. Ich weiß, die Gräfin hat Sorge, wir jammern, welche Versorgungslücke sich wieder mal aufgetan hat, oder wie Paps von seinem Chef politisch unter Druck gesetzt wird. Die Genossen befürchten nämlich, dass wir vor den Menschen aus dem Westen schlecht über unsere Republik reden. So ganz anders eben, als es in unseren Zeitungen steht.
„Sprechen? Eigentlich nichts Besonderes, nichts Politisches wir …“
„Aber doch über Familiäres, oder?“
Oma führt keine Gespräche mit uns, die ist beschäftigt mit ranschleppen aus dem Intershop: Schokolade, Strumpfhosen, Seife, Deo, Werkzeug. Was sie nicht im Intershop bekommt, bestellt sie aus einem dicken Katalog. Von früher spricht sie nie. Frage ich danach, mauert sie. Beispielsweise bei der Frage, wer Paps Vater ist, denn ihr verstorbener Mann, Albert Schanze, war es nicht. Bis zu ihrer Heirat hat Oma mit Paps alleine gelebt, als alleinerziehende Mutter.
Die Gräfin schaut jetzt, wie alle Erwachsenen gucken, wenn es um das Thema Sex geht: mit einem dafür-bist-du-noch-zuklein-Gesicht. Sie verzieht sogar die Mundwinkel ein wenig spöttisch. Jetzt reicht es aber, erst diese blöde Zusatzaufgabe und dann die herablassende Behandlung ausgerechnet von unserer Pionierleiterin! Schließlich sülzt sie noch: „Wenn du erwachsen bist, suchst du dir deinen eigenen Weg, nicht wahr?“
Sie wirft dabei einen vernichtenden Blick auf meine Füße:
„Dann musst du auch keine solchen geschmacklosen Schuhe mehr tragen. Ein Pionier braucht keine Lackschuhe!“
Was sind das für platte Antworten! Geschmacklose Schuhe und suchst dir deinen eigenen Weg – und bis dahin? Wie viele Zusatzaufgaben bin ich davon noch entfernt, meine Güte, ich bin elf! Nein, so lasse ich mich nicht abspeisen. Ich bleibe stehen, obwohl die Gräfin ihre Tür schließen will. Dieses Gespräch wird jetzt fortgesetzt, auch wenn die Alte meine Schuhe zum Kotzen findet!
„Sie waren bestimmt mal Pionier“, nehme ich an, sonst wäre sie ja keine Pionierleiterin.
„Kind, ich war eine der ersten Pioniere in unserer jungen Republik“, erzählt sie stolz und tritt wieder zurück in den Hausflur.
„Oh!“, mein Staunen ist echt.
Das war eine Schlüsselfrage, erfreulicherweise. Die Gräfin vergisst alles um sich herum und erzählt mir, dass ihr Vater stolz auf sie wäre, hätte er das erleben können. Leider sei er im antifaschistischen Widerstandskampf ums Leben gekommen. Wenn ihr Torsten seinen Großvater gekannt hätte, wäre er ebenfalls sehr stolz auf ihn gewesen.
„Bestimmt erzählen Sie ihm viel von seinem Opa, nicht wahr?“
„Mein Vater war ein so guter Mensch“, sagt die Gräfin mit einem verklärten Lächeln, anstatt meine Frage zu beantworten, „ich kann nur sein Erbe fortsetzen.“
Die Haustür geht auf. Die beiden armen Würstchen aus der zweiten kommen. Schon wendet sich die Gräfin ihnen zu.
„War er im KZ?“, ich bin nicht gewillt, unser Gespräch an dieser Stelle abzubrechen.
„Nein, er wurde erschossen.“ Sie reicht dem einen armen Würstchen den Besen.
„Im Krieg also?“
„Ja, ja.“
Das andere arme Würstchen bekommt den Handfeger in die eine und die Kehrschaufel in die andere Hand.
„Ich muss nämlich einen Wandzeitungsartikel über den Klassenkampf von Kurt Schlosser schreiben. Aber Ihr Vater wäre auch ein interessantes Thema.“
Da habe ich wieder ihre volle Aufmerksamkeit.
„Das ist gar keine schlechte Idee“, überlegt sie laut und schaut mich dabei aufmerksam an.
„Ja?“ Eine vage Hoffnung breitet sich in mir aus. Hoffnung, worauf eigentlich? Ich weiß es selbst nicht.
„Julina, das ist eine gute Idee, eine sehr gute sogar.“
Die Gräfin schaut mich jetzt freundlich, fast triumphierend an.
„Das machen wir, genau, das machen wir“, murmelt sie und nimmt ganz nebenbei dem einen armen Würstchen den Besen schon wieder ab, obwohl der ihn gar nicht loswerden, sondern nur was fragen wollte. Das andere arme Würstchen ruft:
„Können wir gehen?“ Die Gräfin macht eine zerstreute Handbewegung und schon springen die beiden armen Würstchen davon, obwohl sie noch gar nicht angefangen haben.
„Du wirst einen Artikel über meinen Vater schreiben, aber mehr so allgemein. Damit unterstützt du mein Vorhaben in erheblichem Maße. Verstehst du?“
Nichts.
„Mein Vater war ein Widerstandskämpfer in Rumänien, damals, in der kommunistischen Partei, genauso wie seinerzeit Georgi Dimitroff, Lenin oder Thälmann, wie alle eben“, sie windet sich ein bisschen, was ich gar nicht von ihr kenne, sonst steht sie immer stocksteif da, total unbeweglich.
Sie hält einen Moment inne.
Dann schaut sie mich merkwürdig an.
„Ich habe nämlich etwas vor“, deutet sie geheimnisvoll an, „und dafür brauche ich Mitstreiter.“ Das riecht nach gesellschaftlicher Arbeit. Gesellschaftliche Arbeit ist immer gut, je mehr, desto besser. Wer gesellschaftliche Arbeit vorzuweisen hat, kann damit manches ausgleichen: eine schlechte Note zum Beispiel oder einen unentschiedenen Durchschnitt. Gesellschaftliche Arbeit ist wie das Zünglein an der Waage. Die meisten drücken sich, aber das kann ich mir nicht leisten. Gesellschaftliche Arbeit ist mein persönlicher Rettungsanker als Nichtpionier. Also her damit.
„Ich möchte nämlich unsere Straße umbenennen. Sie soll nach meinem Vater, Peter-Stocker-Straße heißen. Dafür brauche ich kluge Köpfe wie dich.“
Während mir die Gräfin ihren Plan erläutert, geht oben die Tür.
Das Türklappen macht die Gräfin nervös.
„Wir können ja später noch darüber reden.“ Sie ist schon halb in ihrer Wohnung verschwunden, als oben die Tür wieder zuklappt.
Das wird meine Chance, endlich, endlich bekomme ich eine echte Chance!
„Auftrag verstanden, wird sofort erfüllt“, rufe ich und wende mich noch rasch den Briefkästen zu.
Wir haben Post von Oma. „Meine lieben Kinder“, schreibt Oma, „Morgen mache ich wieder ein Paket für euch fertig, Herr Gül bringt es übermorgen zur Post. Nur damit Ihr Bescheid wisst.“ Dann schreibt sie vom Wetter und lauter solchen belanglosen Kram. Herr Gül ist ihr Nachbar, ein türkischer Taxifahrer, der Oma jeden Sommer mit dem Taxi von Westberlin zu uns nach Dresden bringt. Seine Frau macht Omas Wohnung sauber und Herr Gül repariert, wenn was kaputt geht.
Ich setze mich an meinen Schreibtisch und beginne mit der Zusatzaufgabe.
Unsere Schule trägt stolz den Namen Kurt Schlosser. Er war einer von vielen Widerstandskämpfern. Sie ließen ihr Leben im Klassenkampf, um uns vom Faschismus zu befreien. Genauso wie der Vater unserer Pionierleiterin, Genossin Graaf. Er kämpfte gegen die Faschisten in seiner Heimat Rumänien. Dieser Kampf kostete ihn das Leben wie Kurt Schlosser auch. Aber seiner Tochter, unserer Genossin Graaf, versprechen wir, dass wir allezeit bereit sein wollen für Frieden und Sozialismus. Ganz im Sinne ihres tapferen Vaters.
Wenn ich so einen Opa hätte, wäre ich hundertpro bei den Pionieren. Mit so einem Opa kannst du überall punkten. Mich wundert nur, warum die Gräfin von dem noch nie gesprochen hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie ihren Vater bisher auch nur mit einer Silbe erwähnte. Dabei ist so einer bei uns im Sozialismus doch sowas wie ein Sechser im Lotto.
Wenn sie dich auf dem Amt dumm abfertigen kannst du sie schocken: „Sie wissen wohl nicht, wer ich bin?“ Wenn du mal wieder in eine Versorgungslücke getreten bist, kannst du an Honecker schreiben: „Genosse Staatsratsvorsitzender, wissen Sie eigentlich, wer mein Vater war?“ Im Kapitalismus muss du adlig sein, damit sie Respekt vor dir bekommen, bei uns aber brauchst du einen Widerstandskämpfer in deiner Familie und wenn der dann noch umgebracht wurde, umso besser.
Na, unsere Deutschtussi wird morgen aber Augen kriegen, mit dieser Entdeckung hat sie bestimmt nicht gerechnet!
Ärger mit der Deutschtussi. Westkaffee für Lutter.
Donnerstag, 9. Februar 1989
Erste Stunde Deutsch. Natürlich bin ich Mode. Mit verächtlicher Miene präsentiere ich das Ergebnis der gräflichen Unterhaltung. Die Deutschtussi scheint zufrieden. Ich ordne meine Gesichtszüge zu einem Gewinnerlächeln. Mich, Julina Winterburg, bringt man mit so einer Extraaufgabe nicht in Verlegenheit.
Gerade will ich erhobenen Hauptes dem Unterrichtsgeschehen weiter folgen, als das Gewitter losbricht. „Was soll das, willst du mich veralbern? Warte!“
Das Blatt in der Hand stürmt sie an den Lehrertisch und blättert hastig im Klassenbuch, „das gibt einen Eintrag. Unverschämt. Und außerdem falsch.“ Ich lege die Stirn in Falten, jetzt um einen herablassenden Gesichtsausdruck bemüht. Die kann mich nicht nieder machen, die nicht!
„Genossin Graaf hat mir erlaubt, über ihren Vater zu schreiben!“, schreie ich beleidigt. Schließlich hatte ich Order von höchster Stelle. Unsere Pionierleiterin im Unterricht als eine Instanz anzuführen, die mir Hausaufgaben aufgibt, geht der Deutschtussi sichtbar über die Hutschnur.
„Du hast das Thema verfehlt, basta! Über den Antifaschisten Kurt Schlosser und über sonst keinen solltest du schreiben.“
„Aber die Genossin Graaf hat doch … ihr Vater war doch auch …“
„Der interessiert mich nicht, wenn ich sage, du schreibst über Kurt Schlosser, dann ist das dein Thema, egal, was Kollegin Graaf dir erzählt, hast du mich verstanden?“
Mit verschränkten Armen und niedergeschlagenen Augen sitze ich da und murmle: „Genossin Graaf heißt das, nicht Kollegin!“
„Was hat sie denn?“, Nöller dreht sich zu mir.
„Ich hab eigentlich über den Vater von der Graaf geschrieben, nur ein bisschen über Kurt Schlosser.“ Dass ich mit den Tränen kämpfe, ist mir peinlich.
„Ich finde“, meldet sich Nöller, „Widerstandskämpfer bleibt Widerstandskämpfer, egal, wer.“
Bevor unsere Lehrerin ihm den Mund verbieten kann, setzt Nöller fort: „Wissen Sie, die haben doch alle für die eine gemeinsame Sache gekämpft, die Befreiung der unterdrückten Massen. Ich schlage darum vor, wir gehen in der Pause zu Genossin Graaf und fragen, ob sie Juli einen Auftrag erteilt hat.
Aber so wie Sie das machen, finde ich das unfair. Schließlich hat Juli ihre Zusatzaufgabe gemacht. Sogar einen Forschungsauftrag hat sie erfüllt. Wenn es falsch war, können Sie Juli immer noch bestrafen.“
Nöller ist doch ein gerissener Kerl. Ich halte den Kopf gesenkt und unterdrücke ein Grinsen. Die Gräfin zur Kronzeugin zu machen ist wie Öl ins Feuer zu gießen. Gegen den Sohn vom Direx kommt die Deutschtussi nicht an. Sie zeigt Kompromissbereitschaft.
Pinselchen, Nöller und die Deutschlehrerin gehen in der großen Pause zur Pionierleiterin, wir anderen auf den Schulhof.
Anschließend kommt Pinselchen und winkt aufgeregt. „Gewonnen, Juli! Die Gräfin hat unsere Deutschtussi richtig rund gemacht. Die war vollkommen perplex, wie sich die Gräfin in ihren Unterricht einmischt und dich auch noch lobt, weil du einen Klassenstandpunkt bewiesen hast.“
Ich bin rehabilitiert.
In der vorletzten Stunde, wir haben Zeichnen, holt mich die Gräfin für eine Sonderaufgabe aus dem Unterricht. Auch wenn der Artikel über ihren Vater gut gelungen sei, benötige die Schule einen über Kurt Schlossers Leben. Der Artikel werde mir doch sicher nicht schwerfallen.
Zwei Bücher liegen dafür bereit.
Dieser Artikel aber soll keinesfalls eine Zusatzhausaufgabe sein, sondern ich darf ihn hier, im Freundschaftspionierleiterzimmer, schreiben. Anschließend werde ihn die Gräfin höchstpersönlich an der Wandzeitung befestigen. Den Artikel über ihren Vater aber, die Gräfin legt mein Blatt in eine Mappe, werde sie daheim an die Hauswandzeitung heften.
Unsere Hauswandzeitung, eigentlich das Schwarze Brett, hängt an der Wand vom ersten Treppenabsatz, gleich über dem Sicherungskasten. Bekanntmachungen der Kommunalen Wohnungsverwaltung, der Zettel vom Essenkehrer oder wann Zählerstände abgelesen werden, sind daran mit Reißzwecken befestigt und das Schild, wer mit der Hausordnung dran ist.
In keinem Haus zieren politische Artikel die Hauswandzeitung. „Wird Zeit, dass unsere Hausgemeinschaft Flagge zeigt“, findet die Gräfin.
Vom Schulsekretariat gehen zwei Zimmer ab. Rechts geht es ins Pionierleiterzimmer, links ins Direktorenzimmer. Beide Türen stehen offen. Während ich an dem Tisch hocke, wo normalerweise der Freundschaftsrat seine Sitzungen abhält und die Bücher über Kurt Schlosser wälze, bekomme ich was Interessantes mit. Unser Direx macht Hektik, weil der Pionierpalast schon zum dritten Mal daran erinnert hat, dass von unserer Schule noch niemand für die neue Arbeitsgemeinschaft Junge Reporter benannt wurde. Angeblich fände sich kein Schüler, der freiwillig beitreten möchte.
Das elektrisiert mich förmlich. „Ich!“, rufe ich aus dem Pionierleiterzimmer, „lassen Sie mich hingehen, bitte!“
„Du?“ Herr Nölder scheint für einen Moment nicht abgeneigt, doch gleich erinnert er sich wieder: „In so eine AG können wir nur Pioniere delegieren.“
Hätte ich mir doch denken können. Warum falle ich immer wieder darauf herein? Paps ist ein richtiger Karriereverhinderer. Der wird schon sehen, dass ich mal bei der Straßenreinigung lande, weil aus mir nichts wird, obwohl ich einigermaßen begabt bin.
Mein Artikel über Kurt Schlosser gelingt ausgezeichnet. Mein schriftlich formulierter Anstoß, den nach ihm benannten Bergsteigerchor, der in diesem Jahr wie unsere Republik, seinen 40. Jahrestag feiert, zu besuchen, findet Anklang. Die Gräfin ist schier euphorisch. „Gut gemacht, Julina“, lobt sie immerzu.
„Wenn Sie mir noch ein paar Sachen von Ihrem Vater erzählen, könnte ich den Artikel-“
„Nein, lass erst mal gut sein, Julina!“
„Aber ich meine, dass mit Ihrem Vater, da sollte man doch-“
„Ein anderes Mal, ich gebe dir dann rechtzeitig Bescheid.“
„Wir haben heute sowieso nur wenige Hausaufgaben, da würde ich die Zeit gleich mal-“
„Julina, ich sagte: Jetzt nicht!“ Die Gräfin kramt in ihrem Schreibtisch und legt mir einen Kugelschreiber hin. Im oberen Teil der Hülle fährt ein Schiff hin und her. Ich bedanke mich enttäuscht.
***
Die Schulflure sind leer, die meisten Schüler inzwischen daheim. Die ungewohnte Stille im Schulhaus gibt mir ein Gefühl, wie ich es immer im Kindergarten hatte, wenn ich wieder mal Bummelletzte war, weil meine Eltern Überstunden schieben mussten.
Bevor ich mich verdrücken kann, habe ich Flaschendienst. Ich trabe in meinen Klassenraum, schnappe mir den Milchkasten und spüle die ausgetrunkenen Milchflaschen schnell aus. Leider ist das eine ganz gewöhnliche Funktion, nicht ausschließlich für Pioniere. Schade eigentlich, denn so einem Posten weinst du keine Träne nach. Jeder muss mal Flaschen spülen, das geht reihum. Mein Name ist der unterste im Klassenbuch.
Ich rümpfe die Nase, presse die Lippen zusammen und greife mit spitzen Fingern eine Flasche nach der andern.
Früh morgens, da schlafe ich noch, liefert das Auto vom VE Milchkombinat die Schulmilch. Vermutlich schläft der Hausmeister auch noch, weswegen der Kollege Milchautofahrer die Milchkästen draußen vor der Tür abstellt. Auf jedem Aludeckel schwimmt immer eine kleine, winzige Milchpfütze wie ein Fettauge. Das Fettauge gefriert um diese Jahreszeit natürlich, bis der Hausmeister endlich die Kästen reinholt. Jede Klasse stellt ihren Kasten mit den eiskalten Flaschen an die Heizung, um die Milch wieder auf Trinktemperatur zu bekommen. Die gefrorene Milch auf den Deckeln aber gerinnt in der Heizungswärme und stinkt. Steckt man einen Trinkhalm durch den Deckel, ragte er höchstens drei Zentimeter über die stinkende Milchpfütze. Beim Trinken hat man dann diesen ekligen Käsegeruch in der Nase.
Milch gibt es in den Sorten Normal, Kakao oder Frucht. Ich trinke am liebsten Normal oder Kakao. Frucht schmeckt keinem. Wer eine Frucht bestellt hat, sieht zu, dass er trotzdem Kakao abbekommt. Kakao ist am teuersten.
Lutter und andere Kinder bekommen die Milch umsonst.
Aber nur normale oder Frucht. Die haben wir deshalb in Verdacht, wenn wieder mal Frucht übrig ist für den, der Kakao bestellt hat.
Der Geruch von leeren Milchflaschen ist ebenfalls ein spezieller. Darum drehe ich beim Spülen das Gesicht weg, was nicht gut durchdacht ist. Erst als mein linkes Hosenbein feucht wird, merke ich, dass ich die Milchpampe voll daneben schütte, immer rauf auf meine frisch gewaschene Jeans. „Äh“, schimpfe ich, reiße mich zusammen und spüle die restlichen Flaschen bei vollem Einsatz. Mit Hilfe des Tafellappens beseitige ich die kleine Pfütze unterm Waschbecken. Ein milchiger Fleck bleibt zurück. Ach egal, heute Nachmittag kommt die Reinemachefrau. Ich will keinesfalls länger im Schulhaus verweilen, als unbedingt nötig. Schnell den Milchkasten neben der Essenausgabe gestapelt und dann die Treppe runter.
***
Unten tritt mir Lutter in den Weg. Scheint, als hätte er gewartet. Schüchtern zeigt er mir einen Zehnmarkschein. „Mehr hab ich nicht, aber meine Mutter hat morgen Geburtstag.“ Er schaut mich an wie ein bettelnder Dackel. Ich schnalle nicht, was das mit mir zu tun hat.
„Du verkaufst doch manchmal Sachen aus dem Westen“, stammelt er und wird rot, als hätte er mich was Unanständiges gefragt.
Ach, daher weht der Wind!
„Klar, aber nur gegen Westgeld, kapiert?“ Offenbar bin ich Lutters letzte Hoffnung. Enttäuscht faltet er den Geldschein zusammen und schiebt ihn in seine fürchterliche Silastikhose, die aussieht wie eine ausgebeulte Strumpfhose.
Ich bin ja kein Unmensch. „Also, komm mit.“
Er darf mich genau bis vor unsere Wohnungstür begleiten.
Hinein lasse ich ihn nicht. Im Wohnzimmer, hinter der Schrankwandtür, lagern mindestens sieben Pfundpäckchen Kaffee. Das scheint viel zu sein, aber angesichts der Tatsache, dass wir in unserer Republik inzwischen bei vielen Sachen zum Tauschhandel übergegangen sind, reicht es gerade so.
Paps hat neulich eine neue Feder für unseren Lada gebraucht.
Nur gegen zwei Päckchen Kaffee und fünfzig Mäuse West ist er sofort dran gekommen und hat überhaupt eine Feder gekriegt. Maminka verkauft bei sich im Betrieb den Kaffee für fünfundzwanzig Mark DDR-Geld. Ob meine Eltern die Kaffeepäckchen abgezählt haben?
Ich bringe Lutter ein Päckchen.
„Geht das?“
Der schaut mich an und strahlt. „Juli, das vergesse ich dir nie!“ Er wühlt in seiner Hosentasche nach dem Geldschein.
„Lass mal“, winke ich gönnerhaft ab, „wir haben genug davon. Kannst deiner Mutter ja noch Blumen kaufen oder Pralinen.“
Obwohl ich Lutter absolut widerwärtig finde, geht mir sein glückliches Strahlen den ganzen Nachmittag nicht aus dem Sinn. Es bringt mich auf so merkwürdige Gedanken wie den, doch öfter mal etwas zu verschenken.
Apfelsinen nicht aus Kuba. Das Geheimnis um Frau Pfefferstein.
Freitag, 10. Februar 1989
Im Konsum gibt es Apfelsinen. Die richtigen, nicht die grünen aus Kuba. Die grünen aus Kuba gibt es immer. Die sind grün, anstatt orange, weil es in Kuba nachts nicht so kalt wird, sagt man. Paps jagt jeden Morgen zwei davon durch den elektrischen Entsafter. So zum Essen sind die nämlich nichts. Total faserig. Aber weil wir als DDR Kuba helfen wollen, kaufen wir ihnen diese Apfelsinen ab.
Vom Küchenfenster sehe ich Leute mit Einkaufsnetzen, aus denen die Orangen in der Dämmerung einladend leuchten.
Schnell schnappe ich mir Geld und meine Jacke. Auch wenn wir zu den Privilegierten gehören, die das meiste im Intershop einkaufen, frisches Obst und Gemüse gibt es dort leider nicht. Für Frischware muss ich mich in die lange Schlange, die sich vor dem Konsum gebildet hat, einreihen.
Am Schwarzen Brett im Treppenhaus hängt mein Artikel. Die Gräfin hat von Julina Winterburg mit ihrer Handschrift in roter Tinte hinzugefügt, was mir ein wenig Unbehagen bereitet wenn ich daran denke, was Paps dazu sagen wird.
Als ich zurückkomme, ich habe tatsächlich Apfelsinen ergattert, ist das Schwarze Brett leer. Zerfetzt in winzige Papierschnipsel, liegt der Artikel auf Graafs Fußmatte. So ein destruktiver Umgang mit meiner Kreativität empört mich dann doch. Wer tut so etwas? Auf dem Weg zum Konsum bin ich nur einem einzigen Menschen begegnet: der Hexe. Wir gaben uns an der Haustür die Klinke in die Hand. Kümmern sich Hexen heutzutage um Wandzeitungen?
***
Alle Menschen haben Geheimnisse. Die einen behalten sie für sich, andere teilen sie mit jemandem. So ein Jemand kann sowohl ein Freund wie ein Feind sein. Wenn Freunde Geheimnisse teilen, so haben sie was Verbindendes, wenn aber dein Feind dein Geheimnis kennt, ist es gefährlich. Er kann dich erpressen. So ähnlich behauptet es Oma. Oma hat mehrere Geheimnisse. Das Geheimnis, wer Paps Vater ist, hütet sie streng. Niemand, auch nicht mein Paps, erfährt etwas darüber. Das ginge niemanden etwas an, behauptet Oma, nur sie.
Ein kleines Geheimnis aber teilt sie mit mir. Dabei geht es um Frau Pfefferstein. Frau Pfefferstein wohnt uns gegenüber und ist eine Hexe. Ich muss Oma Recht geben, denn Frau Pfefferstein entspricht dem, was ich von Hexen weiß. Sie spricht komisch deutsch und kommt aus der Klapsmühle. Alle erzählen das und im Konsum weiß man es auch. Sie weiß viel über Kräuter und sammelt selbst im Rinnstein gewachsenes Unkraut. Stets hat sie irgendwelche Stängel in der Hand. Sie reißt ihre Fenster bei jedem Wetter auf und rennt viel barfuß in ihren Schuhen. Ihre große, gebogene Nase, ihr gebeugter Rücken und die unheimlich großen braunen Augen – alles typische Hexenmerkmale.
Außer ihrer komischen Frisur.
Frau Pfefferstein hat am Hinterkopf fast keine Haare mehr.
Noch nie habe ich in einem Bilderbuch eine Hexe mit Glatze gesehen. Eigentlich müsste sie wissen, dass unsere Regierung Hexen überhaupt nicht mag. Hexen sind aus alter Zeit, reaktionär und rückständig. Sie eignen sich nicht als Feinde des Sozialismus. Unsere Feinde heißen Kapitalisten, Revanchisten, Imperialisten, Faschisten, Westdeutsche.
Aus Angst, man könnte mich ebenfalls für rückständig halten, verrate ich keinem was davon. Ob der Gräfin bewusst ist, dass in unserm Haus eine Hexe wohnt, bezweifle ich. Wenn Volkskammerwahl ist, kommt sie mit den Leuten vom Wahllokal und ein paar Pionieren an ihre Tür. Die Pioniere singen der Hexe ein Ständchen. Die vom Wahllokal geben ihr den Wahlzettel und haben einen Pappkarton mit Schlitz dabei. In den Schlitz kommt der Wahlzettel, und schon hat sie gewählt.
Beim Wählen stellt sich die Gräfin neben sie und Genosse Härz von der Zeitung knipst. Am nächsten Tag erscheint das Bild in der Sonderbeilage vom Neuen Deutschland.
Immer wenn Oma zu Besuch kommt legt sie mir ans Herz, mich ja vor der Hexe in Acht zu nehmen, denn sie sei böse, hinterhältig und heimtückisch. Als Beweis brachte sie mal ein großes Märchenbuch mit und zeigte mir die krumme Hexe aus Hänsel und Gretel, mit Hakennase und dunkelrotem Haar.
Mich wundert, dass Hagenbachs sich um die alte Hexe kümmern, als sei es ihre Großmutter. Frau Hagenbach wischt an ihrer Stelle das Treppenhaus, kauft oft für sie im Konsum ein, putzt Fenster bei ihr und früher, als wir klein waren, brachte sie ihr sogar Anne zum Aufpassen. Wenn sie Kohlen bekommt, trägt ihr Jakob die Briketts eimerweise in den Keller, ohne miesepetriges Gesicht.
***
Ich putze vorm Zubettgehen gerade Zähne, als unten die Haustür geht. Gleich ist helle Aufregung im Parterre. Die Gräfin zankt sich mit Frau Hagenbach. Grund der Auseinandersetzung ist mein Artikel, genauer, die Schnipsel auf ihrer Fußmatte. Die Gräfin blafft, Hagenbachs sollten es zugeben, sie könne auch anders. Annes Mutter bleibt gelassen und entgegnet, sie solle sich wieder einkriegen. Bevor sie solche Behauptungen aufstelle, erstmal die Faktenlage überprüfen.
Denn Fakt wäre doch, dass Frau Hagenbach eben erst vom Kindergarten heimgekehrt sei. Anne habe Wettkampf und Jakob halte sich nachweislich, wenn auch nicht freiwillig, bei der NVA in Görlitz auf. Was ihren Mann anginge, der sei schon seit Mittag aus dem Haus. Wenn sie was von ihm wolle, müsse sie die Zauberflöte in der Semperoper unterbrechen lassen. Vielleicht reiche ihr langer Arm ja bis in eine Opernaufführung mit internationalem Publikum. Erst knallt die eine, dann die andere Wohnungstür. Die Ruhe ist fast gespenstisch, dennoch erholsam. Zeit zum Schlafengehen.
Gerade will ich ins Bett steigen, als Paps mir noch ein väterliches Gespräch aufdrängt, wegen eines Päckchens Westkaffee. Woher soll ich denn wissen, dass sie den Kaffee so horten, weil sie einen neuen Wartburg-Tourist in Aussicht haben?
Mich wegen so einer Lappalie vom wohlverdienten Schlaf vor Mitternacht abzuhalten, ist unverschämt!
„Bloß weil wir uns ein Warenlager mit Westkaffee anlegen, darf ich nicht in die Pioniere.“
Paps schaut mich merkwürdig an.
„Seit wann ist die Pionierorganisation für Empfänger von Westkaffee gesperrt?“
„Paps, würden wir Omas Einfluss begrenzen, dürfte ich doch Pionier werden, oder? Pionier zu sein wäre wirklich wichtig für mich. Weil sie gerade eine neue AG im Pionierpalast gründen, genau meine Schiene.“
Paps setzt sein was-geht-mich-das-an-Gesicht auf.
„Die AG Junge Reporter, Paps, bitte, bitte.“
Paps winkt ab.
„Nun mach mal ’nen Punkt“, erwidert er unbeeindruckt, „es gibt so viele AGs, wo du …“ … kein Pionier sein musst, wollte er sagen.
„Ja“, schnaube ich, „Blockflöte, Volkstanz, Mathe, Schach.
Aber in die will ich nicht.“
„Gehst du eben in einen Sportverein, da trägt man Sportsachen und keine Pionierkleidung. Oder–“, jetzt schweigt Paps bedeutungsvoll.
Dieses Schweigen macht mich total aggressiv.
„Hör auf mit diesem Glasbläserscheiß, ich kann das nicht mehr hören. Ich will keine Glasbläserin werden, kapiert das doch endlich!“
„Deine Urgroßmutter Friederike Winterburg war eine begnadete Glaskünstlerin. Juliska, Glas hat in unserer Familie Tradition!“
„Geh mir ab mit deiner Tradition!“, gifte ich und drehe blitzschnell den Spieß um: „Sag mal Paps, was war eigentlich dein Vater von Beruf?“
Paps verschlägt es zunächst die Sprache, doch gleich hat er sich wieder im Griff und herrscht mich an: „Was soll diese blöde Frage?“
„Gar nicht blöd. Vielleicht hatte dein Vater ja das Schreibgen und ich habe das geerbt? Du erzählst nie von deinem Vater, Oma auch nicht, wenn sie uns besucht. Noch nicht mal ein Bild hast du von ihm.“
Paps‘ Miene verheißt nichts Gutes.
„Juliska, bitte!“, winselt Maminka.
„Wenn euch die Tradition so heilig ist, warum ist Oma dann keine Glasbläserin geworden, hä?“
Oma ist ein gutes Stichwort, Paps‘ Miene entspannt sich wieder.
„Juliska, Oma musste zusehen, dass sie mich allein großkriegt, da war keine Zeit für künstlerische Ambitionen.“ Na gut, ist ein Argument, wenn auch ein schwaches. Käme es von mir, würde Paps sicher behaupten: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Aber egal, was für Kinder gilt, scheint den Erwachsenen irgendwo völlig vorbei zu gehen.
„Und du? Warum baust du Rechner und entwirfst nicht bei Sachsenglas neue Schüsseln?“
Paps lässt sich nicht provozieren. Und wegen seinem Vater nochmal anzufangen, wage ich heute Abend nicht mehr.
„Vermutlich habe ich kein Glasgen, mir liegt das nicht. Oma meint …“
„Ja, Oma hinten und vorne. Oma überschüttet uns mit ihren Westpaketen. Dafür bestimmt sie alles. Nur wann wir aufs Klo gehen, dürfen wir noch selbst entscheiden!“
„Jetzt komm mal wieder runter“, höhnt Paps, „gerade du bist doch darauf angewiesen, du mit deinem vegetarischen Fimmel.“ Maminka pflichtet ihm bei: „Bratlingsmischung, Brotaufstriche, Erdnussbutter, Strümpfe, Creme, Schminke, Füller, Hefte, Ranzen – und all diese Sachen.“
„Meine Lackschuhe habt ihr vergessen“, ergänze ich kläglich.
Mir gehen die Argumente aus. Sie haben Recht und doch nicht.
Paps scheint immer noch nicht begriffen zu haben, dass er dabei ist, mir alle Zukunftschancen zu verbauen.
„Ich will Journalistik studieren!“, versuche ich zum x-ten Mal zu erklären, „dafür brauche ich gesellschaftliche Tätigkeit und die nicht gerade in einem Sportverein. Genauso wenig wie bei Glasbläsern. Aber dafür gibt es ja nicht mal eine AG.“
„In deinem Alter weiß man sowieso nicht, was man will.
Heute so und morgen so. Warte mal noch ein paar Jahre, dann sprechen wir uns wieder“, höhnt Paps.
„Die Gräfin, die hilft mir jetzt wenigstens!“ Mein Paps bringt mich gerade zur Weißglut. Mir egal, dass das ganze Haus an unserer Auseinandersetzung teilhat.
„Juliska, nicht so laut“, versucht mich Maminka zu beschwichtigen. Wenn die Gräfin hört wie wir sie nennen, dann ist was los.
Aber es ist Paps, der völlig austickt.
„Was sagst du da? Dir helfen? Wobei denn, hä? Etwa beim Pionierwerden? Das könnt ihr vergessen, alle beide, denn ich unterschreibe nicht, niemals, verstehst du? Nie!“
„Du wirst schon sehen, eines Tages werde ich kriminell, weil ich durch meine Eltern gehindert wurde, normal wie jedes DDR-Kind aufwachsen zu dürfen!“
Ein Gedenkgottesdienst wird gefährlich. Was macht Frau Pfefferstein mit einer Schneekugel in der Kirche?
Montag, 13. Februar 1989
Im Treppenhaus treffe ich, den Mülleimer schwenkend, Anne, die zur Haustür hereinkommt. In ihrem weißen Kunstpelzmantel und dem vor ihrem Bauch baumelnden passenden Muff sieht sie aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Dazu trägt sie weiße Stiefel.
„Gut, dass ich dich treffe, Auguste“, sagt sie hastig, „kannst du mir mal deine roten Schnürstiefel borgen?“
Ab und zu borgt sich Anne von mir Lackschuhe aus. Das ist dann das Tüpfelchen auf dem i, der absolute Hingucker.
„Mama hat mir einen schwarzen Samtrock genäht, dazu würden die Lackstiefel super aussehen.“
„Hol sie dir, wenn du sie brauchst“, bin ich einverstanden, „aber am besten, wenn meine Eltern nicht da sind. Oder sag mir einfach Bescheid, ich bring sie dir runter.“
Paps und Maminka müssen nicht alles wissen.
Annes Mama schaut suchend aus der Tür.
„Beeil dich, sonst verpassen wir die Bahn. Dann kriegen wir wieder keinen Sitzplatz.“
„Konzert?“, mutmaße ich.
Herr Hagenbach spielt nämlich in der FKK, der Freien Kult Kapelle. Das ist eine Band, die nicht offiziell zugelassen ist, denn sie kritisieren den Sozialismus und singen Texte, die der Partei nicht gefallen. Konstruktive Kritik, verteidigt Anne ihren Papa immer. Herr Hagenbach und die FKK wollen die DDR nicht abschaffen, sondern sich durch ihre Kunst für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz einsetzen. Wenn wir so einen Sozialismus hätten, meint Anne, wäre ich besser dran.
Dann würde nur meine Leistung zählen und nicht meine Nichtzugehörigkeit. Wenn wir so einen Sozialismus hätten, würde Paps mir das Aufnahmeformular für die Pioniere ohne Kommentar unterschreiben.
Aber wir haben so einen Sozialismus nicht.
Wir haben die Graafs.
Und deswegen bekommt die FKK von Herrn Hagenbach niemals eine Lizenz und muss illegal spielen. Jeder Auftritt wird nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda publik gemacht. Bisher kriegte sie keiner zu fassen. Das ist peinlich für Graafs. Bei jedem Konzert singt Herr Hagenbach das Lied für den Nachbarn. Jeder aus dem Publikum weiß, es ist an Graafs gerichtet.
Herr Hagenbach singt, wie schön es wäre, sich mit den Nachbarn spontan im Hof auf ein Bier zu treffen, einen Schwatz zu halten oder sich gegenseitig zu helfen. Aber wie soll man sich auf ein Bier treffen, wenn der Nachbar nur in seinem Dienstwagen herumfährt und eine Unterhaltung schon deswegen unmöglich ist, weil man sich sorgen muss, dass die Stasi alles mithört? Ich finde Herrn Hagenbach mutig, mein Vater würde sich nie trauen, die Graafs so zu provozieren.
„Wir fahren in die Kreuzkirche“, klärt mich Anne auf. Ich checke nichts. Sind Hagenbachs fromm geworden?
„Heute ist der 13. Februar.“
Klar, morgen hat Paps Geburtstag.
Das aber meint Anne nicht.
„Am 13. Februar 1945 wurde Dresden zerstört.“
Achja. Ich klatsche mir mit der flachen Hand an die Stirn. Wie konnte ich das vergessen! Paps wurde kurz nach der Bombardierung geboren.
„Wir gehen zum Gedenkgottesdienst wie jedes Jahr.“
Anne tut, als gingen sie freiwillig auf eine Pflichtveranstaltung. Das will ich sehen.
„Ich komm mit wenn ich darf, ja?“
Schnell renne ich nach oben. Dass ich den vollen Mülleimer in die Küche zurückstelle, merke ich gar nicht. Ich greife mein Portemonnaie, steige in die Stiefel, fahre mit einem Arm in meine Winterjacke, schnappe mit der anderen Hand die Packung Duplo, die heute in einem frisch eingetroffenen Westpaket lag.
Als ich schon fast aus der Tür bin, melde ich mich ab:
„Maminka, ich gehe mit Hagenbachs mal in die Kreuzkirche.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, bin ich weg. Ich höre Maminka rufen: „Ich denke, du wolltest den Mülleimer runter bringen?“
Hagenbachs warten schon ungeduldig im Treppenhaus. Obwohl wir, so flott es bei diesen winterlichen Straßen geht, zur Straßenbahn hetzen, haben wir leider Pech. Sie rollt uns vor der Nase davon. Während der Wartezeit spendiere ich eine Runde längste Praline der Welt. Anne darf gar nicht so viel Süßes essen. Leistungssportler eben. Dafür mache ich die Packung klar, mein Magen erinnert mich, dass ich ohne Abendbrot unterwegs bin.
Beim eiligen Überqueren des Altmarkts spüre ich merkwürdiges Magendrücken. Das ist weniger dem fehlenden Abendbrot geschuldet, als vielmehr der anwesenden Polizei. Sie hocken stumm auf ihren LKWs und glotzen in die Dunkelheit, während wir uns mit den Massen durch die riesige Kirchentür quetschen. Herr Hagenbach bahnt uns einen Weg auf die erste Empore. Leider gibt es nur noch Stehplätze. Die Kirche ist brechend voll. Ich war noch nie auf einer Friedensveranstaltung, zu der die Leute freiwillig kommen.
Der Gottesdienst beginnt. Während der Ansprache schaue ich interessiert herum und entdecke schräg über mir Nöller mit Pinselchen. Jede Wette, dass Nöller nie und nimmer mit Billigung seines Direktor-Vaters diesen Gedenkgottesdienst besucht. Auch Pinselchen hat garantiert keine Erlaubnis, Ereignisse dieser Art durch ihre Anwesenheit bedeutender zu machen. Wo deren Mutter doch den Kurs der Anpassung fährt.
Stünde ich nicht so eingekeilt zwischen den Massen, ich wäre getürmt. Es tut weh, die beiden zu beobachten. Was findet Nöller bloß an der? Es macht mich wahnsinnig, dass dieser Mensch sich so wegwirft. Pinselchen ist wirklich die Letzte, die ich ihm gönnen würde, davor kämen viele andere, zum Beispiel – ich. Während ich mit offenen Augen träume, welche Westherrlichkeiten ich diesem Jungen schenken könnte, vorausgesetzt, ich rücke endlich in sein Blickfeld, mache ich eine noch gravierendere Entdeckung. Unten im Kirchenschiff, auf der ersten Reihe, sitzt die Hexe.
Aus der Traum.
Aufgeregt knuffe ich Anne und verursache ein wenig Unruhe. Aber dann folgen die Blicke ihrer Eltern meinem ausgestreckten Arm. Frau Hagenbach schaut fragend zu ihrem Mann. Der zuckt mit den Achseln. Mein anfänglicher Schrecken verfliegt, als mir einfällt, dass Hexerei in Kirchen nicht funktioniert.
Unsere Aufmerksamkeit wird von der Hexe abgelenkt, als ein riesiges Spruchband auftaucht. Weg mit dem Wehrkundeunterricht!, steht darauf. Gegenüber hält jemand ein Plakat hoch.
Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Flugblätter flattern von der obersten Empore durchs Kirchenschiff. Eins landet genau vor meinen Füßen. Schwerter zu Pflugscharen lese ich. Dass es in der Kirche so kurzweilig ist, hätte ich nicht gedacht. Kurz vor zweiundzwanzig Uhr, genau zu der Zeit, als damals der erste Angriff auf Dresden begann, läuten die Glocken. Damit ist dieser Teil des Gottesdienstes vorbei.
Wir sollen jetzt in stillem Gedenken zur Kathedrale gehen, wo der Gottesdienst fortgesetzt werden wird.
Es ist die reine Geduldsprobe, bis wir wieder auf dem Altmarkt stehen, immer geschoben und gedrängt zwischen den Tausenden, die mit uns aus der Kirche kommen. In dem Gewusel sehe ich Nöller und Pinselchen nicht mehr. Weil es mir aber einen Moment so vorkommt, als sähe ich Jakob und Torsten, verliere ich Hagenbachs aus den Augen. Suchend blicke ich mich um, aber die Menge schiebt mich unaufhaltsam in Richtung Tür. Wo ist Anne?
Wenn ich Hagenbachs nicht finde, werde ich gleich zur Straßenbahn laufen, alleine traue ich mich nicht in die Kathedrale.
Da legt mir Frau Hagenbach die Hand auf die Schulter, erleichtert atme ich auf. Herr Hagenbach hat Anne bei der Hand genommen. Gemeinsam mit den anderen bewegen wir uns langsam zum Neumarkt, Richtung Ruine der Frauenkirche.
Zunächst hatte es nach dem Bombenangriff den Anschein gehabt, als sei die Frauenkirche unbeschädigt geblieben. Keiner ahnte, dass die vielen, im Keller gelagerten Filmrollen, vor sich hin brannten und wer weiß wie viel Hitze an das Mauerwerk abgaben. Zwei Tage später stürzte die Kirche ein. Seitdem überwuchern Gras und Unkraut den riesigen Trümmerberg, der als besonderes Mahnmal bleiben soll wie er ist.
Davor schaukeln in flackerndem Kerzenlicht Origami-Kraniche, an die kahlen Sträucher gebunden oder die Absperrzäune gehängt. Herr Hagenbach fischt vier Kerzen aus der Tasche und lässt das Feuerzeug klicken. Über dem Neumarkt liegt feierliche Stille. Alle sind beschäftigt mit Kerzen anzünden, Kranichen aufhängen und stillem Gedenken. Ich fühle mich wie auf dem Friedhof bei einer Trauerfeier. Nur, dass Beerdigungen nicht von der Polizei überwacht werden.
Von wo die Unruhe ausgeht, weiß ich nicht. Da, wo wir brennende Kerzen aufstellen, ist es nicht. Aber irgendwo kommt es her. Plötzlich stehen wie aus dem Boden gestampft, Polizisten zwischen uns und greifen Leute, auch Herrn Hagenbach, der sich aber schimpfend wehrt und schnell in der Dunkelheit verschwindet.
Auch Frau Hagenbach scheint die Nacht verschluckt zu haben. Anne ist ebenfalls weg.
Ich bin allein. Das stimmt natürlich so nicht, denn rechts und links von mir wird geschrien, gebrüllt, geschimpft. Voller Angst renne ich los und finde mich kurz darauf vor der Kathedrale wieder. Aufmerksam mustere ich, wer neben mir läuft, weil ich hoffe, Hagenbachs zu finden.
Meine Beklemmung wächst, als ich inmitten fremder Menschen in die Kathedrale gedrängt werde. So sehr ich mich recke und verrenke, Hagenbachs bleiben verschwunden.
Dann erkenne ich doch jemanden und erschrecke furchtbar:
die Hexe läuft genau vor mir. Kein Zweifel, sie ist es: dieser verbeulte beige Hut, dieser grau-braun-karierte Mantel mit dem speckigen Kragen. Mantel und Hut trägt die Alte Sommer wie Winter. Ich habe noch nie gesehen, was sie darunter anhat, nur dass sie immer dunkle Hosen trägt.
Obwohl es Blödsinn ist zu behaupten, sie hätte mich hypnotisiert, kommt es mir aber tatsächlich so vor. Eingeklemmt in Menschenmassen, die alle Zuflucht in der Kathedrale suchen, schiebt uns der Pulk mal in diese, mal in jene Richtung. Ich rette mich in eine hintere Bankreihe. In den Gängen stauen sich die Menschen. Immer noch vermisse ich Hagenbachs.
Angespannt mustere ich, wer sich durch die Gänge drückt.
Niemand, der wie Hagenbachs aussieht.
Die Masse stockt, der Gedenkgottesdienst wird fortgesetzt.
Mit den Augen suche ich die Reihen vor mir ab. Auch keine Hagenbachs. Ich bin auf unserer Reihe angelangt, beuge mich ein wenig vor und wende den Kopf nach rechts, um zu sehen, wer neben mir sitzt. Als ich die entgegengesetzte Richtung abchecke, erschrecke ich ein weiteres Mal. Zwei Plätze neben mir sitzt die alte Hexe, in der Hand einen Gegenstand. Nicht etwa einen Hexenbesen, Knochen oder anderen Fetisch, nein, sie hält eine Schneekugel. Keiner beachtet ihr Tun, niemand grinst spöttisch oder zeigt auf sie. Dabei ist eine Schneekugel ja wahrhaftig kein religiöser Gegenstand, sondern ein Kinderspielzeug! Tarnt sie sich damit, um nicht als Hexe aufzufallen? Die Suche nach Hagenbachs gerät ins Hintertreffen, die Schneekugel fesselt mich. Plötzlich schwebt sie nach oben, teilt die im Gang Stehenden und verschwindet Richtung Tür.
Wie von unsichtbarer Schnur gezogen, folge ich ihr. Draußen, im Schein der Straßenlampen, beugt sich die Hexe über ihre Tasche und die Schneekugel verschwindet. Jetzt bemerkt sie mich.
„Ach du bist’s Julina, bist du mit den Eltern da?“
Stumm schüttele ich den Kopf.
„Auf mich wartet um die Ecke ein Taxi, wenn du willst, kannst du mitfahren!“
Wie in Trance laufe ich hinterher. Als sie die hintere Tür für mich öffnet, schrecke ich auf. „Nein!“ Ich renne weg, so schnell ich kann.
Um diese Uhrzeit fahren die Straßenbahnen nur noch selten.
Ich erwische eine, die aber leider in die entgegengesetzte Richtung fährt, zum Blauen Wunder. Fast eine Stunde warte ich dort auf den Bus nach Hause. Weit nach Mitternacht bin ich endlich daheim. Mir schlottern noch immer die Knie von der unheimlichen Begegnung. Die Ungewissheit, was mit Hagenbachs ist, tut ein Übriges.
Paps schläft schon, doch Maminka sitzt vollkommen aufgelöst im Wohnzimmer. „Julina“, – dass sie mich mit vollem Namen anspricht, verrät ihre Nervosität, „meine Güte Kind, ich dachte schon, dir sei was zugestoßen.“ Ich solle jetzt schleunigst ins Bett. Und nächstes Mal solche Ausflüge bitte mit ihr absprechen und nicht spontan unternehmen. Um sie nicht noch mehr zu beunruhigen, erzähle ich nichts von der Polizei und den verschwundenen Nachbarn. Wenn Anne der Polizei in die Fänge geraten ist, kann sie das Fechten vergessen. „Du gehst morgen zwei Stunden später, ich schreibe dir einen Entschuldigungszettel“, sagt Maminka. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Obwohl ich so müde bin, kann ich lange nicht einschlafen, weil ich nicht weiß, was mit Hagenbachs ist.
Anne lacht sich ‘nen Ast, mir ist zum Heulen.
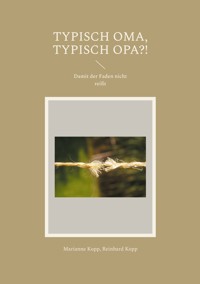

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










