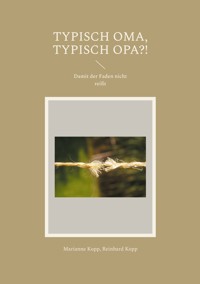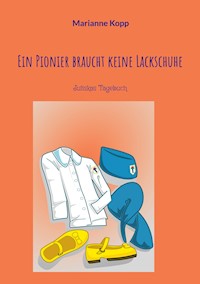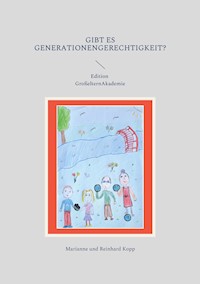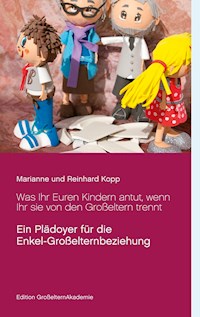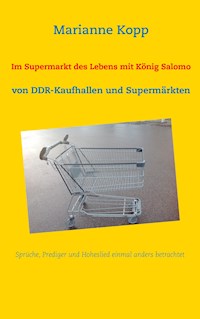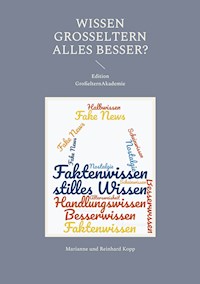
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition GroßelternAkademie
- Sprache: Deutsch
Von den rasanten Veränderungen, die großelterliches Schulwissen im digitalen Zeitalter in Frage stellen. Was ist Besserwisserei, was Fake News und warum ist es notwendig, auch im Alter dazuzulernen? Über Auffassungen zur Arbeitswelt, Vorstellungen von Gesundheit und Familie damals und heute. Von der "Plastik"euphorie zur nachhaltigen Lebensart. Auf der einen Seite Altersweisheit, auf der anderen klimaschützende Enkel - wie geht das zusammen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Glauben Sie, wenn irgendwo in dieser Welt etwas auftritt, von dem ich glaube, dass ich da was lernen kann, dann bin ich sofort unterwegs und sehe mir das an.“
(Reinhard Mohn, 1921-2009, Bertelsmann-Nachkriegsgründer, eingespielt bei „Das Blaue Sofa in Gütersloh“ am 9. Juni 2021.)
Wegen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch hauptsächlich die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Form hat rein schreibtechnische Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Inhaltsverzeichnis
Erstens: Wissen Großeltern alles besser?
Ehrlicher und zugegebener Weise
Großelterliches Wissen und die heutige Zeit
Rasante Veränderungen bringen neue Erkenntnisse
Lebenswissen ist wertvolles Wissen
Wo unser Lebenswissen kaum anwendbar ist
Wenn junge Menschen Erkenntnisse umsetzen
Was Wissen bewirken soll und wo es machtlos bleibt
Der Wissbegierde eine neue Richtung geben
Wissen und UmweltgeWissen
Ansichten und Einsichten
Schwerwiegende Irrtümer
Wissen und Wahrheit
Wissen und Verantwortung
Wissen und Erkenntnis
Unnützes oder nützliches Wissen – Entscheiden Sie selbst!
Müssen wir alles wissen?
Zweitens: Wissen ist Macht
Großelterliches Wissen als Ressource
Großelterliches Wissen ist „stilles“ Wissen
Statisches und dynamisches Wissen
Wissen, die Grundlage des Miteinanders
Verlorengegangenes Wissen – inzwischen wiederentdeckt
Wissen ist Macht – nichts wissen macht nichts?
Drittens: Wissen aus Erfahrungen und Erfahrungsschatz
Unser Wissensquell früher: Was die Erwachsenen sagten, war Gesetz
Wissensdrang aufgrund von Zweifeln
Lebensziele früher und heute
Erfahrungs- und Handlungswissen
Erfahrungswissen aus anderen Quellen
Persönliche Erfahrungen und persönliches Wissen
Großelterliches Wissen als Angebot, nicht als non plus ultra
Viertens: Wissen im Spiegel verschiedener Zeiten
Wissen wandelt sich
Wissenswandel in der Industrie
Wissensdrang treibt vorwärts: Die industriellen Revolutionen
Wissenswandel in der Krankenbehandlung
Wissenslücke? Ausgrenzung statt Inklusion – der Umgang mit Menschen mit Behinderung
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung damals
Umgang mit Menschen mit Behinderung heute
Wissensvorsprung? Erdöl – Segen und Fluch des modernen Zeitalters
Freizeitgestaltung: gewusst wie?
Fünftens: Nostalgie: wann ist sie gut, wann schadet sie?
Nostalgie oder in Erinnerung an früher schwelgen
Nostalgie heute
Flucht in Nostalgie aus Angst vor der Gegenwart
Kennen Sie das noch?
Was machen nostalgische Gefühle mit Ihnen?
Selbsttäuschende Erinnerung oder: war früher alles besser?
Lernen Sie zu differenzieren
Das Leben besteht aus Abschieden
Unterschiedliche Sichtweisen erst ergeben ein Ganzes
Sechstens: Besserwisserei
Besserwisser sind schwierige Menschen
Besserwisserei basiert höchstens auf Halbwissen
Wie entgehen Sie der Besserwisserei?
Wahr, gut, notwendig?
Wie äußert sich großelterliche Besserwisserei?
Typ eines Besserwissers: der „Besserwessi“
Einfach mal den Mund halten
Wie entgehen Großeltern der Gefahr der Besserwisserei?
Wider besseres Wissen(können): Fakten statt Fake
Nachrichten und ihre Glaubwürdigkeit
Wie Sie Nachrichten und Fakten sortieren können
Siebtens: Statt besser wissen: besser machen
Sie dürfen sich steigern!
Was können Großeltern noch besser machen?
Achtens: Wissen kommt vom Lernen, Weisheit kommt vom Leben
Jetzt wird es ein bisschen philosophisch …
Weise Menschen und ihr Lebenssinn
Engagement fürs eigene Umfeld stiftet Lebenssinn
Weisheit des Alters
Quellenverzeichnis
Publikationen der
E
dition GroßelternAkademie
ERSTENS: WISSEN GROßELTERN ALLES BESSER?
Ehrlicher und zugegebener Weise
Ehrlicherweise müssen wir Großeltern zugeben: nein, wir wissen nicht alles besser, manches schon.
Großeltern wissen, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, das meiste klärt sich auf irgendeine Weise von selbst, wird geregelt oder findet anders eine Lösung. Das Leben hat uns gelehrt, Katastrophen sind nicht das Ende von allem. So etwas prägt.
Unsere familiären Strukturen wuchsen über die Jahre. Den familiären Alltag zu organisieren und mit Kinderkrankheiten umzugehen gehörte zu unserm Leben. Wir waren eingebunden ins Schulleben unserer Kinder. Wir wissen wie es ist, Pubertierende zu ertragen, ohne selber verrückt zu werden. Die Ängste, wenn Kinder flügge werden und das Haus verlassen, zum Studium in eine andere Stadt oder gar ins Ausland ziehen, sind noch immer bei uns abrufbar. Uns sind zwiespältige Gefühle, was die Partnerwahl unserer Kinder betraf oder betrifft, nicht fremd.
Wir backen, kochen, heimwerkern.
Kurz gesagt, wir kennen das Leben in- und auswendig – meinen wir, glauben wir, nehmen wir an.
Deswegen – sind wir uns sicher – haben wir das gute Recht, unsern Kindern und Enkeln die Richtung zu weisen, ihnen zu sagen, wo es lang geht, der Hase im Pfeffer liegt oder der Bartel den Most holt. Weil wir einen jahresmäßigen Vorteil haben. Sollen unsere Kinder erstmal mit ihren Tagen in unsere Jahre kommen, dann sehen wir weiter! So oder ähnlich mag mancher Großvater, manche Großmutter denken, wenn es ums Recht haben und Besserwissen geht.
Großelterliches Wissen und die heutige Zeit
Dabei ist vielen Großeltern entgangen, dass sich die Welt heutzutage immer schneller zu drehen scheint, obwohl das, astronomisch gesehen, natürlich Unsinn ist. Für manchen Senior trifft leider genauso das Gegenteil zu: die Tage und Stunden kriechen dahin, man weiß nichts mit sich und seiner Zeit anzufangen. Man benutzt deshalb Kinder und Enkel, dieselbe rum zu bringen, indem man ihnen seine Erkenntnisse von anno dazumal aufdrängt.
Wobei wiederum vergessen wird, dass zu „unserer“ Zeit, als wir Kinder waren, die Telefone eine Wählscheibe hatten, an jeder Ecke ein Telefonhäuschen stand, es Tante Emma-Läden gab, wo sogar angeschrieben wurde. Auf Ämtern und beim Arzt wurde mit Karteikarten, statt dem Computer gearbeitet.
Der Frühling war damals die Zeit, in der wir alle ins Freie eilten, um in kilometerlangen Staus unsere Sonn- und Feiertage bei Benzingestank auf den Straßen zu verbringen.
Wobei niemand an die Umweltschäden und ihre Folgen dachte. Kurzum, unsere Zeit war eine ganz andere, ihr Erkenntnisgewinn ist nur noch bedingt tauglich.
Rasante Veränderungen bringen neue Erkenntnisse
Unsere Welt hat sich in den letzten Jahren einschneidender geändert als zur Zeit unserer Großeltern, wo sich die Mobilität von der Eisenbahn übers Fahrrad und Auto bis zum Flugzeug entwickelte. Den entscheidenden Unterschied macht die digitale weltweite Vernetzung. Digitalisierung bedeutet nicht nur, mit einem Smartphone umzugehen oder ein paar E-Mails abzurufen. Die Digitalisierung krempelt unser bisheriges Leben völlig um. Wir kommen später nochmal darauf zurück.
Wir Großeltern sehen bisweilen mit Stirnrunzeln, dass bereits Grundschüler ihr eigenes Handy besitzen. Sie daddeln, schicken sich gegenseitig Bilder und Botschaften und filmen auch mal mit, wenn der Lehrer einen Tabubruch begeht.
Leider ist die Autorität, die zu unserer Zeit Lehrer, Polizisten oder Pfarrer hatten, im Schwinden. Vorzugsweise Lehrer sehen sich immer mehr Aggressivität von Eltern ausgesetzt, weil sie mit der Benotung ihres (manchmal faulen) Nachwuchses nicht einverstanden sind. Vor unseren Augen wächst scheinbar eine Enkelgeneration heran, die mit Problemen und Schwierigkeiten nicht mehr umzugehen lernt, sich persönlich angegriffen fühlt und beim geringsten Widerstand kapituliert. Die nichts wegstecken kann und bequem gebettet sein will.
Während wir als Kinder mit vielen Spielkameraden auf der Straße „Räuber und Gendarm“ oder „Prinzessin“ spielten, Gummitwist hüpften oder in Hüpfkästchen sprangen, sind heute oft selbst Dreißigerzonen kinderleer, weil die Kleinen auf dem häuslichen Grundstück auf eigenen Spielgeräten toben. Ein Zeichen dafür, dass sich Misstrauen selbst in der engsten Nachbarschaft ausbreitet wie eine Seuche.
Während wir früher unbekümmert spärlich bekleidet oder nackt im See herumhüpften, heißt es heute, vorsichtig zu sein. Nicht nur der mit der auffälligen Kamera, auch der mit dem handlichen Smartphone könnte heimlich Bilder von kleinen Kindern aufnehmen. Ein Umstand, den damals kaum einer von uns auf dem Schirm hatte. Deshalb hüten Sie sich, ungefragt Bilder von fremden Kindern, die hübsch im Sandkasten spielen, zu schießen. Es könnte Sie in ungeahnte Schwierigkeiten bringen. Seit es Datenschutzverordnungen gibt, ist das Leben in vielerlei Hinsicht reglementierter. Ein Umstand, einerseits nicht hoch genug zu loben, andererseits mit Schattenseiten behaftet.
Der Arztbesuch ist zwar analog, die Anmeldung aber digital geworden. Ihre Krankenkasse hat Sie mit einem Kärtchen ausgestattet, dass bei jedem Arztbesuch mit dem Computer verbunden wird.
Oder nehmen wir das Bahnfahren. Die kleinen Pappfahrkarten bei der Bahn sind schon lange passé. Heute sind Sie gezwungen, sich auf einem Display selber Ihre Strecke rauszusuchen und am Automaten zu bezahlen. Alles ohne menschliches Zutun, ohne die dienstleistende Hand eines Bahnmitarbeiters. Denn am Schalter zahlen Sie drauf.
Lebenswissen ist wertvolles Wissen
Kennen Sie den Film oder das Buch „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner? Wenn nicht, sollten Sie das eine oder andere unbedingt sehen oder lesen. Es ist ein Genuss und köstlich! Deshalb verraten wir nicht zu viel.
Wer die Geschichte kennt, weiß, worauf wir im Folgenden anspielen: Dr. Hagedorn ruft seine Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass er sich verlobt hat. Darauf sie: „Du hast dich verlobt? Schreck, laß nach! Hildegard Schulze? Kenne ich nicht. Weshalb denn gleich verloben? Dazu muß man sich doch erst näher kennen. Widersprich nicht. Das weiß ich besser. Ich war schon verlobt, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Wieso willst du das hoffen? Ach so!“ (Seite 192, Erich Kästner, Drei Männer im Schnee, Copyright 1931 by Rascher&Cie. AG, Zürich)
„Das weiß ich besser als du ...“ ist hier keine Besserwisserei, sondern Lebenserfahrung. Manchmal dürfen Großeltern sagen: „Das weiß ich besser als du“, weil dem wirklich so ist.
Wir tauchen nochmal in die Geschichte von Erich Kästner ein. Dr. Hagedorn ist seine Verlobte abhanden gekommen, er kennt nur ihren Allerweltsnamen und hat keine Adresse. Seiner Mutter kommt der nicht unbegründete Verdacht, ihr Sohn sei einer Betrügerin auf den Leim gegangen. An dieser Stelle zitieren wir eine weitere Weisheit von Mutter Hagedorn: (Kästner, Seite 210) „Du bildest dir immer ein, man merkte auf den ersten Blick, ob an einem Menschen etwas dran ist oder nicht. ... Wenn Du recht hättest, müßte die Welt bißchen anders aussehen. Wenn alle ehrlichen Leute ehrlich ausschauten und alle Strolche wie Strolche, dann könnten wir lachen ...“
Natürlich geht die Geschichte gut aus: Dr. Hagedorn findet seine Verlobte wieder und kassiert im Film dabei die Rüge seiner Mutter: „Ein brauchbarer Detektiv wärst du nicht geworden.“ Alles andere lesen oder sehen Sie am besten selbst.
Manchmal juckt es uns Großeltern in den Fingern. Wir würden am liebsten kräftig mitmischen, uns einmischen, auf den Tisch hauen, Kinder und Enkel gleichermaßen durchrütteln und das Heft selbst in die Hand nehmen. Sich zurückzuhalten kostet dabei mehr Kraft und Nerven, als einzuschreiten. Beißen Sie sich trotzdem auf die Zunge, lassen Sie die Fäuste in der Tasche. Denn Großeltern, die ungebeten und ungefragt ihre Weisheiten zum Besten geben, werden als besserwisserisch und sich einmischend abgetan. Das gäbe leichtes „Futter“ für Generationenkonflikte.
Wo unser Lebenswissen kaum anwendbar ist
Bei genauerem Hinsehen bleibt oft nur das Eingeständnis: Obwohl es nur wenige Jahrzehnte her ist, kennen wir vieles nicht mehr wieder.
Beispielsweise, wie es heutzutage in den Schulen zugeht. Weder die Schulzeit unserer Kinder, schon gar nicht unsere eigene, können wir mit der unserer Enkel vergleichen. Besonders nicht in Coronazeiten, wo vorwiegend Homeschooling angesagt war. Den Stress, den diese für unser Land ungewohnte Schulform, bei Eltern, Schülern und Lehrern gleichermaßen verursachte, können Großeltern nicht annähernd nachfühlen. Als wir Kinder waren oder unsere Kinder in diesem Alter, war es zehn und mehr Jahre „normal“, morgens den Schulranzen aufzuschnallen und für sechs oder mehr Stunden im Schulhaus zu sitzen, wo der Lehrer den Unterrichtsstoff mit Kreide an die Wandtafel schrieb. Inzwischen ist das Tafelsystem vielerorts digital. Einer von vielen Unterschieden zu unserer Zeit.
Für uns war es damals „normal“, dass dieser oder jener mal „Klassenkeile“ bezog, es Klassenbeste und Schlusslichter gab, dass Lehrer uns runtermachten oder wir Hausaufgaben vergaßen. Schulbrote aus der Dose, statt Snacks vom Kiosk, Mittagessen daheim, statt in einer Schulkantine. Geregelte Nachmittagsbetreuung für Schüler gab es nur in der ehemaligen DDR, Schulhort genannt. Dort fertigten die Schüler nach dem Mittagessen ihre Hausaufgaben und widmeten sich unter staatlicher Aufsicht Freizeitaktivitäten, bis es Zeit war, heimzugehen.
Das alles gab und gibt es in Zeiten der Pandemie nicht mehr. Jetzt müssen die Kinder daheim vor dem Bildschirm dem Unterricht folgen, die Hausaufgaben runterladen, ausdrucken, ausfüllen, einscannen und wieder hochladen. Wo nur ein Computer für mehrere Kinder zur Verfügung stand, gab es ziemliches Gedränge, manches Kind musste auf dem Smartphonedisplay dem Unterrichtsgeschehen folgen. Außerdem waren viele Eltern ebenfalls im Homeoffice, was beileibe kein Spaß war, denn auch sie mussten für ihr Geld harte Leistung bringen und darauf achten, dass ihnen während einer Videokonferenz nicht die Sprösslinge durchs Bild liefen. Daneben waren noch der Haushalt und die Zubereitung der Mahlzeiten zu bewältigen. Wer es sich leisten konnte, ließ liefern, aber viele, das besagen entsprechende Statistiken, kochten wieder selber. Nicht mal die Großeltern konnten helfen, weil die im ersten Lockdown auch isoliert wurden.
Wie sich solche Situationen anfühlen, erfassen wir Großeltern nur noch aus der Zuschauerperspektive. Damals geriet unser Familienalltag höchstens dann durcheinander, wenn es eine Grippewelle gab und alle darnieder lagen, wenn Kinder über längere Zeit erkrankten, ein Umzug anstand oder eine familiäre Tragödie wie Trennung oder Tod. Unser Leben lief doch bis dato im immer gleichen Trott: Arbeit, Schule, Ferien, Urlaub, Wochenenden, Feiertage.
Unser aller „Normalität“ hat tiefe Risse bekommen. Es wird sie so nie wieder geben. Unsere bisherige Lebenserfahrung passt einfach nicht mehr eins zu eins zur heutigen Realität.
Wenn junge Menschen Erkenntnisse umsetzen
2018, während die Hitze- und Dürrewelle weite Teile Europas erfasste, setzte sich ein kleines schwedisches Mädchen mit einem selbstgemalten Plakat vor den Reichstag in Stockholm, um für Klimaverbesserungen zu „streiken“, was in ihrem Fall bedeutete, nicht mehr zu Schule zu gehen.
Später streikte sie nur freitags, was der Beginn der Fridays for Future-Bewegung war. Was dann folgte, wurde zu einem unaufhaltsamen Strom. Auch in Deutschland streiken inzwischen jeden Freitag Schüler für besseren Klimaschutz und halten uns Großeltern vor, in der Vergangenheit durch fahrlässiges Handeln die Umwelt zerstört zu haben.
Was zunächst wie Effekthascherei oder Schulfaulheit aussah, hat sich als ernst zu nehmende Bewegung etabliert. Die jungen Menschen haben die Politik so vor sich hergetrieben, dass schlagartig alle zur Bundestagswahl stehenden Parteien ihr „grünes Gewissen“ entdecken und manche sogar die dafür gegründete Partei, Bündnis 90/ Die Grünen in den Schatten zu stellen versuchen.
Während wir an diesem Buch schreiben, bewirbt sich eine weibliche Grüne um die Nachfolge von Angela Merkel, gegen zwei Männer aus den Volksparteien.
Was Wissen bewirken soll und wo es machtlos bleibt
1972, da waren viele von uns noch im jugendlichen Alter, erschien das Buch „Grenzen des Wachstums“, herausgegeben vom Club of Rome. In diesem Buch wurde ein bis dahin nicht gekanntes Weltuntergangsszenario apokalyptischen Ausmaßes gezeichnet. Wenn wir weiter so leben und wirtschaften, so der Club of Rome 1972, dem ungehemmten Wachstum und der Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung natürlicher Rohstoffe nicht Einhalt gebieten, zerstören wir unseren Planeten. Rasches und entschiedenes Handeln sei geboten, um das Steuer herumzureißen. Kontroverse Reaktionen, sowohl von politischer wie medialer Seite folgten. Die einen waren tief betroffen, die andern äußerten unverhohlene Ablehnung. Dennoch reichte dieser Bericht, das Vertrauen in den unermesslichen technischen Fortschritt und damit verbundenen Wohlstand nachhaltig zu erschüttern.
Heutige Wissenschaftler sprechen inzwischen von den Grenzen der Anpassung. Gelingt es nicht, den Klimawandel um zwei Grad zu stabilisieren, wird es Situationen geben, wo die Anpassung entweder zu teuer sein oder uns überfordern wird.
Vier Jahre vor dem Erscheinen von „Grenzen des Wachstums“, 1968, erschien zunächst in englischer, 1973 dann in deutscher Sprache, das Buch des amerikanischen Biologen Paul Ehrlich „Die Bevölkerungsbombe“. Ehrlich prognostizierte eine bevorstehende Katastrophe, weil es aufgrund der Bevölkerungsexplosion in absehbarer Zeit zu wenig Nahrung für alle gäbe.
Der 2016 verstorbene amerikanische Futurologe Alvin Toffler brachte 1970 ein Buch unter dem Titel „Der Zukunftsschock“ heraus. Er beschreibt darin Entwicklungen, die seinerzeit kaum einer für möglich gehalten hätte. Dass sich beispielsweise die Familie als feste Institution auflösen, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten und Familien gründen werden. Er kündigte die Digitalisierung mit der blitzschnellen Verbreitung von Nachrichten an und prognostizierte die Verlegung der Arbeit von Großraumbüros nach Hause. Sein Buch beschreibt die Übergangszeit in das Zeitalter des Super-Industrialismus und was diese Entwicklung mit jedem von uns machen würde, falls wir nicht handelten. Wer dem nicht gewachsen sei, so Toffler, werde physische und psychische Folgen spüren mit Symptomen wie Reizbarkeit, Erschöpfung, Lethargie oder panischer Angst.