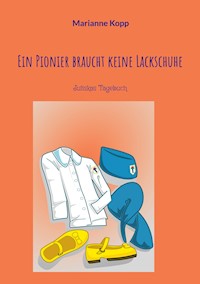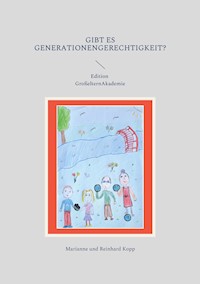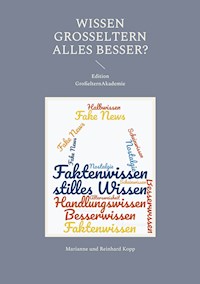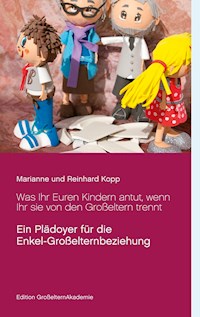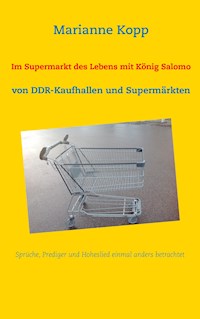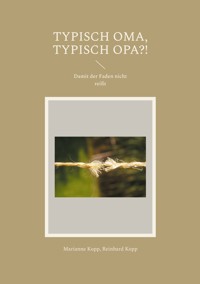
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition GroßelternAkademie
- Sprache: Deutsch
Stark überarbeitete Neuauflage. Wir haben das Buch um die Themen Klimawandel, Digitalisierung und Altersbilder erweitert, weil daran niemand mehr vorbeikommt. Aufgenommen haben wir auch das klassische Großelternthema ums Verwöhnen. Herausgekommen ist wieder ein humorvoller Ratgeber für Großeltern mit einem Quäntchen Lebensberatung für die ältere Generation. Dieser Ratgeber gibt Antworten und Denkanstöße für eine gelingende Großelternschaft, von der nicht nur die junge Generation profitiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marianne und Reinhard Kopp beschäftigen sich seit der Geburt ihres ersten Enkelkindes vor mehr als fünfzehn Jahren mit Großelternschaft.
Sie haben die GroßelternAkademie als Privatinitiative gegründet, halten Vorträge, Seminare und Workshops zur Großelternschaft. Sie leben in der Nähe von Ulm.
Alle Beispiele aus der Ich-Perspektive stammen vorwiegend von Marianne
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Zweiten Auflage
Am Anfang
Nicht wie ein Ei dem andern
Vielseitige Großeltern
Digitalisierung
Klimawandel ist kein Spleen der jungen Generation, sondern unser Nachlass an sie
Schenken, schlucken, schweigen?!
20 Rechte für Großeltern
12 Regeln für Großeltern
Verwöhnen Sie Ihre Enkel richtig?
Verwöhnen Sie sich auch selbst
Altersbilder, Altersstereotype
Quellennachweis:
Edition Großelternakademie
Unsern Enkeln Finn, Svenja, Tian, Pepe und Aria
Ohne Euch hätten wir uns nie auf diese Reise begeben.
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Das Erscheinen unseres ersten Buches »Typisch Oma, typisch Opa?!« (2019) ist zwar erst ein paar wenige Jahre her, dennoch kommt es uns so vor, als sei viel mehr Zeit vergangen. Mitten in Europa tobt ein Krieg, »Fridays for Future« hat sich gegründet und als Pendant »Omas for Future«. Menschen jeden Alters bewaffnen sich mit Sekundenkleber und blockieren wichtige Straßen, indem sie sich auf die Fahrbahn kleben. Klimaschutz und Nachhaltigkeit dürften auch bei der Seniorengeneration wenigstens als Begriffe angekommen sein.
Dazu kommt, dass mancher von uns Älteren sich von Unternehmen wie der Deutschen Bahn ins Abseits gedrängt fühlt, weil Fahrkarten nur noch am Automaten erhältlich sind, die menügesteuert sind und wer dieses Prinzip nicht beherrscht, wird vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen.
Um die Themen Klimaschutz, Digitalisierung, Verwöhnen und heutige Altersbilder haben wir diese Auflage ergänzt.
Den Oma-Opa-Test aber suchen Sie vergeblich. Wir haben ihn ein wenig überarbeitet und unter dem Titel »Küche, Kreuzfahrt, Kombizange?« als Buch herausgebracht.
Wir hoffen, dass mit unserm Großelternratgeber wieder eine praxistaugliche Handreichung für den persönlichen oder den Gebrauch in Großeltern-Gruppen herausgekommen ist.
Marianne und Reinhard Kopp, GroßelternAkademie
AM ANFANG
räumen wir mit dem Mythos auf, dass früher alles besser war und erklären Ihnen, wer die Großelternrolle eigentlich erfunden hat.
Liebe Großeltern,
wenn Sie an Ihre Großeltern denken, was fällt Ihnen ein? Oder auf? Gehen wir zeitlich noch weiter zurück: Besitzen Sie eventuell noch vergilbte Fotos aus der Zeit Ihrer Urgroßeltern, einer Zeit, in der heiß diskutiert wurde, ob Frauen Fahrradfahren dürften? Dass auf solchen Fotos alle angestrengt dreinblicken, lassen wir außen vor. Das war der Fototechnik mit ihren langen Belichtungszeiten geschuldet. Uns fällt auf, dass es sich wirklich um alte Leute handelt, alt im Sinn von hilfsbedürftig, unselbstständig, vulnerabel. Gebrechliche alte Leute. Auch wenn sie auf solchen Fotos aufrecht stehen und mit Würde in die Kamera blicken, lebten die wenigsten von ihnen allein und selbstbestimmt. Viele waren von der nachfolgenden Generation finanziell und sozial abhängig. Nur wenige wurden älter als achtzig Jahre und davor waren sie meist so gebrechlich, dass die Tage mit zunehmendem Alter mühseliger wurden. Nur die wenigsten konnten Großelternschaft mit Enkeln leben oder ein Rentnerdasein genießen, das dem der heutigen Senioren auch nur annähernd vergleichbar wäre.
Die Großeltern unserer Großeltern und die Seniorengenerationen vor ihnen waren eher auf Hilfe angewiesen, als dass sie andern helfen konnten, z. B. im Haushalt oder bei der Erziehung der Enkel. Viele Großväter litten unter Kriegsverletzungen und Altersbeschwerden, unsere Großmütter waren gebeugt von der Last ihrer Jahre. Anstelle von Parfüm gebrauchten sie mit Mitte sechzig Einreibesalben. Ein farbenfrohes Kleid tragen? Das war doch unanständig, alte Leute hatten sich seinerzeit dunkel, mindestens in gedeckten Farben, zu kleiden. Zärtlichkeiten und Sexualität? Vielleicht eine neue Partnerschaft? So etwas schickte sich für Großeltern der vergangenen Jahrhunderte nicht.
Abgesehen vom Äußeren und der gesundheitlichen Lage, wie erinnern Sie Ihre Großeltern sonst? Nett, freundlich, gütig? Oder dominant, herrschsüchtig und zänkisch? Welches Bild haben Sie durch Ihre Großeltern von der älteren Generation mitbekommen? Haben Sie sich eigentlich mal gefragt, wie Sie Ihr Großelterndasein gestalten möchten, oder sind Sie in diese Rolle hineingewachsen, ohne weiter darüber nachzudenken? Gehören Sie zu jener Sorte Großeltern, die glauben, wenn Sie genügend Zeit für die Enkel reservieren, alles getan zu haben? Ist der Trend der »neuen Alten«, der Generation 50 plus, bisher an Ihnen vorüber gegangen?
Vieles, auch bei der Großelternrolle, übernehmen wir durch Nachahmung
Der Großvater hatte immer Sahnebonbons in der Tasche, wenn er Sie besuchte? Denken Sie, Sie sollten es ihm gleichtun? Während Sie seinerzeit gejubelt haben, wenn Opa kam und es Sahnebonbons gab, mault Ihr Enkel und protestiert lauthals, denn er will einen Müsliriegel, Marke Bio. Schon ist man als Opa oder Oma irritiert. Mochten Sie sich seinerzeit wie ein König gefreut haben, als die Großeltern zum Geburtstag ein Mensch-ärgere-dich-nicht als Geschenk brachten, tangiert das Ihren Enkel nur mäßig, denn gesspielt wird inzwischen stundenlang auf dem Handy mit virtuellen Teilnehmern und Sie sind außen vor. Lebensmuster, die jahrhundertelang verbindlich waren, sind in Auflösung. Die rasanten Entwicklungen unserer Zeit machen nicht halt vor unserer überlieferten Großelternrolle und dem traditionellen Familienleben. Statt über Büchern sitzen die meisten Schulkinder gebeugt über einem winzigen Bildschirm und bewgen ihre Daumen in rasender Geschwindigkeit übers Display.
Ein anderes, überkommenes Muster, ist die ständige Verfügbarkeit von Oma und Opa, als hätten die nichts Besseres zu tun, als stets in Rufbereitschaft zu sein. Sich nicht vereinnahmen zu lassen, aber dennoch aktiv am Leben der Kinder und Enkel teilzuhaben, wie soll das gehen? Wie können wir mit unseren Stärken den Kindern helfend zur Seite stehen? Sind wir die Zahlmeister der Familie? Dürfen Oma und Opa ein selbstbestimmtes Leben führen?
Fragen über Fragen, denen wir nachgegangen sind, weil wir selber eine schlüssige Antwort darauf zu finden hofften. Wir haben Erstaunliches entdeckt. Zum Beispiel, dass früher nicht alles besser war.
Früher war nicht alles besser
Um einen Einblick in das soziale Leben der Menschen von vor 400 Jahren zu erhalten, haben Forscher Lebensgeschichten, Leichenpredigten, Testamente, Heiratsurkunden, Klageschriften, Personenstandslisten und sogar Gemälde und Bilder analysiert und Erstaunliches herausgefunden. Statt Ehrfurcht vor dem Alter fanden sie eher Feindseligkeit. Wer nichts zum Lebensunterhalt beitragen konnte, war ein unnützer Esser. Alte, bettlägrige Menschen waren nutzlos. Ihnen blieb nach damaligem Verständnis nur, auf die Gnade Gottes zu hoffen, was für Spott sorgte. Ihnen gebührte nach dieser Lesart keine Ehrfurcht, sondern Verachtung.
Gemälde, auf denen alte Menschen und Kinder miteinander abgebildet sind, wurden lange Zeit als Darstellung eines innigen Verhältnisses der alten und jungen Generation fehlinterpretiert. Die neuere Forschung fand inzwischen heraus, dass hier der Kontrast zwischen der blühenden Jugend und dem vergänglichen, verabscheuungswürdigen Alter dargestellt werden sollte. Genieße die Jugend, so die Botschaft an die damaligen Zeitgenossen, denn allzu schnell kommt das Alter und damit die Vergänglichkeit.
Von Aegidius Albertinus, einem Schriftsteller, sind uns 13 Privilegien alter Leute aus dem Jahre 1610 überliefert. Die Vorrechte, die er alten Menschen zuzugestehen scheint, sind Vorrechte in Anführungszeichen. Albertinus schien alte Menschen zu verabscheuen. Nicht nur, dass er Alter mit Bedrückung und Last gleichsetzte, er verhöhnte die alten Menschen als nutzlos und rückwärtsgewandt, im Bett liegend und auf den Tod wartend. Er war mit seiner Ansicht nicht allein. Alter hatte nach damaliger Auffassung keine Zukunft und war sinnlos. Denn alte, gebrechliche Menschen steuerten nichts zum Familienunterhalt bei. Alte Menschen waren unnütz, lebten von Gnadenbrot. Heute würde solches Verhalten als Altersrassismus gebrandmarkt, auf das sich die Boulevardmedien mit Wonne stürzen würden.
Die damalige ältere Generation hatte ihren Fortpflanzungsauftrag erfüllt und wurde nicht mehr gebraucht. Das innige Band zwischen Großeltern und Enkeln, wie es sich Jahrhunderte später zwischen den Generationen knüpfte, war noch nicht mal am Beginn, das Wort Großeltern noch nicht im Gebrauch. Die Großmutter war die Ahnfrau, der Großvater der Ahnherr.
Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden Bürgerspitäler oder Siechenhäuser, in denen alte Menschen lebten. Seine Bewohner warenvon den Enkelkindern und deren Entwicklung getrennt und vom sozialen Leben außerhalb abgekoppelt. Bei der Landbevölkerung lebten die Alten zwar auf dem Altenteil und damit bei der Familie auf dem Hof, jedoch ohne emotionale Beziehung zur jungen Generation. Was uns hier grausam erscheinen mag, war auch dem Verständnis geschuldet, dass Kindheit noch nicht als Entwicklungsphase galt. Schulbildung oder Spiel waren ausschließlich dem Nachwuchs der Wohlhabenden vorbehalten.
Nachkommenschaft hatte in diesen Zeiten einen rein sozialen Aspekt. Für die ärmere Bevölkerung waren Kinder billige Arbeitskräfte und bei den Wohlhabenden als Erben die Garanten, dass der Besitz nicht an Fremde fallen würde. Kinder waren die Altersversicherung vor dem Hungertod. Ein emotionales Verhältnis, wie es heute zwischen Kindern und Eltern besteht, kannte man zu dieser Zeit nicht.
Das Wort Enkel soll vom Wort Ahne kommen, gebildet in der Ansicht, dass Enkelsöhne eine Wiedergeburt des Großvaters seien, weshalb sie oft dessen Vornamen trugen. Verbunden war diese Namensgebung mit der Hoffnung, dass sich die Kraft und die guten Eigenschaften des Großvaters auf das Enkelchen übertragen sollten.
Machen wir einen Zeitsprung ins 18. Jahrhundert. Eine der ersten ausführlichen Beschreibungen großelterlichen Lebens finden wir bei keinem geringeren als dem Dichterfürsten Goethe. Goethe und sein Großvater hatten das, was wir heute eine Enkel-Großvaterbeziehung nennen. Goethes Großeltern lebten in einem eigenen Haus, der Großvater war sogar noch berufstätig, wie sein Enkel Johann Wolfgang berichtet. Aus des Enkels Feder fließt ein gewisses Erstaunen über die Lebensweise alter Leute: Das Mittagsschläfchen, die »altmodische« Gesinnung, die Wohnungseinrichtung. Diese Äußerungen könnten durchaus auch von der heutigen Enkelgeneration stammen. Goethe konnte sich beispielsweise nicht erinnern, dass seine Großeltern sich etwas Neues angeschafft hätten. Großmütter hatten zu Goethes Zeit übrigens keinen eigenen Stellenwert, weshalb sie auch kaum erwähnt wurden.
Zwei Kunstfiguren entstehen
Von den Gebrüdern Grimm wird berichtet, dass sie ihrem Großvater regelmäßig Briefe schrieben, worin sie von ihren Fortschritten nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung berichteten. Der Großvater seinerseits geizte nicht mit Ermahnungen und guten Ratschlägen. Eine von Großeltern besonders geforderte Enkeleigenschaft – dieser Anspruch hat sich bis heute erhalten – begann sich damals herauszukristallisieren: das Bravsein. Immer wieder versicherten die Gebrüder Grimm ihrem Großvater, dass sie recht artig seien.
Im 19. Jahrhundert versorgte die expandierende Druckindustrie auch die einfache Bevölkerung mit einer steigenden Anzahl von Medien. Über Wanderhändler vertriebene Bilderbögen vermittelten auch auf dem Lande ein bürgerliches Familienmodell und gaben beim Großelternleitbild die Norm vor. Großväter wurden zu Hütern und Bewahrern der damaligen Moralvorstellungen aufgebaut und auf diese Weise zu Autoritäten innerhalb der Familie. Jedoch verschob sich diese scheinbar gefestigte Rolle recht schnell zugunsten der Großmutter. Sie wurde allmählich zur Bewahrerin der Religiosität und prägte die bis heute geltende Vorstellung: zunehmendes Alter bedeute zunehmende Frömmigkeit.
Mitte des 19. Jahrhunderts erschiendas Familienmagazin »Die Gartenlaube«. Diese Zeitschrift prägte die Großelternrolle nachhaltig. Das 19. Jahrhundert ist nicht nur das Jahrhundert der Industrialisierung, des Darwinismus und der sozialdemokratischen Idee, es ist auch das Jahrhundert zweier Kunstfiguren: des Großvaters und der Großmutter. Das Idealbild der sogenannten trigenerativen bürgerlichen Familie wurde geformt: Großeltern, Eltern, Kinder. Es gehörte sich einfach, auf Familienbildern mehrere Generationen abzubilden. Waren die Großeltern bereits verstorben, wurden sie dennoch dazu gemalt. Weihnachten in Familie hat in dieser Zeit seinen Ursprung: die ganze Familie am Heiligabend mit den Großeltern unterm Tannenbaum. Brave Enkel bekommen von freundlich und gütig dreinblickenden Großeltern Geschenke.
Gleichzeitig begann in dieser Zeit das Zelebrieren von Kindergeburtstagen. Statt an Namenstagen kamen die Großeltern zum Geburtstag zu gratulieren und brachten Geschenke. Altersgebrechlichkeit war inzwischen nicht mehr Anlass zu Spott, sondern, im Gegenteil, respektabel. Ehrerbietung gebührte der Großmutter in gedeckter Kleidung, mit Haube oder Kopftuch, dem Großvater mit Bart und Pfeife. Die Metamorphose von der totalen Verachtung alter Leute zu ihrer Überhöhung war damit vollzogen.
Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte die Werbung Großmütter als weise alte Frauen und setzte sie in Bezug zu den Enkelkindern: Großmutter brüht dem Enkel Malzkaffee oder weiß, welche Seife am besten reinigt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und darüber hinaus hielten sich die Bilder von der weisen Großmutter und dem alten, gütigen, aber auch autoritären Großvater. Auf der anderen Seite formte sich die Vorstellung, dass Menschen im fortgeschrittenen Alter keine Wünsche mehr hatten.
Die Kunstfiguren verabschieden sich allmählich ins Museum
Großeltern von heute sind alles andere als hilflose und von ihren Nachkommen abhängige Greise. Großeltern von heute sind gesünder, als es Menschen in ihrem Alter je waren. Sie sind selbstständig und meist finanziell unabhängig. Sie können gut und gerne allein leben, nicht mehr angewiesen auf ein familiäres Umfeld. Nicht wenige gestalten ihren Lebensabend auf diese Weise. Sie gehen auf Kreuzfahrt oder fliegen auf andere Kontinente. Wie die Jungen gehen sie shoppen und sitzen nachmittags in Cafés oder surfen im Internet. Ihnen steht, mit wenigen Abstrichen, die Welt offen. Sie haben die Zeit und das Geld und die meisten sogar Enkel.
Damit Sie das eine nicht lassen müssen, aber das andere auch tun können, nämlich sich um Ihre Enkel kümmern, dafür haben wir dieses Buch geschrieben. Es soll Ihnen zu einem gesunden Maß zwischen Selbstständigkeit und der Bereitschaft, für die Familie da zu sein, verhelfen. Großvater oder Großmutter zu sein ist ein spannendes Abenteuer.
NICHT WIE EIN EI DEM ANDERN
Bei aller Unterschiedlichkeit der Familienformen haben wir Großeltern wichtige Aufgaben.
Bei unseren Seminaren zerlegen wir gerne die Worte GROSSELTERN und ENKELKINDER in ihre einzelnen Buchstaben und bitten die Teilnehmer, jedem Buchstaben ein thematisch bezogenes Wort zuzuordnen.
Hier ein paar Antworten:
G
Großzügigkeit, Güte, Gefühle
R
Ruhe, Rückständigkeit, Rückschau, Rat, Räume, Reisen
O
Offenheit, Opfer, Orientierung
S
Sorgenhelfer, Sehnsucht
S
Seelentröster, Sicherheit
E
Erfahrung, Einfühlsamkeit, Essen
L
Liebe, Loslassen
T
Treue, Trösten
E
Erfahrung, Ehrfurcht
R
Richtschnur, Regeln
N
Neugier, Nähe
E
Energie
N
Neugierde
K
Kritik, Kreativität
E
Erlebnisfreude, Elan, Erlebnisse
L
Liebe, Langeweile
K
Kreativität, Kuscheln
I
Interesse
N
Natürlichkeit, Nachahmen
D
Diskussionsfreude, Draufgänger
E
Extreme, Ehrgeiz, Ekel
R
Respekt, Raufen, Reizüberflutung, Rappel
Diese Denkübung zeigt bereits: Unsere Rolle scheint immer noch festgeschrieben und klar und wir fühlen uns ihr mehr oder weniger verpflichtet. Wer diese Verpflichtung abschüttelt, aus welchen Gründen auch immer, muss sich stets erklären, verteidigen und oft sein eigenes Gewissen beruhigen.
Wir sind noch immer geprägt von einem Großelternbild aus dem vorvorigen Jahrhundert.
Um Ihnen zu verdeutlichen, wie Sie momentan Ihre Rolle als Großeltern sehen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Antworten an:
Welche soziale Funktion erfüllen Großeltern Ihrer Meinung nach?
Kreuzen Sie an, was Ihnen wichtig ist. Machen Sie dort ein Häkchen, wo Sie momentan stehen.
☐ Betreuung
☐ Erziehung
☐ Sponsoring
☐ Brücke in die Vergangenheit
Welche emotionale Funktion haben Großeltern bei der Entwicklung der Enkelkinder?
Kreuzen Sie an, was Ihnen wichtig ist. Machen Sie dort ein Häkchen, wo Sie momentan stehen.
Großeltern ...
☐ fördern die Entwicklung
☐ fördern die Widerstandsfähigkeit (Kinder stark machen)
☐ fördern die sprachliche und schulische Entwicklung
☐ geben ein Sicherheitsgefühl
☐ geben Wurzeln
Großeltern fördern die kindliche Entwicklung
Besonders Großmütter nehmen eine führende Rolle ein, wenn sie die Enkelkinder betreuen, wobei sie nebenher noch dies und das im Haushalt erledigen.
Immer wichtiger werden auch die Großväter beim Werdegang der Enkel. Lassen Großväter das Enkelkind an verschiedenen handwerklichen, gärtnerischen oder sonstigen Tätigkeiten Anteil nehmen, gibt solche Anleitung der Entwicklung der jungen Generation einen riesigen Schub. Dazu gehört auch die Vorbildfunktion bei der Ausübung eines Ehrenamtes. Dazu am Schluss dieses Buches mehr. Großväter von heute kochen übrigens genauso gut wie Großmütter.
Um die kindliche Entwicklung der Enkelkinder zu unterstützen, bedarf es darum keines speziell ausgearbeiteten Förderprogramms. Schon das Einbeziehen der Kleinen in die ganz normalen alltäglichen Abläufe unterstützt die kindliche Entfaltung.
Großeltern fördern die Widerstandsfähigkeit der Kinder
Bringen Sie den Enkeln bei, Grenzen zu ziehen, indem Sie auch selber welche ziehen. Denn es gibt Schränke, Schubladen, Räume und dergleichen, die nur für Sie zugänglich sind, in denen niemand anderes etwas zu suchen hat. Ziehen Sie in Gegenwart der Enkel auch mal Grenzen Ihren Mitmenschen gegenüber, indem Sie sich Unhöflichkeiten jeglicher Art verbitten. Dadurch machen Sie sich nicht zum hilflosen Opfer und geben den Kleinen ein Beispiel, wie das Zusammenleben funktioniert.
Lehren Sie die Enkel besonders das Recht auf ihren eigenen Körper. Bedenken Sie: Kinder haben das Recht, nein zu sagen. Nein, sie wollen nicht geküsst werden und nicht küssen. Nein, sie wollen nicht gestreichelt werden. Das kann kurz darauf wieder anders sein, aber akzeptieren Sie die momentane Verfassung. Wenn Opa die Kleinen ungeniert, ungefragt und übergriffig betatscht, werden sie glauben, das sei normal und auf diese Weise leichte Beute für Pädophile. Großeltern stärken die Widerstandsfähigkeit der Enkel, indem sie ihnen helfen, zu sich selber, ihrem Aussehen und ihren Fähigkeiten zu stehen.
Großeltern fördern die sprachliche und schulische Entwicklung
Schon die normale Ansprache und die alltägliche Unterhaltung miteinander, fördern die sprachliche Entwicklung eines Kindes. Auch Vorlesen, miteinander singen und erzählen gehören dazu. Vielleicht hat mancher von Ihnen in den Zeiten des Lockdowns Enkeln und deren Eltern beim Homeschooling mit unter die Arme gegriffen. Großeltern haben ihren Internetanschluss zur Verfügung gestellt, damit die Enkel Mathe, Deutsch, Physik u. a. per Videoschalte mitverfolgen konnten. Die entsprechenden Arbeitsblätter wurden hochgeladen und ausgedruckt. So waren wir alle ganz nahe dran an den schulischen Anforderungen von heute und konnten vielen Enkeleltern eine riesige Last abnehmen.
Großeltern geben den Enkeln ein Sicherheitsgefühl
Alle Menschen brauchen das Urvertrauen, das Gefühl, dazuzugehören und geborgen zu sein, eben die Gewissheit, dass irgendwie alles lösbar ist und gut wird. Alles zusammen gibt uns ein Sicherheitsgefühl mit dem Wissen, an einem bestimmten Ort Geborgenheit zu finden, geschützt zu sein, sich einigeln zu dürfen. Menschen, die dieses Urvertrauen nicht haben, werden ein Leben lang an sich selbst zweifeln, sind auf haltlos und getrieben. Solche Menschen werden leichter zu Opfern. Dazu später mehr.
Großeltern dürfen sich zwar nicht in elterliche Ehekonflikte einmischen, aber sie dürfen in solchen Situationen verstärkt für die Enkel da sein. Nicht, indem sie Partei ergreifen und Vater oder Mutter bei den Kindern schlecht machen, sondern, indem sie den Enkelkindern Sicherheit geben. Indem sie trösten und ihnen klarmachen, dass es nicht kindliche Schuld ist, warum Eltern sich streiten oder sogar trennen. Auch bei anderen Lebenskonflikten, Krankheit oder Tod, dürfen Großeltern die letzte Rückzugsmöglichkeit für die Enkel sein, ihr Rettungsanker, ihre Fluchtburg.
Großeltern sind die Wurzeln der Familie
Schon durch ihre bloße Existenz sind Großeltern die Wurzeln der Familie. Sie sind der Ursprung, aus dem die nachfolgenden Generationen entstehen und beantworten den Enkeln die wichtige Frage: Wo komme ich her? Die menschliche Existenz braucht diesen familiären Rahmen. Wer die Frage nach seiner persönlichen Herkunft konkret beantworten kann, hat einen wichtigen Schritt ins Leben getan. Aufgrund dieses Wissens kann das Enkelkind getrost an seiner eigenen Lebenszukunft bauen und damit die Frage nach dem Wohin ausreichend beantworten. Wer nicht weiß, woher er kommt, wird das Wohin schwerer herausfinden. Wer sich als Teil einer Familie, Sippe oder Dynastie versteht, hat es leichter, im Leben Fuß zu fassen.
Sollten Sie, liebe Großeltern, durch tragische oder besondere Umstände selber keine Wurzeln haben, so bietet sich durch die Enkelgeneration die Gelegenheit, welche zu bilden. Zwar können Sie in solchem Fall nicht zurückblicken auf Eltern, Großeltern oder andere Verwandte, aber Sie können nach vorne schauen, auf Ihre eigenen Kinder und Enkel, die Ihnen Halt und Lebenssinn geben. Ihnen dürfte deshalb die Familie besonders wertvoll sein. Bringen Sie das auf jeden Fall zum Ausdruck, es stärkt nicht nur Sie, sondern auch Ihre Kinder und Kindeskinder. Die Wurzelmetapher greifen wir nochmal im Kapitel »Was Großeltern dürfen« auf.
Wie wir unsere Rolle als Großeltern ausleben, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, nicht zuletzt von uns selbst
Junge Großeltern um die fünfzig, die selbst noch voll im Berufsleben stehen und eigene Kinder erziehen, werden andere Großeltern sein als Neunzigjährige, die vielleicht im Seniorenheim leben. Für Fünfzigjährige ist die Großelternschaft eher eine bedeutende Nebenrolle, die sie zwar mit viel Engagement ausüben, die aber noch nicht zum dominierenden Lebensinhalt wird. Denn das Berufsleben verlangt ihnen alles ab. Sind noch jüngere Kinder da, so werden die Enkel unkompliziert zusammen mit diesen groß. Die neunzigjährigen Großeltern im Seniorenheim aber – und das ist heutzutage keine Unmöglichkeit mehr – sind eine gute Anlaufstelle für Gespräche und Gedankenaustausch. Oft werden sie – auch das sagen uns entsprechende Statistiken – als »Kreditinstitut« oder »Mäzene« fungieren, die aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse ihren Enkeln gerne beispringen.
Heute spricht man von sechzig als dem neuen vierzig, d. h., noch bis zum Zweiten Weltkrieg und etwas danach, waren Menschen mit vierzig alt und verbraucht. Die Oma im gleichnamigen Roman von Peter Härtling, 1978 erschienen, ist erst siebenundsechzig. Der Autor beschreibt sie, als handele es sich um eine Greisin: alt, gebrechlich, verbraucht und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Heute, fast vierzig Jahre später, sind Siebenundsechzigjährige noch gut in Schuss und fühlen sich jung genug für neue Herausforderungen. Heute erkennt man Omas nicht mehr automatisch an der dunklen Kittelschürze und dem schwarzen Kopftuch. Großmütter von heute tragen selbstbewusst Miniröcke in aktuellen Farben, die Großväter sehen in ihren T-Shirts und den Dreiviertelhosen keinesfalls albern aus. In unserm Zeitalter darf jeder alles tragen, tun oder lassen – wie er oder sie kann und mag. Das spielt uns Großeltern doch bestens in die Hände! Davon können wir profitieren! Wir leben nicht mehr in den Zwängen von »das gehört sich nicht!« oder »was werden die Nachbarn sagen« oder »was denken die andern!« Was die andern denken oder sagen, muss uns nicht interessieren, wir sind heutzutage unser eigener Maßstab. Erlaubt ist, was gefällt, behagt, Spaß macht, ein gutes Gefühl gibt.
Dennoch wäre es falsch zu behaupten, unsere heutige Freiheit sei grenzenlos. Wir unterliegen dennoch manchen Zwängen. Die Gesundheit ist neben dem Finanziellen ein Faktor, der unsere Lebensumstände gravierend bestimmt. Auch gilt es zu beachten, wie wir leben: sind wir noch als Ehepaar zusammen oder in wechselnden Lebenspartnerschaften, die uns viel abverlangen? Leben wir getrennt, geschieden oder in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft? All das wird unsere Großelternrolle auf die eine oder andere Weise beeinflussen.
Von nicht geringer Bedeutung ist auch die Frage, in welchen Wohnverhältnissen Großeltern leben. Ihre Rolle gestaltet sich anders, wenn Sie im Heim untergebracht sind, als wenn Sie in einer kleinen Stadtwohnung leben oder noch immer in dem Haus, in dem auch Ihre Kinder groß geworden sind.
Auch nicht zu vernachlässigen: Zu welcher Gesellschaftsschicht gehören wir? Die Shell-Jugendstudie unterscheidet nach Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht und Oberschicht. Steht Ihnen monatlich gerade die Grundsicherung zur Verfügung, haben Sie ein geregeltes Einkommen oder ist Ihr Gehalt so hoch, dass Sie zu denen gehören, die sich mehr leisten können als die meisten? Alles Faktoren, die unsere Großelternrolle beeinflussen.
Selbst wenn der reiche Opa geizig ist, macht es doch einen Unterschied, ob ein finanzielles Polster vorhanden ist oder zu viel Monat für zu wenig Geld. Die finanzielle Rücklage gibt ein anderes Lebensgefühl als die Unsicherheit, ob denn endlich die dringend benötigte Zahlung eingegangen ist.
Wer in dieser Hinsicht seinen Enkeln keine Hilfestellung geben kann, hat es auch in anderer Weise nicht leicht. Geld regiert die Welt, wie der Volksmund sagt. Auch wenn Geld nun wirklich nicht alles ist, Großeltern, die in finanzieller Hinsicht sorgengeplagt sind, haben oft keine Zeit, sich in gewünschter Weise um Enkel zu kümmern. Sei es, weil ihnen der Antrieb fehlt oder sie noch kleine Nebenjobs annehmen müssen, um über die Runden zu kommen. Es kann sich auch ein soziales Gefälle gegenüber den Kindern entwickeln in der einen oder anderen Richtung: entweder agieren Großeltern als Sponsoren oder als Bittsteller. Neben der finanziellen Seite hat auch die Frage, ob es sich bei den Großeltern um leibliche oder nichtleibliche, wie den Teil einer Patchworkfamilie, handelt, Einfluss. Dazu beantworten Sie bitte nachfolgende Fragen:
Kreuzen Sie an, in welcher Situation Sie sich derzeit befinden. Mehrfachnennung ist möglich.
Bitte nutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgabe die Kommentar- oder Notizfunktion Ihres e-Readers oder ein seperates Blatt Papier.
☐ Ein-Enkelkind-Familie.
Ihre Liebe, Fürsorge und Beschäftigung konzentrieren sich auf ein einziges Enkelkind.
☐ Mehrere Enkelkinder-Familie.
Sie haben mehrere Enkelkinder aus einer Familie.
☐ Enkelkinder aus mehreren Familien.
Sie haben Enkelkinder von mehreren Ihrer Kinder.
☐ Teil einer Patchworkfamilie.
Sie haben Enkelkinder von geschiedenen, wiederverheirateten oder lebenspartnerschaftlich verbundenen Kindern.
☐ Scheidungsgroßeltern.
Ihre Tochter/Ihr Sohn sind geschieden und alleinerziehend.
☐ Verwaiste Scheidungsgroßeltern.
Die Schwiegertochter/der Schwiegersohn (oder Tochter/Sohn) haben die Enkelkinder nach der Trennung mitgenommen und unterbinden jeden Umgang mit den Großeltern.
☐ Großeltern von nicht leiblichen Enkeln.
Ihre Kinder haben Sie durch Adoption eines Kindes zu Großeltern gemacht, bzw. ein Enkelkind stammt aus einer früheren Beziehung eines Schwiegerkindes.
☐ Großeltern von Kindern aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Diese Enkel können sowohl adoptiert sein, als auch aus früheren Partnerschaften der Kinder stammen oder durch Samenspende gezeugt worden sein.
☐ Tagesgroßeltern.
Sie betreuen Ihre Enkel, während die Eltern arbeiten gehen. Das ist besonders für Großväter die Chance nachzuholen, was sie an den eigenen Kindern versäumten bzw. versäumen mussten.
☐ Ersatzeltern.
Weil die Eltern krank, nicht in der Lage oder verstorben sind, kümmern Sie sich um Ihre Enkelkinder und schlüpfen damit in die Rolle der Eltern.
☐ Großeltern aus einem anderen Kulturkreis.
Ein Elternteil Ihrer Enkel stammt nicht aus Ihrem Kulturkreis. Das kann von Vorteil sein, denn die Kinder werden mehrsprachig erzogen, Sie lernen Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen.
☐ Großeltern im Netz bzw. am Telefon.
Sie sind aufgrund großer Entfernungen vorwiegend via Internet oder telefonisch mit ihren Enkeln verbunden.
☐ Leih-, Wahl-, Pflege-Großeltern.
Sie sind als Großeltern für die Kinder einer eigentlich fremden Familie da. Von diesem Modell profitieren beide Seiten.
Solche Bestandsaufnahme führt uns vor Augen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden. Wir können an den entsprechenden Lebenssituationen nichts ändern (mit Ausnahme der Leih- oder Wahlgroßelternschaft, das ist unsere freie Entscheidung), uns nur einfügen, das Gegebene gestalten und das Beste daraus machen. Ob wir die Adoption des Enkels für gut befanden oder nicht, die gleichgeschlechtliche Partnerschaft und die daraus resultierende Familie begrüßen oder verdammen, das alles ändert nichts daran, dass wir damit zu Großeltern geworden sind, die ihrer Verantwortung gerecht werden sollten. Distanzieren wir uns oder was noch schlimmer wäre, verunglimpfen wir diese Familien, fügen wir uns selbst den größten Schaden zu. Einmal geschaufelte Gräben lassen sich nur schwer wieder zuschütten. Wer gut findet, dass wir endlich als Großeltern in einer Zeit ohne gesellschaftliche Zwänge leben dürfen, sollte sich auch in der nötigen Toleranz üben. Egal, ob Sie nur einen Enkel bzw. eine Enkelin haben, eine Rasselbande unterschiedlichster Herkunft oder Enkelkinder aus einer ganz traditionellen Familienform – wichtig ist in jedem Fall, dass Sie die Rolle als Großmutter oder Großvater ausfüllen.
Was bringt uns Großeltern eigentlich eine gesunde Enkelbeziehung?
Das ist ganz einfach zu beantworten: Lebenssinn. Für andere da sein zu können, ist der stärkste Sinnimpuls. Mit anderen Worten: Wer weiß, dass er gebraucht wird, sieht einen Sinn in seinem Leben. Wer um Lebenssinn weiß, hat Zukunft und kann vorwärts gerichtet leben. Mehr dazu am Schluss dieses Buches.
Der Umgang mit der jungen Generation hält uns selber jung. Es ist wissenschaftlich erwiesen: Wer sich um die Enkel kümmert, lebt länger. Der Umgang mit der jungen Generation führt in der Regel zur Dankbarkeit. Dankbare Menschen sind gesünder und weniger anfällig für Krankheiten.
Zufriedenheit ist ein weiterer Aspekt in Bezug auf den Umgang mit der jungen Generation. Zufriedene Menschen kreisen weniger um sich selbst und leben dadurch auch gesünder.
VIELSEITIGE GROßELTERN
Die junge Generation »tickt« so ganz anders. Wie kommt das?
Generation »Tradition« trifft Generation »Reflektion«
»Das gehört sich so« oder: »das ist einfach so«, und: »das macht man so«. Es gibt viele Großeltern, die mit diesen Sätzen aufgewachsen sind. »Man« trug eben zum Hut auch Handschuhe. Händchenhalten oder ein Kuss in der Öffentlichkeit schickte sich nicht, eine Frau ging nicht unbegleitet ins Restaurant. Solche und ähnliche »Regeln« galten noch zur Zeit unserer Großeltern, also der Urgroßeltern unserer Enkelkinder. Manch unsinnige Regel oder angebliche »Weisheit« war auf diese Weise von Generation zu Generation weitergereicht worden. Das hat sich inzwischen – glücklicherweise – grundlegend geändert. Mag sein, dass es damit auch anstrengender für uns Erwachsene und besonders für uns Großeltern geworden ist. Denn die junge Generation von heute ist selbstbewusst und reflektiert genau. »Warum ist das so?«, fragen sie zurück, wenn wir ihnen mit unseren überlieferten Weisheiten kommen wollen. Warum sollte ich als Frau nicht allein ausgehen? Weil das komisch aussieht? Wer sagt denn so was, wer bestimmt das? So oder ähnlich werden wir auch schon mal an die Wand geredet, gehen uns die Argumente aus. Mit »das war schon immer so«, lassen sich junge Menschen keinesfalls abspeisen. Zugegebenermaßen ist durch solche Reflektion auch schon mal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden, floss manch nützliche Regel durch den Abfluss der Geschichte und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Doch würde es keinem etwas nützen, zu palavern und den guten alten Zeiten nachzutrauern.
Kennen Sie diesen Witz? In einem vollbesetzten Bus steht eine alte Oma, die sich mit beiden Händen fest an die Haltestange klammert. An ihren Armen baumeln zudem noch volle Einkaufsbeutel. Sagt ein junger Mann, der gemütlich auf seinem Sitz lümmelt: »Soll ich Ihnen die Beutel abnehmen? Dann hätten Sie die Arme richtig frei zum Festhalten!«
Ja, die Zeiten von Anstand und Benehmen scheinen der Vergangenheit anzugehören. Vielleicht kriegen Sie ja Ihren Enkeln ein bisschen davon beigebracht. Nicht »weil es sich so gehört« oder weil das »höflich« ist, sondern weil es einem selbst etwas bringt, wenn man andern gegenüber rücksichtsvoll ist. Weil man mit solchem Verhalten wie, alten Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln seinen Platz anzubieten, die Welt ein kleines bisschen besser macht. Weltverbesserer möchte eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche sein. Solche Haltung baut auf und stärkt das Selbstbewusstsein.
Die »3 M Generation«
Kennen Sie die drei M der Enkelgeneration? Klar kennen Sie McDonalds, bestimmt haben Sie schon von Microsoft gehört. Sein Gründer, Bill Gates, ist einer der reichsten Menschen der Welt. Microsoft verdanken wir das meiste von dem, was auf den Computern läuft und nicht zu vergessen, das Internet. Das Netzwerk also, innerhalb dessen Ihre Enkel mit Freunden und Fremden verbunden sind. Weltweit. Das dritte M steht für MTV, den Musiksender. Hier werden den ganzen Tag Musikvideos gespielt, deren Klänge und Rhythmen nicht unbedingt unserm Geschmack entsprechen.
Auch Sie und wir gehören einer bestimmten Generation an. Generation nennt man die Menschen, die in eine bestimmte Zeit geboren wurden. Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht, die sie miteinander verbinden und Spuren hinterlassen. Wir haben also einen gemeinsamen Pool von Erlebnissen, Eindrücken, Stimmungen, auch sprachlichen Ausdrücken, mit Menschen, die zu unserer Zeit geboren wurden.
Die fünf Generationen unserer jüngsten Vergangenheit
Zwischen 1925 und 1940 Geborene
wuchsen unter schlimmsten wirtschaftlichen und politischen Bedingungen auf. Es sind die Urgroßeltern der gegenwärtigen Enkelgeneration. Erschwerend kommt bei den 1925 oder 1926 Geborenen hinzu, dass sie ihrer Kindheit und Jugend beraubt wurden.
1968er Generation
besteht aus den 1940 bis 1955 Geborenen. Gerade die in den Fünfzigern Geborenen fanden bereits bessere wirtschaftliche Bedingungen vor. Sie setzten sich von autoritären Machteliten ab und sind die Großeltern der gegenwärtigen Enkelgeneration.
Die sogenannte Babyboomergeneration
sind die von 1955 bis 1970 Geborenen. Sie wagten sich in einem aufstrebenden Land an politische und wirtschaftliche Reformen. Sie sind Großeltern bzw. Eltern der heutigen jungen Generation.
Zwischen 1970 und 1985 Geborene zählt man zur sogenannten Generation X, auch Generation Golf genannt. Diese Generation hat nach dem Wirtschaftswunder die erste Krise am Arbeitsmarkt miterlebt und war auf wirtschaftliche und soziale Hilfe durch ihre Eltern angewiesen. Sie bildeten keine eigenen sozialen Strukturen. Das X kommt hierbei aus der englischen Sprache und will die Unsicherheit ausdrücken, die so eine veränderte Lage mit sich brachte. Außerdem symbolisiert das X ein gewisses Zögern und eine Verwöhntheit, die eine Ignoranz der jungen Menschen zur Folge hatten, indem sie weiterlebten, als wäre nichts Dramatisches passiert und sich weigerten, ihren Lebensstil zu ändern und an ihre persönliche Zukunft und die ihrer Kinder zu denken.
1985 bis 2000 Geborene zählt man zur Generation Y. Das Y ist dem englischen Wort »Why« entlehnt – »Warum?« Es kennzeichnet fragende, sinnsuchende, unsichere junge Menschen, die in unsicheren wirtschaftlichen und politischen Zeiten aufwachsen. Generation Y ist die erste Generation, die mit dem Internet aufwächst und dessen Möglichkeiten vollauf nutzt, um sich ihre eigene Realität zu schaffen.
Ab 1992/93 Geborene nennt man auch digitale Eingeborene, digital natives. Bei ihnen sind alle Lebensbereiche von digitalen Medien durchdrungen. Sie wachsen mit einer immensen Fülle an Informationen auf, deren Folgen wir heute noch gar nicht abschätzen können.
Ab 1995 Geborene nennt man Generation Z, die GenZ. Wissenschaftler schließen aus dem Verhalten dieser Generation auf die Mentalität künftiger Generationen. Diese Generation hat einen noch selbstverständlicheren Umgang mit den digitalen Medien. Selbst Dreijährige wissen schon, wie sie auf dem Smartphonebildschirm durch Wischen ins Menü kommen und auf welche App ihr kleiner Finger tippen muss, um das Lieblingsvideo zu sehen. Dieser selbstverständliche Umgang könnte aber auch einen gewissen Sättigungseffekt mit sich bringen. Das IPhone von heute ist morgen schon veraltet, die VR- Brille bald nichts Besonderes mehr, Kinos mit 4D-Effekt kein Anlass für Begeisterungsstürme.
Die heutige Generation lebt in einer wirtschaftlich vorteilhaften Zeit. Es wird dringend nach Fachkräften gesucht. Sie können also ihre Lebensplanung »relaxt«, wie sie sagen würden, angehen.
Generation Klimawandelversteher
Gerade erleben wir es wieder, während wir dieses Buch überarbeiten: große Teile von Bayern und Baden-Württemberg versinken in den Fluten, die Folgen eines zweitägigen Starkregens sind. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, besonders aus der Großelterngeneration, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Selbstverständlich haben auch wir, Marianne und Reinhard, in unseren vergangenen Jahrzehnten verregnete Sommer erlebt oder Gewitterschauer, die schwere Schäden anrichteten. Im Katastrophenwinter 1978/79 in Norddeutschland wurde unser erstes Kind geboren. Damals sprach man noch von ungewöhnlichem Wetter. Inzwischen aber ist wissenschaftlich geklärt, dass sich unser gesamter Planet im Klimawandel befindet. Während es in Spanien ungewöhnlich heiß und viel zu trocken war, verregneten unsere diesjährigen Frühlingswochen.
Unsere Enkel haben es schneller kapiert, als wir es wahrhaben wollen: Wenn wir nicht alle gemeinsam, also auch wir Älteren, schleunigst umsteuern, gibt es eine Katastrophe. Deshalb schließt sich mancher der Bewegung »Letzte Generation« an oder »Ende Gelände« und wie sie sich alle nennen mögen. Die Art und Weise, wie sie ihre Anliegen proklamieren, mag uns fragwürdig vorkommen, dennoch: sie haben Recht! Die Generation Klimaversteher hat das, was wir von Kindheit an als Wohlstandsbegriff eingetrichtert bekamen, vollends über Bord geworfen. Minimalismus ist für sie angesagt, vegan statt Massentierhaltung. Sie achten auf Tierwohl und Menschenrechte. Statt es als Spinnerei abzutun oder darauf zu verweisen, dass sie mit den Jahren auch zur Vernunft kommen werden, sollten wir ihnen beispringen, so wie viele Großeltern das bereits tun und eigene Bewegungen ins Leben gerufen haben wie »Grandparents for Future«.
Weil wir in einer globalisierten Welt leben, können wir uns vor dem, was außerhalb unserer Grenzen passiert, nicht abschotten. Also spüren auch wir die Folgen von Krisen, Kriegen und Flüchtlingsströmen. Wir erleben inzwischen hautnah wie der Terror und seine Bedrohung zunehmen und sind hilflos angesichts der Tatsache, dass im Osten Europas ein brutaler Krieg ausgebrochen ist. Der globale Überschuss an Informationen steht inzwischen nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu der bisherigen Lebenszeit der jungen Generation. Sie bekommen mehr geliefert, als sie verkraften können. Angesichts solcher Herausforderungen stellt sich uns Großeltern die Frage: Wo ist unser Platz? Was für Großeltern wollen wir sein?
DIGITALISIERUNG
Ein Thema, das wir Ihnen nicht ersparen können und wollen
Wer bietet mehr?
Ein Gerät, das Fotoalben, Taschenlampe, Kalender, Videos, Tonbänder, Taschenrechner, Gesundheitsinformationen, Unwetterwarnungen, Navigation, Lexika, Wecker, Uhr, Fernsehzeitschrift, Übersetzungshilfe, Radio- und Fernsehprogramm und, und, und enthält – und mit dem man auch noch telefonieren kann. Ein Smartphone ist heute ein solches Gerät, das all diese Funktionen und noch mehr enthält.
Digitalisierung bedeutet: kein anderes, sondern ein Leben, das das alte mitnimmt
Niemand wird Ihnen Ihre guten alten Schallplatten streitig machen oder sich belustigen, weil Sie über eine umfangreiche Bibliothek verfügen. Vielleicht schreiben Sie auch noch mit der Schreibmaschine, weil dieses Gerät Sie seit Ihren jungen Jahren begleitet. Doch wenn Sie den PC, das Tablet oder den Laptop erst entdeckt haben, werden diese Geräte Sie garantiert überzeugen. Sie können sich vertippen, so oft Sie wollen (was mir beim Schreiben dieser Zeilen gerade ständig passiert...), das Schreibprogramm macht Sie darauf aufmerksam, Sie können selber nachbessern, ohne Tipp-Ex oder einen Radierer benutzen zu müssen und – Sie können von einem Text unendlich viele Kopien ausdrucken. Oder Sie versenden Ihren Text gleich per E-Mail oder legen ihn als Datei ab, ohne dass Sie Papier benötigen. Innerhalb eines Augenblicks sind Ihre Fotos, Grüße oder amtliche Schreiben beim Empfänger.
Das gute, alte Telefon ...
...früher benutzte man es dosiert und organisiert, denn telefonieren war teuer. Noch Anfang der 90er Jahre war es bei uns ausgemacht, dass wir, heimgekommen, die Großeltern per Klingelzeichen benachrichtigten: wir wählten die Nummer, ließen es dreimal klingeln und legten auf. Das war das Zeichen für: gut angekommen. Denn Telefonate tagsüber hatten ihren Preis.
Inzwischen besitzen wir Smartphones mit einer sogenannten Flatrate. Zu einem festgelegten Tarif gibt es keine zeitliche Begrenzung mehr für Telefonate. Weiter gibt es günstige, sogenannte »Datenpakete«, für die Nutzung des Internets – selbst im Ausland. Das Festnetz benutzen wir immer weniger. Die junge Generation meldet gar nicht erst eines an.
Ohne die digitale Welt
Wäre manches heute nicht möglich. Beginnen wir mit dem PKW. Anstelle von Tasten und Knöpfen gibt es ein tabletähnliches Menü, worauf alles gespeichert ist, was der Fahrzeugführer benötigt: vom Benzinverbrauch, über Navigation bis hin zu aktuellen Verkehrsmeldungen und dem Handbuch für den jeweiligen Fahrzeugtyp. Auch viele Haushaltsgeräte sind inzwischen menügesteuert. Wer die Grundlagen nicht beherrscht, ist aufgeschmissen. Genauso beim Lösen einer Fahrkarte auf dem Bahnsteig. Wer den Touchscreen nicht richtig bedient, bekommt nicht das Gewünschte. Der Bankautomat, die Weltraumfahrt, das Sat-Fernsehen: ohne Digitalisierung wäre alles nicht möglich.
Die Welt wird immer digitaler – bleibt Ihr Leben ausschließlich analog?
Die meisten Anbieter geben die 49-Euro-Tickets nur noch digital heraus. Das bedeutet, dass sich Nutzer dafür mit Ihrem Smartphone anmelden müssen. Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Zugschaffner vor allem bei jungen Menschen die Fahrkarte vom Smartphone abscannt. Ältere Menschen bleiben hierbei oft unberücksichtigt, denn viele Anbieter ignorieren den Wunsch nach einer Fahrkarte auf Papier.
Auch Kundenkarten beim Discounter oder anderen Geschäften hält man über einen Scanner.
Sollen wir wegen solcher Ignoranz und himmelschreiender Ungerechtigkeit auf die Straße gehen, uns beschweren oder einigeln? Wir meinen, dass es Zeit ist für Menschen jeden Alters, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn Digitalisierung ist ein globaler Megatrend, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Ohne elektrischen Strom könnten Sie gut leben, wenn Sie mögen. Sie leuchten abends mit Kerzenlicht oder einer Solarlampe. Zwar haben Sie dann keinen Fernsehempfang und können auch keine Waschmaschine bedienen, aber das Leben wird, wenn auch etwas sehr einfach, funktionieren. Doch ohne Digitalisierung geht es nicht. Ihr Rezept für die Apotheke – ein E-Rezept. Ihre Fahrkarte – wir haben es gerade beschrieben. Sie wollen ein Fußballticket? Nur online.
Wie hat es mal jemand ausgedrückt in Hinsicht auf die ältere Generation? »Draußen findet eine digitale Revolution statt und wir lehnen uns zurück und gehen auf Kreuzfahrt.«
Großeltern sind kaum in der Gefahr, über die digitale die analoge Welt zu vergessen
Deshalb sparen wir uns all das, was wir sonst den Usern von Smartphone und Co. ins Stammbuch schreiben: dass es da draußen noch eine analoge Welt gibt mit echten Tieren, Pflanzen und echtem Wetter, echten Menschen. Aber in diesem Kapitel möchten wir Sie ausdrücklich dazu ermutigen, sich der digitalen Welt anzunähern, falls Sie es nicht schon längst getan haben. Ihre Enkel helfen Ihnen gerne, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Falls Sie ein echtes Greenhorn auf diesem Gebiet sind, wenden Sie sich an Ihre örtliche Volkshochschule oder den Seniorenrat in Ihrer Nähe. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es den sogenannten Digitalpakt für Senioren. Dort werden Senioren jeden Alters mit der Handhabung von Smartphone oder Tablet vertraut gemacht. Ihnen wird geholfen, eine Internetadresse einzurichten und sie werden geschult im Hinblick auf Internetbetrug.
Dank Digitalisierung bieten sich im Alter mehr Chancen
Sie trainieren Ihr Gehirn am Computer, denn diese Geräte verlangen Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit. Sie bekommen neue Kontakte, können sich Hilfe organisieren oder erfahren Neues, denn Internetsuchmaschinen sind schier unerschöpflich, wenn es um Informationen geht. Mit Hilfe der Digitalisierung ist es inzwischen möglich geworden, dass alte Menschen bis zu ihrem Lebensende selbstbestimmt daheim wohnen bleiben können. Menügesteuerte Hilfsmittel (AAL-Systeme) machen es möglich.
Lernen im Alter macht Spass
Lernen im Alter ist dank Internet viel bequemer und angenehmer, als es früher der Fall war. Sie gehen keine Verpflichtungen ein, müssen keine Prüfungen absolvieren. Im Internet können Sie Zeitungen aus aller Welt lesen, mit den Enkeln, die sich vielleicht gerade in Australien befinden, kommunizieren, sich über Krankheiten informieren und noch viel mehr.
Corona hat es schmerzlich gelehrt
Wie für alle, war auch für uns persönlich die Coronaquarantäne eine schwere Zeit. Dank Internet aber haben wir zahlreiche Weiterbildungen absolvieren können, via Zoom weiter Vorträge gehalten und hatten ständig Kontakt mit unsern Kindern und Enkeln. Wir fühlten uns weniger isoliert als die Bewohner der Pflegeheime, die über Wochen in ihren Zimmern bleiben mussten. Viele Heime hatten gar kein W-LAN (Internetzugang) bzw. viele Bewohner waren digital unerfahren, so dass ihnen das Internet, falls vorhanden, nichts nützte. Man hat während der Corona-Zeit via Zoom gemeinsam musiziert, gesungen, sich unterhalten, Tipps und Anregungen ausgetauscht.
Deutschland ist digital ein Schwellenland
Wir haben von Menschen gehört, die aus dem Urwald mit einwandfreiem Empfang per Smartphone nach Deutschland telefonieren konnten, der deutsche Teilnehmer aber leider im Funkloch mitten in der Stadt war, wie es in unserm Land häufig vorkommt.