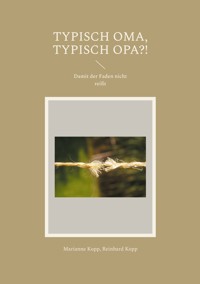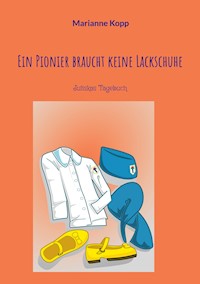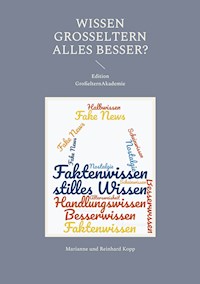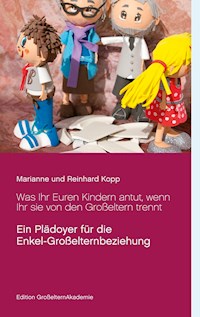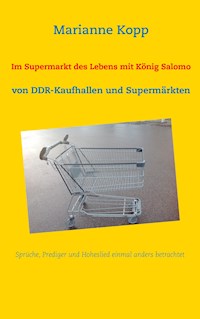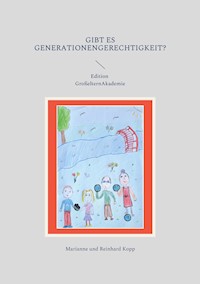
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wird uns Generationengerechtigkeit als etwas Erstrebenswertes von Politik und Medien nur plakativ vorgegaukelt? Was müsste geschehen, um den sozialen Friede zwischen den Generationen nicht weiter zu gefährden? Dieses Buch ist der Versuch einer Antwort. Wir spüren den Bedeutungen der Begriffe Generation und Gerechtigkeit nach. Es geht um Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Demografie und Digitalisierung. Wir erklären den Treibhauseffekt und machen uns Gedanken, wie besonders das Klima zwischen Jung und Alt besser gestaltet werden kann. Warum hängen die Wertschätzung von Produkten und die Geschichte der Abfallwirtschaft unmittelbar zusammen? Müsste wieder mehr repariert, statt entsorgt werden? Sie lernen Berufe kennen, die es längst nicht mehr gibt. Wir belassen es nicht beim Blick von außen, sondern liefern Impulse für persönliche Aktivitäten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Unsern Enkeln Finn, Svenja und Tian
Für euch und alle Heranwachsenden ist es dringend geboten, dass auch wir Großeltern unsern aktiven Teil leisten, um euch die Erde in ihrer Schönheit und Biodiversität lebens- und entdeckenswert zu hinterlassen.
DAS IDEAL
Ja, das möchste:
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn
aber abends zum Kino hast dus nicht weit.
Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:
Neun Zimmer - nein, doch lieber zehn!
Ein Dachgarten, wo die Eichen drauf stehn,
Radio, Zentralheizung, Vakuum,
eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm,
eine süße Frau voller Rasse und Verve
(und eine fürs Wochenend, zur Reserve) ,
eine Bibliothek und drumherum
Einsamkeit und Hummelgesumm.
Im Stall: Zwei Ponies, vier Vollbluthengste,
acht Autos, Motorrad - alles lenkste
natürlich selber - das wär ja gelacht!
Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd.
Ja, und das hab ich ganz vergessen:
Prima Küche - erstes Essen
alte Weine aus schönem Pokal
und egalweg bleibst du dünn wie ein Aal.
Und Geld. Und an Schmuck eine richtige Portion.
Und noch ‘ne Million und noch ‘ne Million.
Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit.
Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit.
Ja, das möchste!
Aber, wie das so ist hienieden:
manchmal scheints so, als sei es beschieden
nur pöapö, das irdische Glück.
Immer fehlt dir irgendein Stück.
Hast du Geld, dann hast du nicht Käten;
hast du die Frau, dann fehln dir Moneten -
hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer:
bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher.
Etwas ist immer.
Tröste dich.
Jedes Glück hat einen kleinen Stich.
Wir möchten so viel: Haben. Sein. Und gelten.
Daß einer alles hat:
das ist selten.
Kurt Tucholsky,
https://www.garten-literatur.de/Leselaube/tucholsky_ideal.html, 14.07.2022
Inhaltsverzeichnis
Als wir dieses Buch planten
Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit und Politik
Klimaschutz ist kein „nice to have“
Nachhaltigkeit
Die Mühen aus den Augen verloren
Reparieren ist (wird) wieder Trend
Reden wir über Abfälle
Dieses Erbe kann niemand ablehnen
Nicht
zuständig
–
nicht
zuständig?
Wie Ältere von Jüngeren lernen
Das Klima zwischen alt und jung gestalten
Unser möglicher Weg zur Generationengerechtigkeit
Quellenverzeichnis
ALS WIR DIESES BUCH PLANTEN
Als wir dieses Buch planten, war von einem Krieg in der Ukraine noch längst keine Rede, aber vom Kampf gegen den Klimawandel. Als wir uns entschlossen, der Frage nach der Generationengerechtigkeit nachzugehen, geschah das aus positiver Neugier. Es ging uns nicht darum, andern nachzuweisen, dass sie falsch lagen. Als wir dieses Buch planten, wollten wir dem Ganzen auf eigene Faust nachspüren: der Klimakrise, dem Generationenkonflikt. Wir bezweckten für uns und auf eigene Art Antworten herausfinden, die zufriedenstellend und nicht plakativ waren. Als wir dieses Buch planten, hatten wir vor allem die Enkelgeneration im Sinn. Wir haben uns als GroßelternAkademie vor mehr als zehn Jahren auf den Weg gemacht herauszufinden, was denn das Besondere am Großeltern-Enkelverhältnis sei und wie Großeltern in heutigen Zeiten ihre Rolle für sich und ihre Enkel zufriedenstellend ausfüllen könnten.
Das Thema Klima und die damit verbundene Krise ließen wir zunächst bewusst außen vor in der Annahme, andere seien zuständiger und kompetenter. Wir gehörten zu denen, die sich zu Beginn der Klimastreiks gehörig über die jungen Menschen echauffierten. Wir klatschen innerlich denen Beifall, die diese Demonstranten arbeiten oder auf die Schulbank schicken wollten, anstatt dass sie schreiend die Straßen blockierten.
Unsere Kritik hat sich im Laufe der Zeit dahingehend gewandelt, dass wir inhaltlich mit vielen Forderungen übereinstimmen, jedoch manche Art und Weise dieser Proteste ablehnen. (Es wird kein Auto- oder LKW-Fahrer „bekehrt“, wenn auf dem Asphalt festgeklebte Demonstranten die Straße blockieren.) Um uns ein eigenes Urteil bilden zu können, haben wir uns informiert, Bücher gelesen, Workshops besucht. Schließlich sind wir zu der Einsicht gelangt: Es muss sich nicht nur etwas, sondern fast alles ändern, aber pronto! Ansonsten werden unsere Enkel, spätestens unsere Urenkel auf diesem ruinierten Planeten keine Lebensgrundlage mehr haben.
Die fetten Jahre sind vorbei und zwar endgültig
Nein, uns hat es nie gereizt, unseren Ruhestand im bequemen Rentner-Wohlstandsleben zu verbringen wie die Senioren vergangener Jahrzehnte, obwohl diese Freiheit im Alter durchaus ihre Vorzüge hatte: tun und lassen können, was beliebte. Seinen Tag frei einzuteilen, ohne finanzielle Sorgen. Fahren, wohin man wollte, Urlaub, wann und wo es einem behagte. Ins Auto steigen oder das Flugzeug nehmen, ein Ferienhaus im Süden, wo es sich bequem überwintern ließ oder mal eine Kaffeefahrt mitmachen.
Was waren die Rentner von vor wenigen Jahren für eine beneidenswerte Bevölkerungsgruppe. Sie ließen sich beim Arzt die neue Hüfte verschreiben, weil ihnen diese Leistung zustand, respektive die Knie oder was sonst in Schieflage geraten war. Sie fuhren danach erstmal in die Reha und im gleichen Jahr noch zur Kur. Das war alles möglich, machbar und gehörte zu einem bequemen Rentnerleben dazu.
Keine Rentnergeneration hatte es so gut wie diese und niemals mehr wird eine Rentnergeneration ihren Ruhestand in so vollen Zügen genießen können.
Aber damit ist jetzt Schluss
Das mit dem Autofahren vermiest uns die junge Generation immer mehr, vom Fliegen ganz zu schweigen. Das Ferienhaus oder die Ferienwohnung im Süden leisten sich nur die bestens Betuchten. Die neue Hüfte gibt es zwar noch, doch die Kur ist meistens gestrichen.
Es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so grundlegend viel verändert, dass es uns Älteren fast den Atem verschlägt. Der Umgang der Generationen miteinander, die Familienkonstellationen, die Digitalisierung, der Klimawandel.
Seitdem die jungen Menschen demonstrieren, dreht sich alles um das 1,5 Grad Ziel und den CO2-Fußabdruck. Man bekommt den Eindruck, die jungen Menschen lehnen unsere Welt, unsern vertrauten Lebensstil – und damit auch uns – ab. Sie verlangen radikale Veränderungen, wir dagegen wünschen, dass alles so weiterläuft wie bisher, in seinen geordneten Bahnen, wie wir sie gewohnt waren. Unsere Wünsche laufen konträr zu denen der jungen Generation, der es nicht schnell genug geht mit dem Kohleausstieg. Die vehement die Abschaffung von Plastik fordert, den Baustopp neuer Straßen und Autobahnen wegen der zunehmenden Flächenversiegelung. Die sogar den Bau neuer Eigenheime ablehnt, weil sonst die Landschaft weiter zersiedelt wird, die das Fliegen ächtet – wer von uns Großeltern versteht da noch die Welt? Anstatt dankbar zu sein für das, was wir geleistet haben, machen sie uns Vorwürfe!
Seien wir mal ehrlich, die meisten von uns hat das Gerede vom Klimawandel doch eher mäßig tangiert, kaum einer fand es öffentlich beklagenswert, dass Tier- und Pflanzenarten aussterben. Wir werden meistens erst aktiv, wenn es unsere eigene Substanz betrifft, uns persönlich Nachteile entstehen. Solange Hochwasser, Krieg, Waldsterben und Klimaveränderung uns nicht persönlich betreffen, sehen die meisten von uns doch keinen Grund, aus dem Sessel aufzustehen.
Genau das gilt es zu ändern und zwar schleunigst.
Sonst sind wir raus. Raus aus der Diskussion, aus der Präsenz, verschwunden aus dem Bewusstsein der jüngeren Menschen. Wie schnell das geht, zeigen gegenwärtig einige Koalitionsverträge verschiedener deutscher Bundesländer, worin Senioren gar nicht mehr vorkommen, wenn, dann nur in Sachen Pflege. Wollen wir ins öffentliche Bewusstsein zurück, müssen WIR etwas ändern, und zwar unverzüglich. Darüber schreiben wir in diesem Buch.
Verstehen wir die Welt nicht mehr?
Wir haben es mit unserer Nachkriegs-Wohlstandstradition weit gebracht: Haus abbezahlt, Firma aufgebaut, Auto in der Garage und alles, was der normale Mittelstand sich an Privilegien geschaffen hat. Und dann grätschen die jungen Leute in unser großelterliches Wohlbefinden: minimalistisch veranlagt, Avocado und Tofu statt Sonntagsbraten. Sie fordern, die Massentierhaltung abzuschaffen, weil sonst zu viel CO2 und Methan in die Atmosphäre gelangen. Junge Menschen, die sich in Bäumen einnisten, um zu verhindern, dass sie einem neuen Kohlerevier zum Opfer fallen, die auf Wind- und Solar- statt auf Kernenergie setzen. Die dafür sorgen, dass innerstädtische Fahrspuren zu Radwegen umfunktioniert werden, das Parken in der Stadt immer teurer wird und Opa den Besuch beim Facharzt aufgrund gestiegener Parkgebühren in seiner Geldbörse merkt.
Stehen wir uns als Jung und Alt auf verschiedenen Eisschollen der abschmelzenden Pole gegenüber und driften immer weiter auseinander? Haben wir Älteren uns, wie auf dem Titelbild zu sehen, drei Erden unter den Nagel gerissen und übrig bleibt nur noch – symbolisch gesehen – eine halbe für die nachfolgenden Generationen?
Früher waren Kinder die Altersversicherung wie die Familie überhaupt, die Angehörigen, die Großfamilie. Heute wird diese Verantwortung an die Sozialkassen ausgelagert, die Rente und die Pflege. Leider funktioniert dieses Prinzip nicht mehr wie geschmiert, im Gegenteil, es holpert tüchtig. Denn immer mehr Rentner und pflegebedürftige Hochbetagte kommen auf immer weniger junge Menschen. Die Alterspyramide hat sich umgedreht. Jetzt bilden die Alten die breite Basis und die Jungen die Spitze. Das kann nicht funktionieren. Darum müssen die Erwartungen beider Generationen den neuen Realitäten angepasst werden. Wir Alten müssen uns von Ansprüchen, wie sie sich die eigenen alten Eltern erlaubten, verabschieden. Sonst bricht unsere Gesellschaft auseinander und Generationengerechtigkeit wird zum Mythos. Denn wir leben in einer anderen Zeit als unsere Vorfahren. Heute haben die meisten Frauen eine eigene Erwerbsbiografie, sind finanziell unabhängig und rentenmäßig abgesichert. Erziehungsurlaube und Kinderbetreuungsangebote helfen, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Sexualaufklärung und freier Zugang zu Verhütungsmitteln haben Auswirkungen auf die Demografie. Frauen bekommen, wenn überhaupt, verhältnismäßig spät Kinder. Kinder ab Mitte dreißig zu bekommen ist heute keine Seltenheit mehr.
„Die Geschäftsgrundlage für den Generationenvertrag hat sich geändert“, stellt der Autor Jörg Tremmel fest. Es sei geboten, diesen Vertrag der neuen Lage anzupassen. Das bedeutet, wir Älteren haben unseren Beitrag zu leisten und unsere Ansprüche zu überdenken.
Jörg Tremmel weiter: „Eine Diktatur der Senioren und Senilen droht in dem Fall, dass die Alten egoistisch die Interessen anderer Generationen zu kurz kommen lassen.“
Damit bringt er für uns Senioren die nächste schmerzliche Erkenntnis: Vieles scheint nicht mehr zu stimmen, ist nicht mehr wie es war. Das bedeutet: Wir brauchen ein neues Miteinander der Generationen.
Wir sind alle Kinder unserer Zeit
Jeder handelt deshalb aus diesem Verständnis heraus. Wir stellen gegenwärtig fest, wie sich unsere Sprache immer mehr verändert. Beispielsweise wird meistens gegendert. Die Schulschrift hat sich verändert wie die Schule überhaupt. Nur selten stehen junge Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf und bieten Älteren ihren Platz an. Die Familienkonstellationen haben sich geändert und sind gesetzlich neu verankert: dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten, ist schon nichts Außergewöhnliches mehr. In der Jugendzeit unserer Eltern war das noch ein Straftatbestand. Unsere Enkel hantieren mit Handy, Tablet und Co., als seien sie damit auf die Welt gekommen. Zumindest aufgewachsen sind sie mit diesen Geräten, weshalb sie keine psychische Barriere im Umgang damit kennen wie unsereins. Wer von Ihnen wurde früher mit dem Auto fast bis ins Klassenzimmer gefahren? Wessen Eltern drohten damals mit dem Anwalt, weil der faule Filius seine Mathearbeit verhauen hatte und deshalb eine miese Zeugnisnote drohte? Sie könnten die Aufzählung sicher fortsetzen. Aber halt, nicht vergessen, jede Zeit ist für ihre Generation eine „normale“ Zeit.
Bestandswahrung anstatt Veränderung?
Sind Ihnen folgende Sätze auch schon über die Lippen gekommen? „Das geht nicht.“ Oder in Bezug auf den Klimawandel: „Alles nur Panikmache!“ Lautet Ihr Redebeitrag im Verein, der Kirchengemeinde, der Familie: „Lasst es doch, wie es war“? Junge Menschen bekommen dadurch den Eindruck, wir Älteren sind auf Bestandswahrung aus, anstatt kleine Veränderungen zu akzeptieren.
Kein Wunder, wenn Ältere als festgefahren und engstirnig dastehen. Um das zu kaschieren, debattieren Senioren arrogant, von oben herab. „Werde nur mal älter“, sagen alte Menschen und vergessen, wie sehr sie diesen Satz aus dem Munde ihrer Großeltern seinerzeit gehasst haben. Dieser vermeintliche „Altersbonus“ ist ein Totschlagargument gegenüber den Enkeln und bringt uns keinesfalls mehr Respekt, eher Mitleid oder Abneigung. Wer sich auf seinen Jahren argumentativ ausruhen möchte, rutscht unweigerlich in eine Funktionärsmentalität. Ein flexibles, auf gegenseitige Achtung gegründetes Miteinander ist dann nur schwer möglich. Niemand mag Großeltern, von denen es heißt: Opa oder Oma haben immer Recht, selbst wenn sie falsch liegen. Dass solche Menschen nicht sehr geschätzt werden, versteht sich von selbst.
Wollen wir das?
Eine wichtige Frage
Haben die nachfolgenden Generationen durch unser Handeln weiterhin genügend Freiraum, um selbst zum Handeln fähig zu sein, oder haben wir sie zu stark eingeschränkt und ihnen dadurch die Möglichkeit der freien Entfaltung genommen? Sind sie durch unser bisheriges Handeln weiterhin fähig, ihre eigenen Ziele zu verfolgen oder gezwungen, in den von uns vorgegebenen Spuren weiterlaufen zu müssen, obwohl der Weg verkehrt war?
Gibt es Generationengerechtigkeit?
Solche und ähnliche Fragen münden in die große Frage nach der Generationengerechtigkeit ein. Zu unüberbrückbar erschienen uns zunächst die Gegensätze. Beim Schreiben dieses Buches haben wir eine für uns schlüssige Antwort auf die Frage nach einer Generationengerechtigkeit gefunden. Wie die lautet, lesen Sie am Schluss unseres Buches.
Wir nehmen Sie jetzt gerne mit in diesen Prozess. Vielleicht können Sie sich uns ja anschließen.
GENERATIONENGERECHTIGKEIT
Was verstehen wir unter Generationengerechtigkeit?
Der Begriff GENERATIONENGERECHTIGKEIT vermittelt zunächst den Eindruck, dass etwas ungerecht, ungleich, nicht in Ordnung und daher abzustellen ist. Gleichzeitig schwingt das Bemühen mit, etwas oder alles (?) recht zu tun.
Generationengerechtigkeit setzt sich aus den Begriffen GENERATION und GERECHTIGKEIT zusammen. Im Wortstamm von Generation steckt die Vorstellung von der Entwicklung von etwas „Neuem“, auf der Grundlage von etwas Bestehendem. Der lateinische Begriff generatio (Zeugungsfähigkeit) ist seit dem 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum als Generation in Gebrauch.
Gegenwärtig ist Generationengerechtigkeit zu einem Modewort geworden. Modewörter kommen immer von der jungen Generation. Sagte in unserer Jugend jemand anerkennend: „geil“, setzte es was hinter die Ohren. Inzwischen ist „geil“ ein anderes Wort für „toll“ oder „klasse“ und nur selten für Triebhaftigkeit.
Beim Wort Generationengerechtigkeit sprechen dagegen Jung und Alt von etwas völlig Verschiedenem. Benutzen wir Älteren den Begriff Generationengerechtigkeit, geht es uns vor allem um soziale Teilhabe bis ins hohe Alter und die Sorge, durch die fortschreitende Digitalisierung ausgegrenzt zu werden. Die Bedürfnisse der Jüngeren, die sie mit dem Wort Generationengerechtigkeit verbinden, tangieren uns weniger. „Ich fürchte, wir sehen gerade die Vorboten einer Rentnerdemokratie: Die Älteren werden immer mehr, und alle Parteien nehmen überproportional Rücksicht auf sie. … Das könnte am Ende in die Richtung gehen, dass die Älteren die Jüngeren ausplündern.“ Das sagte der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog 2008. Generationengerechtigkeit als Begriff in der öffentlichen Debatte über die Gegenwart und Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates ist schon fast überstrapaziert.
Die junge Generation bangt mit Recht darum, vor leeren Sozial- und Rentenkassen und einer enormen Staatsschuldenlast zu stehen. Aber nicht nur der demografische Wandel, dass immer mehr Ältere den Jüngeren gegenüberstehen, befeuert die Debatte. Dazu kommt die Sorge, die Klimafolgen „ausbaden“ zu müssen, weil der Meeresspiegel steigt, die Gletscher immer schneller abschmelzen, der Grundwasserspiegel sinkt, die Waldbrände zunehmen wie auch Dürren, die sogenannten „stillen Unwetter“. Die Klimakrise ist eine schleichende Krise. Die Ursachen sind lange bekannt, die Folgen dagegen überraschen bzw. überrumpeln uns immer aufs Neue.
Somit rücken die Generationenfrage und die der gerechten Verteilung und Vererbung immer mehr in den Focus der Öffentlichkeit. Die Frage lautet: Wie sollen die Beziehungen zwischen den Generationen gestaltet werden? Es geht um Solidarität einerseits und Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts andererseits. Deshalb ist Generationengerechtigkeit für die jungen Menschen von existentiellerer Bedeutung als für Senioren. Auch wenn wir Älteren im letzten Lebensdrittel angekommen sind können wir nicht leugnen, wie sich die Situation dramatisch von Jahr zu Jahr zuspitzt: leergefischte Meere, vermüllter Planet, Gletscherabbrüche, Tornados vermehrt auch bei uns, Starkregenereignisse mit dramatischen Folgen (siehe Ahrtal), ausgetrocknete Flüsse, zunehmende Trockenheit, Dürreernten usw.
Generation als Abfolge
Falls Sie eine Bibel haben, schlagen Sie doch mal das Neue Testament auf. Es beginnt nicht mit der sogenannten „Weihnachtsgeschichte“ sondern mit einer Genealogie. „Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob ...“ Geschichte als Abfolge von Eltern und Kindern. (Das Wort Großeltern gibt es nicht in der Bibel.) Anders ausgedrückt: Eltern kriegen Kinder, die kriegen selber Kinder, dadurch werden die Eltern zu Großeltern, die Kinder zu Eltern und deren Kinder zu Enkeln. Wenn die Enkel Kinder in die Welt setzen, werden sie zu Eltern, ihre Eltern zu Großeltern, die Großeltern zu Urgroßeltern und die Kinder der Enkel zu Urenkeln. Das nennen wir Generationen, unterschiedliche Generationen.
Geläufig ist uns auch diese Generationeneinteilung: die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration, die Kriegsenkelgeneration, die Wohlstandsgeneration. Hier haben alle unter gleichen Umständen gelebt oder leben unter gleichen Umständen. Sie sind als Generationengruppe durch ähnliche Erlebnisse oder gleiche Ereignisse miteinander verbunden und doch wieder nicht. Warum?
Die jüngste deutsche Vergangenheit hat gezeigt, wie gleiche Jahrgänge unterschiedlicher nicht aufwachsen konnten: die einen in der Bundesrepublik unter freiheitlich-demokratischen Bedingungen, die andern in der DDR, unter den Bedingungen einer Diktatur. Die in Westdeutschland konnten ihren Individualismus ausleben. In der DDR wurden die Menschen indoktriniert; der Einzelne sei unbedeutend, die Masse und der Staat, die Ideologie, wären das hehre Ziel. Auf der einen Seite der Mauer der Individualismus, auf der anderen der Wille des Kollektivs.
Trotzdem gilt es festzustellen: weder in Westdeutschland noch in der DDR wuchs die junge Generation unisono gleich auf. Unterschiedliche soziale Voraussetzungen schufen jeweils unterschiedliche Entfaltungsmöglichkeiten.
In der DDR zum Studium zugelassen zu werden, bedeutete meistens, sich mit den politischen Zielen des Staates gemein zu machen. Zwar kostete das Studium kein Geld, aber verlangte die „richtige“ Einstellung.
Die Generationen der 50er Jahre, ob Ost oder West, kannten noch die gravierenden Unterschiede zwischen Stadt und Land. Auf dem Land lebte man anders als in der Stadt. Als Beispiele seien die ländlichen Regionen Bayerns und Oberschwabens genannt, wo es sehr traditionell zuging. Junge Menschen, die zum Studium in die Stadt kamen, fielen schnell als „Landei“ auf.
Deshalb ist es schwierig, von „der“ Generation zu sprechen.