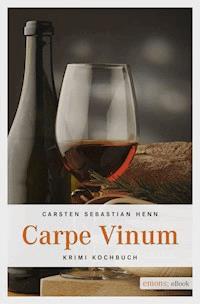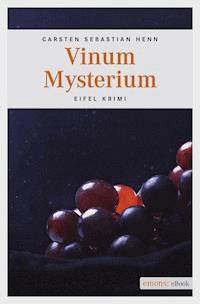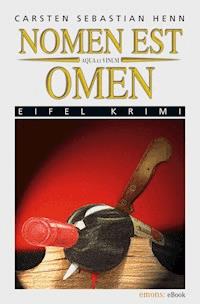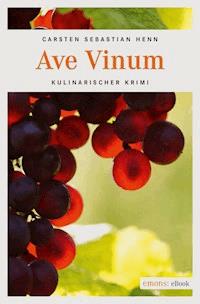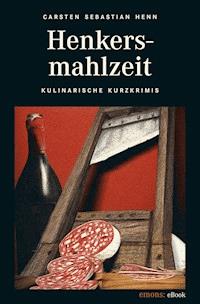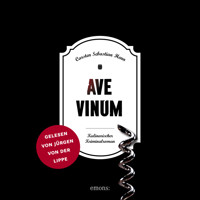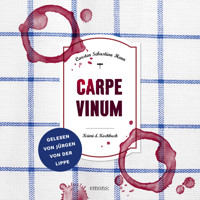8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dublin Stadt des Whiskeys, der Pubs und der Literatur. Mittendrin Janus Rosner, ein Krimiautor mit deutschen Wurzeln, den eine Schreibblockade plagt. Seine Lösung: Mach es wie die großen irischen Autoren und gib dich dem Rausch hin! Bei seiner literarischen Pub-Tour durch das legendäre Viertel Temple Bar muss er dann mitansehen, wie eine junge Frau am Ufer des Liffey mit einem Kopfschuss hingerichtet wird. Vorher zitiert sie unter Tränen einige der unsterblichen Zeilen der bedeutendsten Dichter des Landes, Verse von Oscar Wilde, James Joyce und Jonathan Swift. Oder hat er sich das alles nur eingebildet? Am nächsten Tag steht auf jeden Fall nichts in der Irish Times und auch sonst scheint niemand etwas über das Verbrechen zu wissen. Janus lassen die Geschehnisse der Nacht nicht los, und seine Ermittlungen führen ihn in die Welt der Literatur und des irischen Whiskeys, der gerade einen beispiellosen Boom erlebt. Viel Geld ist damit zu verdienen, viel Geld zu verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dublin – Stadt des Whiskeys, der Pubs und der Literatur. Mittendrin Janus Rosner, ein Krimiautor aus Deutschland, den eine Schreibblockade plagt. Seine Lösung: Mach es wie die großen irischen Autoren und gib dich dem Rausch hin! Bei seiner literarischen Pub-Tour durch das legendäre Viertel Temple Bar muss er dann mitansehen, wie eine junge Frau am Ufer der Liffey mit einem Kopfschuss hingerichtet wird. Vorher zitiert sie einige der unsterblichen Zeilen der bedeutendsten Dichter des Landes, Verse von Oscar Wilde, James Joyce und Jonathan Swift. Oder hat er sich das alles nur eingebildet?
Am nächsten Tag steht nichts in der Zeitung, und auch sonst scheint niemand etwas über das Verbrechen zu wissen. Janus lassen die Geschehnisse der Nacht nicht los, und seine Ermittlungen führen ihn in die Welt der Literatur und des irischen Whiskeys, der gerade einen beispiellosen Boom erlebt. Viel Geld ist damit zu verdienen, viel Geld zu verlieren …
Augenzwinkernd und kenntnisreich erzählt Bestsellerautor Carsten Sebastian Henn von Dublin, der Stadt der trinkenden Dichter und dichtenden Trinker. Und einem rasanten Kriminalfall, der bis in die dunkelsten Ecken der Insel-Metropole führt.
© David Weimann
Carsten Sebastian Henn ist Kulinariker durch und durch. Er hält Hühner und Bienen, studierte Weinbau in Adelaide (Australien), besitzt einen Steilstweinberg an der Terrassenmosel, ist ausgebildeter Barista und neben seiner Arbeit als Schriftsteller einer der renommiertesten Restaurantkritiker und Weinjournalisten Deutschlands. Seine Romane und Sachbücher haben eine Gesamtauflage von über einer halben Million Exemplare und wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Mit ›Der Buchspazierer‹ stand er über ein Jahr lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Bei DuMont erschienen zuletzt ›Der Gin des Lebens‹ (2020), ›Rum oder Ehre‹ (2021) und ›Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam‹ (2022).
CASTEN SEBASTIAN HENN
EIN SCHUSS WHISKEY
Kriminalroman
Von Carsten Henn sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Gin des Lebens
Rum oder Ehre
Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam
eBook 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Alamy Stock Photo & istock by Getty Images
Karten: © cartomedia-karlsruhe
Alle Illustrationen im Innenteil: © Rüdiger Trebels
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8253-3
www.dumont-buchverlag.de
Es gibt dieses Irland:
PROLOG
In Irland ist man nicht, was man isst, sondern was man trinkt. Denn essen tun alle das Gleiche, aber beim Trinken zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen.
Das galt auch für die Frau, die in diesem Moment den letzten Schluck ihres Lebens zu sich nahm. Da sie wusste, dass sie danach keine Gelegenheit mehr haben würde, sich einen ordentlichen Drink zu genehmigen, hatte sie ihn mit Bedacht gewählt. Ein fünfundzwanzig Jahre gereifter Irish Whiskey von der wettergegerbten Halbinsel Dingle an der Westküste, wo sie in einer eiskalten Januarnacht das Licht der Welt erblickt hatte und vor der sie später auf einem Schifferboot die Kindheit verbrachte oder das, was man damals dafür hielt. An manchen Tagen hatte ihr Spielzeug aus dem Beifang bestanden. Sie hatte mit ihren Fischen und dem Meeresgetier am liebsten die Ankunft Cessairs in Irland nachgespielt. Die Enkelin Noahs war zweitausendzweiundvierzig Jahre nach der Erschaffung der Welt auf der Grünen Insel angekommen. Zumindest wenn man dem Lebor Gabála Érenn Glauben schenkte.
In ihren Träumen war sie eine Nachfahrin von Cessair, und ein ganz klein wenig des Blutes von Noah floss durch ihre Adern. Wie bei ihrem Vater, dem Fischer, und dessen Vater zuvor und auch dessen Vater, den ganzen Weg zurück bis Cessair und zu Noah.
Sie hatte nie jemandem davon erzählt, und nun würde sie dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen.
Denn sie hatte verloren.
Und es war ein Spiel gewesen, das man nur einmal verlor.
Denn der Einsatz war das eigene Leben.
Sie nahm einen Schluck des Whiskeys, der so alt war wie sie selbst.
Nie hatte etwas so köstlich geschmeckt, und niemals etwas so traurig.
Ausschnitt aus dem Roman »Der Doppelmord von Dublin«
EINS
»Das beste Männerparfüm ist der Whiskey.«
Brendan Behan
»Ich bin Ire, was ist deine Superkraft?«
Finn – oder Phil, er hatte ziemlich genuschelt, als er sich neben Janus gesetzt und vorgestellt hatte – lachte laut auf und reckte das Glas mit seinem schwarzen Stout-Bier in die Höhe. Er lachte schon die ganze Zeit laut. Sogar wenn er keinen Witz erzählte. Falls ein Lautstärkeregler in ihm verbaut war, musste der kaputt sein. Janus kannte Finn (oder Jim) erst seit einer guten halben Stunde, war aber schon über seine gesamte Lebensgeschichte informiert.
Dabei war Janus eigentlich nur hier, um zu trinken. Vor ihm stand sein drittes Pint. 0,5683Liter eines 4,5-prozentigen Biers, das malzig-bitter schmeckte. Wie flüssige Nahrung.
Noch spürte er viel zu wenig Wirkung.
Vielleicht lag das daran, dass sein Körper in jungen Jahren sehr viel Freude am Wachsen gehabt hatte. Vielleicht sogar zu viel Freude. Lange hatte es Janus geärgert, immer überall der Größte zu sein, aber dann hatte er es sportlich genommen und die zwei Meter angesteuert. Aber sein Körper hielt nichts von runden Zahlen und hörte bei exakt 1,99Metern auf. Wie viele große Menschen ging Janus immer ein wenig gebeugt, damit seine Größe nicht allzu sehr auffiel. Mit seiner blassen Haut und seinen feuerroten Haaren passte er gut nach Irland und wurde oft von Touristen angesprochen, die ihn für einen Einheimischen hielten.
Wahrscheinlich aber lag die unbefriedigende Wirkung des Alkohols daran, dass er eben noch einen Potato Cake bei »Boxtys« gegessen hatte. Auf nüchternen Magen hätte der Alkohol schneller die Kontrolle übernommen. So bildeten die Kohlenhydrate und das Fett eine Barriere, durch die das Zeug erst noch durchmusste.
»Meine Superkraft ist, dass ich es schaffe, dir zuzuhören, obwohl du nur Blödsinn redest.«
Janus blickte in sein Bier, das schneller leer werden musste. Schließlich hatte er heute Nacht eine Mission.
Sie saßen am Tresen des »O’Neills« in der Suffolk Street, wo sie von den Wänden einige der größten Schriftsteller Irlands anschauten, die meisten davon mit kritischem Blick. Das lag sicher daran, dass sie anderen beim Trinken zuschauen mussten und selbst nichts mehr bekamen. Bekanntermaßen hatten Alkohol und Literatur in Irland ja eine enge Verbindung. Optisch machten die Herren Dichter ziemlich wenig her: Samuel Beckett sah aus wie ein protestantischer Priester, Jonathan Swift wie ein Komponist klassischer Musik, Bram Stoker wie ein Country-Sänger, Oscar Wilde wie Stephen Fry und George Bernard Shaw wie der Weihnachtsmann. Trotzdem hatte Letzterer Janus vor einer Weile dazu inspiriert, sein eigenes Gesicht mit Haaren zu füllen. Er hatte die Tage nicht gezählt, aber er musste ungefähr in der sechsten Woche sein.
Das Problem mit seinem werdenden Rotbart war, dass seine Haare ein sehr unterschiedlich ausgeprägtes Bedürfnis hatten, zu einem zu werden. Manche waren Sprinter und wuchsen wie der Teufel, andere sehr gemächlich, sodass der Gesamteindruck sehr zauselig war. Im richtigen Licht sah Janus aus wie ein zerstreuter Professor, im falschen wie ein Terrorist.
Er kippte das Pint herunter. Schließlich musste er Strecke machen.
»Du klingst nicht wie ein Ire, aber du trinkst wie einer. Respekt!«, kam es von seinem komplett in Grün-Weiß gekleideten, glatzköpfigen Tresenkumpanen.
»Ein Lob für die Trinkfestigkeit, was kann ein Mann sich mehr wünschen?« Janus musste grinsen.
»So, wie du dein Pint runterstürzt, hast du schon lange nichts mehr getrunken.«
»Ich habe seit meinem letzten Bier nichts mehr getrunken!« Janus lächelte schwach und nahm noch einen Schluck. »Das war vor mindestens fünf Minuten.«
»Trinkst du, um zu vergessen? Die meisten trinken, um zu vergessen.«
»Bei mir ist es das Gegenteil.«
»Du trinkst, damit du nicht vergisst?« Finn (oder Fingal) kräuselte die Stirn. »Ich sag dir eins, mein Junge. Das klappt nie und nimmer. Und das sagt dir einer, der echt Erfahrung mit dem Trinken hat.«
»Ich trinke, damit mir etwas einfällt!«
Finn (oder Flynn) blickte in Janus’ Glas. »Was willst du denn da drin finden? Ziemlich dunkles Gewässer.«
»Das, was die großen Autoren Dublins in der Brühe gefunden haben. Eine gute Geschichte.«
»Oha.«
»Ja, genau, oha.« Janus blickte zum Barkeeper hinter den Zapfhähnen mit fünferlei Bier und zweierlei Cider. »Noch so eins – und ein doppelter Whiskey.« Er zahlte sofort mit seiner Kreditkarte. Kleingeldzählen verschwendete wichtige Zeit, die er für das Trinken brauchte. Und dafür, wegzuhören, denn der sicher über 60-jährige Solo-Gitarrist auf der kleinen Bühne des »O’Neills« bewies gerade, dass man das fluffige »Dancing Queen« von ABBA so röhren konnte, als wäre man ein Hirsch, der in der Brunft leer ausgegangen war.
»Du nimmst das richtig ernst, oder?«, fragte Janus’ Gegenüber.
»Sonst kann ich es auch gleich sein lassen. Heute trinke ich Oscar Wilde, James Joyce und vielleicht auch noch George Bernard Shaw unter den Tresen!«
Das war zumindest der Plan, damit er seine Schreibblockade endlich überwand. Kopfüber in den hochprozentigen Rausch, der schon so viele Autoren inspiriert hatte.
Und genauso viele davongespült.
Vor über einem Jahr hatte Janus seinen Job in Köln gekündigt und war nach Dublin gezogen, weil er gehofft hatte, die Stadt allein würde ihn schon inspirieren. Doch seine Gedanken schienen noch anderen Treibstoff zu benötigen.
Nach dem Germanistikstudium, das er »summa cum laude« abschloss, hatte er zunächst die Laufbahn vieler hochbegabter Geisteswissenschaftler eingeschlagen: Er war Taxifahrer geworden. Nach einigen Jahren hatte er in ein Berufsfeld gewechselt, in dem die Staus weniger und die Trinkgelder besser waren, und war Kellner geworden. Wieder einige Jahre später zog es ihn dann in ein Callcenter. Nebenbei hatte er versucht, Romane zu schreiben, und es mittlerweile auf fünf großartig begonnene und jämmerlich verendete gebracht – sowie zu einem halbjährigen Stipendium, das er aktuell auf den Kopf haute. Manchmal überlegte er, diese famosen Anfänge, die ihm sogar einige Literaturpreise eingebracht hatten, an Kollegen oder Kolleginnen zu verticken. Verlage hatten leider kein Interesse an einer Sammlung famoser Anfänge. Sie wollten famose Enden mit ein paar Seiten davor.
Jetzt also Dublin und jetzt also ein Kriminalroman.
Janus wollte ihn nicht für Ruhm, Ehre oder irgendwelche Reichtümer schreiben. Sondern für seinen Vater, der einzige Elternteil, der ihm geblieben war. Seit damals, seit dem Unglück, seit seinem … Es gab kein passendes Wort dafür. ›Fehler‹ klang zu alltäglich, ›Missgeschick‹ geradezu zynisch. Er war sieben Jahre alt gewesen und hatte im Gartenhaus gespielt, in dem sich die Werkbank seines Vaters befand. Wie unzählige Male zuvor. Seine Eltern hatten es immer toll gefunden, dass er so gern bastelte. Was sollte auch passieren?
Es passierte das: Eine schlecht isolierte Stromleitung löste ein Feuer aus.
Er wusste immer noch nicht, wie das hatte passieren können. Was er aber noch ganz genau wusste: Als er damals panisch aus dem Gartenhaus fliehen wollte, weg von dem Brand, hatte er sich sein Bein in einem Holzstapel eingeklemmt. Sein Vater war bei der Arbeit, doch seine Mutter hörte die Schreie ihres Sohnes in der Küche und rannte zu ihm.
Sie schaffte es, ihn zu befreien.
Aber sie selbst schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus den Flammen.
Seitdem mied Janus große Feuer. Sie lösten eine Angst in ihm aus, die in seinen Knochen brannte. Sie entzündeten seine Schuldgefühle und, noch schlimmer, die Sehnsucht nach seiner Mutter. Eine kleine Brandnarbe am Hals erinnerte ihn an das Geschehene.
Natürlich fühlte er sich schuldig. Warum hatte er den Brand nicht früh genug bemerkt und direkt gelöscht? Warum hatte er sich sein Bein einklemmen müssen? Warum war er überhaupt an diesem Tag an die Werkbank gegangen, statt mit seinen Freunden Fußball zu spielen, wie es eigentlich geplant gewesen war?
Auch Janus’ Vater fühlte sich schuldig. Weil er Überstunden gemacht hatte, statt bei seiner Familie zu sein, für Papierkram, der gut hätte warten können. Weil er die Leitung vielleicht nicht gut genug isoliert hatte. Weil er seinen Jungen immer an seiner Werkbank hatte spielen lassen. Weil er es natürlich als seine Pflicht betrachtete, die eigene Familie zu beschützen, nicht nur, weil er Polizist war. Die Schuld blieb bei ihm haften wie ein Schatten. Sie hatte nicht nur ihn selbst verfinstert, sondern auch die Beziehung zu Janus. Denn in dessen Gesicht, das dem der Mutter so ähnelte, sah sein Vater immer wieder seine eigene Schuld, sah er einen Vorwurf, den Janus ihm nicht machte. Und er entfernte sich immer mehr von dem Jungen, der ihn so gebraucht hätte.
Damals waren, ohne dass Janus es hätte begreifen können, Schuld und Sühne in ihn geritzt worden.
In der Schule war Janus ein Außenseiter gewesen. Da es für ihn weder zu einem herausragenden Sportler noch zur Mitgliedschaft in der Schulband gereicht hatte, gab es nur ein Mittel, das andere Geschlecht zu beeindrucken: Lyrik. Das hatte zwar auch nur mittelgut funktioniert, aber immerhin. Später wandelte die Lyrik sich in Prosa, aber er fand sein Thema nicht.
Bis er eine Geschichte über den Tod seiner Mutter schrieb. Nur für sich. Er würde sie nie veröffentlichen. Vom Thema Tod war er schriftstellerisch zum Thema Mord übergegangen. Wenn er mit seinem Vater schon nicht über seine Mutter sprechen konnte, dann vielleicht über die Dramen, die in der Welt des Verbrechens lauerten, die Dramen, mit denen sein Vater tagein, tagaus zu tun hatte. Nun sollte es endlich ein richtiger Kriminalroman werden. Es ging Janus nicht darum, seinen Vater stolz zu machen, es ging ihm darum, ihn wieder zurückzugewinnen. Ihm zu zeigen, dass er ihn verstand.
Aber nun fehlten ihm die Worte für den Anfang.
Sein Vater kommunizierte mit ihm eigentlich nur noch über SMS und Postkarten. Zu Geburtstagen, zu den großen kirchlichen Festen, zum Todestag von Janus’ Mutter. Die Nachrichten sahen zum Beispiel so aus:
frhe.osten.hab.
dir.eine.kaRte.geschikkt.
Dein.vAter.aus.koeLN.
Trotz mehrmaliger Erklärung bekam sein alter Herr das mit den Leerzeichen immer noch nicht hin. Und Groß- und Kleinschreibung war seiner Meinung nach nur etwas für echte Computerspezialisten aus dem Silicon Valley.
Als der Kellner den nächsten Whiskey vor Janus stellte, kippte er ihn sofort herunter. Geschmack war nebensächlich. Geschmack störte beim ernsthaften Trinken sogar. Denn konzentrierte man sich auf den Genuss, kam man gar nicht mehr richtig zum Trinken.
»Und, funktioniert’s?«, fragte Finn (oder Kim).
»Sag ich dir, nachdem sie mich aus der Liffey gefischt haben.«
Obwohl er neunundzwanzig Jahre alt war, hatte Janus kaum Erfahrung mit dem Trinken. Also mit echtem Trinken. Er hatte immer aufgehört, bevor sein Hirn in Gefahr geriet, vom Alkohol stillgelegt zu werden. Was er heute tat, war pure Notwehr. Es war schrecklich, nicht schreiben zu können, als triebe er mit einem Floß auf offener See und sähe kein Land mehr.
»Wie heißt du eigentlich?«, fragte Finn (oder Gill).
»Janus.«
»Wie die walisische Punkband?«
»Nein, wie der römische Gott des Anfangs und des Endes, nach dem auch der Monat Januar benannt ist.«
Finn (oder Bill) zog die Augenbrauen empor. »Meine Herren!«
»Meine Mutter war vernarrt ins alte Rom. Kommt in Köln häufiger vor.« Janus erhob sich von dem wackeligen Barhocker. »Ich muss weiter.«
»Wieso? Hier gibt’s doch mehr als genug Bier!«
»Ja, aber nicht genug Inspiration. Ich trinke mich heute durch Dublins literarischste Pubs. Je mehr Inspiration, umso besser. Verstehst du?«
»Und die Leute behaupten immer, wir Iren wären verrückt …«
»Du bist noch nie in Köln gewesen, oder?«
»Nein.«
»Wird sich für dich wie zu Hause anfühlen. Ist quasi die deutschsprachige Version von Dublin: Die Leute sind trinkfreudig, gesellig und redselig. Und wenn du an Karneval kommst, wirst du jede Menge Lieder wiedererkennen, zumindest von der Melodie her. Unsere Bands haben so gut wie jedes berühmte irische Volkslied in einen Karnevalsklopper umgetextet. Selbst wenn es sich im Original um eine traurige Ballade handelt. Da sind wir nicht wählerisch. Mach’s gut, Kumpel!«
Aber Finn (oder Flynn) folgte ihm grölend aus dem O’Neills, sprang auf das Podest mit der Molly-Malone-Statue und packte ihr von hinten an die von vielen Händen blank gescheuerten Brüste. Es sollte Glück bringen, das wusste Janus, der grinsend den Kopf schüttelte.
Dublin war wirklich wie Karneval in der Kölner Altstadt.
Janus hatte sich für diesen Abend eigentlich eine feste Strecke überlegt, die alle literarischen Pubs Dublins, und davon gab es so einige, sinnvoll verband. Aber bald schon lief er kreuz und quer und wusste nicht mehr so genau, wann er in welchem Pub gewesen war. Er trank im »Brazen Head«, dem ältesten Pub Irlands, wo Jonathan Swift einst ein und aus ging, auch im »Toner’s Pub«, wo Joyce, Bram Stoker und Kavanagh gerne einen gehoben hatten. Im »Neary’s« (einem der wenigen Pubs in Dublin, das weder Musik noch Fernseher aufwies) hatte früher Flann O’Brien seine Promille hochgeschraubt. Das »Davy Byrne’s« wurde in Joyce’ »Ulysses« erwähnt, und am Bloomsday, wenn Dublin den großen Dichter feierte, tranken die Menschen hier ein Glas Burgunder und aßen dazu ein Gorgonzola-Sandwich, genau wie Joyce’ Held Leopold Bloom im Roman. Es war fein und stilvoll eingerichtet, sogar mit Tischdecken, und galt einst als Moral Pub, denn der Wirt trank keinen Alkohol.
Auch in der »Palace Bar« in der Fleet Street waren viele Dichter zu Gast gewesen, unter anderem Brendan Behan, der das Trinken zur Kunst erhoben hatte. Seit 1823 hatte sich scheinbar nicht viel am Innenleben des Pubs verändert.
Janus sparte auf seinem Weg durch Dublin die dunklen unbeleuchteten Gassen nicht aus, die kein Warnschild brauchten, damit man wusste, auf was man sich hier einließ. Jede Stadt, die diesen Namen verdiente, war mehrere Städte ineinandergerollt und hatte ihre Viertel, Straßen und Parks, in denen bestimmte gesellschaftliche Kreise verkehrten. Gefährlich wurde es dort, wo sie sich vermischten. So wie es schlammig wurde und Strudel entstanden, wenn salziges Meerwasser und süßes Flusswasser ineinander rauschten.
Genau dort fand man Geschichten.
Es war früh am Morgen, als Janus aus einem Pub nahe der Liffey stolperte und sich gegen eine freundliche Straßenlaterne lehnte, wo er erst mal tief durchatmete.
Er sah auf den Fluss. Dublin hatte das arme Gewässer, das nahe Sally Gap in den Wicklow Mountains entsprang, in eine gerade Linie gespannt und rechts wie links mit hohen Mauern an jedem neckischen Schlenker gehindert. Eine Verschönerungsmaßnahme der letzten Jahre bestand darin, dass die Stadt an der Innenseite der Kaimauer hölzerne Pfade angelegt hatte. Dieser hilflose Versuch, das Ufer attraktiver zu gestalten, verdeutlichte das Elend aber nur noch mehr.
Wäre ich die Liffey, dachte sich Janus, hätte ich die Bohlen längst heruntergerissen und zermalmt. Aber die Liffey floss so träge, als würde sie der Weg durch ihr enges Bett viel Kraft kosten und als wollte sie nun endlich mal ein langes Schläfchen machen. Wach schienen nur die Möwen zu sein, die über dem Wasser kreisten und kratzig schrien.
Janus ließ die freundliche Straßenlaterne los, um eine Zigarette zu rauchen. Er schaffte es gerade so, den Tabak zum Glühen zu bringen, und beschloss, über die Straße zur Betonbrüstung zu gehen, um ein wenig die Füße über der Liffey baumeln zu lassen.
Und wenn er versehentlich hineinaschte, wäre ihr Wasser dann Feuerwasser?
Dem noch nicht komplett unter Alkohol versunkenen Teil seines Großhirns war klar, wie unterirdisch dieser Witz war, der andere Teil fand ihn genau deswegen irre komisch.
Janus kamen die Tränen vor Lachen, und seine Sicht war für einen Moment so, als blickte er durch ein von Regen beschlagenes Fenster.
Nachdem er sich die Tränen aus den Augen gewischt hatte, sah er gegenüber auf dem hölzernen Weg eine Gruppe Menschen.
Alle waren in Schwarz gekleidet und trugen Motorradmasken.
Bis auf eine junge Frau im weißen Kleid mit langen dunklen Locken. Die vor den anderen kniete und hinunter in die Liffey schaute.
Trotz der Dunkelheit der Nacht konnte er erkennen, dass sie einen roten Schal trug, der im Wind leicht flatterte. Sie hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet und sah aus wie eine wunderschöne Madonna.
»›Halte dich an das Hier und Jetzt, durch das alle Zukunft in die Vergangenheit stürzt‹«, rief sie so laut in die Nacht, dass einige der Möwen aufstoben, die sich auf der nahe gelegenen Ha’penny Bridge niedergelassen hatten.
Janus blätterte in der literarischen Abteilung seines Gedächtnisses und wurde fündig. Ein Zitat aus James Joyce’ »Ulysses«.
»›Bei der Wahl seiner Feinde kann man nicht vorsichtig genug sein!‹«, kam es nun von der Frau. Diesmal brauchte Janus nicht zu blättern, die Zeile kannte er gut, stammte sie doch aus dem von ihm sehr geschätzten Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« von Oscar Wilde.
War das hier eine Performance? Janus blickte sich um, das Publikum suchend. Aber es gab keins. Die Uferpromenade war leer, und die wenigen Autos fuhren desinteressiert vorbei. Die Gestalten auf den Holzplanken dort drüben schienen auch keinen Kameramann dabeizuhaben. Was dort passierte, war also nicht für Zuschauer bestimmt.
»›Wir werden alle verrückt geboren. Einige bleiben es‹«, rief die Frau nun mit glockenklarer Stimme. Samuel Beckett, »Warten auf Godot«.
Janus’ Welt schwankte immer noch schwer. Er versuchte seinen Blick fest auf die Frau zu richten, allerdings war es, als probierte er einen glitschigen Fisch festzuhalten. Aber … da glänzte doch etwas an ihrem Kopf! Irgendwas reflektierte das Mondlicht, blitzte auf.
Es kostete Janus einiges an Anstrengung, seinen Blick darauf zu fokussieren, immer wieder drohten seine Pupillen, die Arbeit zu verweigern.
Aber schließlich schaffte er es.
Und erkannte die Pistole, deren Lauf von einem breitschultrigen Mann an die Schläfe der Frau gedrückt wurde.
»›Es gibt zwei Tragödien im Leben‹«, sagte die Frau nun mit zitternder Stimme. »Eine davon ist, unseren Herzenswunsch zu verlieren. Die andere ist, ihn zu gewinnen.«
Eines der berühmtesten und schönsten Zitate von George Bernard Shaw, wie Janus fand.
Er hatte es nie zuvor mit so viel Verzweiflung vorgetragen gehört.
Dann fiel ein Schuss, kurz und hart wie ein Peitschenknall. Das Echo sprang zwischen den Betonwänden der Liffey hin und her.
Und die Frau sackte leblos in sich zusammen.
»Mörder!«, schrie Janus über die Liffey hinweg. »Warum habt ihr das getan?«
Zumindest hatte er das brüllen wollen. Aber seine Sprachmuskulatur war bereits zu Bett gegangen, und ohne sie brachte sein Mund nur etwas zustande, das wie die Laute eines zahnlosen Schotten klang. Ein Schotte, der eine Unterart des Gälischen sprach, die nur er selbst und ein paar uralte Hochlandrinder verstanden.
Trotzdem blickte die Gruppe auf.
Dann kamen die Busse.
Dublin besaß viele Taxis, aber noch mehr Busse. Sie führten regelmäßig ein merkwürdiges, grobschlächtiges Ballett in den Straßen der Stadt auf und liebten es, sich in großen Gruppen zu treffen. Diesmal hatten sich fünf Busse verabredet, von denen drei in östliche und zwei in westliche Richtung unterwegs waren.
Als Janus wieder freien Blick hatte, waren alle Personen auf dem Holzpfad verschwunden. Auch die erschossene Frau. Hektisch suchte Janus die dunklen Wasser ab, doch konnte er keinen darauf treibenden Körper erkennen.
Janus stolperte zur Ha’penny Bridge über die Liffey und zu dem Ort, wo sich eben alles abgespielt hatte.
Aber wo genau war das gewesen? Den Kopf gesenkt, schritt Janus die Holzplanken ab, aber da war nichts.
Er blickte sich um, ob noch jemand den Mord beobachtet hatte, aber niemand sah zu ihm oder kam herbei.
Hatte die ganze Tat vielleicht nur aus Whiskey und Bier bestanden? War die bildhübsche Frau nur Einbildung gewesen? Hatte er tatsächlich so viel getrunken? Mitgezählt hatte er die Pints und Whiskeys nicht, das war Teil des Plans gewesen. Immer weitertrinken, bis die Mauern der Realität zusammenbrachen und die Fantasie völlig freien Lauf hatte.
Janus starrte in die Liffey, aber sie blieb ihm jegliche Antwort schuldig und konzentrierte sich stattdessen darauf, die Stadt zu verlassen und das nahe Meer zu erreichen.
Schnell fummelte Janus das Handy aus seiner Jeansjacke. Noch zehn Prozent Akku. Reichte. Mit zitternden Fingern wählte er die Nummer der Garda, wie die Polizei in Irland genannt wurde. Nach dreimaligem Tuten wurde abgehoben.
Janus redete direkt los, denn der tückische Restalkohol hatte ihm eingeflüstert, dass vorher darüber nachzudenken, was genau er sagen wollte, völlig überflüssig sei.
»Ich will einen Mord melden!«
»Wie ist denn Ihr Name?«, fragte eine Frau, die erschreckend nüchtern klang.
Aus einem spontanen Impuls heraus beschloss Janus, nicht seinen richtigen Namen zu nennen. Stattdessen ließ er sich von dem Bandposter inspirieren, das in seinem Zimmer in der WG über dem Schreibtisch hing.
»George … Mc … Lennon.«
Stille am anderen Ende der Leitung. »George McLennon?«
»Ja.«
»Wollen Sie mich verarschen?«
»Nein.«
»Heißen Sie zufällig Ringo mit zweitem Vornamen?«
»Nein!«
Wieder eine Pause. »Ich höre.«
»Heute Nacht, da habe ich einen Mord beobachtet.«
»Wann genau?«
»Weiß ich nicht. Jetzt gerade erst. Wie viel Uhr ist es denn? Nehmen Sie einfach die Zeit!«
»Soso. Und wo?«
»An der Liffey, zwischen Millennium und Ha’penny Bridge. Auf diesem hölzernen Steg.«
»Dem Liffey Boardwalk. Vor welchem Haus, ungefähr?«
»Weiß ich nicht.«
»Aha.«
So langsam bekam Janus das Gefühl, die Frau nehme ihn nicht für voll. »Das stimmt wirklich!«
»Beschreiben Sie bitte die Tat.«
»Eine Frau wurde erschossen, hingerichtet. Die kniete und hat berühmte Dubliner Schriftsteller zitiert.«
»Ach so.«
»Ich erzähle hier keinen Scheiß!«
»Ja, klar. Wie sah sie denn aus, MrMcLennon? Na los, überraschen Sie mich.«
»Hören Sie …«
»Beschreiben Sie die Frau!«
Janus holte tief Luft, war sicher gut für sein Hirn. »Langes weißes Kleid, roter Schal. Eine sehr schöne Frau.« Er hatte mal gelesen, dass die irischen Frauen vor der großen Hungersnot als die schönsten Europas galten. Der Grund waren die beiden Hauptnahrungsmittel: Kartoffeln und Buttermilch, die als Rest beim Buttermachen blieb. Die Frauen verwendeten die Buttermilch auch zur Gesichtspflege. Sie waren also gesund und schön. Janus verspürte den Impuls, diese Information an die Frau am anderen Ende weiterzugeben, riss sich aber dann doch am Riemen.
»Und wie sah der Täter aus? Oder die Täterin?«
»Ein Mann, ziemlich breitschultrig. Mehr konnte ich nicht erkennen. War ja dunkel. Sie müssen hierherkommen und das untersuchen!«
»Ich fasse mal zusammen: Irgendwann heute Nacht wurde irgendwo zwischen Millennium und Ha’penny Bridge eine Frau im weißen Kleid mit rotem Schal von einem breitschultrigen Mann unbestimmten Alters erschossen.«
»Wenn Sie es so sagen …«
»So sagen Sie das! Ihnen ist schon klar, dass Sie eine Leitung belegen, die andere Menschen genau jetzt ernsthaft benötigen könnten?«
»Also, ich …«
»Wenn Sie sich das nächste Mal mit so absurden Fantasiegeschichten melden, lasse ich den Anruf zurückverfolgen!«
Janus legte schnell auf.
Irgendwie schaffte Janus es, zurück in seine WG zu torkeln, die sich im obersten Stock eines schmucklosen Mehrfamilienhauses aus den Sechzigern befand. Der Schlaf kam über ihn wie eine hart geschwungene Keule. Als er aufwachte, brauchte er einige Zeit, um zu begreifen, wo er war und dass der kleine Digitalwecker auf seinem Nachttisch tatsächlich kurz nach zwölf zeigte. Sein Körper verlangte nach einem Kaffee. Nein, zwei. Oder besser eine ganze Kanne.
In der WG-Küche traf er auf Tessa, die wie so oft ihr Notebook auf dem Esstisch platziert hatte und in einer irren Geschwindigkeit tippte. Sie war zwei Jahre jünger als Janus, und sie hatten sich bei seinem Einzug auf Anhieb verstanden, vielleicht weil auch sie in ihrer Schulzeit zu den Außenseitern gehört hatte. Wenn auch aus völlig anderen Gründen. Tessa war schlau, sogar verdammt schlau. Ein bisschen glich sie in ihrem Fleiß und ihrer Besserwisserei Hermine aus den Harry-Potter-Romanen, allerdings nicht vom Aussehen her. Schon früh hatte sie eine Farbe für sich entdeckt, die gar keine war: Schwarz. Sie kleidete sich komplett darin. Bis auf die Fingernägel und ihre langen Haare, die sie stets zu einem Pferdeschwanz trug. Sowohl Nägel als auch Haare waren neongelb.
Tessas Eltern waren Lehrer. Ihr Vater unterrichtete Physik und Sport, ihre Mutter Mathematik und Chemie. Es war Tessas Art der Auflehnung gewesen, ihr Herz den Geisteswissenschaften zu schenken, vor allem der Literatur. Ihre Eltern hatten lange gehofft, das sei eine kurzzeitige Verirrung, aber mittlerweile unterrichtete sie Germanistik an der University of Dublin. Gerade hatte sie allerdings ein Forschungssemester, in dem sie zum Irlandbild deutscher Autorinnen und Autoren recherchierte, vor allem darüber, wie Heinrich Bölls »Irisches Tagebuch« es beeinflusst hatte. Zumindest wenn Janus es richtig verstanden hatte. Manchmal reiste sie dafür durch Irland, aber die meiste Zeit verbrachte sie in ihrem Uni-Büro, in den Bibliotheken Dublins und am Küchentisch der WG.
»Na, Rheinländer, auch endlich wach? Willst du nicht lieber noch ein bisschen länger pennen?«
»Du mich auch«, antwortete Janus. »Siehst du nicht, wann ein Mann Zuspruch statt Häme benötigt? Oder gibt es Zuspruch für Männer in Westfalen nicht?«
Tessa stammte aus Bielefeld, eine Erbsünde, an die Janus sie gerne erinnerte.
»Westfälische Männer haben so was nicht nötig.«
Er ließ sich neben sie auf die Küchenbank fallen. »Themenwechsel: Was würdest du tun, wenn du eventuell einen Mord beobachtet hättest?«
»Wie kann man denn eventuell einen Mord beobachten?«
»Beantworte einfach die Frage. Und hier kommt eine zweite: Kann ich mir was von deinem Kaffee nehmen?« Er goss sich eine Tasse voll.
»Machst du doch längst schon.«
»War eine rhetorische Frage. Die andere aber nicht.«
Tessa klappte ihr Notebook zu. »Na, zur Garda gehen.«
Janus trank einen Schluck. »Leckomio, der ist stark.«
»Ist westfälischer Kaffee. Nichts für rheinische Warmduscher.«
»Ich würde eher sagen, der ist was für Leute ohne Geschmacksinn.«
»Erklärst du mir jetzt, was es mit diesem eventuellen Mord auf sich hat?«
Janus schüttete so viel Milch in den Kaffee, dass der Kaffee nicht mehr der Hauptbestandteil des Heißgetränks in der Tasse war. »Sagen wir, du hättest dich schon bei der Garda gemeldet, aber sie hätte dir nicht geglaubt …«
Tessas Miene erhellte sich. »Hast du etwa endlich eine Idee für deinen Roman?« Sie lehnte sich zu Janus und umarmte ihn.
»Nein«, antwortete er. »Aber lieb, dass du das für möglich hältst.«
Tessa schnaubte enttäuscht und goss sich noch etwas Kaffee ein. »Dann weiß ich nicht, was das Gerede soll.« Ihr Gesicht beim Trinken bewies, dass der Kaffee ihr auch zu stark war. Aber das würde sie natürlich nie zugeben.
»Bekomme ich trotzdem eine Antwort?«
Tessa setzte die Tasse ab. »Na ja, ich würde unwiderrufliche Beweise dafür suchen, dass es den Mord gegeben hat. Es müsste ja jemand vermisst gemeldet worden sein. Vielleicht gibt es auch Spuren am Tatort.«
»Was, wenn da keine existieren?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich beantworte keine deiner Fragen mehr, wenn du mir nicht endlich sagst, was los ist!«
Janus fuhr sich durch die von der Nacht verstrubbelten Haare. »Die ganze Geschichte klingt, als hätte ich sie nicht mehr alle.«
»Bei mir hast du nichts mehr zu verlieren. Also nur raus damit.«
Janus blickte zur Tür, um zu prüfen, ob der dritte Bewohner der WG zufällig in der Nähe war. Obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür der der Sichtung eines Einhorns gleichkam. Denn Gordon W. Hickley glich Schrödingers Katze, die in zwei Zuständen gleichzeitig existierte. Allerdings hieß das in Gordons Fall nicht, dass er sowohl tot als auch lebendig war, sondern sowohl anwesend als auch fort. Vermutlich – aber die Wissenschaft hatte dies noch nicht beweisen können – befand er sich in seinem stets abgeschlossenen Zimmer. Manchmal hörte man Geräusche, aber die meiste Zeit herrschte Stille. Wirklich gesehen, also längere Zeit von Angesicht zu Angesicht, hatten Janus und Tessa ihren Mitbewohner nur beim Bewerbungsgespräch, als er mit ihnen am Küchentisch saß und munter parlierte. Er machte irgendetwas mit Computern in einer der Firmen in den Docklands, die Dublin, und damit ganz Irland, Anfang der Zweitausenderjahre zum wirtschaftlichen Aufschwung verholfen hatten, bevor es wieder bergab ging. Er war ihnen wie ein sehr geselliger Mensch erschienen, mit dem sie sich lange WG-Abende vorstellen konnten.
Mit dem Moment des Einzugs hatte er sich verändert und war zum Geist der Wohnung mutiert, dessen Anwesenheit man noch nicht mal im Badezimmer spürte, da er all seine Badartikel stets wieder mitnahm und sogar eigenes Toilettenpapier verwendete. Auch in der Küche hielt er sich nie auf, da er einen kleinen Kühlschrank und eine kleine Herdplatte beim Einzug in sein Zimmer mitgebracht hatte. Aber Gordon, der Geist, zahlte pünktlich. Und sein Wellensittich, den man im Gegensatz zu ihm manchmal hörte, hielt die Nachtruhe bemerkenswert konsequent ein.
Gordon stand erwartungsgemäß nicht im Türrahmen, deshalb vertraute Janus Tessa alles an.
»Mysteriös«, sagte sie danach.
»Oder?«
Sie ging mit ihrer Kaffeetasse zum Fenster und schaute hinaus. »Es könnte doch noch jemand außer dir etwas mitbekommen haben. So, wie ich jetzt sehe, was auf der Straße vor sich geht, aber keiner mich sieht. Vielleicht konnte jemand nicht schlafen und stand im Dunkeln am Fenster.«
»Aber hätte er …«
»… oder sie …«
»… den Mord dann nicht ebenfalls der Garda gemeldet? Und hätte die Garda dann nicht anders auf meinen Anruf reagiert?«
»Vielleicht ging es der Person genau wie dir, und sie hat ihren Augen nicht getraut, weil sie auf die Schnapsidee gekommen war, durch Komasaufen die Kreativität anzukurbeln.« Sie lachte. »Schnapsidee passt echt super. Was machst du?«
»Ich geh los und hör mich an der Ormond Quay Lower um. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Außerdem gibt es da ordentlichen Kaffee.«
»Arsch.«
Janus grinste breit. »Anti-Barista.«
Auf dem Weg zum Tatort verschwand der Restalkohol langsam aus Janus’ Kopf und hinterließ eine schmerzende Leere. Wieso konnte Alkohol nicht genauso charmant sein, wenn er einen verließ, wie wenn er einen begrüßte? Wäre das nicht logisch? Janus beschloss, beizeiten ein ernstes Gespräch mit einer jungfräulichen Flasche Whiskey zu führen, die noch alles vor sich hatte und es besser machen konnte als ihre unzähligen Vorgänger.
Auf der Ormond Quay Lower zwischen Millennium und Ha’penny Bridge war wenig los. Die übliche Mischung aus Touristen, die auf der O’Connell Street shoppten, und Einheimischen, die in der Mittagspause etwas schnell Essbares zu einem vernünftigen Preis finden wollten. Und natürlich Busse und Möwen, wie überall in der Stadt. Von beiden musste es viele Nester geben.
Janus ging zu der Stelle, an der die Frau im weißen Kleid letzte Nacht erschossen worden war. Er kniete sich hin und suchte das Holz ab, vielleicht hatte sich ja ein weißer Fetzen Stoff hier verfangen? Schließlich waren in die Bretter überall Nägel eingeschlagen.
Aber nicht einmal ein Faden war zu finden.
Kein Blutstropfen, keine Patronenhülse.
Nichts, was darauf hindeutete, dass hier vor nur wenigen Stunden das Leben einer Frau geendet hatte, deren Bild sich auf Janus’ Netzhaut eingebrannt hatte. Er fühlte eine Verbundenheit zu ihr, für die es keinerlei Grundlage gab. Natürlich war ihm völlig bewusst, dass es eine emotionale Sackgasse war, sich in eine Tote zu verlieben.
Eine Möwe setzte sich neben Janus auf die Planken und legte den Kopf interessiert auf die Seite.
»Hast du heute Nacht etwas beobachtet?«, fragte Janus. »Falls ja, ist eine ganze Tüte Pommes für dich drin.« Er kramte in seinen Hosentaschen, fand einen Keksbrösel und warf ihn ihr zu.
Die Möwe legte den Kopf auf die andere Seite, watschelte zwei Schritte heran, schnappte sich den Brösel und flog davon.
»Betrachte es als Anzahlung«, rief Janus ihr nach, erhob sich wieder und nahm die Häuserzeile auf der anderen Seite der Straße in Augenschein. Ein irisches Restaurant namens »The Woollen Mills«, ein japanisches, das den Namen »Yamamori« trug, und ein in Grün gestrichener Buchladen, der sich »The Winding Stair« nannte.
Janus’ Blick blieb daran haften, denn so hieß auch ein Gedicht von W.B. Yeats.
Purer Zufall, dass eine Buchhandlung sich in der Nähe des Schauplatzes eines Mords befand, der mit Literatur zu tun hatte? Auf jeden Fall hätte man aus dem ersten Stockwerk eine hervorragende Sicht auf das Geschehen in der Nacht gehabt.
Janus ging zur Ampel, überquerte die Ormond Quay Lower und trat in den kleinen Buchladen. An den Wänden waren alte Holzregale angebracht, dazu kamen unter Bücherstapeln ächzende Tische, vorne am Fenster stand einladend ein Ohrensessel. Und hinter einem Schreibtisch, auf dem sich eine altertümliche Kasse befand, saß zusammengesunken etwas, das wirkte, als hätte es eine Katze aus dem Garten hereingetragen – ein Etwas um die vierzig, mit grauen verwuschelten Haaren, einem goldenen Ohrring und einem grünen Hawaiihemd mit gelben Ananassen darauf. Falls das der korrekte Plural war.
Eigentlich wollte Janus direkt zu ihm treten, aber er schaffte es nie, einfach so an Büchern vorbeizugehen, er musste sie in die Hand nehmen, aufschlagen, reinlesen.
Für die knapp fünf Meter brauchte er deshalb eine Viertelstunde.
»Hi«, sagte er zu dem Zerknautschten. »Sag mal, wohnst du zufällig hier? In dem Haus?«
Er erntete ein belustigtes Schnaufen. »Ob ich hier wohne? Sehe ich so aus, als könnte ich mir leisten, in dieser Nachbarschaft zu leben?«
»Ich wollte nur …«
»Hier drüber ist ein Restaurant, da wohnt keiner. Es sei denn, einer aus dem Küchenteam ist zu Hause rausgeflogen und weiß nicht, wohin. Aber das hast du nicht von mir gehört. Ach, was soll’s, ist mir auch egal. Das kannst du ruhig von mir wissen. Also, willst du was kaufen oder bloß blöde Fragen stellen? Falls Letzteres der Fall ist: Wende dich bitte vertrauensvoll an eine andere Buchhandlung. Mit anderen Worten: Auf Wiedersehen.«
»Ich bin Janus.«
»Interessiert mich einen Scheiß. Ich sitze hier, um Bücher zu verticken, nicht, um Freundschaften zu schließen.« Er schob ein Buch Richtung Janus. »Hier, das ist super, kauf das. Du bekommst es auch ohne Geschenkpapier. Zum selben Preis.«
Janus sah es sich an. »Da geht es um einen pupsenden Drachen.«
»Super Buch, alle Kunden sind zufrieden damit. Pupsen ist ein Thema, das jeden betrifft.«
»Es ist für Kinder ab sechs Jahren …«
»Hast du etwa kein inneres Kind?«
Sackgasse, dachte Janus und schob ihm das Buch zurück. »Es ist beim Gespräch mit deinem inneren Kind gerade verstorben.«
Der Zerknautschte tat so, als wischte er sich mit dem Handrücken Tränen weg. »Falls du es von den Toten wiedererwecken willst, findest du da unsere Bilderbücher.« Er wies mit dem Kinn zum zweiten, kleineren Raum der Buchhandlung. »Nein, warte. Mir ist was Besseres eingefallen: Verschwinde!« Aus Reflex sah Janus in die vom Zerknautschten gezeigte Richtung und erblickte einen weiteren Ohrensessel – über dessen Lehne ein roter Schal hing.
Genau in der intensiven Farbe wie der, den die Frau in der Nacht getragen hatte.
»Hast du ein Gespenst gesehen?«, fragte der Verkäufer und blickte sich suchend um. »Eigentlich hatten wir bisher keins.«
»Ist das dein …« Nein, die Frage war saublöd, dachte Janus, er musste eine andere stellen. »Eine Freundin von mir hat gestern Nacht genau so einen Schal verloren. Hier in der Nähe. Hast du den zufällig gefunden?«
Der Mann im Hawaiihemd sah ihn lange an, dann schüttelte er den Kopf. »Der hängt schon ewig hier. Ist Deko. Gibt dem Laden einen weiblichen Touch. Das mögen die Kundinnen. Warum erkläre ich dir das alles? Du bist ein Nicht-Käufer ohne inneres Kind! Deshalb haust du jetzt auch besser ab.«
Janus ging zu dem Schal und nahm ihn in die Hand.
Zwei Dinge fielen ihm sofort auf.
Er war leicht feucht.
Und in seinem Gewebe fand sich ein Holzspan, dessen Farbe dem der Bohlen des Boardwalks an der Liffey glich.
Eine Hand packte ihn am Kragen und bugsierte ihn vor die Tür. »Hausverbot! Für immer und ewig! Schöne Schals bekommst du auf der Grafton Street!«
Die Tür wurde nicht nur geschlossen, sondern auch verriegelt und das Schild, das eben noch »Open« verkündet hatte, auf »Closed« gedreht.
Trotzdem lächelte Janus.
Er hatte sich das alles doch nicht im Alkoholrausch eingebildet.
Dann verschwand sein Lächeln.
Ein Mord hatte stattgefunden, aber niemand würde ihm glauben.
***
Ich hatte mich immer schon gefragt, wie es klingt, wenn eine Patrone den Schädelknochen durchschlägt. Ein lautes Bersten? Ein Knacken? Oder rast die Munition so schnell hindurch und in die feuchte Gehirnmasse, dass eher ein feuchter, schmatzender Laut entsteht?
Als die Patrone an der linken Schläfenseite in Ciaras Kopf eintrat und an der rechten wieder herausschoss, hörte ich keines dieser Geräusche, denn der Knall der Pistole war so laut, dass er jeden anderen Ton in der Umgebung vernichtete, wie ein hungriges Raubtier, das alles in seiner Nähe verschlang.
Danach hörte ich das matte Geräusch von Ciaras leblosem Körper, der auf die Holzplanken des Boardwalks kippte. Nicht einmal Ciaras letzten Atemzug vernahm ich, kein letztes zitternd-verzweifeltes Einatmen, kein kraftloses, nur noch rein mechanisches Ausatmen, dem nichts mehr folgt.
Es war akustisch höchst enttäuschend.
Ciara kannte die Regeln, sie hatte sich aus freien Stücken darauf eingelassen.
Wie wir alle.
Dass sie dann plötzlich so ein Theater machte, um ihr Leben bettelte, war nicht nur unangenehm, sondern beleidigte unseren Bund.
Erst als ich drohte, ihre Eltern zu erschießen, wenn sie ihren Teil der Vereinbarung nicht erfüllte, kam sie wieder zu Verstand.
Über ihre Auswahl der Dichter haben wir alle uns sehr gewundert. Joyce, Wilde, Beckett und Shaw? Wirklich? So enttäuschend naheliegend. Wenn ich meine letzten Worte wählen muss, wird mir sicher etwas Individuelleres einfallen. Seamus Heaney wäre zum Beispiel eine gute Wahl.
Aber das Zitat, das Ciara von Shaw ausgewählt hat, fand ich zumindest thematisch passend. Von wegen Tragödie im Leben und Herzenswunsch. In diesem Moment dachte ich mir: Was Besseres kommt von ihr bestimmt nicht mehr, also beenden wir es an der Stelle.
Ehrlich gesagt war mir der Arm da auch schon ein bisschen schwer geworden. So eine Pistole wiegt ja doch ganz schön etwas.
Als ich die Waffe sinken ließ, spürte ich die Leere in ihr. An der Stelle, wo vorher die Patrone gesteckt und wie ein Rennpferd vor dem Start ungeduldig den entscheidenden Moment erwartet hatte. Sie glich der Leere in mir, die aber ungleich größer war, denn diese hatte exakt die Größe von Ciara, die ich geliebt hatte wie keine Frau zuvor.
Ihre langen tintenschwarzen Locken, die hochsommerblauen Augen, die Lippen von der Farbe unreifer Erdbeeren und dieses mysteriöse Lächeln, das sie damit formen konnte. Selbst die Mona Lisa wäre darauf neidisch gewesen. All die Momente mit ihr schossen mir nun wie Patronen durch den Kopf, als würde die Waffe in meiner kraftlosen Hand sie durch mein Hirn feuern.
Es folgte ein Moment des Innehaltens, in dem die Welt für einen kurzen Moment die Luft anzuhalten schien. Ein wundervoller Moment.
Und dann brüllt irgend so ein Vollidiot von der anderen Seite der Liffey etwas zu uns herüber. Keine klaren Worte, mehr ein Grölen. Vielleicht nur ein Betrunkener, der am nächsten Tag alles schon vergessen haben wird.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht einer, der schnell sein Handy gezückt und Fotos geschossen hat.
Dann half uns das Schicksal, weil es ein Herz für die Irren und Verrückten hat, die immer wieder meinen, es herausfordern zu müssen. Mehrere Busse versperrten wie auf ein geheimes Zeichen hin die Sicht.
Wir warfen Ciara über das Geländer und stoben in alle Richtungen davon, wurden zu Schatten in Hauseingängen, zu Schemen in der Nacht.
Der brüllende Affe, der meinen besonderen Moment zerstört hat, lässt mir seitdem keine Ruhe.
Ich durchforste das Internet danach, ob er irgendwo etwas zu Ciaras Hinrichtung gepostet hat.
Bisher nichts.
Aber wenn er glaubt, was er gesehen hat, wird er nicht stillhalten können.
Dann wird er sich zeigen.
Und das wird ein großer Fehler sein.
Ausschnitt aus dem Roman »Der Doppelmord von Dublin«
***
Janus war es gewohnt, lange zu stehen. Vor Bushaltestellen, Konzertsälen und früher vor der furchterregenden Tür der Schuldirektorin. Aber Stehen und Beobachten war eine ganz andere Sache.
Man fühlte sich dabei nämlich selbst beobachtet.
Er hatte sich einen Platz gegenüber dem »The Winding Stair« gesucht und lehnte an der Betonmauer zur Liffey. Die meiste Zeit blickte er auf sein Handy, aber immer wieder hoch, falls der Typ – er hatte ihn wegen des Namens der Buchhandlung Yeats getauft – den Laden verließ.
Janus checkte zum dutzendsten Mal die Homepage der Dublin Garda. Immer noch keine Tote. Und niemand war als vermisst gemeldet.
Er prüfte auch regelmäßig die Homepage von RTÉ, der nationalen Radio- und Fernsehsendergruppe Irlands.
Ebenfalls kein Treffer.
Jetzt klickte er sich durch etliche Dublin-Fotos auf Instagram, die zu der fraglichen Zeit aufgenommen worden waren. Meistens zeigten sie Feiernde in verschiedenen Phasen der Trunkenheit. Es hatte eine gewisse Faszination, was manche Menschen für würdig hielten, fotografiert und veröffentlicht zu werden.
Als Janus diesmal hochschaute, trat Yeats heraus. Er blieb neben dem Eingang stehen und fingerte eine krumme Kippe aus der Brusttasche seines Hawaiihemds – es zeigte heute Surfer auf beeindruckenden Wellen. So gut es ging, begradigte er die Zigarette und zündete sie sich routiniert an. Es schien, als würde ihm jeder Zug Schmerzen bereiten, denn sein aufgequollenes Gesicht verzog sich jedes Mal. Trotzdem rauchte er bis zum allerletzten Stummel auf, bevor er diesen auf den Boden warf, heftig zertrat, wütend wegkickte und dabei fluchte.
Da hatte wohl jemand ein Problem mit dem Rauchen. Und mit sich selbst.
Nachdem Yeats wieder ins »The Winding Stair« gegangen war, fand Janus eine Facebook-Gruppe namens »Dublin Confidential«, die sich lokalen Kriminalfällen widmete. Mit Vorliebe ungelösten oder solchen, bei denen vermutet wurde, dass die öffentlichen Stellen etwas verheimlichten. Ohne lange darüber nachzudenken, schrieb er einen Post:
Hat jemand letzte Nacht etwas an der Ormond Quay Lower zwischen Millennium und Ha’penny Bridge beobachtet? Stichworte: Schöne Frau, weißes Kleid?
Der erste Kommentar ploppte binnen Sekunden auf: »Ey, Mann, das ist hier kein Dating-Portal!!!«
Schon erschien der nächste: »Weiße Frau? Sag mal, siehst du Geister? Ist sie über das Wasser geschwebt? Spinner!«
Zack, kam der nächste: »Warum muss es eigentlich immer eine schöne Frau im Kleid sein? Kann es nicht zur Abwechslung mal ein Kerl im Kleid sein? So ein verranzter Holzfällertyp mit Rauschebart? Das wär doch mal was!«
Es dauerte keine zehn Sekunden, bis Janus realisierte, dass sein Post eine saublöde Idee gewesen war.
Als er ihn löschte, erblickte er für einen kurzen Moment einen weiteren Kommentar, bevor dieser ins digitale Nirwana überging. Er stammte von einem gewissen Whizzkey, ein Wortspiel aus Whizz, was so viel wie Genie bedeutete, und Whiskey.
Du warst das also …
Verdammt!
Als er versuchte, auf der Whizzkey-Seite Informationen zu finden, musste er feststellen, dass nur Freunde die Beiträge sehen konnten. Und er war natürlich keiner.
Also schickte er eine Freundschaftsanfrage.
Dann war der Akku seines klobigen Handys leer, das beim Kauf vor drei Jahren schon als hoffnungslos veraltet gegolten hatte.
Ohne Handy wurde das Warten zur Qual. Und Janus hatte nun nichts mehr in der Hand, was erklärte, warum er hier stand, weshalb er das Gefühl bekam, ständig irritierte Blicke zu ernten.
Erst kurz nach Ladenschluss, um 18.10Uhr, verließ Yeats den Buchladen.
Er trug den roten Schal um den Hals wie eine Trophäe.
Schlurfend bog er Richtung Middle Abbey Street ab. Janus folgte ihm mit pochendem Herzen in ungefähr zwanzig Metern Abstand, hielt sich gebeugt und versteckte sich, wenn möglich, hinter anderen Fußgängern.
Yeats’ Weg führte fort von den belebten Straßen Dublins in immer kleinere, verlassenere, bis er schließlich ein Pub betrat, in dessen rotem Neonschild mehrere Buchstaben unkontrolliert flackerten, was Janus an die letzten Zuckungen eines Sterbenden denken ließ. Er hatte nie von diesem Laden gehört. Er hieß »The Dead Poets Society« und war das, was man gemeinhin als Drecksloch bezeichnete. Allerdings war das in diesem Fall eine Beleidigung für jedes anständige Drecksloch.
Der Pub schaffte es sogar, dass der Gehweg nach miesem Whiskey stank, als würde er aus den Poren seines Mauerwerks dringen.
Der Griff der Eingangstür war klebrig, und sie zu öffnen war, wie einen alten Kaugummi von der Schuhsohle zu ziehen. Diese Tür wollte eigentlich nicht geöffnet, sondern in Ruhe gelassen werden.
Die meisten Pubs waren dunkel, dieses war regelrecht duster – was sicherlich im Interesse aller Gäste war. So konnte man sich vormachen, das hier wäre nicht die ranzigste Zusammenrottung verlorener Seelen, die diese Stadt zu bieten hatte. Und Dublin hatte weiß Gott keinen kleinen Vorrat daran. Janus schien es oft, als hätte die Stadt eine ziemliche Sammelleidenschaft entwickelt, was gescheiterte Existenzen betraf. So wie Köln Kirchen sammelte oder London Restaurants, so sammelte Dublin die größten Pechvögel Irlands und manchmal auch ein paar exotische Exemplare aus anderen Ländern.
Aktuell befanden sich gut dreißig im »Dead Poets Society«, das aus lauter Nischen mit windschiefen Tischen und Tropfkerzen bestand. An der Theke wurden gerade einmal drei verschiedene Biere ausgeschenkt, für Dublin eine geradezu lächerliche Zahl. Janus bestellte sich ein Half Pint von einem leichten Cider, weil ihm der Kopf immer noch von der letzten Nacht pochte, und gönnte seinen Augen Zeit, um sich an die Licht- oder besser Dunkelheitsverhältnisse zu gewöhnen.
Die Barkeeperin unbestimmbaren Alters – das lange, fettige Haar hing komplett übers Gesicht – reichte Janus sein Half Pint.
Als er von seinem ersten Schluck aufblickte, entdeckte er Yeats in einer der Nischen über ein Glas gebeugt, dessen Inhalt nach Whiskey aussah. Nach einem doppelten. Mit ihm saßen drei, nein, vier weitere Gestalten am Tisch, deren Gläser ebenfalls mit Hochprozentigem gefüllt zu sein schienen. Janus versuchte, ihre Gesichter auszumachen, aber er konnte kaum etwas erkennen. Vielleicht lag es an der Dunkelheit des Pubs, dass Janus so ungehemmt hinüberstarrte. Aber gerade in den dunkelsten Pubs achteten die Menschen auf das Wenige, was sie beobachten konnten.
Jemand tippte ihm auf die Schulter. Eine Stimme wie die eines Papageis erklang, der sein Leben auf den Schultern des übelsten Piraten aller Weltmeere verbracht hatte. »Hey, was machst du da, warum glotzt du die so an?«
Janus drehte sich um. Das Gesicht passte leider zur Stimme. »Ich glotz überhaupt nicht, ich schau eigentlich nirgendwohin. Will nur in Ruhe trinken.«
»Du hast die dahinten angeguckt, hab ich genau gesehen! Willst du eine von den Bräuten klarmachen? Kannste gleich vergessen, hab ich auch schon erfolglos versucht. Und ich versteh was von Frauen!« Er ließ die Augenbrauen tanzen.
»Wer sind die denn?«
»Also interessierste dich doch! Hab ich gleich gewusst!«
»Ne, eigentlich interessiere ich mich nicht. Versuche nur, ein bisschen Konversation zu betreiben.«
»Klar.«
Janus nahm einen weiteren Schluck seines Ciders. »Dann eben nicht.«
»Musst doch nicht gleich eingeschnappt sein, mein Freund. Das da ist die ›Drunken Poets Society‹.«
»Soll das ein Witz sein?«
»Keine Ahnung. So heißen die halt.«
»Und die sind hier zum Trinken?«
»Wofür bist du denn hier? Zur Pediküre?«
»Nein.«
»Das ist gut, denn egal, wer hier versuchen würde, dir die Zehennägel zu schneiden, du hättest danach keine Zehen mehr.« Er lachte glucksend. »Und nur wenn du verdammt viel Glück hast, noch Füße!«
Janus bemühte sich um einen beiläufigen Ton: »Ich meinte, ob die nur zum Trinken hier sind.«
»Das ist ’n literarischer Zirkel. Die wollen unter sich bleiben. Und trinken dabei Whiskey.« Der Mann beugte sich vor. »Die können es gar nicht leiden, wenn einer sie bespitzelt. Das mag hier keiner. Entweder du gibst mir jetzt einen aus, oder ich erzähl denen, dass du sie beobachtet hast.«
»Du bist ja ein richtig mieses Wiesel.«
»Ich würde mich als richtig durstigen Mann beschreiben!« Er lachte wieder glucksend.
Janus gab ihm einen aus und setzte sich in eine frei gewordene Ecke, von der aus er einen besseren Blick auf die Truppe hatte. Es waren insgesamt drei Männer und zwei Frauen. Leider war kein Wort ihres Gesprächs zu verstehen. Aber je später der Abend, desto erhitzter wirkte die Diskussion, desto ausladender wurden die Gesten. Yeats glich irgendwann einer Windmühle, allerdings einer mit hochrotem Kopf. Die Barkeeperin nötigte Janus stetig, weitere Pints zu bestellen, und irgendwann schlief er zwischen zwei Schlucken ein, dabei hatte er eigentlich nur ganz kurz die Augen schließen wollen. Als er wieder aufwachte, war er der letzte Gast im Pub, und die Barkeeperin stand mit einem leeren Glas vor ihm, dessen Inhalt sie, wenn er das Tropfen seines Barts richtig deutete, gerade in Janus’ Gesicht geschüttet hatte.
Janus sah sie an. »Zahlen, bitte.«
Auf dem Rückweg kam er am Ormond Quay vorbei, wo sich eine große Menschenmenge am Ufer der Liffey versammelt hatte. Alle schienen ein Handy in der Hand zu halten und etwas im Fluss zu fotografieren oder zu filmen.
Es war nicht einfach, sich hindurchzudrängen und selbst einen Blick zu erhaschen.
Janus sah etwas Weißes aufblitzen.
Etwas Rotes.
Dann erkannte er eine tote Frau im dunklen Wasser der Liffey.
Weißes Kleid, roter Schal.
Sie war wunderschön, ihre Haare wie Plankton um ihren Kopf.
Aber es war nicht die Frau von letzter Nacht.
ZWEI
»Ich will leben, bis ich hundertfünfzig Jahre alt bin. Und wenn ich sterbe, möchte ich eine Zigarette in der einen und ein Glas Whiskey in der anderen Hand halten.«
Ava Gardner
Nächte waren eigentlich zum Schlafen da. Janus hatte sich allerdings dafür entschieden, in der Küche zu warten, bis Tessa wach wurde. Wobei »entschieden« das falsche Wort war, denn sobald er versucht hatte zu schlafen, liefen die Bilder der letzten beiden Nächte wie der Video-Clip einer Doom-Metal-Band vor seinem inneren Auge ab.
Er hätte Tessa wecken können, aber dann hätte es in dieser Nacht eine weitere Leiche gegeben. Sie war unerträglich, wenn sie nicht genug Schlaf bekam. Ansprechbar war sie erst nach dem ersten Kaffee. Das heißt, ansprechbar war sie schon vorher, nur erhielt man dann keine verständlichen Worte als Antwort. Nur eine Art Knurren.
Also hatte er sich die Zeit vertrieben. Zuerst hatte Janus sich durch diverse Homepages geklickt, um Infos über die Tote dieser Nacht zu finden, aber da war diese Unruhe in ihm, die ihn zwang, sich zu bewegen.
Also hatte er die Küche gefegt.
Obwohl er diese Woche gar nicht damit dran war.
Und er hatte sie auch noch ordentlich, ja, geradezu penibel, gewischt. Wohl wissend, dass dies ein Riesenfehler war. Nun würde er nie wieder behaupten können, das mit dem Wischen nicht zu beherrschen.
Als Tessa endlich im schwarzen Morgenmantel in der Küche erschien, hatte er sogar das Flusensieb der Waschmaschine entleert. Er goss ihr direkt eine schöne Tasse Thermoskannenkaffee ein. Unruhig wartete er, bis sie diese an die Küchenzeile gelehnt ausgetrunken hatte, dann schoss er die Sätze heraus, die er Tessa im Kopf schon mindestens ein Dutzend Mal gesagt hatte. Dass die Leiche, die sie jetzt aus der Liffey gefischt hatten, blonde statt dunkle Haare hatte. Und was er sich deshalb von ihr wünschte.
»Ich soll was?«, fragte sie danach und legte ihren Kopf schief, als hätte sie sich gerade verhört.
»Soll ich es noch mal erklären?«
»Nein, das war rhetorisch gemeint. Ich kann einfach nicht fassen. was du da von mir verlangst! Ich soll meine weiblichen Reize spielen lassen? Ernsthaft? Du weißt schon, dass wir uns im einundzwanzigsten Jahrhundert befinden und nicht im zwölften?«
»Tessa, also …«
Sie schüttelte den Kopf und steckte eine Scheibe Weißbrot in den Toaster. »Mal ganz davon abgesehen war mir gar nicht bewusst, dass dir meine weiblichen Reize aufgefallen sind.«
»Jede Frau hat doch irgendwelche …«
Sie hob die Hand. »Danke, reicht! Du weißt wirklich ganz genau, wie man mit Frauen redet.«
»So war das ü-ber-haupt nicht gemeint!«
»Um die Diskussion hier zu beenden: Ich, Tessa Droste, bei voller geistiger Gesundheit – im Gegensatz zu dir –, erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich nicht irgendwelche Polizisten bezirzen werde – deine Wortwahl –, um Informationen über die Tote in der Liffey zu erhalten.«
Janus stand auf und trat zu ihr. »Soll ich dir deinen Toast schmieren? Mit extra viel Honig drauf?«
Tessa lachte trocken. »Das ist dein Versuch, mich umzustimmen? Ehrlich? Einen Toast zu schmieren? Wuhu!«
»Ich könnte dir auch Rührei machen?«
Das Brot schoss aus dem Toaster, als würde es nicht ertragen, sich gemütlich bräunen zu lassen, während ein einzelner Mann so viel Blödsinn erzählte.
»Du könntest mir hier ein Drei-Gänge-Menü kochen und ich würde mich nicht für dich prostituieren.«
»Darum geht es doch gar nicht! Du sollst nur mit einem von der Garda reden!«
Tessa strich gesalzene Butter auf ihren Toast, die sofort darauf zerfloss. »Willst du auch einen? Dein Hirn könnte feste Nahrung sicher gut gebrauchen.«
Janus ließ sich wieder auf die Küchenbank fallen. »Ja, gern.«
»Du weißt schon, dass das eine weitere deiner Schnapsideen ist? Die häufen sich in letzter Zeit dramatisch.«
Er ließ seinen Kopf auf die Tischplatte sinken. »Als ich sie heute Nacht hatte, klang sie in meinem Kopf absolut genial.«
Tessa reichte ihm eine gebutterte Toastscheibe. »Merkste jetzt selbst, dass dein Plan ziemlich hirnrissig ist, oder?«
»Ja, tut mir leid. Saublöde Idee, dich da mit reinzuziehen.«
Sie biss einmal ab, der Toast knusperte köstlich. »Warum ist dir die Sache eigentlich so wichtig? Du kanntest die Frau doch gar nicht. Also keine der beiden Frauen, oder?«
Janus versenkte die Zähne in seinem Toast, der wirklich guttat. »Vielleicht weil sie so unfassbar schön war. Richtig atemberaubend, weißt du.«
»Ach so.« Tessa klang mit einem Mal distanzierter.
»Und ich bin der Einzige, der weiß, was in der vorletzten Nacht abgelaufen ist. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, dass es die Leiche einer anderen, aber gleich gekleideten Frau ist, die eine Nacht später auftaucht. Aber ohne mein Wissen fehlt ein entscheidendes Puzzlestück, um den Mordfall zu lösen. Entweder ich hänge mich rein, oder dieses Verbrechen wird nicht aufgeklärt.«
»Warte es doch erst mal ab.«
Janus biss wieder zu, diesmal härter, als hätte er noch eine Rechnung offen mit dem Toast. »Dann verschwinden Beweise und Indizien, Zeugen vergessen Details. Es ist wie mit Spuren im Sand, über die eine Welle nach der anderen hinwegspült. Ich muss da jetzt alle Energie reinstecken!«
»Lass mich raten: Mit deinem Roman geht es gerade nicht gut voran?«
»Das hier ist wichtiger, das ist echt!«
Tessa nahm mit belustigtem Blick noch einen Schluck Kaffee.
»Du bist Schriftsteller. Was befähigt dich dazu, einen Mord aufzuklären?«
»Meine Neugierde. Und dass ich gerade Zeit habe. Auch meine Unverfrorenheit. Ich trau mich zum Beispiel, meine Mitbewohnerin zu instrumentalisieren.«
»Das nenne ich mal rheinischen Frohsinn.« Tessa winkte ab. »Völlig entkoppelt von der Realität.«