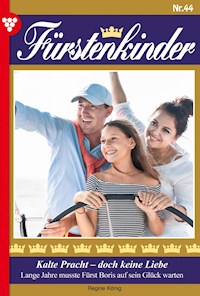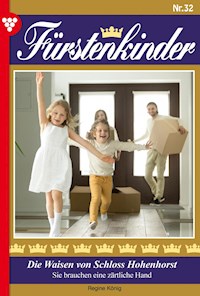Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkinder
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkinder" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Ihre Lebensschicksale gehen zu Herzen, ihre erstaunliche Jugend, ihre erste Liebe – ein Leben in Reichtum, in Saus und Braus, aber oft auch in großer, verletzender Einsamkeit. Große Gefühle, zauberhafte Prinzessinnen, edle Prinzen begeistern die Leserinnen dieser einzigartigen Romane und ziehen sie in ihren Bann. »Schlaf, Kindchen, schlaf, und träume etwas Schönes!« Die alte weißhaarige Frau Katrin beugte sich tief über das Bett. »Und träume etwas Schönes, mein kleines Herzblatt, etwas Märchenhaftes!« »Katrin!« Aus den weißen Kissen hob sich heftig ein lichter Kopf. Goldenes, natürlich gewelltes Haar fiel lose auf die kindlich schmalen Schultern des Mädchens, das jetzt mit schreckhaft aufgerissenen Augen der alten Frau, der Betreuerin ihrer Kindheit, ins Gesicht schaute. »Katrin, wie kann man etwas Schönes träumen, wenn das Leben so hart ist, so schrecklich?« Da setzte sich die alte Frau auf den Bettrand des Mädchens und legte schützend den Arm um sie. »Christina, meine kleine Tina, das Leben geht auf und ab. Es ist nicht immer schwer und drückend. Und jeder tut gut daran, seine Hoffnung zu bewahren. Ohne Hoffnung und ohne unsere Träume können wir nicht leben. Schon gar nicht solch kleines Mädchen wie du, das eigentlich erst mit dem Leben beginnt.« »Ich bin alt, Katrin! Uralt komme ich mir vor!« Jetzt setzte sich das Mädchen in den weißen Kissen auf. »Katrin, ich bin heute sechzehn Jahre alt geworden!« Die Frau nickte. »Katrin, und dieser Geburtstag…« Die Frau ließ Christina nicht aussprechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkinder – 28 –
Ein Schwesterchen für Andy
Wird der Wunsch des kleinen Jungen in Erfüllung gehen?
Regine König
»Schlaf, Kindchen, schlaf, und träume etwas Schönes!« Die alte weißhaarige Frau Katrin beugte sich tief über das Bett. »Und träume etwas Schönes, mein kleines Herzblatt, etwas Märchenhaftes!«
»Katrin!« Aus den weißen Kissen hob sich heftig ein lichter Kopf. Goldenes, natürlich gewelltes Haar fiel lose auf die kindlich schmalen Schultern des Mädchens, das jetzt mit schreckhaft aufgerissenen Augen der alten Frau, der Betreuerin ihrer Kindheit, ins Gesicht schaute. »Katrin, wie kann man etwas Schönes träumen, wenn das Leben so hart ist, so schrecklich?«
Da setzte sich die alte Frau auf den Bettrand des Mädchens und legte schützend den Arm um sie. »Christina, meine kleine Tina, das Leben geht auf und ab. Es ist nicht immer schwer und drückend. Und jeder tut gut daran, seine Hoffnung zu bewahren. Ohne Hoffnung und ohne unsere Träume können wir nicht leben. Schon gar nicht solch kleines Mädchen wie du, das eigentlich erst mit dem Leben beginnt.«
»Ich bin alt, Katrin! Uralt komme ich mir vor!« Jetzt setzte sich das Mädchen in den weißen Kissen auf. »Katrin, ich bin heute sechzehn Jahre alt geworden!«
Die Frau nickte.
»Katrin, und dieser Geburtstag…«
Die Frau ließ Christina nicht aussprechen. »Ja, es war ein schrecklicher Tag, Tina! Aber du wirst auch einmal achtzehn Jahre alt sein. Und dann wird es wieder schöner für dich, mein kleines Herzblatt.«
»Oh, Katrin, wenn wir dich nicht hätten!« Ungestüm schmiegte das Mädchen sich in die Arme der Frau. »Niemals, niemals darfst du Brigitte und mich verlassen, hörst du, niemals!«
Die alte Katrin schwieg. Sie, die noch vor wenigen Minuten von den Träumen und Hoffnungen gesprochen hatte, wagte nicht daran zu erinnern, daß es dieses ›Niemals‹ auf dieser Erde gab, daß man mit ihm rechnen müsse.
Niemals kann Unglück auf Wiedenbruch heimisch werden –, hätten alle noch vor wenig mehr als drei Jahren gedacht.
Es gab kaum glücklichere Menschen als den in den besten Mannesjahren stehenden Stephan von Wiedenbruch, seine geliebte Frau Mechthild und beider Töchter Brigitte und Christina.
Stephan von Wiedenbruch war weitum der angesehenste Mann. Vom Vater hatte er die Fabrik übernommen, die schon mehr als 150 Jahre von den Wiedenbruchs geführt wurde. Sie lag auf dem Land, erinnerte in ihrer Umgebung mehr an ein Gut, vor allem mit dem schloßähnlichen weißen Herrenhaus. Tatsächlich war Wiedenbruch einmal ein Gut gewesen. Ein Vorfahre hatte es zum größten Teil verspielt, dem Sohn ein schweres Erbe hinterlassen. Dieser Sohn aber fand den Anschluß an das Industriezeitalter. Er schuf ein Fabrikunternehmen von internationalem Rang.
»Katrin, weshalb«, fragte in diesem Augenblick die kleine Christina und hob das zarte, fast noch kindliche Gesicht zu der mütterlichen Betreuerin, »Katrin, weshalb mußten Papa und Mama verunglücken?«
Weil die Zeiten verrückt sind! wollte Katrin antworten. Und weil man sich nicht in Flugzeuge setzen soll. Sie hatte ja immer gewarnt. Aber dann war jenes Entsetzliche geschehen, und die beiden Schwestern Wiedenbruch hatten an einem Tag beide Eltern verloren.
»Katrin, mich friert!« Die kleine Tina verbarg jetzt ihr Gesichtchen an der fülligen Brust der alten, so geliebten Frau. »Katrin, muß es denn gerade heute so stürmen? Horch nur!«
Ganz still verhielten sich die Frau und das noch so kindliche Mädchen. Wirklich –, um das Haus tobte ein Sturm, wie es sogar zur Herbstzeit selten war.
»Katrin, es ist beinahe so wie in der Nacht, als Papa und Mama verunglückten!« Plötzlich richtete sich Tina hoch auf. »Meinst du, daß heute auch ein Unglück kommt?«
Ist schon gerade genug Unglück über Wiedenbruch gekommen! dachte die alte Frau bei sich. Was sollte nun noch hereinbrechen?
Sie erinnerte sich daran, daß nach dem Tod Stephan von Wiedenbruchs und seiner Frau ein Mann auftauchte, den Wiedenbruch immer als Freund bezeichnet hatte. Bald aber wußte es der letzte Lehrling im Betrieb, daß dieser Mann kein Freund war. Rolf Lohmöller hatte sich als Vormund der beiden noch unmündigen Schwestern Brigitte und Christina anerboten. Er, der selber auch Industrieller war, hatte sich bereit erklärt, auch noch ein Auge auf den Wiedenbruchschen Betrieb zu werfen, selbst als er einen Geschäftsführer eingesetzt hatte. Der alte Prokurist aber schüttelte schon bald den Kopf.
»Er beabsichtigt unseren Ruin!« äußerte er insgeheim.
Keiner wollte ihm Glauben schenken.
Keiner wußte, daß Stephan von Wiedenbruch sich in diesem Freund getäuscht hatte. Rolf Lohmöller, der sich aus bescheidenen Verhältnissen hatte emporarbeiten müssen und durch einen kleinen Buckel von Natur aus gekennzeichnet war, hatte den strahlenden, überall beliebten Freund stets beneidet.
»Katrin!« flüsterte in diesem Augenblick die kleine Tina. »Glaubst du auch, daß Onkel Rolf Wiedenbruch absichtlich ruiniert hat? Die Leute sagen es!«
»Kindchen, Kindchen, laß die Leute reden. Es hilft weder dir noch Brigitte etwas. Laß das Grübeln. Es ist alles schon schlimm genug.«
Ja, es war entsetzlich. Denn die roten Bilanzzahlen erlaubten dem Unternehmen kein Weiterarbeiten mehr. Der Vorschlag zu verkaufen war aufgetaucht. Es war nur schwer, einen solventen Käufer zu finden. Man mußte schon neben der eigentlichen Fabrik auch den übrigen Besitz mit anbieten: das Herrenhaus, den Park.
»Katrin«, flüsterte die kleine Tina, die sich jetzt wegen des immer stärker heulenden Sturmes die Ohren zuhielt. »Katrin, kann man auch in der Stadt leben?«
»Man kann viel!« entgegnete die alte Frau, während sie die Hände von Tinas Ohren wegnahm. »Aber man soll die Augen und Ohren immer offenhalten.« In diesem Augenblick dachte die alte Kinderfrau auf Wiedenbruch daran, daß sie nicht nur die noch so kindliche Tina, die sich in dieser Sturmnacht fürchtete, betreuen mußte, sondern auch deren ältere Schwester Brigitte.
»Schlaf jetzt, Kindchen!« sagte sie deshalb zu Tina und erhob sich. »Ich will noch mal nach Britta sehen.«
»Die sitzt doch gewiß mit dem Maler zusammen, der die großen Gemälde in Papas Arbeitszimmer abtaxieren soll. Da kannst du ihr gar nicht helfen, Katrin. Von Bildern verstehst du doch nichts.«
Aber von Menschen! wollte die alte Frau sagen. Viel von Menschen. Und dieser Maler erscheint mir gefährlich. Britta ist kein Kind mehr, sie ist eine Schönheit, was du, kleine Tina, vielleicht noch nicht bemerkt hast, und zwar eine Schönheit, die alle Männer anzieht. Sie ist erst achtzehn und hat bisher wie ein kleines Mädchen unter meiner Obhut gelebt. Und nun sitzt sie Stunde um Stunde mit diesem Maler zusammen, den der Konkursverwalter geschickt hat. Matthias Petersen heißt er. Er sieht gut aus. Wer weiß, welches Unglück noch über Wiedenbruch kommen kann.
Im Augenblick, da Katrin die Tür öffnete, schlug sie ihr der über den breiten Flur jagende Sturm aus der Hand. Irgendwo mußte ein Fenster offenstehen.
Da will ich doch…
Aber Katrin sprach diesen Satz nicht mehr aus.
Plötzlich war der späte Herbstabend heller als ein Tag.
Und schon schrien ringsum Stimmen: »Es brennt. Ja, es brennt!«
Da wandte Katrin sich um. »Steh auf, Kindchen, kleine Christina, steh auf! Wer weiß, was sich alles ereignet!« Mit zitternden Händen zog die kleine Tina sich an. Sie packte auch ein paar Habseligkeiten in ihr Köfferchen. Es war das letzte, was sie von Wiedenbruch mitnahm. Denn in dieser Nacht brannte der gesamte Besitz ab. Die Feuerlöschzüge trafen verspätet ein. Der Sturm tat ein übriges.
Es gab kein Herrenhaus mehr, keine Fabrik. Selbst die uralten Parkbäume erhielten Brandmale, da es vorher wochenlang trocken gewesen war. Das Ausmaß des Unglücks war nicht abzusehen.
Keiner wußte, wie sich der Brand hatte entwickeln können. Nur der alte Diener Ruppert, der kurze Zeit darauf seinen Brandwunden erlag, flüsterte: »Ich hab’ ihn gesehen, den Geschäftsführer Weyler. Er kam aus seinem Kontor. Und dort hat es angefangen zu brennen. Hätte er nicht die Panzerschränke mit den Unterlagen retten können? Aber die Schränke waren geöffnet. Alles ist mit verbrannt. Alles…« Und dann flüsterte Ruppert nur noch den Namen der beiden Kinder seines Herrn, an dem er genauso gehangen hatte wie Katrin: »Gott bewahre sie. Furchtbares kommt auf sie zu. Ja, Waisen, mit Waisen hatte selten einer Erbarmen.«
Der alte Ruppert war tot. Er hörte nichts mehr vom Gerede der Leute. Er wäre dankbar gewesen, nicht mehr miterleben zu brauchen, wie Rolf Lohmöller achselzuckend den vollkommenen Untergang Wiedenbruchs feststellte, und er erfuhr auch nicht, welche Summe er dem letzten Wiedenbruchschen Geschäftsführer Weyler auf ein Auslandskonto einzahlte, weil er seinem Wunsch gemäß gehandelt hatte. Den Kindern Stephan von Wiedenbruch war so gut wie nichts mehr geblieben. Gerade so viel, daß sie eine bescheidene Ausbildung in einem Handelsschulkursus durchmachen konnten.
»Es kann einem nicht immer gutgehen!« hatte Lohmöller weise gesagt, als er die beiden fast noch kinderjungen Mädchen vor sich stehen sah. »Arbeiten, das müssen andere auch.«
Das war alles gewesen.
Und trotzdem träumte die kleine Tina noch von ihrer verlorenen Heimat Wiedenbruch.
Ich möchte einmal die Schwäne auf dem Schloßteich wiedersehen. Aber keiner dürfte mich dabei beobachten! dachte sie an diesem Nachmittag, an dem sie langsam den langen Gang des Krankenhauses entlangschritt.
Vor einer Stunde hatte man sie gebeten, sofort zu kommen.
Tinas Augen wanderten rundum. So lang schien dieser Gang mit den weißen Türen, im Hintergrund gab es eine Glastür.
Tina war vorher noch niemals in einem Krankenhaus gewesen. Hilfesuchend sah sie sich um. In der Ferne hörte sie Stimmen. An ihr vorbei wurde eine Trage gefahren, auf der eine Frau mit wächsernem Gesicht ruhte. Sie sah aus wie tot.
Britta, meine Britta! durchfuhr es die verstörte Tina, die plötzlich nicht mehr an die Schwäne dachte. Britta, was ist mir dir geschehen? Tinas Augen folgten voll Entsetzen der vorüberrollenden Trage, vor der sich die Glastür ganz kurz auftat, um sie dann in sich hinabzuschlucken. Monatelang hatte Tina die Schwester, an der sie mit allen Fasern ihres Herzens hing, nicht mehr gesehen. Während Tina mit Katrin in einer winzigen Wohnung in der Wiedenbruch benachbarten Großstadt lebte, hatte Britta plötzlich behauptet, sie könne eine besser bezahlte Stellung in einer kleineren Stadt bekommen. Sie habe dort eine frühere Klassenkameradin…
Britta hatte dies alles nervös erzählt. Vor allem war sie Katrins forschenden Augen ausgewichen. »Katrin, liebe alte Katrin!« hatte sie nur gesagt. »Du sagst doch selber immer: Kopf hoch und nicht vergessen, daß wir geborene Wiedenbruchs sind. In deinen Augen sind wir sogar Komtessen. Denn dir hat es ja nie gefallen, daß unser Vorfahr, als er seine Fabrik gründete und sich selber weniger gönnte als ein Landarbeiter, seinen Grafentitel ablegte.«
Brittas Augen waren unruhig hin und her gegangen. Ja, ihre Nerven waren entsetzlich angegriffen. Ihr tat eine Stelle in einer kleineren Stadt vielleicht gut.
Sie schrieb regelmäßig bis in die letzten Wochen, in denen ihre Briefe immer seltener wurden. Und dann hatte Tinas Nachbarin heute diesen Anruf aus dem Krankenhaus überbracht. Sie solle unverzüglich kommen. Zu ihrer Schwester.
Ich habe nicht mal gewartet, daß Katrin zurückgekommen ist, die nur für zwei Stunden eine Bekannte besuchen wollte, dachte Tina. Nur einen Zettel habe ich ihr hingelegt, damit sie sich nicht ängstigt. Aber ich – beinahe furchtsam schaute sie sich in der ihr so ungewohnten Umgebung um – ich ängstige mich entsetzlich.
Wenn doch irgendeiner käme!
»Na, kleines Mädchen!« In Tinas Einsamkeit klang eine dunkle, warme Männerstimme. »Was suchen Sie denn hier? Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Als Tina aufschaute, sah sie nicht den weißen Kittel des Mannes, der an Krankenaus, Glastüren, Tragen mit wie tot aussehenden Patienten erinnerte, sondern nur dies schmale, männliche Antlitz mit den dunklen, fast grauen Augen, die an die Farbe eines wolkenverhangenen Wintertages erinnerten. Und aus dem Verhangenen würden sich Schneeflocken lösen, weiße, leichte Flocken, wie sie immer den Park von Wiedenbruch verzaubert hatten. Dieses Wiedenbruch, die geliebte Heimat, aber war für alle Zeiten verloren. Vor einem halben Jahr war es verkauft worden an einen Mann, der etwas völlig Neues dort aufbauen wollte. Tina hatte erfahren, daß er die letzten noch stehenden Reste der Gebäude hatte abreißen lassen, alles sollte planiert werden, um ein Krankenhaus errichten zu können. Ein Krankenhaus für Kinder, die gelähmt waren.
Tinas Augen schauten weit geöffnet in die grauen des Mannes, der sich von seiner Höhe jetzt ein wenig zu ihr hinabneigte. »Haben Sie einen lieben Angehörigen hier liegen?« erkundigte sich nun die Stimme des Mannes.
Da schluchzte Tina auf.
»Ja, aber ich weiß gar nicht, weshalb. Und Britta hat doch niemals etwas von Kranksein geschrieben. Und jetzt – man hat mich angerufen. Aber ich weiß nicht…«
Boris Graf von Altenburg, Chef des der Allgemeinen Universitätsklinik angegliederten Kinderkrankenhauses, gehörte nicht zu den Männern, die sich lächelnd über die Unbeholfenheit anderer hinwegsetzten. »Wir werden Ihre Schwester suchen!« sagte er, schob Tina neben sich her, gerade auf die geheimnisvolle Glastür zu, hinter der sich ein langer Gang mit glänzend weißgelackten Türen auftat.
In kurzer Zeit hatte Prof. Boris von Altenburg festgestellt, welche Bewandtnis es mit der telefonischen Benachrichtigung auf sich hatte.
Die warmherzige Oberschwester Antonie schaute über die völlig verstörte Tina hinweg, als sie dem Arzt sagte:
»Brigitte von Wiedenbruch ist heute nacht von einem Jungen entbunden worden.«
»Britta – ein Junge?« Tina stammelte. Sie weinte jetzt nicht mehr, ihr war, als stürze rund um sie alles zusammen. »Ja, aber… Britta ist doch gar nicht verheiratet!«
Graf Boris von Altenburg wechselte mit der Oberschwester einen Blick. Hier schien eine Familientragödie größten Ausmaßes vorzuliegen. »Sie nehmen sich ihrer an?« fragte der Arzt nur kurz und deutete auf Tina. »Und – lassen Sie mich bei Gelegenheit das Nähere wissen!«
Die Oberschwester nickte nur kurz. Sie hatte Tina schon bei der Hand genommen. »Man braucht nicht immer verheiratet zu sein, um Kinder zu bekommen!« sagte sie.
Tina nickte. Natürlich. Wer sollte das mit siebzehn Jahren nicht wissen. Aber Britta – niemals hatte sie doch geschrieben, daß ihr ein Mann nahegestanden hatte. Sie hatte auch nicht gesagt, daß sie einer Geburt entgegensehe.
»Einem Kranken zuliebe muß man sein Herz ganz tapfer in beide Hände nehmen!« Oberschwester Antonie streichelte plötzlich über das leuchtendgoldene Haar Tinas. Dann fragte sie: »Haben Sie denn nicht noch ältere Verwandte?«
»Unsere Eltern sind tot!« sagte Tina so leise, daß die Worte fast nur zu erraten waren. »Und wir haben auch kein Zuhause. Nirgendwo. Papa und Mama hatten keine Geschwister. Und Katrin… Katrin besucht eine alte Freundin.« Dies letzte klang so alltäglich, so banal. Aber die Schwester spürte, daß es gut gewesen wäre, wenn diese Katrin in dieser Stunde auch hier im Krankenhaus hätte sein können. Denn in ihren Fieberdelirien hatte Brigitte von Wiedenbruch gerade nach dieser Katrin gerufen.
»Es ist gut«, erklärte Oberschwester Antonie auch deshalb, »wenn man eine solche Katrin besitzt. Es freut mich für Sie. Und nun – tapfer sein! Unsere kleine Mutter braucht ein wenig Sonnenschein.« Oberschwester Antonie öffnete bei diesen Worten die Tür eines Krankenzimmers, in dem nur ein einzelnes Bett stand. Sie wußte, daß diese kleine, schmale Gestalt in den hochaufgerichteten Kissen nicht mehr lange irdischen Sonnenschein nötig hatte.
»So, da kommt die Ersehnte!« sagte die Schwester, schob Tina einen Stuhl neben das Bett und zog dann leise die Tür hinter sich zu.
Tina starrte in das totenblasse, so völlig veränderte Gesicht der Schwester, deren Schönheit sie schon als kleines Mädchen bewundert hatte.
»Britta, oh, Britta!« Sie griff nach der schon wie leblos auf der Decke liegenden Hand der Schwester. »Britta, weshalb hast du Katrin und mir niemals die Wahrheit geschrieben?«
Da trat ein unsagbar hochmütiger Zug in das schon vom Tode gezeichnete Gesicht der jungen Frau. »Kleine Tina!« flüsterte sie. »Ich habe Schande über die Wiedenbruchs gebracht. Verstehst du das denn nicht?«
»Aber Britta!« Tinas Hände streichelten beinahe beschwörend der Schwester leblose Finger. »Wir haben doch schon soviel erlebt. Wir haben immer zusammengehalten. Weshalb hast du denn nichts gesagt?« Die kleine Christina von Wiedenbruch senkte den Kopf. »Britta, wenigstens zu Katrin hättest du Vertrauen haben müssen.«
»Katrin, unsere Katrin!« Das Gesicht Brigittes verklärte sich. Ein sehnsüchtiger, beinahe kindlicher Zug verlieh ihm einen aller irdischen Qualen entrückten Glanz. »Gerade Katrin hätte mich nie verstanden. Und«, die Stimme wurde tonlos, »ich habe mich selber nicht verstanden.«
Und dann flüsterte Brigitte wie zu sich selbst Wortfetzen, Gedankensplitter:
»Das war damals in jener Nacht. Tina erinnere dich doch! Als Wiedenbruch niederbrannte. So entsetzlich war alles. Ich habe mich so gefürchtet, so schrecklich gefürchtet! Alles war am Ende. Und ich war so allein. Und da…«
Ja, sie hatte sich dem Maler Matthias Petersen in die Arme geworfen, sie hatte Schutz, menschliche Nähe, Wärme bei ihm gesucht.
»Und dafür will ein Mann etwas haben!« sagte Brigitte, als besitze sie Erfahrung aus Jahrzehnten.
»Und weshalb«, Tina zitterte am ganzen Körper, »weshalb hast du ihn nicht geheiratet?«
Wie verloren schaute Brigitte die kleine Schwester an. »Er… er hat doch nichts davon gesagt. Damals, in der Brandnacht.«
»Aber du hast ihn doch gewiß wiedergesehen?«
Brigittes immer müder werdende Augen verneinten. »Nein, Tina, ich habe mich geschämt. Auch vor ihm geschämt. Er ist ein berühmter Mann. Und ich…, ich war doch ein Nichts.«
»Aber wenn du doch einen kleinen Jungen hast…« Tina reckte die kindlich zarte Gestalt jetzt straff auf.
Ganz langsam lösten sich Tränen aus den halb von den Lidern bedeckten Augen der jungen Mutter. »Tina – ich habe soviel Schande über Wiedenbruch gebracht. Ich… ich habe keine Haltung gehabt. Ich… ich konnte Matthias Petersen nicht schreiben, daß ich ein Kind von ihm erwarte.«
»Und wie hattest du dir das weiter gedacht?« fragte plötzlich sehr nüchtern die kleine Tina.
»Tina!« Kaum hörbar klang jetzt die Stimme Brigittes, auf deren Stirn sich von der Anstrengung des Sprechens helle Schweißtropfen abzeichneten. »Tina, ich habe gar nichts gedacht in den letzten neun Monaten. Ich hab’ vielleicht auf ein Wunder gehofft. Ich hatte solche Angst. Oh, mein Gott, Tina, sie waren entsetzlich, diese Monate. Sterben wollte ich. Aber da wuchs doch dies Leben in mir, dies kleine Leben, das sich nichts hatte zuschulden kommen lassen.«
Da schaute die kleine Tina die große, immer so bewunderte Schwester an. »Weißt du«, sagte sie, um etwas Tröstliches zu sagen, »du bist so schön, Britta, und alle haben immer gesagt, wie lustig und witzig du bist. Dein Maler wird dich gewiß heiraten, wenn er erfährt, daß du einen kleinen Jungen hast. Oder« – Tina zögerte – »ist er vielleicht schon verheiratet?«
Britta versuchte, den Kopf zu schütteln, war aber schon zu schwach. Tina las die Verneinung in ihren Augen.
»Dann ist es doch ganz einfach.« Tina fand plötzlich einen rettenden Einfall. »Weißt du, Britta, wir schicken einfach Katrin zu ihm hin. Katrin kann alles. Du weißt doch.«
Da umklammerten Brigittes beinahe bis zum Skelett abgemagerten Hände die zarten, noch so kindlichen Finger der Schwester. »Tina – versteh – ich weiß, ich habe keine Zeit mehr. Ich…«
»Britta!« Tina schrie plötzlich entsetzt auf. »Britta, nein, sag das nicht!«
»Ist es so schlimm zu sterben?« fragte die kleine, überzarte Gestalt in den Kissen.