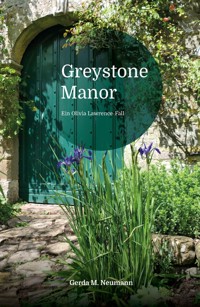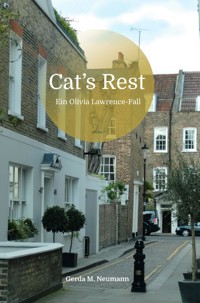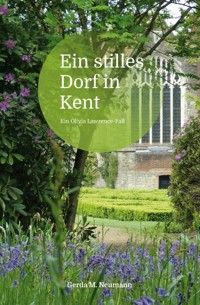
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein stilles Dorf in Kent, mit Eulen im Kirchturm und selbstgemachten Quittenprodukten im Überfluss, ist das Zuhause des Onkels von Olivia Lawrence. In diesem ländlichen Frieden sterben seit einiger Zeit erstaunlich viele ältere Menschen und Pfarrer Mottram beginnt, sich ernstliche Sorgen zu machen. Als dann eine ihm nahestehende Nachbarin unerwartet stirbt, ist das Maß voll. Olivias Onkel, Militärhistoriker im Ruhestand und mit dem Pfarrer befreundet, bittet seine Nichte um Hilfe. Und Olivia hat bald einen furchtbaren Verdacht…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein stilles Dorf in Kent
TitelseiteImpressumSkizze von HowlethurstKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Über die AutorinDie Olivia Lawrence-FälleTitelseite
Gerda M. Neumann
Ein stilles Dorf in Kent
Olivias fünfter Fall
Impressum
Copyright © 2017 der vorliegenden Ausgabe: Gerda M. Neumann.Erstausgabe.Satz: Eleonore Neumann.Umschlaggestaltung: © Copyright by Benjamin Albinger, Berlin.www.epubli.deVerlag: Gerda NeumannDruck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Skizze von Howlethurst
Skizze von Howlethurst
Kapitel 1
Könntet ihr womöglich mit Leonards Auto kommen, Puck?‹ ›Sicher! Wir können auch mit der Bahn kommen, wenn dir das lieber sein sollte? Allerdings hättest du dann die Fahrerei nach Staplehurst am Hals.‹ ›Das macht nichts. Gar nichts. Wunderbar, Puck, ganz wunderbar. So machen wir es.‹ Olivia, die sich diesen Dialogfetzen in Erinnerung rief, während die Zugbremsen rumorten, blitzte Leonard vergnügt an: »Welches Geheimnis wohl auf uns wartet?« Und der Zug kam zum Stehen. Fast schneller als die Waggontüren sich öffneten, sprang sie auf den Bahnsteig und umarmte ihren Onkel. Raymund Fisher war physisch betrachtet ein kleiner Mann, nicht viel größer als seine Nichte, also etwa ein Meter siebzig groß. Dazu hager, mit tiefen Furchen im Gesicht und, wie zur Milderung dieser Lebensspuren, einem sich allmählich lichtenden Dschungel grauer Locken. Olivia war überzeugt, dass er sie jetzt, wo er auf dem Lande lebte, gelegentlich eigenhändig mit der Schere traktierte. Er erwiderte ihre Umarmung mit Freuden. Dann umfasste er ihre Schultern und schob sie so weit von sich, dass er sie ansehen konnte. Zwei gleiche dunkelbraune Augenpaare versicherten sich ihrer Zusammengehörigkeit. Raymund Fisher drückte noch einmal die Schultern seiner Nichte, bevor er sich Leonard zuwandte. Er mochte Olivias Freund oder Lebenspartner oder wie immer er ihn bezeichnen sollte – wie viel einfacher war es doch gewesen, als so eine Beziehung zur Ehe geführt hatte und man einfach von dem ›Mann‹ reden konnte – aber er war wohl wieder einmal unnötig kompliziert: Der baumlang vor ihm aufragende Mann war inzwischen auch für ihn einfach ›Leonard‹ und sie verstanden sich ausgezeichnet. Während der Autofahrt schwiegen sie. Olivia schaute auf das vorbeiziehende Land: die heckenumsäumten Weiden, den lichten Wald, die roten Ziegelsteinhäuser von Sissinghurst und wieder auf Wald. Sie unterdrückte einen Seufzer: »Es ist so schön hier, Raymund, ich verstehe gerade überhaupt nicht, warum ich so lange nicht hier gewesen bin!« »Das kann ich dir sagen, Puck, weil ich nicht hier sein wollte. Ich bin lieber nach London gekommen. Anns Tod hat mir diese ländliche Idylle entschieden verleidet… aber langsam wird es besser. Als in diesem Frühjahr die Osterglocken blühten und die bescheidenen Primeln unter den Hecken, fand ich das Leben alles in allem doch wieder ganz schön.« Olivia nickte stumm. Bilder ihrer Tante Ann schoben sich vor die vorbeiziehende Landschaft. Ihre hellen, lachenden Augen in dem klaren alterslosen Gesicht, die glatten, kurzen Haare, die immer hellbraun geblieben zu sein schienen und allen Wetterunbillen standhielten, und die weitgeöffneten Arme, die sie zur Begrüßung fest an den weichen molligen Körper zogen. Gerade bevor eine unerwartete Traurigkeit sich ihrer bemächtigte, waren sie angekommen. Der Wagen hielt vor einer schwarzen Haustür. Den kurzen Weg von der Straße dorthin säumte Heiligenkraut. ›Es gibt kein gastlicheres Willkommen‹, dachte Olivia auch dieses Mal und wehrte sich entschlossen gegen die lauernde Traurigkeit. Der Zugang öffnete sich wie ausgestreckte Arme und machte Platz für zwei bequeme Holzsessel rechts und links neben der Haustür. Wer immer kam, er konnte sich niederlassen. Das Haus selbst war ein Fachwerkhaus aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts mit schiefen Wänden, einem behäbigen Dach und geziegelten Schornsteinen. Raymund führte seine Gäste ins Bad, damit sie sich frisch machen konnten. Er selbst richtete den vorbereiteten Lunch, plötzlich ein wenig aufgeregt und ein klein wenig umständlich. Olivia versuchte zu helfen, doch er ließ es nicht zu. Also sah sie sich um. Onkel und Tante hatten das Haus zu beiden Seiten ausgebaut: Neben der Küche ein großes Bad und auf der gegenüberliegenden Seite neben dem Wohnzimmer eine Bibliothek, damit war der Garten zur Straße hin vollständig abgeschirmt, nur ein schmaler Weg an der Badezimmermauer entlang stellte die Verbindung nach draußen her. Anschließend hatten sie das Haus nach hinten geöffnet: Rückwand von Küche und Wohnzimmer markierten lediglich einige Stützsäulen, dahinter erstreckte sich in der vollen Ausdehnung des alten Hauses ein Wintergarten. Hier stand der Esstisch, an den Raymund sie nun einlud, Platz zu nehmen. Leonard trennte sich von dem ersten Bücherregal, an dem er hängen geblieben war, Bücher zur Geschichte von Kent und Gartenbücher. »Nicht nur«, Raymund deutete auf die beiden untersten Fächer, »dort stehen Bücher über Oxford und die Themse und so weiter. Die Vergangenheit lebt noch, wenn auch etwas abgesenkt.« Während sie munter zugriffen, das Frühstück in Fulham lag nun doch eine Weile zurück, tauschten sie Neuigkeiten aus. Olivia hatte die Übersetzung eines modernen Romans ins Deutsche fast beendet, Leonard war gerade wieder in Mombasa gewesen, bei großen Wiederaufforstungsprojekten, an denen er als Wissenschaftler der London School of Economics teilnahm. Onkel Raymund stellte viele Fragen und gewann dabei seine alte, Olivia so sehr vertraute Gelassenheit zurück. Er selber hatte die letzten Wochen hindurch gelesen, wie auch all die Monate davor, viele Bücher, die er sein Leben lang schon hatte lesen wollen, war Fragen nachgegangen, zu denen er immer schon Antworten hatte bekommen wollen. Und nichts von alledem hatte mit seinem Fachgebiet als Universitätsprofessor zu tun gehabt. »Wisst ihr, Militärgeschichte ist nicht geeignet, persönliche Fragen zu beantworten. Ganz gelegentlich denke ich in den letzten Wochen wieder an meine alte Profession, aber noch drängt es mich nicht zur Rückkehr.« Olivia sah ihn aufmerksam an: »Aber mit irgendwelchen strategischen Fragen beschäftigst du dich, sonst hätten wir nicht mit der Bahn kommen sollen.« Ein Grummeln, das fast aus Raymunds Brustkorb zu kommen schien, ersetzte die Antwort und ließ Olivia und Leonard kurzfristig den Atem anhalten. Ein ganz ähnliches Grummeln schien von den Palmen her zu antworten, die am anderen Ende des Wintergartens um eine Sitzgruppe herumstanden. Der Haufen aus Kissen und Decken, der dort lag, bewegte sich und ein Katzengesicht schob sich verschlafen aus der Lücke unter der Decke heraus. Die beiden Gäste starrten es an und die schrägen Bernsteinaugen starrten sie an. Onkel Raymund nahm das verschlafene Tier auf den Arm: »Siehst du, das ist Olivia und da drüben, das ist Leonard, zwei sehr enge Familienmitglieder, du solltest dich mit ihnen anfreunden, bitte.« Und mit einem leisen Lächeln fuhr er fort: »Darf ich vorstellen: Marmalade, Nachfahrin von Jock III. Hausherr über Chartwell.« »Das ist nicht wahr!« »Aber ja, Puck, natürlich ist es wahr.« Das Lächeln in seinen Augen verstärkte sich, während er sachlich erklärte: »Winston Churchill wünschte sich, dass immer ein Nachfahre seines Katers Jock auf Chartwell leben sollte. Und ihr wisst ja, erfüllbaren Wünschen kommt der National Trust durchaus nach. Katzen haben aber nun mal nicht nur einen Nachkommen und so fand ein alter Freund nach Anns Tod, es sei eine gute Idee, mir eine Nachfahrin von Churchills Kater in Obhut zu geben… für einen alten Militärhistoriker nachgerade eine Schuldigkeit… Wie dem auch sei, ich habe diesem lieben Gesicht nicht lange widerstanden.« »Du hast mir nie davon erzählt!« »Nein. Zu Anfang war es mir ein wenig peinlich, fürchte ich. Und dann dachte ich, es sei das nächstliegende, ihr würdet euch einfach kennenlernen.« Olivia war zu ihrem Onkel an die Glasfront getreten und betrachtete das Tier auf seinem Arm: Es hatte weiches ingwerfarbenes Fell mit einem leichten Tigermuster, einen weißen Brustlatz, weiße Pfoten und eine rosa Nasenspitze wie ein Jaguar. Leise begann sie mit ihr zu reden, nach kurzem Zögern schnupperte Marmalade in den Luftraum zwischen sich und der fremden Frau. Raymund setzte sie auf den Boden und öffnete die Tür: »Kommt, wir gehen ein wenig durch den Garten.« Der Garten war von hohen Hecken umschlossen. Dem Wintergarten gegenüber standen Haselnusssträucher im ersten Frühlingsgrün, zur rechten, auf der Seite der Bibliothek, wuchs eine dichte Taxushecke, davor lagen einige Gemüsebeete, und zur linken, nach Süden, schloss eine Lorbeerhecke das Grundstück ab. Es war groß genug, dass man sich bedenkenlos draußen unterhalten konnte. Marmalade strich um sie herum und entschied sich dann, Leonard genauer kennenzulernen. »Das letzte Jahr war ein schlechtes Haselnussjahr, in diesem Frühjahr sehen die Sträucher vielversprechender aus.« Raymund schlenderte auf die Hecke zu. »Klingt wie die Gesprächseröffnung eines MI5-Agenten.« Keine Reaktion. »Schau, die Wolfsmilch blüht, die Leberblümchen nicht mehr, aber bald werden die Akelei wieder Blau vor die Hecken bringen. Da drüben übrigens«, er deutete nach links an die Füße eines besonders mächtigen Strauches, »werden etwas später wilde Akelei blühen, sie sind weinrot und klein, eine bescheidene, sehr schöne Waldblume.« Olivia liebte Gärten. So hatte sie kein Problem mit dem Thema, das ihr Onkel beharrlich verfolgte. Gleichzeitig wuchs die Neugier auf das, was er nicht erzählte, mit mindestens gleicher Beharrlichkeit. Die Rettung bog im schwarzen Anzug um die Ecke des Wintergartens. Der Anzug gehörte zu einem korpulenten, mäßig großen Mann. Dessen kahlen Schädel umstand ein dichter, sorgfältig gestutzter Kranz grauer Haare. Auf der Nase saß eine unauffällige Hornbrille. Den Oberkörper leicht zur Seite geneigt eilte der Pfarrer die Gartenpfade entlang, die Rechte zum Gruß ausgestreckt. »Miss Lawrence, wie schön, Sie zu sehen. Es freut mich wirklich sehr.« Höflich reichte sie ihm ihrerseits die Hand. Sie hatte Pfarrer Mottram vor drei oder vier Jahren kennengelernt, als sie Tante und Onkel in ihrem neuen Haus besucht und sich im Sonntagsgottesdienst wiedergefunden hatte. Raymund spielte die Orgel. In Oxford hatte er es zwei Jahrzehnte hindurch jeden Abend unter der Woche getan, in der Kapelle seines Colleges. Hier in Howlethurst in Kent, seinem neuen Wohnort, spielte er nun bei allen größeren Gottesdiensten. Auf diesem Wege war er zu einem bekannten und anerkannten Gemeindemitglied geworden, wiewohl er gerade mal vier Jahre in Howlethurst lebte, davon die Hälfte der Zeit als Witwer. Olivia hatte den Pfarrer allerdings wesentlich zurückhaltender in Erinnerung. Im Moment wirkte er ein wenig seltsam, mit einer unterdrückten Unruhe, die anscheinend mit ihr zu tun hatte. Seine eindringliche Musterung beendete sie, indem sie ihm Leonard vorstellte. »Mr Kilpatrick«, seine Wendung zu dem Mann etwas abseits auf dem Rasen verlief so heftig, dass er dabei Marmalade mit dem Fuß anstieß. Gekränkt marschierte sie davon; auch sie schien ihren alten Freund heute verändert zu finden. »Es freut mich natürlich außerordentlich, dass Sie Ihre Frau begleitet haben. Jeder Denker mehr erhöht die Möglichkeit, unser Problem zu erhellen. Gerade die Unvoreingenommenheit eines Außenstehenden scheint mir Hilfe zu versprechen. Raymund und ich sind ratlos, müssen Sie wissen. Vollständig ratlos. Verstehen Sie?« »Um ehrlich zu sein – nein. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen«, bekannte Leonard. Der Pfarrer vollführte eine weitere heftige Bewegung um seine Achse: »Raymund, soll das heißen, du hast noch nicht über unser Problem gesprochen? In all der Zeit?« »In all der Zeit! Olivia und Leonard sind gerade mal anderthalb Stunden hier. Und das nach zwei Jahren! Da muss man doch erst einmal in Ruhe ankommen.« »Wenn du dazu die Ruhe hast… ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr euch die Jahre hindurch nicht gesehen hättet.« »Roger…« Raymunds Hand legte sich leicht um den Oberarm seines Freundes, »wir werden es jetzt tun, nachdem wir Tee gekocht und Fenster und Türen geschlossen haben.« Olivia musterte unauffällig den sichtlich rastlosen Pfarrer, während sie Teegeschirr zu jener Sitzecke des Wintergartens trug, die dem Wohnzimmer vorgelagert war und mit einer reichen Sammlung großer Topfpflanzen wie die Lichtung in einem Hain wirkte. Ganz natürlich hatte Marmalade hier ihren Schlafplatz bekommen, fand sie. Mitten auf dem Tisch thronte die Plätzchendose ihrer Tante, so wie immer. Sie musste einfach hineingucken – und staunte: Duft von frischem Ingwer strömte ihr entgegen. »Ingwerplätzchen! Raymund, darf ich kosten?« »Selbstverständlich! Greif zu!« Sie knabberte an dem knusprigen und gleichzeitig ein wenig klebrigen Keks und schaute zu, wie ihr Onkel das gerade nicht mehr kochende Wasser geruhsam über die Teeblätter goss. Schließlich war die große Kanne gefüllt. »Die Plätzchen sind auch gut, aber ganz anders als die von Ann.« »Aber ja, Puck! Sei nicht enttäuscht, alles im Leben ändert sich einmal. Und gerade für Ingwerplätzchen, denke ich, hat jede englische Hausfrau ihr Geheimrezept. Diese enthalten bestimmt irgendetwas von der Quitte. Sie sind von Aphra Mottram, weißt du…«
⋆
Olivia sah zum Pfarrer hinüber; Roger Mottram verteilte das Teegeschirr mit leicht zitternden Händen, verrückte dabei jedes Teil mehrmals, bis er die Hände zurückzog, und dann doch noch einen Löffel anders legen musste. Sie kam die letzten paar Schritte zu ihrem Onkel heran: »Gewinnt sie auch Aufputschmittel aus Quitten… wenn man sie lange genug liegen lässt und dann auspresst, zum Beispiel… Pferde sollen durch den Genuss von Fallobst in die seltsamsten Zustände geraten sein…« Sie musste endlich doch lachen, wenn auch leise: »Du alter Stratege, dein Freund ist deiner Disziplin nicht gewachsen. Nun erlöse ihn endlich und rede.« Raymund Fisher ließ sich noch immer Zeit. Er schenkte Tee ein und barg die Kanne sorgfältig unter einer gefütterten Haube. Er reichte ihnen das Kännchen mit heißer Milch und wartete, bis jeder genommen hatte, er reichte den Zucker, den außer Roger Mottram niemand gebrauchte. Dabei redete er gerade so viel über seine einzelnen Handgriffe, dass daneben kein anderes Thema aufkommen konnte. Er öffnete die Plätzchendose und trug den Deckel zu einem Beistelltischchen. Endlich setzte er sich. Doch lag die Rolle des Majordomus so zweifelsfrei bei ihm, dass keiner sich rührte. Olivia beobachtete den Schalk hinten in seinen Augen, die wachsende Sorge in der Miene des Pfarrers und Leonards zunehmende Verwunderung. Sie trank dabei in kleinen Schlucken ihren heißen Tee.
⋆
»Roger, du bist dran«, äußerte Raymund beiläufig und griff zu seiner Teetasse. Roger schnaufte tief und geräuschvoll, reinigte seine vor Schreck überlaufende Nase noch geräuschvoller und setzte sich stöhnend wie ein alter Mann wieder in seinen Sessel. »Also weißt du, alter Freund, du wirst doch nicht angeklagt – wenigstens will ich hoffen, dass es am Ende so ist.« Raymund behielt seine Leichtigkeit bei. »Erzähle einfach von deinen Beobachtungen. Ich bin sicher, Olivia und Leonard werden sie zuerst einmal als unerwartetes Gesprächsthema auffassen.« Pfarrer Mottram leerte seine noch dampfende Teetasse in einem Zug. ›Vermutlich Raucher‹, schloss Olivia im Stillen, ›ein wenig ungewöhnlich für diesen Typ Ehemann.‹ Er stellte die Tasse ab und stützte die freigewordene Hand auf das vorgeschobene Knie. »Sie werden gleich verstehen, warum mir das Reden so schwer fällt. Die Sache ist die, in meiner Gemeinde mehren sich seit einigen Jahren die Todesfälle unter den älteren Mitbürgern. Nicht gerade spektakulär, aber doch deutlich nicht mehr normal, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß eigentlich nicht einmal, an welchem Punkt ich ernsthaft ins Grübeln kam. Ich sprach mit meiner Frau darüber und praktisch, wie sie ist, schlug sie vor, so etwas wie eine Statistik zu erstellen. Wir taten das auf der Basis des Kirchenbuches für die letzten zehn Jahre.« Nach kurzer Pause, in der die Falte über seinem Nasenrücken sich zur Furche vertiefte, nahm er Olivia fest in den Blick: »In den letzten drei Jahren starben pro Jahr nahezu doppelt so viele Mitbürger zwischen sechzig und achtzig wie in den sieben Jahren davor.« Er schwieg. Olivia sah, dass er eine Reaktion von ihr erwartete. »Darf ich fragen, was dieser Befund in absoluten Zahlen bedeutet?« Roger Mottram atmete hörbar durch. »Ja, selbstverständlich. In den ersten sieben Jahren, die wir durchsahen, waren es drei, gelegentlich vier Todesfälle, in den letzten drei Jahren zunächst acht, im letzten Jahr zehn.« Er sah Olivia ernst an: »In absoluten Zahlen scheint das nicht viel zu sein, schließlich handelt es sich um ältere Menschen. Aber wir hatten in den letzten Jahren keine schweren Erkältungswellen, keine ungewöhnlichen Grippeserien, warum dann also? Und warum so konstant?« »Gab es in den anderen Altersgruppen auch veränderte Todesraten?« erkundigte Leonard sich sachlich. Der Pfarrer schrak zusammen: »Das weiß ich nicht exakt zu sagen. Wir haben nur die Fälle zusammengezählt, von denen ich sprach.« Er sah Leonard ein wenig verstört an: »Wir können das nachholen, wenn Sie das für wichtig halten.« »Ob es wichtig ist, wissen wir erst hinterher«, reagierte Leonard beruhigend, »wenn Sie wollen, kann ich es gern nachher für Sie auszählen.« »Wenn Sie dazu bereit wären… wir könnten es zusammen machen. Dann gewinnen wir wissenschaftliche Klarheit – gewissermaßen. Das wäre tatsächlich beruhigend.« Raymund verteilte erneut heißen Tee, dieses Mal sagte er kaum ein Wort. Olivia sah ihren Onkel aufmerksam an. Sie wagte nicht zu schließen, was der alte Fuchs im Schilde führte. Leonard nahm sich erneut des Themas an: »Haben Sie mit jemandem über Ihre Entdeckung gesprochen? Zum Beispiel mit dem zuständigen Arzt?« Wieder holte Mr Mottram tief Luft: »Ja, das tat ich.« »Und?« »Ja, wissen Sie, seitdem bin ich eigentlich erst richtig beunruhigt. Dr. Chalklin hörte sich meine Sorgen ruhig an. Danach bat er lediglich um eine Liste der Todesfälle der in Frage stehenden Jahre. Kein Wort mehr. Ich brachte sie ihm und eine Woche später bat er mich am Abend zu sich und ging die Liste durch, indem er mir zu jedem Fall die Todesursache erläuterte. Alles schien so normal, dass ich mich fast schämte, ihm so viel Mühe gemacht zu haben. Wieder ließ er sich kein Wort zu viel entfallen. Als Arzt darf er das einerseits nicht, andererseits könnte ihm mein Berufsstand doch eine Ausnahme von seiner Schweigepflicht ermöglichen.« »Warum steigerte dieses Gespräch Ihre Unruhe?« »Ja, wieder eine berechtigte Frage.« Er sah Leonard eine Weile lang schweigend an. »Ich fürchte, diese sachliche Neutralität machte mich fertig. Er stellte medizinische Tatsachen fest, zu denen sich nichts hinzufügen ließ. Dabei muss man sich doch wundern dürfen! Selbst die Wissenschaft müsste ihren Fortschritt einstellen, wenn die Forscher verlernen würden, sich zu wundern – aber das sah er nicht ein.« »Ist Dr. Chalklin ein guter Arzt?« Olivia sah über ihre dampfende Teetasse hinweg zu Mr Mottram. Der musterte sie eine geraume Weile, währenddessen sie feststellte, dass er zwar etwas ruhiger geworden war, aber auch sehr viel ernster. »Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Seine fachliche Kompetenz bestreitet niemand, jedenfalls hätte ich das nie gehört. Ebenso wenig weiß ich von gravierenden Fehlentscheidungen. Er hält engen Kontakt zur medizinischen Forschung, er ist neuen Medikamenten oder sonstigen Therapien gegenüber aufgeschlossen. Alles bestens. Und doch will mir scheinen, dass da etwas fehlt. In meinen Augen ist die Medizin keine reine Naturwissenschaft, doch das bestreitet Dr. Chalklin entschieden.« »Behandelt er Migränepatienten?« »Persönlich weiß ich von einem Fall. Er nahm eine genaue Untersuchung vor, befragte sein pharmazeutisches Handbuch und verschrieb Tabletten, die auch halfen. Ansonsten hätte er seinen Patienten sicherlich zum Spezialisten überwiesen. Streng sachlich das Ganze.« »Wie lange ist er Arzt hier in Howlethurst?« »Bald dreißig Jahre müssen es sein; er war schon da, als meine Frau und ich hierherkamen vor vierundzwanzig Jahren.« »Wie gut kennen Sie einander?« »Auch das ist schwer zu sagen. Natürlich kommt in so vielen Jahren alles Mögliche zur Sprache. Aber was nicht zu Sprache kommt, ist vermutlich wesentlich mehr und wäre bedeutend interessanter. Ich denke, ich kenne ihn nicht sehr gut. Und auch sonst niemand hier.« »Mit wem haben Sie noch über Ihre Beobachtung gesprochen?« schaltete Leonard sich dazwischen. Mr Mottrams Kopf flog herum: »Was sagten Sie? Ach ja richtig, entschuldigen Sie. Wer sonst noch.« Er versuchte, ruhig durchzuatmen, bevor er antwortete. »Da ist niemand. Es ergab sich vor einigen Wochen, dass ich mit dem Chief Inspector von Cranbrook sprach, zugegeben sehr neutral. Doch seine Reaktion war klar: Derartige Verdachtsmomente fallen unter seine Wahrnehmungsschwelle.« »Und ein Apotheker?« »Nein. Die gängigen Medikamente hat Dr. Chalklin vorrätig, besorgt sie in dringenden Fällen auch, hier auf dem Land gibt es diesen täglichen Lieferservice, sehr praktisch. Ansonsten kauft man seine Hustenbonbons in Cranbrook oder Tenterden. Alles sehr anonym.« »Das heißt: Von Ihren konkreten Sorgen wissen Dr. Chalklin und Ihr Freund Raymund hier, sonst niemand?« fasste Leonard zusammen. »Kein alter Studienfreund wer-weiß-wo in England?« »Nein, niemand, außer meiner Frau natürlich. Aber sie redet sicher mit niemandem darüber.« Raymund Fisher sah in die Runde, dann erhob er sich und holte Gläser und eine Flasche Sherry. Ruhig und schweigend goss er ein, alle drei sahen ihm wortlos zu und hoben wortlos ihre Gläser. »Ich trinke darauf, dass wir dieses Problem aufklären können!« Olivia, die während dieser kleinen Zeremonie Pfarrer Mottram im Blick behalte hatte, schaute überrascht zu ihrem Onkel. »Ganz recht, Puck, wir setzen unsere Hoffnungen in deinen Scharfsinn.« Olivias dunkelbraune Haare flogen um ihren Kopf, der Sherry geriet in schweren Seegang und beruhigte sich wieder, genau wie die glatten Haare wieder in ihre alte Position zurückglitten. »Damit wäre die Katze also aus dem Sack…« »Lediglich Rogers Hoffnung – für eine Katze viel zu defensiv.« Ihre dunklen Augen wanderten in den Garten hinaus, nach einer regungslosen Minute kehrten sie zum Gemeindehirten zurück. »Was ist passiert? Warum wollen Sie jetzt auf einmal aktiv werden?« Als er zurückschrak, schüttelte sie noch einmal den Kopf, dieses Mal nur andeutungsweise. »Der Fall beschäftigt Sie offensichtlich schon eine ganze Weile. Irgendetwas muss passiert sein, das Ihre Beobachtungen zu einem wirklichen Verdacht hin verschoben hat. Sonst säßen wir nicht hier.« Pfarrer Mottram räusperte sich, rückte in seinem Sessel nach vorn und begann: »Sie haben recht. Vor zwei Wochen starb Delia Large. Ihr gehörte das schöne Haus drei Grundstücke von hier Richtung Hauptstraße. Sie war eine enge Freundin meiner Frau, deshalb kennen wir ihre Verhältnisse recht gut. Und deswegen verstehen wir ihren plötzlichen Tod überhaupt nicht. Dr. Chalklin hat Sekundenherztod diagnostiziert. Das stimmt vermutlich, aber wie kam es dazu? Sie hatte ein schwaches Herz, aber es sah nicht bedrohlich aus. Außerdem war sie gerade in der letzten Zeit sehr entspannt.« »Gab es dafür einen besonderen Grund?« »Sie erwartete ihre Großnichte, die den Sommer bei ihr verbringen wollte. Sie liebte diese Nichte sehr, entsprechend freute sie sich auf die gemeinsame Zeit.« »Was können Sie mir über diese Nichte erzählen?« »Susan Large hat eine etwas ungeordnete Kindheit im Rücken: Die Eltern trennten sich, als sie in der Grundschule war, der Vater ging nach Cardiff, die Mutter lebte in kurzfristigen Beziehungen und nahm sich wenig Zeit für ihre Tochter. Deshalb drängte der Vater darauf, sie ins Internat zu geben. Sie besuchte mehrere, warum weiß ich nicht. Danach ging sie nach Indien und arbeitete in einem Waisenhaus in einem Tal am Fuße des Himalaya. Im Sommer wären es drei Jahre gewesen. Ihre Großtante hoffte, dass sie sich jetzt nach einer Lebensperspektive in England umsehen wollte.« »Wo ist sie im Augenblick?« »Drei Häuser weiter. Ihre Großtante hat ihr das Haus hinterlassen.« »Wo war sie beim Tod ihrer Tante?« »In Indien.« »Wusste sie vom Inhalt des Testamentes?« »Nein.« »So sicher?« »Ja. Wir waren bei der Testamentseröffnung dabei. Ihre – und auch die Reaktion ihres Vaters – lassen keinen Zweifel zu.« »Müssten wir uns mit dem Vater näher beschäftigen?« »Ich denke nicht. Er lebt noch immer in Cardiff, in einer zweiten Ehe, wieder mit einer Tochter. Alle drei kamen jeden Sommer für eine Woche zu Besuch. Das übrige Jahr hindurch hielt er telefonisch lockeren Kontakt zu Delia Large. Sie verstanden sich gut, ohne einander sehr nahe zu stehen.« »Wissen Sie etwas über das Verhältnis zwischen Vater und Tochter?« Mr Mottram leerte sein Sherryglas, in Ruhe, stellte Olivia bei sich fest. »Ich fürchte, darüber weiß ich nichts«, bekannte er bedauernd. »Aber das könnte ein gutes Thema für Sie sein, wenn Sie mit der jungen Frau ins Gespräch kommen, meinen Sie nicht?« »Wenn…« Sie sah einen nach dem anderen genau an: Leonard bemühte sich, ein neutrales Gesicht zu machen, Raymund schaute ernst und offen, Roger Mottram voll erwartungsvoller Hoffnung. Wie kam er nur dazu, sie war Übersetzerin und Journalistin und zwar gern. Nur weil die Neugierde sie sehr gelegentlich in einen Mordfall hineingerissen hatte, musste sie doch nicht zwangsläufig zur Wiederholungstäterin werden. Sie seufzte hörbar: »Wissen Sie, ich bin alles andere als ein Profi im Aufstöbern von Erklärungen für verwirrende Befunde oder auch für eine so klare Frage wie die: Wer hat Delia Large ermordet. Mit einem solchen Verdacht sollte man doch die Polizei in Bewegung setzen können.« »Du übersiehst den Totenschein von Dr. Chalklin, Puck«, erinnerte Raymund sie sanft und zurückhaltend. »Aphra und Roger sind aus einer Reihe von Gründen anderer Meinung als er, aber das interessiert unter diesen Umständen keine offizielle Stelle.«
Kapitel 2
Raymund Fisher ging hinaus in den Garten. Leise rief er nach Marmalade. Das Katzenmädchen schob sich mit durchhängendem Kreuz unter der Buchsbaumabgrenzung zum Gemüsegarten hindurch, streckte sich behaglich und spazierte heran, strich um die Beine seines Besitzers und wandte sich neugierig Olivia zu. Folgsam hockte diese sich nieder und kraulte die junge Dame hinter den Ohren. Leise erzählte sie ihr, wie hübsch sie sei, doch nicht lange, dann musste sie lachen. »Wie viel närrisches Zeug man aus dem Stegreif zu reden imstande ist!« Sie streckte sich nun ebenfalls. Einen Handstandüberschlag oder andere unerwartet ausgreifende Aktionen verkniff sie sich angesichts des Katzenmädchens. Seit den Balletträumen ihrer Schulzeit halfen ihre die seinerzeit vieltrainierte Übungen, ihrem inneren Menschen Luft zu verschaffen und sich zu entspannen. Das ging nun nicht, aber es bedeutete ihr gerade nicht viel. »Ach, Raymund, wie schön es bei dir ist! Schau mal«, sie schlenderte zu den Rosen hinüber, »das dunkle Rot der jungen Blätter über einem Meer blauer Frühlingsanemonen.« Während er sein Rosenbeet betrachtete, nahm der Onkel zum ersten Mal Stellung: »Puck, selbstverständlich kannst du Rogers Ansinnen ablehnen.« Olivia sah ihn an: »Warum hast du mir nichts gesagt?« »Du weißt, dass ich die Dinge nicht gern unnütz herum rolle. Er sollte es dir zuerst einmal selber erzählen, handelt es sich doch um sein Problem. Ihm würdest du helfen, nicht mir, jedenfalls nicht in erster Linie.« »Aber du nimmst es genauso ernst?« »Bis zum Tode von Mrs Large nahm ich es ernst, weil ich Roger sehr ernst nehme. Aber ich sah weder eine Möglichkeit noch wirklich eine Notwendigkeit zum Handeln. Jetzt, denke ich, ist der Zeitpunkt zum Handeln gekommen, weil Rogers Verdacht für mich unabweisbar zu sein scheint, ich sage scheint, und außerdem ein erster Ansatzpunkt für Fragen greifbar ist.« Er sah sie offen an. Langsam schlenderten sie an den verschiedenen Rosen entlang. Schließlich blieb Olivia stehen: »Der einzige Schluss, den deine Äußerung zulässt, ist der, dass auch du den Tod von Mrs Large für Mord hältst.« Sie sah ihn fest an. »Demnach wäre die Überzahl der Todesfälle ebenfalls auf Mord zurückzuführen. Und da Morden kein Gesellschaftssport ist, hättet ihr einen Serientäter unter euch.« »Vermutlich eine Täterin.« Olivia wartete. »Die meisten Toten sind Frauen«, ergänzte ihr Onkel, »ich glaube, man darf das aus Rogers Befund schließen. Es geschieht vollkommen gewaltfrei und aus präziser Kenntnis der Verstorbenen. Nur so ist es möglich, dass Dr. Chalklin immer eine natürliche Todesursache diagnostiziert. Deshalb halte ich es für die Handschrift einer Frau.« »Wenn auch du den Tod der Mrs Large für Mord hältst, wäre das trotz Dr. Chalklin der Zeitpunkt, die Polizei zu benachrichtigen.« »Die wird uns auf den Totenschein zurückverweisen.« »Also steht Dr. Chalklin zwischen euch und der Polizei.« »So kann man es sehen.« »Hältst du es wirklich für vollkommen zwecklos, mit ihm über den letzten Fall, nur über den letzten, noch einmal zu reden?« »Es ist zwecklos. Roger hat es versucht und wurde kompromisslos abgeschmettert. Chalklin lässt nur Fakten gelten.« »Hmm, mit so einem Menschen kann man sich im Grunde nicht persönlich unterhalten.« »Das unternimmt auch niemand. Aber bevor er beginnt, dir leid zu tun, kann ich dich beruhigen: Er hat ein kleines Apartment in London. Dorthin fährt er, sobald die Praxis geschlossen ist. Das Leben dort scheint mir ein durchaus geselliges zu sein, sonst müssten allmählich kauzige Züge an ihm sichtbar werden. Das ist nicht der Fall.« Ihr Schlendern durch den Garten kam vor dem Wintergarten wieder zum Stehen. Gemeinsam sahen sie auf die ruhige Rasenfläche, die geraden Linien des Buchsbaums und die überall neu erwachenden Stauden. »Mein Problem ist«, hob Raymund an, »dass ich niemanden außer dir sehe, der sich dieses Falles annehmen würde. Und gleichzeitig habe ich beträchtliche Angst um dich.« Wieder sah er seiner Nichte ernst und offen in die Augen. »Wir haben eine Feindin, dürfen allerdings bereits hier nicht vergessen, dass das Geschlecht unseres Gegenübers nur eine These ist. Sehr streng betrachtet, ist bereits die Annahme einer Feindin eine These. Nehmen wir an, diese These stimmt. Dann müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass die Frau gefährlich ist. Tatsächliche Gefahr für dich, vor allem für dich, in der Konsequenz sogar für mich, besteht aber erst, wenn klar wird, was du tust.« »Verstehe. Um beim Anfang zu beginnen: Warum sollte ich mit dem Zug kommen?« »Nun, in unseren ersten Jahren hier, in der Zeit also, in der deine detektivischen Fähigkeiten offensichtlich wurden, hast du uns gelegentlich besucht. Irgendwer hat sich deinen alten Saab bestimmt gemerkt. Seit Anns Beerdigung warst du nicht mehr hier, das heißt, wenn du dein Aussehen ein klein wenig verändern würdest, könntest du als eine andere Nichte durchgehen, keiner hier weiß die Zahl meiner Verwandten. Das wäre für dich sehr viel sicherer.« »Du hast wirklich Angst?« »Lass uns jetzt nicht über wirklich und theoretisch debattieren. Ich gebe zu, dass ich sicherlich nicht folgenlos mein Leben mit Kriegsgeschichte verbracht habe. Eines der obersten Gebote ist, dass der Feind nie wissen darf, was man im Schilde führt. Schon vor zweieinhalbtausend Jahren schrieb Sun Tsu in China, dass jede Kriegsführung auf Täuschung gründet. Die Menschen haben sich nicht verändert, also wollen wir das beherzigen.« Er lächelte. »Marmalade braucht ihr Futter. Also lass uns hineingehen.« Ein ingwerfarbener Pfeil tauchte umgehend von irgendwoher auf und schloss sich der Kolonne in die Küche an. Raymund öffnete eine Dose mit Lachs, füllte die genaue Hälfte des Inhalts auf einen Teller und zerteilte die Masse in kleine Bissen. Der Teller hatte seinen Platz neben der Küchenanrichte, das Trinkwasser wurde erneuert, dann ging Raymund in den Wintergarten, er zögerte kurz, schloss dann aber energisch die Tür zum Garten und streckte seinen Arm Richtung Teetisch aus: »Lass uns hier Platz nehmen. Der Garten ist groß, ich bin überzeugt, bei normaler Lautstärke kann niemand mithören. Aber Schlachtpläne entwirft man grundsätzlich in geschlossenen Räumen. Wobei mir auffällt, dass ich gerade über dich verfüge. Das liegt mir völlig fern. Du hast natürlich die Freiheit, abzuwinken.« Olivia schlang die Arme um ihren Onkel: »Nein, habe ich nicht, weil ich sehe, welche Sorgen du dir machst. Wäre es nur ein Problem von Pfarrer Mottram, dann vielleicht. So nicht.« Sie drückte ihm einen Kuss auf jede Wange und gab ihn frei. »Ein technisches Problem ist die Zeit. Dieser Fall kann sich hinziehen. Also werde ich meine Arbeit mit hierherbringen und schauen, alles gleichzeitig zu machen. Das schadet nichts, ein Prickeln in den Adern erhöht die Lebendigkeit. Damit bist du einverstanden?« »Selbstverständlich, mehr als das. Ich werde mich zu deinem Hüter machen und zu deinem Koch und zu deinem Assistenten, wenn ich das kann.« Beide waren nach dieser Entscheidung sehr vergnügt.
⋆
Die Dämmerung senkte sich bereits über die dreieckige, ziemlich große Rasenfläche, die den Mittelpunkt des kleinen Ortes ausmachte, als Leonard vom Pfarrhaus zurückkam. Gemeinsam machten die drei sich an die weitere Vernichtung des Lunches. Er schmeckte ein wenig angetrocknet, niemand hatte tagsüber weiter an die Speisen auf dem Esstisch gedacht. Aber sie achteten wenig darauf. Neben Leonards Teller lag ein Stoß Papier. »Ich fürchte, ich war ein wenig pedantisch und kann nur hoffen, dass Mr Mottram es mir nicht nachträgt. Howlethurst ist ein ziemlich amorphes Gebilde. Stört es dich, Raymund, wenn ich die Karte ausbreite?« Die Essensreste trockneten weiter vor sich hin, während die drei sich wie Verschwörer oder wie Generäle, das war eine Perspektivenfrage, an der anderen Tischhälfte über die Karte beugten. »Hier ist der dreieckige Green mit der Kirche an der Südspitze und den ältesten Häusern des Ortes an seinen Flanken, hier steht dein Haus. Die Hauptstraße schließt den Platz nach Norden ab. Wir wollen die Himmelsrichtungen nicht nautisch genau nehmen, denke ich. Hier an der Westgrenze von Howlethurst liegt das alte Herrenhaus, einen guten Kilometer nach Norden ein Internat, nach Nordosten schräg hinüber sicher fünf bis sechs Kilometer entfernt das Krankenhaus, erstaunlich genug. Zieht man von dort eine imaginäre Linie nach Süden zur Haupt- oder Landstraße, ergibt sich ein weiteres, sehr viel größeres Dreieck, in dem einige Farmen liegen.« Seine beiden Zuhörer nickten stumm. »Mottrams Daten und Erinnerungen führen zu folgendem Ergebnis: im Internat hier«, Leonards Finger tippte kurz auf die Karte, »starb in den letzten zehn Jahren niemand. An die Todesfälle auf den Farmen erinnert sich Mottram noch, an jeden einzelnen. Das hat mich sprachlos gemacht. Er hielt sie allesamt für genauso ›normal‹ wie Dr. Chalklin, aber ganz sicher ist er sich inzwischen nicht mehr – so, wir überqueren die Hauptstraße und wenden uns damit dem eigentlichen Ort zu: nochmal – hier das grüne Dreieck des Green. Vom Green nach Westen hat die Hauptstraße auf beiden Seiten eine geschlossene Bebauung, nach Norden einreihig, nach Süden eine größere Siedlung mit Mietshäusern, jeweils sechs Wohnungen pro Haus, an der Straße ein großes Wirtshaus. Dem Green gegenüber reihen sich einige Geschäfte an der Straße auf, dahinter und weiter nach Osten gibt es etliche Wohnstraßen, bis der Ort am Sportplatz endet.« Er richtete sich auf. »Lassen wir die Karte liegen, ich habe Hunger.« Olivia blieb noch daran hängen: »Hier führt ein Fußweg von der Kirche nach Süden zu einzelnen Häusern…« »Dort wird es dir gefallen. Die Kirche liegt auf dem höchsten Punkt. Wenn du den Kirchhof verlässt und das Wäldchen hinter dir hast, liegt dir Kent zu Füßen.« »Warum waren wir da nie?« »Ich fürchte, Ann hat deine Besuche genutzt, um im Land herumzufahren, Ziele genug gibt es ja.« Mit diesem Stichwort schweiften Olivias Gedanken in die Grafschaft hinaus, durch den Haselnussgang von Sissinghurst im Mai oder über die dortige Wiese mit Bäumen voll reifer Äpfel und darunter Herbstzeitlose dicht an dicht, zu den Hopfenhäusern und den Weiden voller Lämmer und den Straßenrändern voller Osterglocken, zu dem alten Haus von Rudyard Kipling aus honiggelbem Kalkstein, eingenistet in ein stilles Tal, allerdings war das bereits Sussex. Doch die Landschaft wusste von diesen Grafschaftsgrenzen nichts, und den Menschen waren sie heute auch nicht mehr wichtig. Sie dachte an ihre Tante. Entschlossen griff Olivia sich einen Apfel und begann ihn zu vierteln. »Leonard, auf deinen Zetteln steht doch sicher noch mehr.« »Ja, richtig. Ich habe mich für die Bevölkerungsstruktur interessiert. Ihr wisst, Kent-Sussex-Surrey sind beliebte Gegenden für Alterswohnsitze. Aber das gilt wohl eher für die Küste, für Städtchen wie Tunbridge Wells und Tenterden. Howlethurst jedenfalls hat sich kaum vergrößert, und wenn, waren es Ansässige, die nun eigene Familien gegründet haben. Es sind also keine älteren Menschen zugezogen, dennoch starben deutlich mehr als früher. Pfarrer Mottram macht sich zurecht Gedanken, auch wenn ich als harmloser Mensch immer auch eine harmlose Erklärung für möglich halte. Statistische Unregelmäßigkeiten sind so selten nicht.« »Dein Blick auf die Karte legt nahe, dass du die Todesfälle konkret auf der Karte aufgesucht hast.« »Auch das haben wir unternommen. Es wohnten mehr der Toten hier um den Green und in den angrenzenden Straßen als weiter nach Norden in den neueren Häusern, aber das sagt nichts aus, weil der Ort von innen nach außen ziemlich organisch gewachsen ist, will sagen, innen wohnen mehr ältere Menschen als außen. Bei den Farmen wird eine Einschätzung schwieriger. Man müsste erst einmal feststellen, wie viele Menschen auf ihnen jeweils wohnen und so weiter.« »Die Wissenschaft versagt«, stellte Raymund trocken fest.
Kapitel 3
Am Sonntagnachmittag waren Olivia und Leonard nach London zurückgekehrt. Am Dienstagabend bezog Olivia das Zimmer ihrer Tante in Howlethurst. Es nahm fast die Hälfte des Dachgeschosses ein mit einem normalen Gaubenfenster nach vorn und einem halbrunden am Boden nach hinten zum Garten. Auf dunkelrotem Teppichboden standen weiße Möbel, die Wände waren zart altrosa, auf den leichten weißen Vorhängen blühten Rosen. Raymund hatte den Raum in den vergangenen anderthalb Tagen wieder zum Leben erweckt. Mit Rogers Hilfe hatte er einen alten Gartentisch aus dem Pfarrhaus vor das große Fenster gebracht als Schreibtisch, die Frisierkommode hatten sie etwas zur Seite geschoben, Olivia konnte sie aber durchaus noch benutzten, wenn sie wollte. Neben dem Fenster stand nun eine große Palme, und am Boden vor dem Gartenfenster hatte er die leeren Töpfe mit Zwergrosen in verschiedenen Rosatönen gefüllt. Olivia hatte ausgepackt und ihre Arbeit wie üblich in chronologischer Reihenfolge nebeneinander angeordnet. Es brach mal wieder eine Zeit äußerster Disziplin an. Im Augenblick stand sie am Fenster und schaute hinaus auf die dreieckige Rasenfläche. Überrascht entdeckte sie, dass die frischen Triebe der Linden den Blick bereits jetzt hinderten auszuschweifen. Sie sauste die Treppe hinunter und fand Raymund am Herd: »Du magst süßsauer noch immer?« »Hmhm, ja, es riecht köstlich. Kann ich helfen?« »Oh nein! Ich bin der Koch, du erinnerst dich, wir haben ein Abkommen.« Sie strich ihm liebevoll über den Rücken und ging langsam durch die Weite des offenen Erdgeschosses. Ihr Blick blieb an Anns Klavier hängen. Sanft strich sie mit der Hand über den glänzenden Lack und die Notenbücher. »Spielst du manchmal Klavier?« mit der Frage kam sie zurück in die Küche. »Das Instrument sieht irgendwie so aus.« Raymund nickte stumm. Nach einer Weile räusperte er sich: »Ja, seit einigen Monaten spiele ich wieder. Weißt du, es tat dem Orgelspiel in der Kirche auf die Dauer nicht sehr gut, dass ich unter der Woche meine Finger so gar nicht trainierte.« »Kann ich mir vorstellen. Ann würde sich sicher darüber freuen.« »Das täte sie bestimmt. Weißt du, manchmal scheint es mir, als wären wir uns dort besonders nahe. Es tut mir gut – inzwischen – ich bin gleich fertig hier«, ergänzte er mit Blick auf seine Hände, wieder munterer. Olivia ging zum Fenster und schaute auf den Green hinaus. Hier unten konnte sie unter den Linden hindurch Bänke am Rand des Green sehen und Leute. Allerdings hatte Ann Rosen vor das Küchenfenster gesetzt, die sich anschickten, mit ihren neuen Blättern den Blick zu durchkreuzen. »Ich glaube, dies ist der einzige Green in ganz England, der von Spalierbäumen umstanden ist.« Raymund nickte zustimmend: »Magst du Avocado lieber als Creme oder in Scheiben?« »Ich mag beides.« »Das ist gut! Dann gibt es sie heute als Creme mit Naan-Brot, das gibt es auch zum Curry. Und übermorgen Scheiben mit Peperoni bestreut und Tomaten – das Lindenspalier ist, so weit ich weiß, tatsächlich das einzige in England. Howlethurst hatte im neunzehnten Jahrhundert schon mal einen tatenlustigen Pfarrer. Der stellte im Laufe der Jahre fest – so will es jedenfalls die Geschichte – dass das Miteinander seiner Pfarrkinder um den Green herum weitaus streitlustiger und auch sonst schwieriger war als notwendig. Sie wussten einfach zu genau übereinander Bescheid. Er beschloss, den Blick aufeinander zuzupflanzen, gewann seine Gemeinde für diese ungewöhnliche Idee, indem er ein allgemeines Dorfverschönerungsprojekt ins Leben rief, und alle machten mit.« »Vom Küchenfenster hier unten sehe ich immer noch ganz gut.« »Über die freie Fläche, aber nicht in die anderen Häuser«, konterte Raymund. »Stimmt, die oberen Stockwerke sind verdeckt und unten haben fast alle relativ hohe Pflanzen stehen.« »Niemand lässt sich gerne allzu genau beobachten, aber niemand unternimmt gern als erster etwas dagegen. Dazu brauchte es den Pfarrer.« Olivia wandte sich wieder der Aussicht zu. Die Häuser waren sehr verschieden, verschieden groß und verschieden alt. »Wer wohnt in dem Haus gegenüber auf der anderen Rasenseite?« »Welches genau meinst du?« kam die Rückfrage vom Herd, der in der Mitte der Küche stand. Raymund werkelte daneben an der Vorspeise. »Das rote oder das weiße?« »Das rote mit den symmetrischen vorgebauten Erkern und dem säulenflankierten Hauseingang. Seine unteren Erkerfenster sind nicht zugepflanzt.« »Dort lebt Mrs Graham. Und der größte Teil des Erdgeschosses beherbergt die hiesige Leihbücherei. Tagsüber braucht sie die Fenster nicht zu schützen, weil sich das halbe Dorf ohnehin drinnen tummelt. Abends zieht sie dann schwere Portieren vor. Ich für meinen Teil glaube allerdings, dass sie im ersten Stock ein privates Wohnzimmer hat und nur mit Besuch das untere benutzt.« »Aha…« ein wenig ratlos wandte Olivia sich ihrem Onkel wieder zu. »Ich werde versuchen, zusammenzufassen. Mrs Graham ist heute um die sechzig Jahre alt und grauhaarig, doch Witwe ist sie schon seit dreißig Jahren, ungefähr. Sie hat einen Sohn, der im Internat von Marlborough erzogen wurde und nur die Ferien hier verbrachte. Die alte englische Geschichte: Die Frauen sind sehr früh die meiste Zeit allein.« »Erzähl mir jetzt aber bitte keine Biographie aus dem 19.Jahrhundert. Wer hinderte sie, ihr Haus zu verlassen und ihr Leben in die Hand zu nehmen?« »Weiß ich nicht. Ich kannte sie damals nicht und Ann auch nicht. Kurz und gut: Es war wieder der Pfarrer, Rogers Vorgänger, der anregte, in einem der vorderen Räume eine Leihbücherei einzurichten. Irgendeiner der umliegenden Landsitze, genauer ein neuer Besitzer, der die alten Bücher nicht wollte, hatte sie der Gemeinde als Geschenk angeboten. Es handelte sich um eine ziemlich umfassende Sammlung, die allerdings erst im 19.Jahrhundert begonnen worden war und enthielt, was die damaligen Besitzer selber lasen, will sagen, genau das Richtige für eine Leihbücherei und wenig geeignet, sie zu Geld zu machen. Das war der Anfang. Heute steht nur noch in der Wohnküche ein Esstisch und vor dem Wohnzimmerfenster zum Garten eine Sitzgruppe. Alles andere im Erdgeschoss ist Bücherei. Wie sie sich darin fühlt, weiß ich noch immer nicht. Zwar helfe ich jeden Donnerstagnachmittag, aber wir unterhalten uns nicht privat.« Raymund hatte unter dem Reden die Avocadocreme fertiggestellt. Er rührte das Curry noch einmal um und ging voraus zum Esstisch. Olivia folgte ihm mit einem Krug voll frischem Wasser, doch vorher zog sie die Küchenvorhänge zu. Er quittierte es mit einem leichten Lächeln um die Augen, während er die Kerzen auf dem Tisch anzündete. »Dir ist ungemütlich?« »Ich habe gern den Rücken frei. Noch sind die Rosen vor dem Fenster nicht grün.« »Nein, noch nicht. Wenn es so weit ist, sollte uns nicht mehr ungemütlich sein. Ich hoffe es wenigstens.« Während sie sich die Vorspeise schmecken ließen, überlegte Raymund weiter: »Ich mache auch meinerseits die bedauerliche Entdeckung, dass ich mich nicht so unbeteiligt fühle, wie ich es unter natürlichen Umständen täte, wenn ich dir von meinen Nachbarn erzähle.« »Was hat sich verändert?« »Bei allem, was ich dir erzähle, begleitet mich die Frage, ob ich irgendeinen Hinweis finde, der uns helfen könnte, Licht in Rogers Problem zu bringen.« »Auch bei Dr. Chalklin?«
Kapitel 4
Der nächste Tag begann mit leichtem Nebel. Olivia saß an dem weißen Gartentisch in Anns Zimmer und übersetzte in Ruhe zehn Seiten des neuen Romans von Neville Seymour. Sie hielt ihn für einen der bedeutendsten unter den Gegenwartsautoren in England. In ihren Augen war er ein Dichter, ein Nachfahre von Virginia Woolf und Dylan Thomas. Sie hatte das Glück gehabt, ihn dank ihrer Freundin Amanda persönlich kennenzulernen. Grausigerweise waren sie alle am selben Abend als Gäste des Schriftstellers Keith Aulton in dessen unerwarteten Tod verwickelt worden. Ihre Beharrlichkeit und ihr Verständnis hatten diesen Todesfall schließlich aufgeklärt. Offenbar hatte Seymour sie nicht vergessen, denn ein Jahr später hatte sein Verlag bei ihr angefragt, ob sie die Übersetzung seines neuen Romans ins Deutsche übernehmen würde. Ihr hatte der Atem gestockt – und sie hatte angenommen, es war die bisher größte Herausforderung an ihr Können als Übersetzerin. Jetzt saß sie also in Anns Zimmer an dem alten Gartentisch an der Arbeit, die ihre Konzentration vollständig von der übrigen Welt abzog. Als sie ihr Tagespensum geschafft hatte, holte sie sich einen Apfel aus der Küche und machte sich an einen Artikel für den ›Guardian‹. Diese Übersetzung ging wesentlich zügiger von statten. Der Nebel hatte sich derweil verzogen, was zu dem zweifelsfreien Schluss führte, dass sie von ihrem Fenster aus so gut wie niemanden beobachten konnte. Das Lindenspalier war dagegen. Um halb zwölf stand sie vor der schwarzen Haustür. Sie trug ein Herrenhemd in dunklem Lila, doch dazu nicht ihr übliche schmale Hose, sondern eine weite mit großen Blüten aus Wangaris Afrikaladen. In den Blüten war auch lila. Ins Haar hatte sie ein lila Band geschlungen und einen bunten Schal um die Taille. Sie fühlte sich in dieser Aufmachung fremd genug, um als eine andere Nichte von Raymund Fisher los zu spazieren. Der Green war menschenleer. An seinem Nordrand, die Hauptstraße entlang, radelte eine Frau in einem wehenden Blumenrock. Olivia zupfte ein paar alte Blätter aus den Pflanzen vor dem Wohnzimmerfenster und schlenderte dann um die Spitze des Platzes herum, an der Kirchhofsmauer entlang und weiter zu Mrs Grahams Haus. Davor blieb sie stehen und schaute durch das eine Erkerfenster hinein: Bücherregale, hoch und dunkelbraun, nah beieinander und sehr voll. Kein Mensch war drinnen zu sehen, auch hinter dem anderen Fenster nicht. An der Haustür konnte sie die Öffnungszeiten feststellen: von zwei bis sieben Uhr nachmittags jeden Tag außer Sonntag, das war großzügig für einen so kleinen Ort. Langsam ging sie weiter, prägte sich die Namen auf den Türschildern ein und hielt immer wieder inne, um über den Rasen zu schauen. An der Hauptstraße, die eigentlich eher eine Landstraße war, die durch einen Ort führte, blieb sie wieder stehen. Es war wirklich gar nichts los. Doch bevor sie sich entschieden hatte, welchen Teil von Howlethurst sie genauer besichtigen wollte, kam ihr der Zufall zu Hilfe. Vor einem der Häuser hinter den Linden an Raymunds Seite machte sich jemand an die Gartenarbeit. Olivia umrundete also weiter den Green und blieb neben der jungen Frau stehen. Drei Häuser weiter sah sie die schwarze Haustür ihres Onkels, demnach hatte sie Susan Large vor sich. Sie grüßte freundlich: »Die Buschwindröschen sind wunderschön. Blühen sie immer so spät in diesem Teil von England?« Die junge Frau richtete sich in ihrem Beet auf. Sie hatte dunkle, kurzgeschnittene Haare und für den englischen Frühling sehr dunkle Haut. Ein Lächeln streifte die weißen Blüten unter dem Haselnussstrauch, bevor ihre braunen Augen den noch dunkleren von Olivia begegneten. »Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Es ist mein erster Frühling hier.« »Sie haben in einer wärmeren Gegend des Commonwealth gelebt?« »Wie kommen Sie darauf?« Olivia lachte: »Sie sind so beneidenswert braun, unter englischer Wintersonne wird man das nicht.« »Ja, ich habe in Indien gelebt, zwar im kühlen Norden, aber doch unter einer anderen Sonne.« Fragend musterte die junge Frau ihr Gegenüber: »Wohnen Sie hier im Ort?« »Für die nächste Zeit wohne ich bei meinem Onkel, Raymund Fisher, drei Häuser weiter.« »Wenn das so ist, könnten wir vielleicht einmal zusammen einen Spaziergang machen«, Susan zögerte, »ganz allein ist es doch nicht so spannend.« »Ja, gern! Welche Tageszeit ist Ihnen die liebste?« »Am Vormittag ist es stiller, man kann sich dann mehr auf das Land einlassen.« Olivia nickte zustimmend. »Morgen gegen elf Uhr, wäre Ihnen das recht?« Auf die schweigende Bestätigung der jungen Frau hin ergänzte sie: »Ich freue mich und ich werde da sein. Unter dieser schönen Perspektive überlasse ich Sie jetzt ihren Pflanzen.« Olivia neigte leicht den Kopf und ging weiter zu Raymunds Gartenpforte und ums Haus herum. Ihr Onkel säte gerade Feuerbohnen hinter die Salatpflanzen. Marmalade saß auf den Hinterpfoten und schaute zu. Im Näherkommen sah Olivia ihr die Unschlüssigkeit an, ob sie Olivia als Mitbewohner begrüßen oder ignorieren sollte. Die hockte sich neben das Katzenmädchen und begann, ihr leise von ihrem Spaziergang zu erzählen. Onkel und Katze hörten sich die Neuigkeiten an. Als alles erzählt war, lag auch der letzte Bohnenkern in seinem Loch. Raymund erhob sich und griff nach seinem Gartengerät. Sie schauten zu, wie er Erde über die Löcher schob. »So, meine Lieben, jetzt ist Zeit für den Lunch. Ab ins Haus.«
⋆
Für den Abend hatten sie eine Einladung ins Pfarrhaus. Olivia trug wieder gänzlich eigene Kleider: einen schwarzen Schmetterlingspullover zu einem weiten knöchellangen Rock mit dünnen schwarzen und rotbraunen Streifen, dazu Ballerinas ohne jeden Zierrat. Die schweren braunen Haare konnten wieder frei fliegen, wenn sie den Kopf schüttelte, doch im Augenblick stand sie sehr ruhig neben ihrem Onkel und wartete ab, was auf das Klingelzeichen folgen würde. Pfarrer Mottram öffnete die Tür, im schwarzen Jacket und weißen schmalen Kragen stand er sehr offiziell im Türrahmen und bat sie herein. Die wechselseitige Begrüßung fand hinter der verschlossenen Haustür statt. Roger Mottram wirkte sichtlich angespannt. Er führte seine Gäste ins Arbeitszimmer und schenkte einen Aperitif ein, es handelte sich um ein Quitten-Weingetränk, wie er überkorrekt erklärte, seine Frau habe es hergestellt. Raymund erinnerte ihn daran, dass er es schon häufiger und immer gern getrunken habe. Pfarrer Mottram hielt inne und sah ihn aufmerksam an: »Ja, du hast recht, alter Freund. Überhaupt sind wir unter Freunden. Alles, was wir heute reden, bleibt unter uns und wir können diese seltsame Unternehmung jederzeit abbrechen, ohne dass für irgendjemanden ein Schaden entsteht.« Deutlich erleichtert füllte er die kleinen Süßweingläser nach und trank erneut auf das gemeinsame Wohl. Olivia sah sich in dem dunklen holzgetäfelten Raum um: Bücherregale, ein Kamin und davor zwei Ledersessel, ein großer Schreibtisch, dahinter weitere Bücherregale, viele Ablagekästen, über dem Türrahmen ein schlichtes Holzkreuz. Es wirkte, als sei Roger Mottram in den Raum seines Vorgängers eingezogen und habe alles beim Alten gelassen. Bevor sie darüber ins Grübeln kam, flog die Tür auf und Aphra Mottram begrüßte ihre Gäste, schlicht, herzlich und mit der Einladung, sich um den Esstisch zu versammeln. Auch im Esszimmer standen die alten Eichenmöbel wie vermutlich schon vor hundert Jahren. Doch die Vorliebe der Pfarrersgattin für Quitten hatte sich hier in den Farben der Inneneinrichtung durchgesetzt. Die Holzvertäfelung, in diesem Raum nur bis zur halben Höhe, war in einem warmen, fast dunklen Gelb gestrichen, die Wände darüber sehr hell gelb und weiß die Zimmerdecke. Auf den Stühlen lagen gelbe und hellgrüne Polster und die zugezogenen Vorhänge waren gelbgrün gestreift. Eine Vase mit Frühlingszweigen machte den heiteren Eindruck perfekt. Olivia fühlte sich rätselhaft in der Gegenwart angekommen. Sie schaute Aphra Mottram zu, die freundlich und zielstrebig die Suppe verteilte, ihren Mann zu einem kurzen Segen veranlasste und das Essen eröffnete. Sie war schmal und dunkel, vermutlich fast so groß wie ihr Mann, der aber dreimal so viel Raumvolumen verdrängte. ›Eine Elbenkönigin in den Waliser Bergen könnte so aussehen‹, ging es Olivia durch den Kopf. »Wachsen Quitten auch wild?« wollte sie in einer Gesprächspause wissen. Mit leicht geneigtem Kopf sah sie ihre Gastgeberin an. Aphra Mottram besann sich kurz: »Hier in der Nähe in einer Hecke gibt es zwei, sie tragen allerdings keine Früchte. Und am Waldrand, wenn Sie dem Pfad vom Kirchhof den Südhang hinunter folgen, steht ein großer struppiger Busch. Dessen Früchte sind klein und hart und von wunderbarem Aroma. Sie lagen einmal einen ganzen Winter lang in der Sakristei und es duftete dort endlich nicht mehr nach staubigen Kleidern, sondern nach Leben. Seitdem bringe ich jeden Herbst einen großen Korb voll dorthin.« Sie sprachen die Mahlzeit hindurch über allgemeine Themen. Zum Beispiel beunruhigte Roger Mottram, ausgelöst durch den sehr trockenen April, die Wasserknappheit, die an einigen Stellen in Kent im letzten Sommer für Probleme gesorgt hatte. Es war allgemein bekannt, dass vierzig Prozent des Trinkwassers auf dem Weg durch die alten Rohre verloren ging, und niemand entschloss sich, etwas dagegen zu unternehmen. Noch war Howlethurst nicht betroffen. Es lag an einer Wasserscheide, nach allen Seiten schien Wasser munter und für immer unterwegs zu sein. Aber es war nicht überall so. Zum Abschluss des Essens gab es eine kleine Käseplatte mit Quittenstücken dazu. Sie hatten dem Aperitif ihr Aroma gegeben, waren danach gekocht und wieder abgekühlt worden und begleiteten nun den Käse. Endlich stellte Olivia die zwingende Frage: »Wie kamen Sie zu Ihrer Begeisterung für Quitten?«