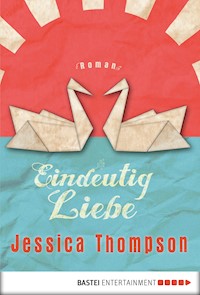4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal braucht es nur einen Augenblick, um ein Leben zu verändern.
Als die Sonne an einem milden Frühlingsabend im März untergeht, haben sich die Leben von Bryony, Sara, Tynice und Rachel für immer geändert. Die Welt, in der sie gelebt haben, die Menschen, von denen sie glaubten, sie zu kennen - innerhalb eines einzigen Moments ist alles anders. Alles um sie herum scheint zu zerbrechen. Können drei kleine Wörter ihnen helfen, die Bruchstücke wieder zusammenzusetzen? Um ins Leben zurückzufinden, brauchen sie neben Liebe vor allem die Kraft, verzeihen zu können ...
Ein Roman, der unter die Haut geht!
Weitere berührende Geschichten von Jessica Thompson:
Eindeutig Liebe
Lieben lernen
Wenn du wieder bei mir bist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Zitat
1 – Er wünschte, er hätte sich rasiert.
2 – Es wird ganz schön spät, oder?
3 – Es war Klaustrophobie in Vollendung.
4 – »Ein kleiner Schaufensterbummel kann ja nicht schaden.«
5 – Sie verabscheute Kohl.
6 – Ich möchte meinen Jungen sehen.
7 – Den heutigen Tag musste er zu etwas ganz Besonderem machen. Dem besten Tag überhaupt.
8 – »Er ist wirklich tot, oder, Mum?«
9 – Diesmal sollte sich niemand nach ihr umdrehen.
10 – »In dieser Branche wird viel getratscht.«
11 – Alle klimperten mit den Wimpern und streckten die Titten raus.
12 – »Mit Sahne?«
13 – Er fragte sich, wen er anrufen konnte.
14 – »Bitte setzen Sie sich.«
15 – Seine Freunde konnten gar nicht anders, sie mussten ihm zusehen und grinsen.
16 – Ein Verbrecher.
17 – Sie wusste, dass er von Tom kam.
18 – »Idiot.«
19 – Sweetest Thing.
20 – »Nur an Max.«
21 – Weiße Höschen mit Grauschleier.
22 – Es war undenkbar.
23 – Diesen Hut kannte sie gut.
24 – Wicked Game.
25 – Spliss.
26 – Sie war schon zu weit gegangen.
27 – »Ja, am Apparat.«
28 – »Ganz schön vornehmer Schuppen hier, was?«
29 – »Soll ich die Schuhe ausziehen?«
30 – Das Opfer war sie.
31 – Glückliche Menschen.
32 – … er versuchte, mit Gott zu sprechen.
33 – »Wie hast du das geschafft?«
34 – Sie fragte sich, wohin sie gehörte.
35 – »Was um alles in der Welt soll das?«
36 – Von der schönen jungen Frau, die ihr gegenübersaß.
37 – Am Himmel zogen sich Wolken zusammen.
38 – »Der Mond ist an einem blöden Fleck am Himmel.«
39 – Wenn sie es nur versuchen würde.
40 – »Das klappt nicht mit uns beiden.«
41 – »Ich habe niemanden.«
42 – Das war nicht seine Schrift.
43 – »… puste doch die Flamme aus.«
44 – Es wurde Zeit, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen.
45 – Da war er.
46 – »Ich möchte jetzt allein sein.«
47 – »Wie geht es dir, Bryony?«
48 – Das Telefon klingelte.
Zitat
Danksagungen
Über die Autorin
Jessica Thompson wurde in den späten Achtzigerjahren in Yorkshire geboren und lebte in Frankreich und Kent, bevor sie endlich nach London zog – in die Stadt, die sie so sehr liebt. Sie schreibt seit frühester Kindheit und arbeitet inzwischen als Journalistin. Ein Tag im März ist ihr zweiter Roman.
JESSICA THOMPSON
Ein TagimMärz
ROMAN
Aus dem Englischen vonDietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Jessica Thompson
Titel der englischen Originalausgabe: »Three Little Words«
Originalverlag: First published in Great Britain in 2013 by Coronet,
An imprint of Hodder & Stoughton, An Hachette UK company
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Cathrin Wirtz, New York
Titelillustration: © Sandra Taufer, München
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-4562-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für die Girls
verzeihen – Verb Feindseligkeit/Verbitterung/Missgunst/Ärger aufgeben, erlittenes Unrecht vergeben
Irren ist menschlich, verzeihen ist göttlich.
Alexander Pope
1
Er wünschte, er hätte sich rasiert.
Mittwoch, 1. April 2009
Angel, Nord-London
13 Uhr
Mein Gott, ist sie schön, dachte Adam und spähte durch das klapprige Regal voll Kakaopulver und Zuckerpäckchen hindurch, um einen Blick auf die junge Frau zu erhaschen.
Seit zwei Wochen kam sie regelmäßig in das Café, in dem er arbeitete, setzte sich an den runden Holztisch gleich am Fenster und schaute hinaus auf das Straßenpanorama von Londons Stadtteil Angel. Er kannte weder ihren Namen, noch wusste er irgendetwas über sie. Er konnte nicht sagen, warum, aber sie machte auf ihn den Eindruck, dass der unverbindlich freundliche Plauderton, den er den Gästen gegenüber normalerweise anschlug, bei ihr nicht gut ankommen würde.
Sie war geheimnisvoll. Das mochte er an ihr. Ihre schöne Haut war mit Sommersprossen übersät, und im sonnigen Wetter der letzten Tage hatte sich neue, kleinere hinzugesellt, die sich wie winzige Sterne zwischen die größeren schmiegten. Ihre Augen waren von einem durchdringenden Grün, und ihre ausgeprägten Wangenknochen verliehen ihr das Aussehen eines Supermodels. Trotzdem war sie nicht zu perfekt, fand Adam: Die winzigen Lachfältchen um ihre Augen und die kleine silbrige Narbe gleich unter ihrer Unterlippe bewiesen, dass sie trotz allem sehr real und durchaus greifbar war. Adam erschien die Unbekannte durch diese winzigen Makel nur umso schöner.
Normalerweise band sie das kastanienbraune Haar zu einem glatten Pferdeschwanz zurück, aber heute trug sie es in einem unordentlichen Dutt, und dazu eine große Sonnenbrille, als herrschte in London glühheißer Sommer. Verdammt, sie ist der Wahnsinn, flüsterte er unhörbar vor sich hin.
»Adam, steh nicht nur rum, okay?«, rief Tara. Er zuckte so sehr zusammen, dass er sich den Kopf am Regal stieß und alles darin ratterte, als lachte es ihn aus.
»Sorry, Bohoss«, erwiderte er in der Stimme einer Zeichentrickfigur mit amerikanischem Akzent, die vor Sarkasmus triefte, während er von dem Regal und allem, was ihn verspottete, zurücktrat. Er stellte sich an die Spüle und tat so, als wolle er abwaschen. Er drückte ein Glas mit Kakaoresten ins warme, schaumige Wasser und sinnierte darüber, wie ein Typ wie er es jemals schaffen sollte, eine Frau wie die schöne Unbekannte mit einem vollständigen Satz anzusprechen.
Er hatte sich schon oft ausgemalt, wie es ablaufen könnte: »Hi … Name? … Meiner … Adam … argghhh!«
»Tisch zehn, bitte, Ad. Und beeil dich«, bellte Tara und legte ihm mahnend die Hand auf den Rücken. Manchmal hätte er ihr am liebsten gesagt, sie könnte sich den Job sonst wohin stecken, doch im nächsten Moment dachte er immer an den ständig wachsenden Stapel der Kreditkartenrechnungen in seinem Flur, und plötzlich fiel es ihm ganz leicht, den Mund zu halten.
»Natürlich, tut mir leid«, stieß er hervor. Er wusste genau, dass an Tisch zehn die Unbekannte saß. Er hatte gehofft, sie diesmal nicht bedienen zu müssen, denn allmählich machte sie ihn nervös. Er war eben richtig in sie verknallt.
Er schlurfte durch das Café, und er war sich dabei nur allzu bewusst, dass seine hellblauen Boxershorts vermutlich aus seiner Hose ragten. Scheiß drauf, dachte er. Wir sind in London. Wir sind jung und trendy. Wir können uns das leisten. Oder?
»Hallo, was kann ich Ihnen bringen?«, fragte er die junge Frau und fuhr sich beiläufig durch das erst kürzlich geschnittene dunkelbraune Haar. Mit einem Mal fiel Adam das Fehlen seines vertrauten Ponys auf, und es stellte sich plötzlich ein Gefühl ein, als fehle ihm eins seiner Gliedmaßen.
Gleichzeitig dachte er, dass sie als wunderschöne Heldin in einem alten Schwarzweißfilm ganz und gar nicht fehl am Platze wirken würde.
Er wünschte, er hätte sich rasiert.
Adam war sich zu allem anderen nur zu deutlich bewusst, dass er gerade eine sinnlose Frage gestellt hatte, denn er kannte die Antwort bereits. Sie bestellte jedes Mal das Gleiche, und sie sagte es ihm immer auf die gleiche Art. Die Unbekannte drehte sich ihm stets mit einem schüchternen angedeuteten Lächeln zu, das ihre geraden weißen Zähne zum Vorschein brachte. Doch mit dem Lächeln schien es ihr nie ernst zu sein – es war eher, als wäre sie auf einen Stecker getreten, der mit den Kontakten nach oben lag, oder gegen eine Glastür gelaufen. Das war zwar sehr schmerzhaft, aber weil Leute zusahen, musste sie es mit einem Lächeln hinter sich bringen. Dann sagte sie immer: »Äh, hi, danke. Ja, bringen Sie mir …«
So fing sie immer an, dann straffte sie auf dem hölzernen Stuhl leicht den Rücken, wodurch wiederum ihr Hals anmutig gestreckt wurde und das perfekteste Schlüsselbein enthüllte, das Adam je gesehen hatte. Sie trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, als überlegte sie, was sie wollte. Er stand daneben, den Kuli auf dem Block angesetzt, der fast an seiner schwitzenden Handfläche klebte.
»Könnte ich bitte einen koffeinfreien Latte mit einem Stück Zucker haben?«, fragte sie dann mit tieftrauriger Stimme, als könnten alle koffeinfreien Lattes im gesamten Universum sie nicht über das hinwegtrösten, was sie so traurig machte. Was auch immer es war.
»Mit Sahne?«, fragte er dann immer, obwohl es Sahne eigentlich nur zu Kakao gab und nicht zu Latte.
»Nein, danke«, entgegnete sie. Sie sagte immer nein, aber er fragte trotzdem. Adam fand, dass sie die Sahne verdiente. Und die Schokostreusel.
Sie drehte dann den Kopf und blickte aus dem Fenster. Es war immer das Gleiche. Jedes Mal.
Die anderen Angestellten fragten ihn schon ständig, wer denn »dieses Mädchen« sei; endlich sprachen sie ihn mal auf etwas anderes an als die fortschreitende Verkalkung des Kaffeeautomaten oder die vollkommene Wirkungslosigkeit der aufgestellten Mausefalle. Sie fragten Adam, wer sie sei, die schöne Unbekannte da an Tisch zehn, die jeden Tag kam und dort stundenlang saß und mit unfassbarer Traurigkeit zusah, wie die Welt an ihr vorbeizog.
2
Es wird ganz schön spät, oder?
Donnerstag, 12. März 2009
Finsbury Oark, Nord-London
23.30 Uhr
In der Nähe der U-Bahn-Station Finsbury Park kauerte Keon Hendry mit leicht zitternden Händen hinter einem Busch.
Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, und er war so nervös, dass er fürchtete, jeden Moment die Beherrschung zu verlieren. Gleichzeitig merkte er aber, dass er sich vollkommen und grenzenlos lebendig fühlte.
»Du weißt also, was du zu tun hast, alles klar?«, flüsterte Steve Jeffrey und wischte sich mit dem Ärmel seiner navyblauen nachgemachten Barbour-Jacke den Schweiß von der blassen Stirn. Seine Augen waren glasig, weil er den ganzen Abend am Spielplatz in der Nähe Gras geraucht hatte. Es war ein feuchter Frühlingstag gewesen, und bis der Regen sie verschluckte, waren die Wolken aus süßlichem Rauch davongetrieben wie Luftballons, die niemand haben wollte.
Keon kräuselte leicht die Nase und schnüffelte die feuchte Luft. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Seine schwarze Jogginghose war ihm viel zu groß, und er zog sie hinten hoch.
Er konnte nicht sagen, wie es überhaupt so weit hatte kommen können. In letzter Zeit gerieten die Dinge bei seinen Schulkameraden völlig aus dem Ruder. Einige von ihnen hatten schon immer Messer dabeigehabt – aber kleine, die Sorte, die man zum Zelten mitnahm und mit denen man am Ende höchstens mal die Schnur zwischen zwei Würstchen durchtrennte. Er selbst war mit dem Springmesser, das er normalerweise in der Tasche trug, ziemlich gut vertraut. Er hatte sich so sehr daran gewöhnt, dass er gar nicht mehr daran dachte, es dabeizuhaben. Aber dann waren die Klingen größer geworden – Mütter in ganz London mussten sich gefragt haben, wohin ihre Küchenmesser verschwanden. Trotzdem hatte niemand vorgehabt, sie je zu benutzen … oder zumindest hatte Keon das immer geglaubt. Mittlerweile fragte er sich immer mehr, ob er nicht vielleicht ein wenig naiv war. Je mehr andere Jungen auf der Straße ein Messer dabeihatten, desto eher brauchte man selber eines; und wenn sie ein größeres hatten, dann musste man sich selbst auch ein größeres anschaffen. Aber so war das moderne Leben eben. Es war nicht seine Schuld. Wenigstens sagte er sich das immer wieder, damit er überhaupt weitermachen konnte.
Keon rückte auf dem kalten und ziemlich unbequemen Beton herum und brachte das linke Knie neben das andere, sodass er nun kniete. Einen Augenblick lang überlegte er, wie unerfreulich das Ganze war und wie gern er jetzt zu Hause sitzen und mit seiner Schwester Reb einen Film anschauen und Chips essen würde. Kurz überlegte er, wie angeekelt sie wäre, wenn sie wüsste, dass er in der Nähe der U-Bahn-Station Finsbury Park hinter einem Busch lauerte, um jemanden so sehr einzuschüchtern, dass er sich vor Angst in die Hose machte.
»Keon? Bist du bei uns? Erde an Keon!« Fast ranzte Steve ihn an, er klang sauer. Seine Stirn hatte er vor Wut gekräuselt; weiche, weißliche Haut spannte sich über scharf geschnittene Knochen.
»Ja, ja, schon gut! Wenn er rauskommt, dann machen wir ihm Druck. Ich hab’s ja kapiert.« Keon antwortete leise, beinahe knurrend, und fragte sich gleichzeitig, ob es schon zu spät war, um die Sache abzublasen.
»Und treib’s bloß nicht zu weit, klar? Wir wollen dafür keinen Ärger kriegen. Tu nur, was du tun musst, damit der kleine Scheißer uns in Ruhe lässt, okay?«, fuhr Steve fort. Er steckte sich eine Zigarette zwischen die schmalen Lippen und zündete sie mit einem Zippo an. Seine Augen sahen aus wie Satellitenschüsseln, riesig und wässrig. Fadenförmige Blutgefäße überzogen seine Augäpfel und machten aus dem Weiß ein helles Rosa.
»Natürlich tue ich ihm nichts. Für wen hältst du mich eigentlich?«, fragte Keon und fuhr unbewusst mit dem Zeigefinger über das kühle, glatte Metall, das ihm vom Bund seiner Boxershorts gegen den Bauch gedrückt wurde. Sein Herz begann wieder heftiger zu schlagen. Gut, er hatte vielleicht nicht vor, Ricky Watson etwas anzutun, aber er wusste, dass das, was sie planten, eindeutig falsch war, genau die Sorte Mist, die seine Mutter veranlassen würde, noch öfter in die Kirche zu gehen und noch mehr zu heulen.
Was er alles anstellte, ohne dass sie Wind davon bekam, war schon unglaublich. Jedes Mal, wenn er daran dachte, schauderte er vor Schuldbewusstsein. Wie oft kam er komplett zugedröhnt nach Hause. Wenn ihn dann der Heißhunger überfiel, nickte seine Mutter, lächelte stolz und sagte etwas in der Richtung, er sei »im Wachstum«, während er Nudeln in sich hineinstopfte, bis er fast platzte.
Keon war es immer gelungen, echten Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, aber trotzdem mit den üblen Typen herumzuhängen. Er stand immer dabei, lachte über die richtigen Witze und trug die richtige Kleidung, doch irgendwie schaffte er es, sich niemals die Hände schmutzig zu machen. Insgeheim war er stolz, dass er zu der respektiertesten Gang der Schule gehörte, und ihm taten die Mitschüler leid, die ihre Gesichter hinter dichten Ponys versteckten und ihre Unsicherheiten in ihren abgegriffenen, schweren Rucksäcken mit sich herumtrugen.
In letzter Zeit hatte allerdings jeder in der Gang Keon gedrängt, mal etwas Größeres zu machen. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn durchschauen würden, wenn er sich weigerte. Und wenn sie ihn durchschauten, dann würden sie ihn rauswerfen, und dann hätte er keine Freunde mehr. Ihm war klar, dass er jedes bisschen Respekt, den er von den Jungs bekommen konnte, dringend nötig hatte, und heute Abend würde er sich Respekt verdienen. Danach konnte er wieder untertauchen und sich aus dem irrsinnigen Machtkampf raushalten, der zwischen den meisten Jungen im Fairgrove Estate und an der Elm Highschool herrschte. Er wäre bekannt als derjenige, der Ricky Watson dazu gebracht hatte, für immer den Kopf einzuziehen. Der dafür gesorgt hatte, dass die Kämpfe aufhörten, indem er ihm so viel Angst machte, dass er klein beigab.
Auch wenn er Ricky heute Nacht nur einschüchtern sollte – so etwas Aggressives hatte er noch nie getan. Doch Keon hasste Ricky von ganzem Herzen. Ricky hatte nicht nur zahlreiche von Keons Freunden verprügelt, sondern hatte zu guter Letzt auch noch Steves kleiner Schwester das Taschengeld abgenommen. Das war zu viel. Ricky hatte das verdient, was ihm nun blühte. Heute Nacht würde Keon Hendry ihm seine Grenzen zeigen, und niemand würde sich je wieder mit Keon anlegen. Er wollte nur dafür sorgen, dass sich seiner Gang gegenüber niemand mehr etwas herausnahm, und dann konnte er es vielleicht alles hinter sich lassen. Aufs College gehen und sich auf den Abschluss konzentrieren. Danach vielleicht sogar die Universität besuchen, ganz wie seine Mutter es sich schon so lange wünschte.
»Wann kommt er denn überhaupt? Es wird ganz schön spät, oder?«, fragte Keon mit einem Blick auf das Zifferblatt seiner riesigen, mit falschen Diamanten besetzten Uhr. Er hoffte im Stillen noch immer, dass er aus der Sache herauskam. Die ersten Tropfen fielen vom Himmel.
23.35 Uhr.
»Nee, nee, alles cool«, erwiderte Steve und trat seinen Zigarettenstummel aus. Der Kies knirschte laut unter seiner Schuhsohle. »Er geht jeden Donnerstagabend boxen und fährt mit der U-Bahn nach Hause. Wenn er in zehn Minuten nicht kommt, versuchen wir es nächste Woche wieder.« Er blickte Keon aus dem Augenwinkel an. »Du hast doch den Mumm, oder, Keon? Auf dich kommt’s jetzt an. Aber noch mal, pass auf, dass keinem was passiert, okay?«
Keon rutschte wieder voller Unbehagen hin und her. Die hohe Mauer links von ihnen war mit bunten Graffiti besprüht, die der Stadtrat nicht hatte übermalen lassen, weil sie als Kunst galten. Während Keon sie betrachtete, dachte er kurz über den feinen Unterschied zwischen Straftat und Kunst nach. Was ich tue, ist doch sicherlich keine Straftat, oder?, dachte er. Die Waffe, die er bei sich trug, wollte er nicht benutzen; er wollte damit nur jemanden einschüchtern. Einen Eindruck hinterlassen. Etwas verändern.
Ein betrunkener Mittfünfziger wankte an ihren Busch und blieb einen Augenblick lang stehen. Die Jungen konnten ihn durch die Blätter und Zweige gerade eben so erkennen; sie sahen schütteres graues Haar, eine gefurchte Stirn, eine Tweedjacke und eine braune Hose. Der Mann schwankte hin und her und versuchte, die Titelmelodie von Coronation Street zu pfeifen, bekam es aber nicht hin.
»Verfluchte Scheiße …«, flüsterte Keon.
Die beiden rührten sich nicht. Ihre Augen glänzten im Straßenlicht. Der Mann stabilisierte seinen Stand, dann zog er sich den Reißverschluss herunter und begann auf den Busch zu pinkeln, nur ein paar Zentimeter von Steve entfernt. Steve verzog gequält das Gesicht, fletschte die Zähne und ballte die Faust. Der Uringestank stand rings um die beiden in der Luft.
Keon verkniff sich ein Lachen, blickte auf seine Air-Force-1-Turnschuhe und lenkte sich ab, indem er einen Fleck von der Spitze des linken Schuhs rieb. Schließlich ging der Mann mit dem schütteren Haar und der Tweedjacke wieder weiter.
»Das war knapp, Alter«, sagte Steve. Er klang mehr als nur ein bisschen sauer.
»Der Typ hat gepisst wie ein Kamel«, erwiderte Keon, das Gesicht vor Heiterkeit verzerrt. Doch sofort senkte sich wieder das Schweigen über beide, und die Luft war zum Schneiden. Der Regen fiel jetzt dichter.
23.41 Uhr.
Plötzlich waren Schritte in dem Durchgang zur U-Bahn zu hören, die zur Straßenebene hinaufstiegen; sie begannen leise und mit großem Hall und wurden immer lauter und schärfer. Das könnte jeder sein, dachte Keon.
Die üblichen Pendler und Kneipengäste, die an der Bushaltestelle auf die W3 warteten, waren fort, und der U-Bahnhof und seine Umgebung menschenleer. Die Jungen gingen in die Hocke, eine Hand am Boden, wie Olympiasprinter, die auf den Startschuss warteten. Auf das Signal zum Angriff.
Keon war es schlecht.
»Da ist er!«, rief Steve plötzlich und stieß Keon in die Außenwelt, ehe er eine Chance hatte, noch zu kneifen. Der Busch spie ihn auf die Straße, seine Füße polterten über den Boden.
Ricky, ein großer weißer Typ in einer schwarzen Jacke, ging mit übergezogener Kapuze, den Kopf nach vorn gebeugt, damit er keinen Regen ins Gesicht bekam.
Keon eilte auf ihn zu. Sein Herz klopfte so heftig, dass er kaum die Finger ruhig halten konnte. Die Aufregung machte ihn fertig, seine Beine fühlten sich an wie Gummibänder. Mit drei langen Schritten hatte er Rick erreicht. »Komm her, du blöde Sau!«, brüllte Keon, riss ihn an der Schulter herum und hielt ihm die Pistole vor die Brust.
Aber dann hörte er es.
Einen Schuss. Einen Knall, der so laut war, dass Keon glaubte, er wäre von anderswoher gekommen. Die Härchen auf seinen Armen stellten sich auf. Nein! Das konnte doch nicht sein? Sein Zeigefinger zuckte wieder, die Pistole hing locker in seiner rechten Hand am Ende des herunterbaumelnden schlaffen Arms neben dem Knie. Aber der Abzug war so weit an den Griff zurückgezogen, wie es nur ging. Das musste er getan haben.
Vielleicht träumte er nur, vielleicht war es nur ein Albtraum? Die Sorte, bei der man aufwacht und im Bett aufrecht sitzt und um Atem ringt, die Beine in einer Masse aus verschwitzten Laken verfangen?
Ricky wandte sich ihm zu und krümmte sich dabei in unverhohlenem, nacktem Schmerz zusammen. Jede Bewegung schien in Zeitlupe abzulaufen.
»Oh, Scheiße«, keuchte er, einen Ausdruck grenzenlosen Entsetzens in den Augen. Er hielt sich mit der rechten Hand die Brust, und ein Rucksack fiel auf den Boden.
Doch das Gesicht, in dem der Schmerz der letzten Lebenssekunden stand, war nicht Rickys Gesicht … Die ängstlich zusammengepressten Lippen gehörten nicht Ricky. Die Wangen, aus denen jede Farbe verschwunden war, passten nicht …
Keon sah sich nach Unterstützung um. Steve haute gerade ab, er hörte nur noch seine in der Ferne verhallenden Schritte auf der Straße. Weg. Nirgendwo zu sehen.
Der Mann. Dieser Kerl, wer immer es war, sackte wie ein Sack Kartoffeln auf den Gehweg und krümmte sich zusammen. »Scheiße, du Arsch. Du hast auf mich geschossen … wieso hast du auf mich geschossen?«, rief er; sein Atem rasselte.
Keon stand nur da und starrte auf den Mann, dem das Blut aus dem Körper rann. Es bildete schon eine kleine Lache. Mageninhalt stieg Keon in die Kehle.
Einen flüchtigen Moment lang stellte er sich vor, sie wären beim Fußballspiel samstagmorgens, und er sehe einen verletzten Fußballer an, einen Mannschaftskameraden vielleicht, der gleich wieder aufstehen würde, Schweiß auf der Stirn, und lachte, ehe er sich die Hände an den Shorts abwischte und auf den Rasen ausspuckte. Aber nein … dieser Mann atmete schwer und unregelmäßig, als hätte er etwas im Hals, und er lag nicht auf dem grünen Gras des Sportplatzes, sondern auf einer kalten, feuchten Londoner Straße.
Nur ein winziges Wimmern kam noch über die Lippen des Mannes, und aus seinem Mund floss noch mehr Blut auf den schmutzigen Beton.
Keon ließ die Pistole fallen. Sie klapperte laut über den Boden. Ein paar Sekunden stand er da. Seine Sicht zuckte und sprang, als würde er Polka tanzen, und die Übelkeit übermannte ihn. Pure Panik. Seine Lunge presste ihm mit Nachdruck und lautem Keuchen die Luft aus dem Leib.
Wie aus dem Nichts erschien eine Frau mit drahtigem Haar, schlug die Hände vor den Mund und blieb ein paar Meter entfernt stehen. Ohne ihren cremefarbenen Mantel, der unter der Straßenlaterne grellweiß strahlte, wäre sie kaum zu erkennen gewesen. Sie war aus der Dunkelheit auf eine Bühne getreten, auf der sich eine Tragödie des wirklichen Lebens abspielte. Jetzt war sie Teil des Dramas und hatte weder einen Text, den sie sprechen konnte, noch eine Vorstellung davon, wie die Szene enden würde.
Keon drehte sich um und starrte sie an. Er atmete tief und schnell, dann blickte er wieder auf den Mann, den er vielleicht ermordet hatte. Ihre Blicke trafen sich, und ein paar Sekunden lang herrschte Verwirrung. Er konnte versuchen, den Kerl zu retten; er sah aus wie ein netter Mensch. Er wusste es nicht mit Sicherheit, aber bestimmt hatte er eine Mutter, oder eine Frau, Kinder sogar … Der Mann klammerte sich an seinen braunen Rucksack. Er war aus Leder und sah teuer aus. Vielleicht war das ein Banker? Ein Buchhalter? Ein Anwalt?
Doch er konnte jetzt nichts weiter tun, also rannte er, kämpfte darum, die Übelkeit und die Säure unten zu halten, die ihm in die Kehle stiegen. Er musste hier weg. Er musste von alldem weg. Weg von dem Mann, der sterbend auf der Straße lag.
»He, du! Komm zurück!«, brüllte die Frau. Ihre Stimme war rau vom Qualm Tausender Zigaretten. Keons Beine, die jetzt vor Angst heftig zuckten, trugen ihn mit einer Geschwindigkeit in die Nacht davon, die er immer für unmöglich gehalten hatte. Jeder Schritt seiner Trainingsschuhe hallte durch die Straße und drang ihm, wie um ihn zu verhöhnen, wieder in die Ohren. Dieses Geräusch würde ihn sein Lebtag lang verfolgen und an die Nacht erinnern, in der er vielleicht mehr als nur ein Leben ruiniert hatte.
Die Frau rannte zu dem Mann, Tränen in den Augen. In dem strömenden Regen kniete sie sich neben ihn, legte ihm die Finger auf die Brust, spürte die feuchte Wärme seines Blutes, das seine Kleidung durchtränkte. Sie hob die Finger in den Schein der nahen Straßenlaterne. Ihr Magen zog sich zusammen, als ihr Blick auf das helle rote Blut an ihren Fingerspitzen fiel.
Der Mann griff sich in die Tasche und keuchte dabei. Die Frau sah ihn erstaunt an, als er etwas herauszog und es ihr in die Hand drückte. Sie sah sich nicht an, was sie erhielt, sie steckte es nur in die eigene Manteltasche; sie war zu sehr mit ihm beschäftigt.
»Geben Sie das … bitte geben Sie das …«, stieß er hervor.
Er konnte nicht mehr reden, und in seine Augen trat ein abwesender Ausdruck. Sie hörte nur sein angestrengtes Atmen, das immer wieder von verzweifeltem, tränenersticktem Wimmern unterbrochen wurde.
»Bleiben Sie doch hier«, flüsterte sie und brachte ihr Gesicht näher. Sie drückte seine Wangen zwischen den Händen, als könnte sie ihn dadurch hindern, für immer in Schlaf zu fallen, und hinterließ einen traurigen Streifen aus seinem eigenen Blut auf seinen Wangen.
Mit zitternden Händen wählte sie den Notruf. »Ja, hallo. Ich heiße Lisa. Wir brauchen dringend einen Rettungswagen. Bitte beeilen Sie sich; ich habe hier einen Mann, der angeschossen wurde.«
Als sie telefoniert hatte, nahm sie seine Hand. Zuerst erwiderte er den Druck, doch am Ende wurde sie ganz schlaff.
3
Es war Klaustrophobie in Vollendung.
Donnerstag, 12. März 2009
Finsbury Park, Nord-London
22.30 Uhr
Bryony Weaver schob sich tiefer ins Bett. Das Laken strich ihr über die nackten, frisch rasierten Beine und hüllte sie ein. Wunderbares Gefühl, dachte sie.
Erst vor einer halben Stunde war sie die Konturen ihrer Waden und Knie mit einer Klinge entlanggefahren und hatte sich versehentlich geschnitten. Zweimal. Wie jedes Mal. »Scheiße, Scheiße, Scheiße …«, hatte sie geflüstert, wenn sie merkte, wie die Schneide an einem Stückchen Haut hängenblieb und es säuberlich abtrennte. Nicht schon wieder… Eine Schramme hatte sie unter dem Knie, die andere gleich über dem linken Fußgelenk.
Die Zeit, bis die kleinen Schnitte zu bluten aufhörten, war ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen – und Bryony kam es vor, als hätte sie eine ganze Rolle Klopapier verbraucht. Danach hatte sie sich ein schwarzes Unterhemd und karierte grüne Shorts angezogen – die sie immer an die Tapeten amerikanischer Mädchen in Teenagerfilmen erinnerten – und das lange, dichte Haar zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Im Nacken spürte sie den Luftzug, der durch das offene Schlafzimmerfenster hereinkam.
Sie schmiegte sich noch ein wenig tiefer ins Bett und spürte den kühlen Stoff der Daunendecke. Ohne Max erschien ihr das Bett wie eine unendlich weite Landschaft. War er zu Hause, weckte er sie ständig mit einem fliegenden Arm oder einem sanften Kopfstoß, wenn er sich von seinem letzten Auftrag träumend hin und her wälzte. Seine Arbeit war so vielfältig und manchmal so erschreckend und intensiv, dass er nie richtig abschalten konnte. Seit er die Stelle als Kameramann beim Fernsehen angetreten hatte, träumte er sehr lebhaft. Gerade war er noch auf den Fidschi-Inseln und filmte Prominente, wie sie lebendige Insekten aßen, und im nächsten Moment hetzte er durch ein leerstehendes Lagerhaus irgendwo in Afrika und machte wichtige Aufnahmen für seine neueste Dokumentation. Egal, wann er nach Hause kam, ihm ging noch eine ganze Weile lang alles Mögliche durch den Kopf, wie die flackernden Bilder auf einem Zoetrop. Er lebte für seine Arbeit – sie war das Einzige auf der Welt, was er beinahe so sehr liebte wie Bryony Weaver.
Wenn Max da war und das Zimmer mit dem Geruch des Rasierwassers füllte, das er benutzte, seit er neunzehn war, kam es Bryony oft so vor, als erstickten sie in der Gegenwart des anderen. Sie mochte es allerdings so. Es war Klaustrophobie in Vollendung.
Irgendwie fühlte es sich merkwürdig an, allein zu sein – dabei hätte sie es eigentlich gewöhnt sein müssen. Früher war Max viel auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. In letzter Zeit filmte er jedoch tagsüber in Londoner Studios.
Sie nahm ihr Handy und scrollte zu der letzten SMS, die er ihr am Morgen gesendet hatte: »Filmen heute Abend in West-London, verdammte Anweisung in letzter Sekunde. Tut mir leid, Schönheit. Bin morgen früh wieder da. Guck mal in den Kühlschrank, unterstes Fach. Liebe dich. Maximus X.«
Bryony streckte die Hand nach dem Nachttisch aus, den sie mit trendigem Papier dekoriert hatte, das Max nicht leiden konnte, und hob einen kleinen blauen Beilagenteller herunter. Darauf war ein Leckerbissen, den Max ihr mitgebracht und als Überraschung im Kühlschrank versteckt hatte. Zitronenkuchen. Ihre Leibspeise.
Sie senkte die Zähne hinein. Die Glasur splitterte, dann drang sie in den weichen Teig darunter vor und schmeckte intensiv bitteres Zitronenaroma. Es war fünf Minuten nach halb elf am Donnerstagabend, und sie konnte tun und lassen, was sie wollte. Auch wenn sie Max nun vermisste, sie wusste, dass sie sich nach dem Alleinsein sehnen würde, wenn er erst wieder da war und seinen üblichen Unsinn anstellte – wie etwa zu versuchen, seine Sachen auf dem Bett zu bügeln, weil er keine Lust hatte, das Bügelbrett aufzustellen.
Als sie den Kuchen zu Ende gegessen hatte, stellte sie den Teller wieder auf den Nachttisch und tastete nach ihrem Buch. Nachdem sie einige gestreifte Kissen in ihrem Rücken aufgebaut hatte, schob sie die Finger zwischen die Seiten von George Orwells 1984. Das Buch war eine wirklich alte Ausgabe, genau, wie Bryony es mochte: Es war voller Teeflecke, und es roch nach Zigaretten – ein Geruch, den man in modernen Buchläden nicht fand. Bryony hielt es sich vors Gesicht, vergrub die Nase zwischen den Seiten und atmete tief ein, malte sich Erinnerungen aus, die nicht ihre Erinnerungen waren. Der Geruch eines Buches konnte mehr Geschichten erzählen als die Wörter darin.
Sie schloss die Augen und schnüffelte wieder. Diesmal ließ sie sich von dem Rauchgeruch in ihre eigene Vergangenheit entführen. Bryony wurde ins Jahr 2002 zurückversetzt, in den Mai, in den Biergarten eines kleinen Lokals in Shoreditch. Sie hatte eine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wie einen Joint und aus halb geschlossenen Augen einen Mann beobachtet, der ihr gegenübersaß und den sie noch nie gesehen hatte.
»Rauchen ist verflucht ungesund«, hatte er gesagt und einen kräftigen Zug von seiner Zigarette genommen, dann mit der freien Hand die Bierflasche gehoben, an der das Kondenswasser hinunterlief und sich auf seinen Fingern sammelte.
Bryony war schon recht angetrunken, obwohl es noch früh war, und fragte sich, ob es ihm auffallen würde, wenn sie ihr linkes Auge mit der Hand bedeckte und ihn nur mit dem rechten ansah. Nur damit sie ihn deutlicher erkennen konnte, natürlich … »Entschuldigung, wer sind Sie?«, fragte sie voller Angst, sie könnte vielleicht lallen.
Der Mann vor ihr sah so gut aus, dass es ihr beinahe Angst machte, aber der viele Wein, den sie an diesem Nachmittag getrunken hatte, hinderte sie daran, das zu tun, was sie normalerweise in einer solchen Situation tat – nämlich eine Entschuldigung zu murmeln und davonzueilen, bevor sie sich blamieren konnte. Die junge Bryony Weaver hatte kein sonderlich großes Selbstvertrauen besessen.
Er trug sein marineblau und weiß gestreiftes T-Shirt mit ungezwungener Lässigkeit. Sein dunkelbraunes Haar war an den Seiten ganz kurz geschnitten, aber auf dem Scheitel spross es ein wenig wilder. Sein Pony war so lang, dass er zu einer Spitze zusammenlief und fast seine Augen bedeckte. Ihn umgab etwas Geheimnisvolles. Irgendwie wirkte er schmuddelig, als müsste er einmal kräftig abgeschrubbt werden. Gleichzeitig gefiel ihr die Vorstellung nicht, ihn sauberzuwaschen, so als wäre er dadurch ein wenig verdorben worden.
Bryony lächelte breit in ihr Buch, als sie sich an den Tag erinnerte.
Er hatte einen gewissen schurkischen Charme an sich, etwas Abenteuerliches, als wäre er in der Lage, sie zu überreden, einfach ihre Sachen zu packen, zu ihm ins Auto zu springen und mit unbekanntem Ziel loszufahren. Ein Mann musste schon ungewöhnlich sein, damit ein Mädchen so empfand.
Bryony war einundzwanzig gewesen und mochte die Jungen von Shoreditch und ihre Pfoten, die schmuddelig waren, weil sie den ganzen Tag lang in einem verstaubten Künstleratelier irgendeine traurige, nackte Gestalt abmalten. Sie waren intelligent, aufmerksam und kreativ. Sie hatten etwas Besonderes an sich. Bryony hatte die gelackten Jungen aus der City in ihren schicken Anzügen immer verabscheut, wie sie in ihren Nachtclubs im Bankenviertel herumhingen und ein Mädchen suchten, das sie nach Hause abschleppen konnten, um sich über die bittere Einsamkeit ihres Arbeitslebens hinwegzutrösten. Sie standen für alles, was Bryony zuwider war.
Im Rückblick fand sie das alles sehr komisch.
Doch so sehr sie die jungen Künstler gemocht hatte, fand sie sie auch einschüchternd wegen der Art, wie sie sich kleideten und über Politik sprachen, die sie offenbar niemals wirklich verstanden. An der Universität hatte Bryony ihre zermürbende Schüchternheit nicht verloren, und jedes Mal, wenn ein gut aussehender Mann in der Nähe war, stieg ihr eine tiefe Röte in die Wangen. Dafür hasste sie sich.
»Ich bin Max Tooley«, hatte er gesagt. Mit seinen dunkelbraunen Augen suchte er ihren Blick und nahm einen Kontakt auf, den sie als verstörend nah empfand. Ihr war dabei ein wenig, als durchfließe sie ein elektrischer Strom.
Er hatte eine tolle Nase … Sie hätte nicht sagen können, was an dieser Nase so gut war, aber sie war gut – ein Hinweis auf seinen Charakter vielleicht? Aber in diesem frühen Stadium ließ sich das noch nicht sagen. Jedenfalls, die Nase war gerade, nicht zu groß, nicht zu klein. Einfach ideal.
Max schürzte die Lippen, als denke er nach, dann blickte er auf und lächelte sie frech an. Er streckte die Hand über den verwitterten Biertisch, und dort schwebte sie einen Augenblick lang.
Ihr fiel auf, dass an seinen Fingern keine getrocknete Farbe klebte, keine Kreide, und dass er auch keine Schnitte von Metallarbeit hatte. Auf der Stelle fragte sie sich, was er wohl machte.
»Schüttelst du mir jetzt die Hand oder nicht?«, fragte er und lachte ein wenig. Seine Zigarette zitterte zwischen seinen wohlgeformten Lippen. Wie spitzbübisch er wirkte.
Sie hielt kurz inne. Plötzlich hatte sie sich völlig unter Kontrolle, weil der Wein betäubend auf ihre gewohnte Schüchternheit wirkte, und sie hob die rechte Augenbraue, während sie ihn eingehend musterte. »Hallo, Max, schön, dich kennenzulernen.« Sie streckte die Hand in die Leere zwischen ihnen, und der ungewöhnliche Ring an ihrem Zeigefinger funkelte in der Sonne des frühen Abends. Er war beträchtlich schwerer, seit ihre Mitbewohnerin einen rabenschwarzen Stein darangeklebt hatte.
Doch kaum reichte sie ihm die Hand, als Max seine Rechte wegzog wie ein Kind. »Ha, ha! Zu spät!«, rief er, lachte schallend und knallte die Handfläche auf den Tisch, sodass die leeren Gläser klirrend gegeneinanderstießen.
Sie zog ihre Hand ebenso rasch zurück. Sie war verlegen und zugleich verärgert. »Wie erwachsen«, sagte sie tonlos und starrte ihn kalt an.
Ihr wurde klar, dass sie wahrscheinlich ziemlich ungehobelt wirkte, und lächelte deshalb. Ihr Lächeln war ein Versuch, diese Wirkung zu überspielen, die ja nur Resultat ihrer Schüchternheit war; sie verjagte damit aber jeden netten Mann.
»Das ist aber eine hübsche Kauleiste, die du da hast … äh … wie heißt du eigentlich?« Max drückte mit der einen Hand den Stummel seiner Selbstgedrehten in dem Glasaschenbecher aus und wedelte extravagant mit der anderen.
»Bryony«, sagte sie und schnippte ihre Kippe in einen Busch hinter ihr, eine beschwipste Auflehnung gegen das System.
Er sah sie stirnrunzelnd an, Umweltverschmutzerin, die sie war.
»Kauleiste?«, fragte sie. Das hatte noch niemand zu ihr gesagt.
»Zähne. Du hast hübsche Zähne«, sagte er, dann sprang er von der Bank auf und hetzte in den Pub, als hätte er gerade entdeckt, dass er in einem Ameisenhaufen saß.
Den ganzen Abend war sie diese Begegnung mit ihrer Mitbewohnerin Eliza durchgegangen, einer angehenden Schmuckdesignerin. Bei jeder Gelegenheit befestigte sie mit einer Klebepistole, die tropfte wie das Maul eines bissigen Hundes, begeistert Halbedelsteine an Bryonys Ringen und Halsketten.
»Was heißt es, wenn ein Mann dir sagt, du hast schöne Zähne, Eliza? Mag er dich dann?«, fragte Bryony. Sie lag vor ihrem Bett, die Beine auf die Matratze gelegt, das lange Haar auf dem Vorleger ausgebreitet. Max Tooleys Gesicht ging ihr einfach nicht aus dem Kopf.
Eliza ringelte einen dünnen Draht mit einer unglaublich kleinen Zange. In ihrer Konzentration wackelte sie mit den Zehen.
»Äh … Zähne? Zähne … hmmmm. Ich weiß es nicht, Bryony. Ich meine, er hat ja nicht zu dir gesagt, du hättest einen süßen Po oder hübsche Beine oder so was, oder?«, fragte sie und blickte auf, qualvolle Aufrichtigkeit in den Augen.
Bryony seufzte tief.
»Und welcher Mann redet schon über Zähne? Mir kommt das ein bisschen komisch vor.« Eliza sprach immer langsamer, weil sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren wollte, und öffnete den Miniaturschraubstock, der ihr Werkstück hielt, einen Ring. Sie hob ihre Kreation ins Licht und betrachtete sie kritisch, den Mund zu einem unzufriedenen Schmollen verzogen.
»Das ist Mist, Bryony! Absoluter Mist!«, rief sie frustriert und warf das Ding in den Metallabfall. Dort schepperte der misslungene Ring laut am Boden. Das Scheppern war das Geräusch des Fehlschlags, das in ihrem 700 Pfund im Monat teuren Wohnklo nur allzu oft zu hören war.
»Mach das nicht, Eliza. Ich mag die Stücke, die du machst«, sagte Bryony. »Also sollte ich Max lieber vergessen?«, fragte sie wieder und hoffte, ihre treue Freundin würde ihr Selbstbewusstsein genügend stärken, damit sie zurück in den Pub gehen und ihn nach seiner Telefonnummer fragen konnte. Vielleicht war er noch da … Wenn Eliza ihre Zustimmung aussprach, konnte sie sich ihren schmeichelhaftesten BH anziehen und ein enges schwarzes Top, sich mit der Bürste durch die wilde Mähne fahren, einen knallroten Lippenstift auftragen und wieder im Pub aufkreuzen, ganz beiläufig … irgendwie …
»Ja, ich glaube schon, Süße«, sagte Eliza jedoch, dann verließ sie ihre Miniaturwerkstatt und schlurfte in die Küche, die keine Tür hatte, weil ihr Exfreund vor vier Monaten ein Loch hineingeschlagen hatte. Sie hatten sich entschieden, die Tür ganz auszuhängen, weil ständig jemand fragte, was damit passiert war, und nicht ganz glauben wollte, dass Bryony betrunken in die Tür gefallen war, während sie Common People von Pulp in einen Mopp sang. Noch lange nach dem Zwischenfall trieb jede Erwähnung ihres Ex Eliza ins Bad; zehn Minuten später kam sie dann mit verschmiertem Make-up wieder heraus und roch nach Gras und Tequila. »Ich weiß echt nicht, wieso du dich mit den Typen hier abgibst«, rief sie aus dem Kühlschrank, in dem sie nach etwas wühlte, das sie sich auf den Toast streichen konnte.
Bryony hatte sich vom Bett gleiten lassen und suchte in dem Abfalleimer leise nach dem misslungenen Ring, bis sie ihn unter einem zusammengeknüllten Kontoauszug ertastete. Sie nahm ihn heraus und steckte sich ihn an. Er passte perfekt auf ihren Finger. Er ist wunderbar, dachte sie. Sie würde ihn in die Schachtel legen, die sie in ihrer obersten Kommodenschublade versteckt hatte und die gefüllt war mit Elizas Schmuck-»Abfall«, den sie mochte und heimlich trug.
»Ich meine, die sind hier alle so schlunzig. Und alle haben sie den gleichen großen Traum, der nächste große Künstler zu sein und nie erwachsen werden zu müssen. Sich niemals wirklich der Realität stellen zu brauchen mit ihren Rechnungen und der gesellschaftlichen Verantwortung. Verstehst du, was ich meine?« Eliza zog den Kopf aus dem Kühlschrank. Eine Lage Scheibenkäse fiel heraus und klatschte auf den Küchenboden.
»Das verstehe ich gut«, sagte Bryony und verbarg ihre Hand unter der Bettdecke, damit Eliza nicht sah, dass sie den Ring adoptiert hatte, »aber manche Menschen brauchen einfach einen großen Traum, oder? Und wenn niemand Risiken eingeht und nicht hart an sich arbeitet, dann gibt es eben keine großen Künstler oder Sportler oder Musiker, stimmt’s?« Die schlanke Eliza häufte sich Erdnussbutter auf ihre Toastscheibe. »Ich meine, was ist mit deinem Traum, Schmuck zu designen? Du willst doch auch die nächste große Sensation sein, oder?«
Kurz herrschte Schweigen. Ein wunder Punkt.
»Das ist wahr«, gab Eliza schließlich mürrisch zu. »Da hast du natürlich recht. Aber was deinen Typen betrifft, Bryony, dann weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll, außer, dass er ja wohl kaum aufgesprungen und einfach so verschwunden wäre, wenn er die Mühe wert wäre, oder?« Sie stand im offenen Durchgang, in der einen Hand ihren kleinen Teller, und krauste leicht die Nase. Ihre lockige Mähne aus dichtem blonden Haar fiel fast von selbst in Dreadlocks. Im schwachen Licht funkelte ihr Nasenpiercing.
Manchmal war sie einfach entsetzlich ehrlich.
In diesem Moment hatte Bryony ihn fast schon aufgegeben. Sie erinnerte sich noch an ihre tiefe Enttäuschung, mit einem Buch schlafen zu gehen statt mit dem Mann, in den sie sich während einer beschwipsten zweiminütigen Unterhaltung verguckt hatte. Sie hatte sich gefragt, ob es jemals einfach sein konnte.
Doch jetzt war es einfach.
Sie war endlich erwachsen. Achtundzwanzig. Sie hatte einen festen, gut bezahlten Job in der PR-Branche, stand nicht in der Verkehrssünderkartei und konnte etwas Besseres zum Abendbrot essen als einen Toast mit Käse und einer Dose Bier. Und sie hatte einen wunderbaren Lebensgefährten.
Max Tooley.
Er hatte aufgehört, ihr unerreichbarer Schwarm zu sein, und war in ihren Alltag eingetreten, nachdem er ihr an einem Sommernachmittag versehentlich ein großes Glas Foster’s auf ihr weißes Kleid geschüttet hatte, nur wenige Wochen nach ihrer ersten Begegnung.
Bryony hatte geglaubt, sie würde ihn niemals wiedersehen, und war völlig überrascht, sein entsetztes Gesicht vor sich zu sehen, in der Hand ein leeres Bierglas, schräg gehalten, während die beinahe eiskalte Flüssigkeit durch den weichen Stoff ihres Kleides sickerte und zu ihrer Haut vordrang. Er hatte über ihren gepunkteten BH gelacht, und sie hatte ihn geohrfeigt.
Den ganzen Sommer lang hatte er ihr persönlich Rosen in die Secondhand-Boutique gebracht, in der sie arbeitete und die sie hasste, und den Sommer 2002 zum besten Sommer ihres Lebens gemacht. Noch besser als den Sommer 1999, den sie als Rucksacktouristin in Australien verbracht hatte. Besser als den Sommer 2000, in dem sie entdeckt hatte, wie toll es war, bis sieben Uhr morgens durchzufeiern. Sogar besser als den Sommer von 1996, in dem sie nach zig erfolgreichen Versuchen und einem gebrochenen Arm das Radschlagen meisterte.
Bryony hatte zuerst gezögert, ihn an sich heranzulassen. Die Blumen hatten ihr natürlich gefallen, und die Aufmerksamkeit auch. Sie hatte es gemocht, wie die Mädchen, die außer ihr in der Boutique arbeiteten, mit ihrem Pony spielten, wann immer er hereinkam, und ihn über die Theke hinweg anschmachteten. Sie fand die verzweifelte Liebe entzückend, die ihm ins Gesicht geschrieben stand …
Lächelnd schlug Bryony das Buch auf und schaltete die Nachttischlampe ab, sodass nur noch das Licht von fünf Kerzen das Schlafzimmer erhellte. Ihr Schein reichte gerade aus, um dabei zu lesen. Dennoch, sie war ein wenig abgelenkt. Sie fühlte sich unruhig, aufgeregt und merkwürdig lebendig.
Sie drehte den Kopf nach rechts und blickte aus dem offenen Fenster auf die Straße in Finsbury Park, an der das Haus lag. Unter dem Fenster stand eine große lederne Reisetasche und wartete darauf, für den Trip nach Amsterdam gepackt zu werden, den Max und sie am Wochenende unternehmen wollten.
Sie konnte es nicht abwarten, aber gleichzeitig machte sie misstrauisch, wie Max sich in letzter Zeit benahm. Der Wochenendtrip … der Kuchen … das gesteigerte Verlangen nach Sex … Es war, als verliebte er sich wieder neu in sie, und sie konnte nicht anders, sie musste sich fragen, woher das kam.
Ihre Wohnung war im zweiten Stock, und durch das Fenster konnte Bryony mehrere Reihen von Dächern sehen. Hinter Vorhängen brannten viele behagliche Lichter, und Bryony fragte sich, was in den Zimmern vorging. Sie hoffte, dass die Menschen dort genauso glücklich wären wie sie.
Einige Vorhänge waren modern und bunt, pink, grün und rot.
Einige waren hässliche altmodische Katastrophen aus Spitze, die sie an die weißen Häkelkleider von Klorollenpuppen erinnerten.
Sie wandte sich wieder ihrem Buch zu, doch gerade, als sie den Faden aufnahm, hörte sie einen Knall. Er war so laut, dass er in der Straße widerhallte, von Haus zu Wohnung und Laden und wieder zurück geworfen wurde. Trotzdem merkte sie, dass sein Ursprung ein paar hundert Meter entfernt war.
Sie zuckte in ihrem Bett leicht zusammen und legte das Buch auf die Bettdecke. Ihr Herz klopfte ein wenig.
Die Stadt war voller unerklärlicher Geräusche; die Einwohner von Finsbury Park beachteten sie kaum. Ständig hörte man Mülltonnen klappern und Katzen schreien, die manchmal klangen wie ein Mädchen in Todesnot. Füchse rasselten mit leeren Konservendosen, Automotoren hatten Fehlzündungen, Krankenwagen heulten hysterisch. Der Knall jedoch hatte etwas an sich, das Bryony veranlasste, sich einen Augenblick lang aufzusetzen und die Hand an die Brust zu heben, unbewusst den Zeigefinger in die weiche Kuhle an ihrer Kehle zu legen. Sie schluckte mühsam.
Stille.
Und dann, etwas später, Sirenen.
4
»Ein kleiner Schaufensterbummel kann ja nicht schaden.«
Donnerstag, 12. März 2009
Crouch End, Nord-London
16.55 Uhr
»Mach Feierabend. Ich brauche Wein und Zigaretten. Dringend.
Tanya x.«
Die SMS war kurz und brachte es auf den Punkt. Sara konnte jedoch nur dann rechtzeitig von der Arbeit weg, wenn sie jemanden fand, der mit ihr die Schicht tauschte.
Sie schob das weiße iPhone wieder in die Tasche und atmete tief ein, während sie um sich blickte. Sie schaute auf das schöne, saubere, stilvolle und – sie wagte es zu denken – trendige Restaurant White Rope in Crouch End.
Ihr Restaurant.
Na ja, nicht so ganz ihr Restaurant … aber sie hatte die erhabene Stellung der Managerin inne. Für Sara war damit ein Traum Wirklichkeit geworden. Endlich, im Alter von achtundzwanzig Jahren, stand sie dort, wohin sie immer gewollt hatte.
Träume. Werden. Wirklich. Wahr. Diesen Satz hatte sie ihrem Ehemann in vier SMS gesendet, sofort nachdem sie von Mauro Dellati die Neuigkeit erfahren hatte.
Mauro, ein alternder Italiener und Inhaber des White Rope, trug auf seinen Schultern die schwere Last unverwirklichter lebenslanger Träume. Als Kind hatte er sich ausgemalt, die ganze Welt seinem köstlich-dekadenten Delikatessen-Imperium zu unterwerfen, während er in der engen Küche seiner Mutter komplizierte »Dinge auf Ciabatta« anrichtete; damals hatte er auf einem Stapel Telefonbücher stehen müssen, um an die Arbeitsplatte heranzukommen.
Mauro, acht Jahre alt, mit Mehl bestäubt.
Mauro, neun Jahre alt, der erfolgreich seine erste Paella kreierte.
Mit zehn konnte Mauro frische Nudeln herstellen, und seine Mutter beobachtete ihn gebannt, während sie sich knallroten Lippenstift auf den Mund malte, gigantische Lockenwickler im Haar.
Doch es war nicht so gekommen, wie er gehofft hatte, und die Jahre verstrichen, bis seine Träume sich weit außerhalb seiner Reichweite befanden. Es ließ ihn nicht los. Der Ausbruch einer Arthrose und ein ausuferndes Alkoholproblem hatten den Tagen, an denen er arbeiten konnte, schließlich ein Ende gemacht, und heute nahm er nur den Gewinn, den das Restaurant abwarf, und delegierte die Verantwortung. Lediglich an Sonntagabenden kam er vorbei, einen Gehstock umklammernd, und setzte sich in eine stille Ecke, wo er Weißwein trank und traurig das Restaurant beäugte, das er einmal geführt hatte.
»Sie, Sara, meine Liebe, machen aus diesem Haus Ihr eigenes«, hatte er im letzten Oktober gesagt, und Tränen stiegen ihm in die braunen Augen. Seine Hände hatten auf ihren schmalen Schultern geruht, die von einem feinen Trägerhemdchen kaum bedeckt gewesen waren – als schlage er sie zum Ritter. Sie hatte seine raue Haut gespürt und sein aufdringliches Aftershave gerochen. Die Knollennase in seinem runden, freundlichen Gesicht war rot von Jahren ausdauernden Trinkens.
Er behandelte sie wie ein Großvater, ein exzentrischer, wunderbarer Mann, der beiseitegetreten war, um ihr eine Chance zu geben, Jahre nachdem sie, noch als Schulmädchen, an Samstagnachmittagen bei ihm auszuhelfen begonnen hatte. Niemand hatte ihr Potenzial je so erkannt wie Mauro. Niemand schien je so viel Geduld mit ihr gehabt zu haben. Er hatte sie niemals gemaßregelt oder angebrüllt, nicht einmal, als sie eine Sektflasche so ungeschickt öffnete, dass der Gast mit einer Augenverletzung ins Krankenhaus musste. Er hatte nur leise kichernd in der Küchenecke gesessen und den Unfallbericht ausgefüllt.
Ein Gefühl der Wärme breitete sich in ihr aus, als sie an Mauro dachte, der immer an sie geglaubt hatte.
Sara hatte nie erwartet, es weit zu bringen. Sie war eine eigenwillige, ungewöhnliche Frau mit kurzem dunklen Haar. Ihre Haut war so blass, dass sie fast durchscheinend wirkte, und ihre Augen waren von einem umwerfenden Blau. Sie war schmal und grazil gebaut und auf eine ätherische Weise schön, eine unabhängige Seele mit einer angenehmen, akzentuierten Stimme, die unter den richtigen Umständen zusammenschmelzen und ganz bodenständig klingen konnte. Als soziales Chamäleon wusste sie sich überall einzufügen, aber oft blieb sie dann die Antwort auf die Frage schuldig, wer sie war: Sie konnte das Mädchen beim Konzert einer Band sein, deren dunkler Eyeliner im Stroboskoplicht wie Tigerstreifen wirkte, aber auch, wenn sie es wollte, die nüchterne Geschäftsfrau in Kostüm und High Heels.
Sara besaß einen eigentümlichen, trockenen Sinn für Humor, aber vor allem war sie leicht auf die Palme zu bringen. Sie war für ihre Hitzigkeit bekannt, und sie hatte ihr schon mehrfach Ärger eingebracht. Wer anders war, fiel auf, und wer auffiel, bekam Schwierigkeiten. Sie fragte sich oft, wieso sie durch das gewaltig breite Spektrum an Reaktionen, die sie im Laufe der Jahre bei Menschen hervorgerufen hatte, keine unkonventionelle Haltung zu den Wechselfällen des Lebens entwickelt hatte. Männer verliebten sich entweder leidenschaftlich in sie oder gerieten mit ihr in wütende Streitgespräche, weil sie es gewagt hatten, einer Freundin in der Schlange vor einem Nachtclub gegenüber den Begriff »Tusse« oder »Schnalle« zu gebrauchen. Sara war unverblümt, aber oft auch still. Sie war bezaubernd schön, aber sie neigte dennoch dazu, sich in den Hintergrund zurückzuziehen.
Und während Saras Eltern noch hofften, dass sie ihrem Vorbild folgen und eine juristische Laufbahn einschlagen würde, war Sara mit der Leitung des White Rope zufriedener, als sie sich je hatte vorstellen können.
Aus den Lautsprechern klangen leise die Maccabees. Sara sang das Lied leise mit, während sie nach hinten ging, um in der kleinen Büronische, die noch zum Gastraum gehörte, den Papierkram durchzusehen.
Es war ruhig. Nur ein einziger Gast, ein älterer Herr, saß an einem Tisch im hinteren Teil des Restaurants, trank Kaffee und starrte ihr in den Nacken, erinnerte sich an die Jugend und eine Frau, die zu lieben er einst das Glück gehabt hatte. Er saß immer dort, wenn es im Restaurant ruhiger zuging, damit er in der Nähe eines anderen Menschen war.
Das White Rope fügte sich gut in die Hauptstraße ein. Es befand sich zwischen einem extravaganten Café und einer mondänen Bäckerei, in der es normalerweise von Scharen von jungen Frauen mit honigblonden Strähnchen und Kinderwagen wimmelte, aus deren Runde perlendes Gelächter aufstieg.
Im Winter leuchtete es warm und romantisch, und im Sommer verwandelte es sich in ein frisches, offenes Esslokal, das solch ein authentisches mediterranes Flair verbreitete, dass Passanten beim Vorbeigehen sich oft nostalgisch an ihren Frankreich- oder Italienurlaub erinnert fühlten. Das Restaurant war das ganze Jahr über perfekt. Sara fühlte sich dort wie zu Hause.
Was Sara mit Mauro verband, war ein gemeinsamer Wunsch: Auch sie hatte ein eigenes Restaurant betreiben wollen, seit sie fünf war. In ihrem Zimmer hatte sie es mit Puppenmöbeln aus Plastik und alten modrigen Lappen als Tischdecken aufgebaut. Und jetzt war sie hier.
Sie dachte wieder an die Aufgabe, die sie erwartete, und redete leise mit sich selbst, um die Managerin in sich zu wecken. Sie sang weiterhin vor sich hin, etwas lauter nun. Der ältere Herr – seinem Alter entsprechend verwittert – begann leise vor sich hin zu lachen.
»He, Missy! Ich versuche hier in Ruhe Kaffee zu trinken«, sagte er mit tiefer, rauer Stimme. Als er sie angrinste, sah Sara Lücken, wo einmal Zähne gewesen waren.
»Ach, tut mir leid, John!« Sara warf mit einem Lachen den Kopf in den Nacken und drehte sich mit dem Sessel um. Sie zeigte ihm ihr strahlendes, breites Lächeln, von dem Fremde oft ganz verdattert waren. »Manchmal vergesse ich einfach, wo ich bin«, sagte sie, drehte sich wieder um und sann weiter darüber nach, wen sie bitten konnte, ihre Schicht zu übernehmen.
John lachte leise vor sich hin, dann wandte er sich einem Fenster an der Front des Restaurants zu. Er blickte hinaus und betrachtete das übliche Gewimmel des Stadtzentrums. Ein Obdachloser bettelte vor dem Waitrose um Kleingeld; ein paar Kinder spielten laut rufend Fußball. Sara war immer ein »netter Mensch« gewesen – man hatte ihr schon nachgesagt, dass sie gewöhnlich die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stelle.
Der einzige Mensch, der diese Eigenschaft rundheraus positiv ansah, war Tom, ihr Ehemann, ein neunundzwanzigjähriger, wild kreativer Künstler, der behauptete, es seien Saras Ehrlichkeit und Verständnis für die Welt ringsum, die sie für ihn überhaupt erst so anziehend machten. Er war der einzige Mensch, der sie nie enttäuscht hatte. Sie hatten sich erst vor drei Jahren kennengelernt, aber Sara war in dem Moment, in dem sie ihn bei einer Party gemeinsamer Freunde zum ersten Mal erblickte, sofort klar gewesen, dass er der Eine für sie war.
Während sie über das Vertretungsproblem nachdachte, registrierte sie zufrieden, dass die Tische gedeckt wurden. Bald kamen die glamouröseren und oft auch anspruchsvolleren Abendgäste, und dann herrschte im Restaurant eine ganz andere Atmosphäre. Geschäftig eilten die Kellner hin und her, bis überall funkelndes Besteck und gestärkte weiße Servietten lagen. Es dauerte nicht lange, und es war sechs. Die ersten Pärchen kamen herein und hielten unter und über den Tischen Händchen. Die meisten von ihnen aßen auf die Schnelle eine Portion Linguine mit Meeresfrüchten oder Risotto Spezial, ehe sie weiterzogen, um sich irgendeinen leidenschaftlichen Möchtegernstar anzusehen, der altbekannte Songs zum Besten gab.
Innerhalb einer halben Stunde brannten die Kerzen, und es spielte leise Musik. Die Atmosphäre war wunderbar. Genau so wollte sie es.
Sara stand im hinteren Teil des Gastraums und nahm die Ruhe vor dem Sturm in sich auf, wurde aber von dem Gedanken an ihre kurvenreiche und bezaubernd schöne beste Freundin Tanya abgelenkt, die zu Hause auf dem Sofa saß, durch die Musikkanäle zappte und über die Frage nachgrübelte, ob es noch zu früh war, um einen Becher Ben & Jerrys’s zu öffnen oder nicht. Tanya litt in letzter Zeit an mehr als nur ein wenig gebrochenem Herzen, und Sara hatte versprochen, sie in die Welt des Internet-Datings einzuführen. Soweit es sie betraf, konnte man sich mittlerweile darauf einlassen. Man lief nicht mehr Gefahr, dass der gut aussehende »Jed«, mit dem man chattete, sich als neunzigjähriger Eremit aus Arkansas entpuppte, der sich die Zehennägel zum letzten Mal vor zwanzig Jahren geschnitten hatte, und zwar anlässlich des Todes seiner Frau. Sara wusste von mehreren, die den oder die »Richtige« über Dating-Websites gefunden hatten, und schätzte die Chancen als sehr gut ein.
Und Tanya musste unbedingt jemanden kennenlernen, dem sie normalerweise niemals über den Weg laufen würde. Sie musste den üblichen Typen, die auf ihre perfekte Sanduhrfigur und ihre atemberaubenden Augen flogen, aus dem Weg gehen – den Typen, die in einer Bar auf sie zustolzierten, während die netten Männer in ihr Bier starrten und sich still fragten, warum sie nicht den Mut zusammenbekommen hatten, Tanya als Erste anzusprechen.
Sara tauschte nicht gern die Schicht … sie bat andere nur sehr ungern, kurzfristig ihre Pflichten zu übernehmen. Sie ging in die Büronische zurück, wo das Telefon stand, und vergewisserte sich mit raschen Blicken, dass genügend Personal hinter der Theke stand und sich auf »Patrouille« befand. Sie war stolz auf das glückliche Team, das sie aufgebaut hatte. Sie nahm den Hörer und wählte.
Es klingelte viermal, dann nahm jemand ab. »Äh, ja, hallo?«, hörte sie Simons tiefe, erdige Stimme.
»Hi, Simon«, schnurrte Sara in den Hörer. Sie erhaschte einen Blick auf sich selbst im Computerbildschirm: Ihr Kurzhaarschnitt war schon wieder länger, als es ihr gefiel. Sie zupfte an ihrem Pony und schalt sich, weil sie es nicht geschafft hatte, ihn am Morgen zu stutzen.
»Oh, oh, äh, hi, Sara. Alles okay? Ich meine, wie geht es dir?«
»Ja, gut, danke. Hör mal, ich muss mich kurz fassen – könntest du heute Abend meine Schicht übernehmen? Ich kann für dich deine Schicht morgen übernehmen; und du weißt, was das heißt, oder?«, fragte sie mit dem gleichen »Wenn-Sie-zögern-ist-er-weg«-Ton in der Stimme, wie ihn ein hochtalentierter Autoverkäufer anschlägt. Sie bezweifelte, ob er lange genug zögerte, um sich die Krawatte zurechtzurücken.
»Das heißt, ich kann heute Nacht ins Pacha gehen und brauche morgen nicht zu arbeiten, oder?« Aus seiner Stimme war sein Lächeln herauszuhören.
»Ganz genau das … kannst du in einer halben Stunde hier sein?« Sie wusste, dass seine Wohnung nur zwei Minuten entfernt lag, eine merkwürdige, baufällig wirkende enge Behausung über einem Zeitungsladen, der noch Bleistiftaufsätze und lose Süßigkeiten für einen Penny verkaufte.
»Ja, geht klar. Gib mir fünfundzwanzig Minuten«, murmelte er und legte auf.
Sara legte mit einem erleichterten Seufzer auf und holte ihr Handy heraus. Rasch gab sie eine SMS ein, in der sie Tanya mitteilte, dass sie bald mit einer Flasche Pinot Noir vorbeikäme. Als das erledigt war, räumte Sara rasch das Büro auf, ehe sie ging. In dem trüben Licht, das der Computerbildschirm warf, blitzte ihr Ehering auf, als sie einen gefährlich hohen Papierstapel in eine Ablagebox räumte. Sein Anblick weckte in ihr noch immer ein Gefühl der Wärme. Jedes Mal, wenn sie den Ring ansah, konnte sie fast gar nicht glauben, dass es wirklich geschehen war.
Vor einem Jahr hatte sie Tom Wilson geheiratet und war Sara Wilson, geborene Peabody, geworden. Sie liebte Tom mehr als alles auf der Welt, aber zu den besonderen Vorteilen der Heirat hatte auch gehört, dass sie endlich ihren Mädchennamen ablegen konnte, diese Kombination aus den Wörtern für »Erbse« und »Körper«, für den man sie auf der Schule mehr als nur ein wenig aufgezogen hatte. Die meisten Schultyrannen mussten nach den üblichen Zielkriterien Ausschau halten: X-Beine, Rachitis, Essensreste in Zahnspangen, unvorteilhaftes Haar oder dicke Brillen, aber Sara war dank ihres Nachnamens für solche Plagegeister ein Geschenk auf dem Präsentierteller. Heute Abend ging Tom zu irgendeiner Vernissage, auf der endlos Tabletts mit Kanapees herumgetragen wurden und kleine »Skulpturen« aus Lebensmitteln wie Fischrogen und gebackenem Ziegenkäse sich in gefährlicher Höhe aneinanderstützten. Es klang toll, aber sie war schon auf so vielen davon gewesen, also überließ sie das ihm – in letzter Zeit musste er immer öfter allein gehen. Er hatte Verständnis dafür, und Sara verlangte von ihm wiederum nicht, dass er bei wichtigen Events im Restaurant teilnahm. In dieser Hinsicht führten sie ein relativ getrenntes Leben, und sie hielt es für gesund. Toms Karriere hatte in den letzten Monaten abgehoben, als die aufstrebende Mulai Gallery auf der Tottenham Court Road anbot, seine Arbeiten auszustellen. Für Tom war das ein großer Schritt nach vorn gewesen; ein Riesenschritt sogar.
Sara erkannte deutlich den Kontrast zwischen ihrem und Tanyas Liebesleben. Während Sara nach Hause zu ihrem gammeligen, aber umwerfenden Ehemann gehen konnte, ließ sich Tanya von einem schlimmen Finger nach dem anderen das Herz immer wieder aufs Neue brechen.
Schließlich trat Simon in schwarzem Hemd und grauer Hose vor sie. Sein blondes Haar lag, wie sie erwartet hatte: makellos.
»Hi, Saz«, sagte er, glitt an ihr vorbei und band sich eine burgunderrote Schürze um den Leib. »Wohin musst du?«, fragte er grinsend, schloss den Knoten hinter seinem Rücken und stemmte beide Hände zuversichtlich in die Hüften.
»Ich muss mich um eine Freundin kümmern. Männerprobleme.« Sie warf ihren Notizblock auf einen Papierstoß am hinteren Teil des Schreibtischs und band rasch ihre Schürze ab. Ihr konzentrierter Gesichtsausdruck krauste ihr ein wenig die gerade Nase.
»Ach du je, na, viel Glück dabei. Ich rufe dich an, falls der Laden abbrennt, okay? Oder möchtest du es dann lieber nicht wissen?«, rief er ihr nach, als sie zur Tür hinausging, grinsend und mit den Augen rollend.
Tanya wohnte in Finsbury Park nicht weit von der U-Bahn-Station. Sara eilte unterwegs in einen Getränkeladen und kaufte eine Flasche Wein, eine Riesentafel Schokolade und ein Päckchen Marlboro Gold, dann stieg sie in den Bus. Das gab wieder so einen Abend, das wusste sie jetzt schon. Wie Tanya sich anhörte, war sie untröstlich. Während der Bus sich auf der kurzen Fahrt Steigungen hinaufquälte und ungelenk um Ecken bog, dachte Sara nach. Weder Tanya noch sie tranken viel, aber heute Abend brauchten sie vielleicht doch ein, zwei Glas.
Nach fünfzehn Minuten hielt der Bus an der belebten U-Bahn-Station Finsbury Park, und Sara stieg aus, die Einkaufstüte an die Brust gepresst. Tanya wohnte nicht weit weg von einer Bar, die kurzzeitig in gewesen, danach aber trotzdem nicht den Weg alles Irdischen gegangen war – sie hatte ein paar schöne Abende darin verbracht und verschwitzt zur Musik von Indie-Bands getanzt.