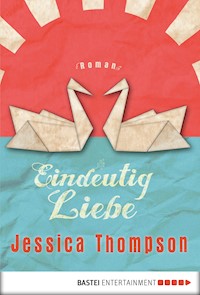4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn man verlernt hat zu lieben?
Ben Lawrence scheint alles zu haben, was man sich nur wünschen kann: Traumjob, Traumauto, Traumwohnung, Traumfrauen. Aber ein verhängnisvoller Tag in seiner Vergangenheit gefährdet seine Zukunft. Um für seinen Fehler zu bezahlen, hat er geschworen, auf Liebe zu verzichten. Er hat zwar zahlreiche Affären, lässt aber keine wirkliche Nähe zu. Als eines Tages Effy in die PR-Firma kommt, für die Ben arbeitet, ahnt keiner von beiden, dass ihre Leben sich von nun an grundlegend ändern werden ...
Weitere berührende Romane von Jessica Thompson:
Ein Tag im März
Eindeutig Liebe
Wenn du wieder bei mir bist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Über die Autorin
Jessica Thompson wurde in den späten Achtzigerjahren in Yorkshire geboren und lebte in Frankreich und Kent, bevor sie endlich nach London zog – in die Stadt, die sie so sehr liebt. Sie schreibt seit frühester Kindheit und arbeitet inzwischen als Journalistin. Lieben lernen ist nach Eindeutig Liebe und Ein Tag im März ihr dritter Roman.
Jessica Thompson
Liebenlernen
Roman
Aus dem Englischen vonAngela Koonen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Jessica Thompson
Titel der englischen Originalausgabe: »Paper Swans«
First published in Great Britain in 2014 by Coronet,
An Imprint of Hodder & Stoughton, An Hachette UK company.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dorothee Cabras, Grevenbroich
Titelillustration: Sandra Taufer, München, unter Verwendung von Motiven
von © shutterstock/Molesko Studio; shutterstock/Vasilyeva Larisa;
shutterstock/Woodhouse; shutterstock/Vilmos Varga; shutterstock/
Vyazovskaya Julia
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0685-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Andrew,den ich mehr liebe als die Internationale Raumstation
1
Hochstimmung oder Verzweiflung,es fühlte sich immer gleich an.
Donnerstag, 19. Juni 2014Canary Wharf, London
Ben Lawrence saß in seinem stillen Büro und hielt den Mauszeiger auf der Betreffzeile einer soeben eingegangenen E-Mail. Sie und die tausend anderen, über denen sie gelandet war, verwandelten sich zu einem Getöse kleiner imaginärer Stimmen, die alle verlangten, er solle Dinge erledigen, Termine einhalten, Zusagen erfüllen. In Wirklichkeit war nur zu hören, was von den anderen Arbeitsplätzen durch seine Tür drang, dringliches Telefonläuten und ab und zu das helle Gelächter der Kolleginnen. Ben las die Betreffzeile noch einmal: Öl-Kampagne.
Sein Magen flatterte, und an den Handflächen trat Schweiß aus und bildete ein feuchtes Netz menschlicher Angst.
Um sich zu beruhigen, griff er zu dem Plastikbecher auf seinem Schreibtisch und trank ein paar Schlucke Wasser. Es schmeckte metallisch, weil es aus dem Spender in der bescheidenen Personalküche stammte, der kaum benutzt wurde, da es in unmittelbarer Nachbarschaft angesagte Restaurants und Weinlokale gab.
Na komm, Ben! Alles wird gut, sagte er sich und atmete tief durch die Nase ein und aus. Das war sein Mantra, das waren die Worte, die er in seinem Beruf brauchte, wo so viel auf seine Schultern geladen wurde und so viel durch einen einfachen Fehler zunichtegemacht werden konnte.
Die E-Mail war von Dermot Frances, seinem Chef. Er war sechzig Jahre alt und ein lauter, Furcht einflößender PR-Veteran, der mehr Geld besaß, als er ausgeben konnte, selbst bei verschwenderischem Lebensstil. Er hatte eine schmächtige Statur und ein krummes, gebrechlich erscheinendes Rückgrat. Sein alternder Körper war darumdrapiert wie ein zerknautschter Trenchcoat, der darauf wartet, bei eBay verhökert zu werden. Doch bei alldem und trotz eines sich rasch zurückziehenden Haaransatzes, den er häufig mithilfe einer raffinierten Kämmtechnik und unter Designerhüten zu verbergen suchte, war er eine beeindruckende Persönlichkeit und beherrschte sofort jeden Raum. Wahrscheinlich war das der Grund seines Erfolgs. Ben hatte an vielen angespannten Vormittagen darüber nachgedacht, wenn sich der Vorstand aus dem großen Konferenzraum zurückgezogen hatte und die Herren sich den Kragen lockern und die Schweißperlen von der Stirn wischen konnten. Dermots Launen waren im ganzen Haus zu spüren. Auf Versagen reagierte er mit Härte, bei Erfolg ließ er den Champagner strömen. Seine Angestellten verließen sein Büro unter Tränen oder in Hochstimmung unterschiedlichen Grades, auf jeden Fall aber mit zitternden Knien. Während der kurzen Gelegenheitspausen auf dem Flur wurde oft über ihn geflüstert. Was führt zu Erfolg? Was macht einen Mann, dem man im Café oder an der Bushaltestelle keinen zweiten Blick gönnt, so mächtig?
Ossa PR war in der Branche gesichtswahrender Retusche wegweisend und führend und hatte seinen Sitz in einem zentralen Geschäftshaus, das liebevoll die Wolken küsste und stolz in der City-Sonne glänzte. Die ganze PR-Magie entfaltete sich auf zwei Etagen eines sich in die Höhe schraubenden Rundbaus aus Glas und Stahl, in dem die bedeutendsten Köpfe der Branche arbeiteten.
Viele hielten Ben für den besten unter den jungen Aufsteigern. Er hatte sich einen Namen gemacht und fuhr gerade die Erträge seiner Mühen ein. Führungskräfte anderer Firmen sprachen häufig über ihn, während sie in Nobelrestaurants eine Magnumflasche Champagner tranken. Er war Gesprächsthema, er hatte sich einen Ruf erarbeitet, er hatte eine Karriere und ein Leben, um das er beneidet wurde.
Von außen betrachtet, war alles perfekt. Mit seinem Gehalt konnte er sich teure Designerkleidung und eine große Eigentumswohnung in Dalston leisten, die er mit unverständlichen Kunstwerken und einer vollautomatischen Kaffeemaschine ausgestattet hatte. Ja, äußerlich war Bens Leben ideal, und manche Leute nahmen ihm das übel. Er sah auffallend gut aus, war ein junger, ungebundener Großstädter. Die Frauen begehrten ihn und leckten sich unwillkürlich über die Unterlippe, wenn sie überlegten, wie es wohl wäre, ihn zu küssen. Die Männer verachteten ihn oder krochen ihm in den Hintern.
Aber heute war ein schwerer Tag. Heute machten sich die wirklichen Belastungen in seinem Leben bemerkbar, Probleme, die man ihm nicht ansah und die die Leute sich bei ihm nicht einmal vorstellen konnten.
Dermots Büro lag am Ende einer Etage, auf der man sich dank der kürzlich eingebauten hohen, grellbunten Trennwände vorkam wie in einem Kaninchenbau. Zwischen ihnen hatten selbst die dienstältesten Mitarbeiter anfangs die Orientierung verloren und gereizt feststellen müssen, dass sie sich im eigenen Revier verlaufen hatten.
»Die Kampagne, Scheiße, die Kampagne!«, murmelte Ben mit Herzklopfen unter seinem frischen blauen Hemd. Er nahm die Unterlippe zwischen die Zähne und fuhr sich durch die dunkelbraunen Haare. Er musste dringend zum Friseur, denn seine Stirntolle drohte ihm allmählich ins Gesicht zu fallen. Als seine Haare wieder lagen, wie sie sollten, atmete er noch einmal tief durch.
Diese Kampagne war bisher seine größte gewesen. Mit nur achtundzwanzig Jahren hatte er einen unerwarteten Erfolg erzielt, und nun wurden die Aufgaben, die man ihm stellte, ständig bedeutender – und bei dieser war selbst er nervös geworden.
Sie überhaupt anzunehmen war eine schwierige Entscheidung gewesen. Eine angeschlagene Ölfirma, die eine der bisher haarsträubendsten Umweltkatastrophen des einundzwanzigsten Jahrhunderts verschuldet hatte, war an seinen Arbeitgeber herangetreten, um sich den Ruf retten zu lassen: mit einem kurzfristigen Konzept, bei dem die ganze Angelegenheit auf den Kopf gestellt und der Karren aus dem Dreck gezogen werden sollte, um der Firma wieder große Gewinne zu ermöglichen.
Für Ossa PR war das ein immenser, millionenschwerer Auftrag. Er war unerwartet als vorläufige Anfrage hereingekommen, und nur Minuten später hatte eine Sitzung stattgefunden, bei der sich die Führungskräfte über dessen Größe die Köpfe heißgeredet hatten. Die Wahl fiel auf Ben, der als außerordentlich kreativ galt. Er sollte Ropek Oil aus dem dunklen Tunnel herausführen und der Firma in nur zwölf Monaten wieder zu einem guten Ansehen verhelfen.
Seine Mutter war darüber gar nicht erfreut gewesen. An dem Wochenende, nachdem er das Mandat angenommen hatte, besuchte sie ihn zum Lunch in seiner Wohnung und rügte ihn für seine Entscheidung. Er zuckte zusammen, als sie einen Kaiserhummer auseinanderriss, als wäre es ihr Sohn, der wehrlos auf dem dünnen Bett aus Salatblättern und Knoblauchöl lag und auf sein grausiges Ende wartete. Sie hielt die Übernahme des Projekts für unmoralisch und sagte Ben das klar und deutlich. In ihren Augen war die Ölfirma so inkompetent gewesen, dass sie keine zweite Chance verdiente. Sein Vater Michael hielt sich an dem Tag auf dem Golfplatz auf, aber Ben wurde versichert, er sei über die Entscheidung auch »stocksauer«. Obwohl er sich vermutlich erst am achtzehnten Loch die Zeit nehmen würde, überhaupt darüber nachzudenken.
Claire Lawrence war stolz auf Ben, weil er so viel erreicht hatte, aber sie wollte, dass er glücklich wurde. Sein materieller Erfolg war zwar spektakulär, sie träumte jedoch von dem Tag, an dem er heiraten und mit seiner Familie aufs Land ziehen, also endlich zu echter Zufriedenheit finden würde. So sah sie es jedenfalls. Sie verstand sein Leben nicht. Es hatte nichts, mit dem sie sich identifizieren konnte, zumal sie selbst während ihrer berufstätigen Zeit eine Kunstgalerie im Ashdown Forest geführt hatte, im Zentrum einer eng verbundenen Gemeinde. Ihr war unbegreiflich, wie ihn ständiges Trinken und Feiern glücklich machen sollten oder wie er den ausdruckslosen Augen der teuren modernen Porträts, die er bei Sotheby’s ersteigerte, echte Freude abgewinnen konnte.
»Du musst anfangen, an deine Zukunft zu denken, Ben. Du weißt, was ich meine, nicht wahr?«, hatte sie an einem Samstagnachmittag vor ein, zwei Jahren gesagt. Dabei war es ihr sichtlich peinlich gewesen, ihn darauf anzusprechen. Bens Antwort war ein Seufzer. »Es tut mir leid, mein Lieber, ich fürchte nur, eines Tages wird dir das alles«, sie deutete auf seine Wohnung, »nicht mehr genug sein.« Er brauchte Liebe – das war jedenfalls ihre Meinung. Laut dachte sie darüber nach, ob ihm das Großstadtleben, wo alles verfügbar war, vielleicht doch nicht mehr entsprach. Sie fragte sich besorgt, was die Zukunft wohl bereithielt. Es bereitete ihr Sorgen, wie viel er trank, wie gestresst er war, wie viel er rauchte, wie oft er die Frauen wechselte, als bedeuteten ihre Gefühle nichts. Sie war, nun ja, eben besorgt um ihn.
Ben neigte den Kopf zur Seite und runzelte verwirrt die Stirn, während sie einem weiteren Kaiserhummer wütend den Kopf abriss. »Aber so ist PR-Arbeit nun mal, Mum. Ich kann nicht wählerisch sein … Die Firma hat ihr Verschulden an der ganzen Sache akzeptiert und ist zu einer immensen Geldstrafe verurteilt worden. Sie hat für ihre Fehler bezahlt und muss jetzt nach vorn blicken. Das ist nicht meine Angelegenheit … ich muss nur meine Arbeit tun«, hielt er ihr freundlich lächelnd entgegen und lockerte einen Halloumi-Salat mit zwei großen Holzlöffeln auf. Wenn er lächelte, hob sich der linke Mundwinkel immer schneller als der rechte, sodass es ein bisschen frech aussah. Ihm war das bewusst, weil er manchmal zärtlich darauf hingewiesen wurde.
»Du kannst sehr wohl wählen, Ben. Bei dem Feuer sind Hunderte Menschen umgekommen und noch viel mehr verletzt worden. Du wirst Teil der Maschinerie sein, die das einfach wegwischt und den Schuldigen die Chance eröffnet, wieder große Gewinne zu machen. Durch diesen Auftrag trägst du dazu bei und wirst hinterher damit leben müssen.«
Ben konnte wirklich nicht verstehen, wie sie zu dieser Ansicht kam. Sie verstand das einfach nicht. Er beendete das Thema, indem er die Teller zur Spüle trug und von seiner letzten Verabredung mit einer Frau erzählte. Er bauschte die Geschichte auf, weil seine Mutter gespannt darauf wartete, dass er endlich jemanden kennenlernte. Er wusste, damit würde sie sich ablenken lassen. In Wirklichkeit hatte er auf die Frau mit dem glitzernden Augen-Make-up gar keinen Bock gehabt. Es war damals zwei Tage her gewesen. In einer Bar in East London hatte sie ihm gegenübergesessen und sich ständig eine ihrer Locken um den Finger gedreht und beim Lachen den Kopf zurückgeworfen. Sie waren jeder Art romantischer Spannung ausgewichen, indem sie in betrunkener Hast in seine Wohnung gestolpert waren und ihre Kleidungsstücke verstreut hatten. Seitdem hatte er von der Frau nichts mehr gehört, und das war ihm gerade recht.
Inzwischen war der umstrittene Auftrag erledigt, und sein Chef würde ihm gleich mitteilen, ob der Auftraggeber zufrieden war. Das wäre die Krönung monatelanger harter Arbeit und Strategieplanung, der Lohn langer Nächte, in denen er am Ende mit einem Espresso in der Hand über der Tastatur eingeschlafen war.
Ben, kommen Sie bitte in mein Büro!
Mehr stand da nicht. Kurz und fordernd. Typisch Dermot.
Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Ben starrte ein paar Augenblicke lang auf die Zeile, die im grellen Weiß des Bildschirms fast unterging. Er blinzelte heftig, aber die Worte hatten sich ihm schon eingeprägt.
Kurz sah er sich seine persönlichen Sachen – ein Anti-Stress-Spielzeug mit den Konturen eines Telefons, eine Frank-Ocean-CD und ein kleines Radio mit abgebrochenem Griff – in einen Karton packen und mit gesenktem Kopf das Gebäude verlassen.
Er stand auf und drehte sich rastlos auf der Stelle, als könnte er sich damit für das Kommende wappnen. Er lächelte breit und lachte leise in sich hinein, wie häufig, wenn er sich ein bisschen durchgedreht fühlte – es hatte durchaus einen Anflug von Wahnsinn. Ben verschränkte die Hände am Hinterkopf und nahm bei einem kurzen Schwenkblick das Büro in sich auf, das im fünfundvierzigsten Stock des Tower 100 lag.
Vom Fenster hinter seinem Schreibtisch hatte man einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Wenn er sich an die Scheibe stellte, das Gesicht dagegendrückte und mit ausgebreiteten Armen zur Gherkin schaute, war ihm, als würde er gleich über die Kante kippen. Schon oft hatte er so dagestanden, in Hochstimmung oder Verzweiflung, es fühlte sich immer gleich an.
Je mehr er anhäufte, desto mehr fürchtete er, alles zu verlieren; diese Erfahrung hatte er inzwischen gemacht. Die Sorge wurde nicht kleiner, nur weil die Zahl auf seinem Konto mehr Nullen bekam.
Er hörte seinen Puls in den Ohren pochen und lächelte. Bei diesem Gefühl blühte er auf. Was gleich passieren würde, war für seine Zukunft entscheidend. Wenn er versagt hatte, würde es im Job für ihn hart werden. Wenn ihm die Kampagne geglückt war, würde man ihm mehr und vor allem größere Projekte anvertrauen. Und er würde weiter aufsteigen.
Ben sammelte sich, nahm sein Jackett vom Haken an der Wand, warf es sich über die Schulter und ging hinaus auf den Flur. Dabei gab er sich restlos gelassen.
Das konnte er gut: so tun als ob.
Das musste er können.
»Ben! Hi, Kollege, gehen wir nachher zum Lunch?«, fragte David, zeigte mit beiden Händen auf Ben und wackelte dabei mit Hüften und Oberkörper. Sein freches Grinsen und die Bewegung deuteten an, dass es kein schnelles Sandwich und ein O-Saft im Pub nebenan sein sollte.
»Nicht jetzt, Kumpel«, sagte Ben und stürmte an ihm vorbei, den Blick stur geradeaus gerichtet.
Die Leute machten ihm Platz. Was sie sagten, war für ihn nur Geräusch. David erwiderte etwas, aber Ben verstand ihn nicht, weil das Blut in seinen Ohren rauschte.
Er kam an der Tür seines Chefs an, an der in geraden, goldenen Buchstaben dessen Name stand: Dermot Frances.
Ben klopfte an, und im selben Moment wurde die Tür von innen aufgerissen, sodass die zweite Klopfbewegung ins Leere ging und seine erhobene Hand zwischen ihm und Dermot schwebte.
Wie gewöhnlich gab Frances ihm das Gefühl, klein zu sein, noch bevor die Besprechung begonnen hatte.
Ben nahm hastig die Hand herunter und lächelte.
»Ah, Mr. Lawrence, genau der Mann, den ich sprechen wollte. Nun kommen Sie schon herein!« Sein Ton verriet nicht das Geringste. Auch sein Gesichtsausdruck gab nichts preis. Darin war er richtig gut. Man sah ihm nie an, was er dachte.
Aber schließlich war er ein PR-Veteran.
»Nehmen Sie Platz!«, befahl Dermot, während er hinter seinen Schreibtisch ging, ein altmodisches, schweres Holzmöbel mit grüner Lederauflage, die mit Messingnägeln befestigt war. Man fühlte sich stark an Mad Men erinnert. Eigentlich in der ganzen Agentur, wenn man darüber nachdachte. Es gab kaum Frauen in leitenden Positionen. Obwohl Ossa PR ein innovatives Unternehmen war, hinkte es in Bezug auf seine Wertvorstellungen hinterher. Ben war überzeugt, dass Dermot Frances der Grund dafür war.
Als Ben seinem furchterregenden Chef gegenübersaß, fiel ihm wieder einmal auf, wie klein er verglichen mit seiner Persönlichkeit war. Telefongespräche mit ihm beschworen Bilder von einem großen Kerl herauf, den die Aura stählerner Kräfte umgab. In Wirklichkeit war er ein sehniger Bursche mit einigen letzten grauen Haarsträhnen, die aussahen, als könnten sie beim nächsten Windstoß davonfliegen. Seine Statur hinderte ihn jedoch nicht daran, Autorität auszustrahlen, und die hatte er maximiert.
Ben lehnte sich in den ebenfalls lederbezogenen Stuhl und scharrte mit den Füßen, um seine nervöse Energie unauffällig loszuwerden.
»Also, Benjamin, wie Sie sich denken können, habe ich heute die Abschlussbewertung von Ropek Oil bekommen.«
Er legte eine bedeutungsschwangere Pause ein. Hinter ihm flog ein großer Vogel gegen die Fensterscheibe. Der Aufprall war nicht zu hören, weil das Glas so dick war, aber Ben sah den Schock in dem Schnabelgesicht. Er zuckte ein wenig zusammen und beobachtete entsetzt, wie sich das Tier verschämt von der Scheibe löste und benommen einem fast sicheren, schmerzhaften Ende entgegenstürzte. Er blinzelte.
»Sie sind mit den Gedanken woanders, nicht wahr?«, sagte Dermot verärgert und drehte den Kopf, um zu sehen, was Bens Blick gefesselt hatte.
Natürlich war da nur noch ein kleiner Schmierfleck an der Scheibe.
»Nein, nein … Verzeihung. Bitte fahren Sie fort«, murmelte Ben.
»Das werde ich«, sagte sein Chef knapp. »Also … das Schreiben von Ropek Oil. Die abschließende Bewertung … ist der Grund unseres Gesprächs … darum geht es hier.« Seine tiefe Stimme fiel noch um eine Oktave und gab zu verstehen, dass es sich um ein sehr ernstes Thema handelte. Er zog jedes Wort wie Kaugummi und ließ lange Pausen zwischen den Satzteilen, etwa wie Erwachsene, die durch dichten Verkehr fahren und dabei mit ihren Kindern sprechen.
Na los, na los … hör auf, es hinauszuzögern!, dachte Ben hinter der Maske des Selbstvertrauens. Er nahm sich vor, die Kosten des Nervenzusammenbruchs, den er in fünf Jahren dank seiner schwindelerregend hohen Position in der Agentur unweigerlich bekommen würde, seinem Chef in Rechnung zu stellen.
Stille.
Dermot lehnte sich zurück, so undurchschaubar wie die Stirn des Pokerspielers hinter seinem ordentlich aufgefächerten Blatt. Nicht mal ein verräterisches Funkeln lag in seinen Augen. Ben fragte sich, ob er einen Roboter vor sich hatte, mit einem Herzen aus Blech und Batteriesäure in den Adern.
Es klopfte an der Tür, was das gegenseitige Starren unterbrach.
Zuerst der blöde Vogel, jetzt das …
»Kommen Sie nicht herein!«, rief Dermot aufgebracht und betonte das »nicht« mit donnernder Lautstärke. Doch der arme Tropf jenseits der Tür musste an selektivem Hören leiden, denn die Tür öffnete sich langsam und quietschend.
Es war Gavin von der IT. Der einzige Mitarbeiter, der so dumm war, Dermot tagtäglich mit »Chef« anzureden.
»Hallo, Chef, ich komme nur kurz wegen der Netzwerk-Sache.« Er zupfte sich nervös am Ohrläppchen.
»Ich sagte: Sie sollen nicht hereinkommen, Gavin! Das macht einen enormen Bedeutungsunterschied aus, nicht wahr?«, erwiderte Dermot ruhig und faltete in gespielter Geduld die Hände über dem Bauch.
»Oh, Entschuldigung. Stimmt! Ich … äh … tja, ich verschwinde dann mal wieder«, stotterte Gavin und zog sich erschrocken zurück wie eine Schnecke in ihr Haus.
»Blöder Idiot.« Dermot wandte sich Ben wieder zu, dem jetzt entschieden mulmig war.
Frances schien heute geradezu beißwütig zu sein, als hätte ihn jemand mit einem langen Stock bis aufs Blut gereizt.
Kein gutes Zeichen.
»Wir sind nicht sehr gesprächig heute, oder, Benjamin?«, fragte er und trommelte dabei mit den dürren Fingern auf der Schreibtischplatte. Sie erinnerten an die Beine einer bösen kleinen Spinne.
»Man sollte weniger reden und mehr sagen«, entgegnete Ben. Er war überrascht, dass er äußerlich so ruhig blieb. Doch er war nun mal ein redegewandter Typ, der sich nichts anmerken ließ.
»Sehr weise.« Sein Chef blickte ihn ein wenig prüfend an. »Nun, wie gesagt, die Abschlussbewertung von Ropek Oil ist da, und wir müssen darüber sprechen«, wiederholte Dermot und griff unter den Schreibtisch.
Ben schluckte. Die Zeit gerann zu einer klebrigen Masse. Gespannt wartete er ab, was unter dem Schreibtisch zum Vorschein kommen würde, und sah für den Bruchteil einer Sekunde einen Revolver vor sich, genauer gesagt, seinen eigenen P45 …
2
Das verdanken wir nur Ihnenund Ihrem Grips.
Es dauerte noch ein paar Sekunden, bis Dermot beschloss, Ben aus seinem Elend zu erlösen. »Nun, Sie haben natürlich einen Riesenerfolg gelandet, nicht wahr?«, rief er aus, als wäre gar nichts anderes zu erwarten gewesen. Dabei entspannte sich seine Miene, und er zog eine Magnumflasche Moët & Chandon unter dem Schreibtisch hervor.
Einen Moment lang kochte in Ben der Ärger hoch, weil Dermot ihn so lange auf die Folter gespannt hatte. Typisch, dachte er, als eine Woge der Erleichterung durch seinen Körper strömte und bis in die Fingerspitzen kribbelte. Im selben Augenblick erkannte er, dass sein Chef ein Schauspieler und das Unternehmen seine Bühne war. Er genoss jede Minute, das Drama, den Schweiß, die Tränen. Er spielte den Leuten etwas vor, meistens nur mit Mimik und Körperhaltung, und das machte er ganz hervorragend.
»Ihre Kampagne hat Ropek Oil eine Kehrtwende beschert, und der Vorstand ist natürlich sehr, sehr glücklich. Wir haben mehr Geld verdient, als anfangs erwartet, und das verdanken wir nur Ihnen und Ihrem Grips.« Dermot stellte die Flasche behutsam auf den Schreibtisch.
»Vielen Dank«, sagte Ben und grinste selbstsicher. Er gab sich den Anschein, als hätte er von Anfang an mit nichts anderem gerechnet.
»Und hier ist ein zusätzlicher Bonus für Sie … Auch Ihre Mitarbeiter sollen einen bekommen.« Dermot schob ihm einen dicken weißen Umschlag zu. Vermutlich mit John-Lewis-Gutscheinen, wie üblich.
»Oh, Donnerwetter. Vielen Dank, das ist … das ist großartig. Ich bin froh, hier …«
»Lassen Sie die Stotterei, Ben! Ich schicke Ihnen das Schreiben von Ropek Oil, damit Sie es selbst lesen, und dann möchte ich, dass Sie sich mit den Jungs zum Lunch verziehen und Ihren Erfolg feiern.« Dermot lächelte zwar noch, war aber sichtlich erpicht, ihn loszuwerden und den nächsten Bauern in seiner großen Schachpartie zu bewegen.
»Jetzt gehen Sie bitte, und kommen Sie nicht vor morgen wieder! Ich will nicht, dass der ganze Haufen nach Schnaps und Zigarettenrauch stinkt und so tut, als arbeitete er, nein danke«, sagte Dermot zwinkernd.
»Richtig, äh, in Ordnung … Vielen Dank. Bis morgen dann.« Ben nahm die Flasche und verließ das Büro.
Draußen lehnte er sich für ein, zwei Augenblicke in den Durchgang zu Dermots Folterhöhle. Sein Herz schlug allmählich langsamer und entspannte sich in dem nutzlos aufgeschwemmten Adrenalin. Kurz fragte sich Ben, wo all die nervöse Energie hinging – vielleicht könnte er sie ins nationale Netz einspeisen …
Schon wieder erschien David wie aus dem Nichts. Sein kleiner Wanst ließ sich vom Jackett nicht kaschieren und hing über die schwarze Hose. »Ben! Sagenhaft! Der Auftrag war ein Erfolg, wie ich sehe?« Er beäugte die Schampusflasche, dann zog er Ben in eine Männerumarmung und klopfte ihm so hart auf den Rücken, dass Ben versucht war, demonstrativ zu husten.
»Ja, ja, danke. Ist der Lunch noch aktuell?« Es klang ein wenig gezwungen, doch er lächelte und freute sich aufs Feiern.
»Absolut«, sagte David und ging mit ihm den Flur entlang.
Ben kehrte in sein Büro zurück. Unterwegs musste er sich von mehreren Leuten abklatschen lassen. Der Flurfunk funktionierte wieder mal bestens.
Als er die Tür sacht hinter sich schloss und über das schöne London blickte, fühlte er sich wie ein König.
Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete den Umschlag. Das dicke Papier riss mit beträchtlichem Geräusch.
Vierzigtausend Pfund.
»Du meine Güte!«, flüsterte er.
*
Freitag, 20. Juni 2014,Dalston, London
»Bitte, geh noch nicht!«, sagte Marina.
Zur Antwort fasste Ben ihr fester um die Taille, eine halbherzige Beruhigungsgeste. Er spürte die weichen Härchen auf ihrer Haut. Die Morgensonne strömte durch die Schlitze der Jalousie und beschien Marinas Gesicht.
Beim Wachwerden hatte Ben sich eine Sekunde lang gewundert, was sie splitternackt bei ihm im Bett zu suchen hatte. Dann hatte sich der Kater bemerkbar gemacht. Jeder Laut schmerzte wie ein schräger Posaunenchor, ihm war übel, und er hatte einen widerlichen Geschmack im Mund.
Auch das Schuldgefühl beschlich ihn wieder.
Er war mit seinen Kollegen einen trinken gewesen, um den Erfolg zu feiern. Doch er konnte sich kaum an etwas erinnern. Worte und Bilder blieben unscharf wie hinter einer schmutzigen Fensterscheibe. Unausweichlich hatte der Abend mit einem mitternächtlichen Anruf und einer Verabredung zum Sex geendet, wie so oft. Es war eine Gewohnheit geworden, über die er gar nicht mehr nachdachte, so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Marina war um halb zwei vor seiner sanft beleuchteten Türschwelle erschienen. Halb sauer, halb ausgelassen und voller Lust auf sanfte Küsse, schwankte sie auf den Absätzen wie eine neugeborene Giraffe. Ihre Kurven steckten in einem schwarzen Neckholder-Kleid, und Ben durchflutete die vertraute animalische Begierde, als ihr Parfüm in seine Nase wehte. Sie drückte ihn sanft gegen die Tür, zog mit dem Finger seine Unterlippe nach, und Ben schmolz dahin. Er wusste, sie gehörte ganz ihm, jedenfalls für ein paar Stunden …
Jetzt wäre er gern aufgestanden, um das dumpfe Wummern hinter der Stirn mit einem Kaffee und ein paar Schmerztabletten wegzuwischen. Er strich mit dem Mund über ihren Nacken und stellte wieder einmal fest, wie unglaublich weich ihre Haut war. Kichernd drehte sie sich unter ihm herum, bis sie ihm ins Gesicht sehen konnte. Ihre Augen hatten ein klares Blau.
»Ich muss bald zur Arbeit«, sagte Ben.
»Ach, komm! Du stolzierst doch immer erst um halb elf in euren Laden«, flüsterte sie und strich ihm mit dem Zeigefinger über die Nase.
Er küsste die Fingerspitze, sowie sie seinen Mund erreichte. Dagegen ließ sich schwerlich etwas sagen. Sie hatte recht.
Ben musterte sie im Halbdunkel. Ihre braunen Haare lagen auf dem Kopfkissen, ein paar hellere Strähnen über ihrem Gesicht. Sie war genau die Richtige, im Moment. Bisher. Für die aufregenden Nächte und nackten Morgen, die sie zusammen verbrachten, bevor sie für ihn wieder eine Fremde wurde wie die Leute, die an ihm vorbeidrängten, um im Berufsverkehr die Victoria Line zu erwischen.
»Wohl wahr.« Er seufzte theatralisch. »Aber musst du nicht bald anfangen? Leuten das Leben retten und dergleichen?«, scherzte er zwischen zarten Küssen. Er war überzeugt, dass sie ins Bad gehuscht war und sich die Zähne geputzt hatte, als er noch geschlafen hatte. Sie schmeckte erstaunlich frisch, roch ein bisschen nach Pfefferminz.
Ben schaffte es trotz seiner langen Arbeitstage, viele Frauen kennenzulernen. Er arbeitete hart und sorgte kompromisslos für sein Vergnügen. Meistens passierte es, wenn er mit Freunden einen trinken ging. Nach einigen Gläsern Wein oder Hochprozentigerem, je nach Wochentag und Gelegenheit, fand er sich benebelt und bester Laune an der Theke wieder, und da entdeckte er sie dann, wie sie meistens schüchtern über ihr Cocktailglas hinweg zu ihm hinsahen. Ben brauchte sich nicht anzustrengen, um Frauen kennenzulernen. Dafür sorgte sein gutes Aussehen. Bei seinen Freunden löste das Ärger und Bewunderung aus.
Vor sechs Monaten war er Marina in einer Bar in Holborn über den Weg gelaufen, und seitdem hatten sie sich hin und wieder getroffen, um unverbindlich miteinander Spaß zu haben. Sie war ihm damals sofort aufgefallen, wie sie in einer Gruppe Freundinnen mit in die Höhe gereckten Armen tanzte und die Hüften schwang. Ihr Tanzstil brachte ihn zum Lächeln, und sie war sein Typ: schlank, aber kein Hungerhaken, und ziemlich schelmisch.
Sie kamen gut miteinander aus, doch für etwas Verbindliches war er nicht zu haben. Er war noch nicht bereit dazu oder nicht fähig, sich so weit auf eine Frau einzulassen. Nicht auf Marina und auch auf keine andere. Manche Menschen sind eben so, dachte er immer, und solange man hinsichtlich seiner Absichten ehrlich ist, ist das in Ordnung. Seiner Überzeugung nach war sein Wunsch nach Unabhängigkeit genauso berechtigt wie der Wunsch anderer nach Bindung. Es kam nur auf Ehrlichkeit an. Leider liefen die Dinge aber nicht immer so glatt, das hatte er schon festgestellt.
Neuerdings hatte sie einen etwas anderen Ausdruck in den Augen. Den kannte er gut. Hatte ihn wahrscheinlich schon zu oft gesehen. Trotz der stillschweigenden Übereinkunft, es könne nichts Ernstes daraus werden, änderten sich irgendwann die Gefühle, und der andere wollte mehr. Plötzlich gab es Erwartungen, und mit ihnen kamen die Enttäuschungen und am Ende Wut.
Erfahrungsgemäß endete es mit Tränen, und einer von beiden (in seinem Fall die Frau) zog sich hastig die Unterwäsche an, meistens verkehrt herum, und rauschte kurz darauf türenknallend aus der Wohnung. Wie es aussah, war Marina die Nächste, die ihn verließ, und er würde wieder zwischen zerwühlten Laken und mit einem seltsamen Verlustgefühl dasitzen, das maximal eine Woche anhielt, um sich dann in das Flickwerk seines sonderbaren, leicht problembehafteten Lebens einzufügen.
Ben konnte nicht lieben, wie diese jungen Frauen es gern hätten. In seinem Leben passierte zu viel. Sein Job war zu anspruchsvoll. Er hatte unmöglich lange Arbeitszeiten und konnte niemanden gebrauchen, der auch noch Bedürfnisse anmeldete, und es wäre unfair, eine Frau glauben zu lassen, dass er das je könnte. Außerdem war da noch diese andere Sache …
»Ben.« Marinas Ton wurde ernst. Sie zog die Brauen zusammen, auf diese Art, die bei ihr auf Ärger hindeutete.
Ben fühlte eine leise Angst im Magen. Jetzt war es klar: Sie hatte seine Absichten falsch gedeutet, obwohl er gesagt hatte, dass er etwas Unverbindliches wollte. Ich verstehe nicht, warum so viele Frauen das als Herausforderung ansehen, dachte er, während er die Regungen in ihrem Gesicht beobachtete.
Er hatte geglaubt, Marina sei anders. Sie war ihm immer äußerst unabhängig vorgekommen, sodass er angenommen hatte, ihre Beziehung wäre auch für sie genau das Richtige. Beim zweiten Treffen hatte sie ihm ihre Geschichte erzählt, in einem abgefahrenen Burger-Laden in Chelsea. Es hatte ihm gefallen, dass sie mehr Essen bestellte als er. Sie war cool, hatte aber offenbar einen mächtigen Groll auf jemanden, denn sie platzte mit ihrer Geschichte heraus, während sie nicht sehr anmutig Burger und Salat in sich hineinstopfte. Dabei unterstrich sie ihre Worte mit lebhaften Gesten und selbstbewusster Körpersprache. Er mochte ihren Schneid. Sie stammte aus Italien und war mit neunzehn Jahren nach England gegangen, weil sie sich nach dem x-ten Streit mit ihrem Freund zu etwas Drastischem gezwungen sah. Da sie der theatralische Typ war, fand sie es angemessen, spontan einen Flug nach London zu buchen. Dann war sie in England geblieben. Jetzt, mit sechsundzwanzig, war sie Oberschwester im London Bridge Hospital und arbeitete beinahe rund um die Uhr, und wenn sie wie durch ein Wunder ein paar Stunden Freizeit hatte, wollte sie die mit Ben verbringen.
»Ja?« Er gab sich zuhörbereit und küsste sie, weil er hoffte, das werde sie ablenken. Sie strich ihm durch die dichten Haare und holte tief Luft. Ihm lief ein Schauder den Rücken hinunter. Marina war betörend und hinreißend, doch das änderte nichts an seiner Haltung.
»Was ist los?«, fragte sie.
»Womit?«
»Mit uns.« Sie legte die Lippen an seine Nase. Ihre Körpersprache drückte Verehrung aus. Plötzlich bemerkte er, dass sie sich wie Efeu um ihn geschlungen hatte.
Ben tat verständnislos, was sich, wie ihm eine innere Stimme sagte, als Fehler erweisen könnte. »Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte er und betrachtete das winzige Muttermal unter ihrem linken Auge.
Er wusste genau, was sie meinte.
Marina holte tief Luft. »Hör zu, ich weiß zwar … das sollte nur zum Vergnügen sein, doch es geht jetzt schon eine ganze Weile. Allmählich finde ich … na ja, ich empfinde mehr für dich«, sagte sie. Kurz beschien die Sonne ihr Gesicht, als der Wind, der durch das offene Fenster ins Zimmer wehte, die Jalousie ins Schwanken brachte.
Da haben wir es wieder, dachte Ben und gab ihr einen sanften Kuss auf die Wange.
»Also ich bin wirklich gern mit dir zusammen«, begann er behutsam, »und wir haben offensichtlich viel Spaß miteinander … aber ich bin einfach nicht so weit …« Kälte überschwemmte seinen Magen. Es war unangenehm. Was jetzt kommen würde, war ihm ganz ehrlich zuwider. Doch wenn es um Liebe ging, blieb es in ihm tot, da war keine … Sie existierte nicht.
Im Stillen hatte er immer gehofft, seine Unfähigkeit zu lieben würde sich auflösen, wenn er mal die richtige Frau träfe. Und die habe ich unter denen, die einen Long Island Ice Tea nippen und alle paar Minuten zu mir herüberblicken, eben noch nicht entdeckt, sagte er sich.
Marina betrachtete Bens Brust und zog mit einem manikürten Fingernagel sein Schlüsselbein nach. Es kitzelte ein bisschen.
»Warum ist es so schwierig, dir nah zu sein, Benjy? Ich meine nicht diese, sondern wirkliche Nähe«, fragte sie dicht an seinen Lippen.
Er wusste, warum. Natürlich wusste er es.
»Es tut mir leid«, sagte er leise und küsste sie wieder. Er konnte keine Lösung anbieten.
Seufzend zog sie ihn näher zu sich, sofern das noch möglich war. Für Ben war klar, dass er jetzt zum letzten Mal so mit ihr zusammen sein würde, und er wollte das Beste daraus machen. Selbst wenn sie sich entschiede, das Verhältnis nach diesem Gespräch weiterlaufen zu lassen, für Ben war hier Schluss. Sie konnte sich offenbar vorstellen, ihn eines Tages ernsthaft zu lieben, vielleicht sogar schon bald, und er fand, sie verdiente einen Besseren als ihn, jemanden, der lieben konnte.
»Ich kann so nicht weitermachen, das verstehst du doch, oder?« Sie strich mit den Fingerspitzen seinen Rücken hinunter.
Er würde sie natürlich vermissen, doch es wäre unfair, die Beziehung fortzusetzen. Sie hatte sich bereits geschworen, gefasst zu bleiben. Das sah er ihr an. An ihren Blicken, an der Art, wie sich die Lachfältchen bildeten, an den Mundwinkeln, die leicht abwärtszeigten, obwohl sie sich wirklich zusammenriss.
Wie viele Enttäuschte, würde sie sich in der Toilettenkabine während der Arbeitszeit ausheulen und mit der Affäre abschließen. Vielleicht gab es eine mitfühlende Kollegin, die ihr den Rücken tätschelte und die richtigen Worte fand. Dann würde Marina die Tränen mit einem zerknüllten Papierhandtuch abtupfen und ihr Leben weiterführen. Und genau das sollte sie seiner Meinung nach tun, denn eine Frau wie sie verdiente nichts weniger, als auf Händen getragen zu werden. Ben versuchte, sich nicht schlecht vorzukommen, und dachte an ihre Geschichte zurück. Sie hatte in dieser verrückten Stadt im zarten Alter von neunzehn Fuß gefasst, da würde sie auch diesen Bruch überleben. Der war bloß eine kurze Irritation.
Ben Lawrence war bloß eine kurze Irritation.
»Natürlich, das verstehe ich voll und ganz. Ich werde traurig sein, wenn ich dich nicht mehr sehe, doch wenn es dich unglücklich macht …«
»Ich muss los«, sagte sie abrupt. Ben sah, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten, und kam sich vor wie das letzte Arschloch, wieder mal.
Obwohl er zu ihr immer ehrlich gewesen war.
Sie küsste ihn sanft auf die Wange. Zum letzten Mal.
Während sie sich anzog, saß Ben im Bett und strich an seinen Haaren herum, die kreuz und quer abstanden. Seine Kopfschmerzen nahmen ein völlig neues Ausmaß an. Er überlegte, was er tun sollte. Er durfte nichts versprechen, was er nicht halten konnte …
»Bye, Ben, pass auf dich auf!«, sagte Marina mit einem gezwungenen Lächeln.
In Wirklichkeit hoffte sie wahrscheinlich, er würde von einem Bus gerammt.
Er stand auf, um sie zur Tür zu bringen, doch sie drückte ihn sanft aufs Bett zurück. »Nein. Bitte«, flüsterte sie, und ihre Augen schwammen in Tränen.
3
Er konnte sich auf Filme nicht mehrkonzentrieren.
Samstag, 21. Juni 2014Crouch End, North London
»Also, ich finde Sie einfach sensationell!«, meinte die junge Frau leise seufzend und schob sich die dicke, runde Brille ein Stückchen die Stupsnase hinauf.
Es herrschte verlegenes Schweigen, während Effy Jones sich anstarren ließ. Die Bewunderung färbte vermutlich alles rosarot. Es war ein typischer Samstagmorgen im Londoner Norden. Sie hatten sich im Vintage Tea Rooms in Crouch End verabredet. Das Gespräch würde vor einer Kulisse aus zart gemusterten Teetassen, gestrickten Tieren mit unterschiedlich langen, verschiedenfarbigen Beinen und zahllosen skurrilen Gemälden stattfinden.
»Nun ja, meine Güte, danke.« Effy rückte sich peinlich berührt auf ihrem Stuhl zurecht und trank einen Schluck Kaffee, nur um die Gesprächslücke zu überbrücken.
Sie hatte Komplimente noch nie gut annehmen können. Außerdem fand sie es sehr schwierig, solchen abgegriffenen Attributen gerecht zu werden, den vielen »sensationell« und »inspirierend« und dem anschließenden »Ich habe meiner Oma alles über Sie erzählt«. Das machte sie nervös. Sie fühlte sich eigentlich ziemlich durcheinander.
Diese einundzwanzig Jahre alte, tätowierte Hochschulabsolventin namens Lily starrte weiterhin in ihr sommersprossiges Gesicht, betrachtete die langen dichten Wimpern und die rotbraunen Locken, die ihr über die Schultern fielen.
Die Kleine himmelte sie geradezu an.
»Dann erzählen Sie mir mal ein bisschen über sich!«, sagte Effy nach einem Räuspern. Sie kramte ein paar Unterlagen hervor und schaltete ihren launischen Laptop ein. Sie war noch benommen und müde, da sie den ganzen vergangenen Tag, von fünf Uhr früh bis halb drei in der Nacht, vor dem Computer verbracht hatte. Außerdem konnte man bei dem Stimmengewirr in dem Café plötzlich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen, seit eine Schar Mütter mit Kleinkindern hereingekommen war, um sich über die vergangene Woche auszutauschen. Die Müdigkeit gaukelte ihr vor, sie wären alle gleichzeitig hereingequollen, und sie wunderte sich, wie dieses Gewirr aus Kinderwagen, Gliedmaßen und teuren Klamotten unbeschädigt durch die Tür gelangt war. Schon nach Augenblicken begannen die Kinder, durch das Café zu flitzen, rissen Tassen um, weinten und beschmierten sich mit Rotz. Die Mütter schienen das alles nicht zu bemerken, sondern unterhielten sich über Karatekurse, den anstehenden vierten Geburtstag, Geschäftsreisen und Spanx. Sie trugen ihren Teil zur lebhaften Atmosphäre bei. In dem Café saß man trotzdem nett. Es war ein beliebter Treffpunkt, der schon Preise bekommen hatte. Gut aussehende Bedienungen sorgten dafür, dass sich jeder Gast den Bauch mit köstlichem Kaffee und saftigem, schwerem Kuchen vollschlug. Rings um die Fenster brannten das ganze Jahr über Lichterketten. Effy kam oft zum Arbeiten hierher, wenn ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fiel.
Sie versuchte, sich wieder auf ihr jugendlich frisches Gegenüber zu konzentrieren. Lily war eine Hübsche, auf die ungekünstelte Art. Sie hatte einen üppigen, widerspenstigen Bob drahtiger schwarzer Haare und strahlend blaue Augen, die sicher manchen in ihren Bann schlagen konnten. Ihr Tattoo schlängelte sich unter dem Strickjackenärmel hervor, dicke schwarze Linien und graue Schattierungen. Soweit Effy sehen konnte, ergaben sie ein englisches Landschaftsmotiv mit Mohnblumen, Rosen und Hummeln.
Wie schön, dachte Effy und wünschte sich plötzlich, sie wäre in ihrer Jugend ein bisschen mutiger gewesen. Sie erinnerte sich an das eine Mal, wo sie sich hatte tätowieren lassen wollen. Der Tätowierer hatte die Nadel schon in der Hand gehabt und verblüfft zusehen müssen, wie sie plötzlich aufsprang und hinausrannte. Ihr selbst war das so peinlich gewesen, dass sie nicht mehr zurückgegangen war, um ihre vergessene Strickjacke zu holen.
»Tja, also, ich habe Internationale Entwicklung studiert und gerade mit Eins bestanden. Das Fach hat mir Spaß gemacht, und ich habe wirklich hart dafür gearbeitet, wissen Sie? Es hat sich gelohnt. Ich kann kaum glauben, dass ich eine Eins bekommen habe. Das war ein richtiger Schock. Ich hatte einen Freund, aber er hat mich nur abgelenkt, darum habe ich ihn abserviert, ha. Oh Gott, das klingt gemein! Tut mir leid. Na, jedenfalls … tja, ich möchte für Ihre Organisation arbeiten. Ich habe schon so viel darüber gehört … es ist, na ja, einfach toll, oder? Ich finde es unglaublich, dass Dafina Kampala den Kindern in Uganda helfen will – und noch dazu mit einem ganzheitlichen Ansatz –, also auch ihre Familien unterstützt. Wie alt sind Sie, Effy? Sie sehen zu jung aus, um all das schon auf die Beine gestellt zu haben. Entschuldigung, war eine blöde Frage. Ich werde für Ihre Organisation sehr wertvoll sein. Ich werde wirklich hart arbeiten, nie zu spät kommen, und ich bin sehr flexibel … ich … Entschuldigung, sind wir schon im Vorstellungsgespräch?«
Lily redete atemberaubend schnell und hatte wohl gerade gemerkt, wie hysterisch sie rüberkam. Mit einem Schreck wurde ihr bewusst, dass dieser Auftritt schon ihr selbst nicht gefiel.
Effy hatte sich sehr konzentrieren müssen, um alles mitzubekommen. Der geballte Ehrgeiz, die Wünsche und Hoffnungen der Jugend saßen ihr gegenüber, eingehüllt in Grobstrick, mit witziger Brille und kunstvollen Tätowierungen. Die Welt erschien grenzenlos. Es gab keine Ecken und Kanten und keine Hindernisse. Man konnte alles erreichen. Das war reizend, wenn auch ein bisschen ungestüm …
Mit einundzwanzig war Effy auch so gewesen. Da war sie frisch von der Uni gekommen und hatte die Modewelt im Sturm erobern wollen. Sie hätte sich nie träumen lassen, mal eine Hilfsorganisation zu gründen. Sie fragte sich oft, ob das Leben vorherbestimmt war und ob es für jeden einen Weg gab und man im Grunde wenig Einfluss darauf hatte, wo genau der verlief.
So lebhaft und unverbogen diese junge Frau war, so froh war Effy, sie kennenzulernen. Denn die Begegnung ermahnte sie, nicht abzustumpfen, sondern das Wesentliche, die Möglichkeiten im Auge zu behalten … Man wurde sehr leicht müde, kraftlos und pessimistisch. Doch wenn man dieser Energie mit Disziplin begegnete und sie in die richtigen Bahnen lenkte, konnte sie sehr nützlich sein.
»Ich werde demnächst achtundzwanzig, Lily, also bin ich nicht so jung, wie Sie vielleicht denken«, flüsterte Effy und fing an zu kichern.
»Hey! Nicht traurig sein. Das ist doch kein Alter, also, echt nicht«, widersprach Lily und zerrte einen widerspenstigen Schnellhefter aus ihrer Ledertasche.
»Ich bin nicht traurig … es ist okay«, sagte Effy, die sich im Stillen amüsierte, und nahm den Stoß eselsohriger DIN-A4-Blätter entgegen, der ihr zugeschoben wurde.
Sie überflog den Lebenslauf. Die äußere Gestaltung wirkte noch ungeübt, doch Lily hatte schon viel Erfahrung gesammelt. Effy war beeindruckt. Fundraising, Planung, Social-Media-Konzepte, Budgetierung, Ressourcenmanagement und viele Praktika bei lokalen und internationalen Wohltätigkeitsvereinen. Das war ein guter Start.
»Das gefällt mir, Lily. Wie viele Tage können Sie helfen? Sie wissen, ich kann Sie nicht bezahlen. Die Organisation ist gerade erst gegründet worden, und ich habe noch keine Mittel beschafft«, sagte Effy. Sie hoffte, eines Tages bezahlte Kräfte beschäftigen zu können. Sie wünschte sich ein eigenes Büro mit fünf oder sechs Mitarbeitern und schönen neuen, von einem Lokalunternehmer gespendeten Computern, wo Motivationsplakate an den Wänden hingen … Doch sie war noch am Anfang. Ein Samenkorn war ausgelegt, aus dem hoffentlich bald ein starker Baum wachsen würde.
»Ich weiß, Effy, das geht in Ordnung. Ich will nur für Dafina Kampala arbeiten. Ich möchte kranken Kindern helfen, ein besseres Leben zu führen. Ich kann drei Tage in der Woche. Ist das okay?«
Effy riss die Augen auf. Das kann wirklich etwas bringen, dachte sie. Sie zupfte den Rock ihres grünen Wickelkleids zurecht. »Das ist fantastisch, Lily! Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen zu arbeiten.«
»Ja!«, jubelte Lily und führte einen kleinen Freudentanz auf. Effy war peinlich berührt, dann musste sie doch lachen. Lily machte sie auf die netteste Art und Weise verlegen.
Ihre neu eingestellte Kraft hielt plötzlich unsicher inne, nur um im nächsten Moment weiterzuplappern. »Sie werden es nicht bereuen, Effy! Wir werden Berge erklimmen … äh … versetzen oder wie das heißt. Das wird der Hammer!«, versicherte Lily so begeistert, dass Effy sich anstecken ließ.
*
Sonntag, 22. Juni 2014London
Beginne mit einem quadratischen Stück Papier. Origami-Papier bekommst du in den meisten Hobbyläden … dachte Effy, den Blick auf ein hellblaues Blatt gerichtet, das auf der Rückseite ein dunkleres Blau hatte.
Die Anleitung, die sie bei ihrer Tante in Afrika gelesen hatte, kannte sie auswendig. Präzises Falten hatte etwas Beruhigendes.
Effy faltete massenhaft Papierschwäne. Sie tat es, um in Stresszeiten zur Ruhe zu kommen, und Stress hatte sie in letzter Zeit viel. Die Schwäne lagen überall herum, zerknickt am Grund ihrer Handtasche, auf Fensterbrettern, zwischen Klappkarten in Umschlägen für Freunde und Verwandte. Sie waren wie eine Signatur.
Zuerst falte das Blatt in der Mitte … Sie hörte die Anleitung Wort für Wort und fuhr mit dem Finger über den neuen Falz.
Sie gönnte sich eine Pause, nachdem sie drei Stunden lang vor dem Laptop gesessen und sich mit dem Bleistift am Kopf gekratzt hatte, weil sie versuchte, aus der dreizehnten Seite des neuesten Antragsformulars für Zuschüsse für Hilfsorganisationen schlau zu werden.
Frank, ihr Freund, lag auf dem Bett, was er in letzter Zeit häufig tat, und starrte vermutlich Löcher in die Decke oder drehte Däumchen.
Um sich Zeit zum Nachdenken zu lassen, faltete sie noch einen Schwan, den sie neben sich auf den bereits schwankenden Stapel der anderen setzen würde.
Nun falte das Blatt quer und gib acht, dass die Ecken genau aufeinanderliegen … Effy faltete und fummelte, bis der Schwan einen Rumpf und den Ausgangspunkt für die Flügel hatte. Dabei dachte sie an die Zeit zurück, als alles begonnen hatte …
Effy war Anfang zwanzig gewesen und hatte noch in der Modebranche gearbeitet, als sie ihre Tante in Uganda besuchte. Ihre Tante war geschäftlich dort, und dieser Sommer veränderte Effys Leben: Er weckte in ihr den Wunsch, eine Wohltätigkeitsorganisation aufzubauen. Sie faltete die Papierschwäne, um sich das vor Augen zu halten. Um sich an die Gründe zu erinnern, warum sie so hart arbeitete. Welchem Zweck das diente. Das hielt sie in Gang.
Mit dem offenen Ende nach links falte ein Kläppchen so, dass die Kante auf die Mittellinie trifft …
Ein Seufzer von Frank unterbrach sie. Er war so laut, dass er den Flur ihrer Muswell-Hill-Wohnung entlang an ihr linkes Ohr kroch und hineinflüsterte, um sie an seine Unzufriedenheit zu erinnern.
Effy fragte sich, ob er mit Absicht so laut seufzte. Sie wünschte, er würde weniger Zeit im Bett und mehr in der Außenwelt verbringen, irgendetwas tun, etwas für sich selbst, was, das war ihr egal.
Hauptsache, er schlich nicht ständig in der Wohnung herum und verbreitete schlechte Laune.
Der Kopf ist einfach zu falten. Schlage Falz Nummer eins der oberen Spitzen so ein …
Es war schon halb eins. Vermutlich konnte er wieder mal nicht schlafen. Manchmal überlegte sie, ob er vielleicht depressiv war. In letzter Zeit hatte er sich so sehr verändert, da fand sie es schwer zu glauben, dass das nur an ihrer neuen Arbeit liegen sollte. Er konnte sich auf Filme nicht mehr konzentrieren, fand die Bilder auf dem großen Flachbildschirm eintönig und langweilig, wie ein Kind, das ein tolles Geburtstagsgeschenk nur aus Trotz zurückweist. Einmal hatte er beim Abendessen gesagt, diese fiktionalen Leben erschienen durch die HD-Technik zu wirklich. Eigentlich ist er schon immer anders gewesen, dachte sie. Er war aufreizend kühl, und das brachte eine ablehnende Haltung mit sich, zum Beispiel gegen diese neuen Fernseher, durch die man bei den Schauspielern wirklich jede Falte sehen konnte, sogar den Flaum auf den Wangen der Frauen. Vielleicht hatte das mit seiner Angst vor dem Altwerden zu tun. Für Frank war vieles »nicht akzeptabel«, und Effy verachtete ihn heimlich dafür. Seine rigiden, starren Ansichten stießen sie ab, ebenso, dass er nicht mal mehr bei ein paar Bier und einem guten Film auf einer verdammt guten Mattscheibe für ein, zwei Stunden entspannen konnte, während sie versuchte zu arbeiten.
Bei ihrer ersten Begegnung hatte sie das ziemlich attraktiv gefunden, aber damals war es noch nicht so weit gegangen. Er hatte ein ausgeprägtes Interesse an Recycling gehabt und sich alte Filme mit einem Projektor angeschaut. Damals war das okay gewesen, weil sie sich wahnsinnig in ihn verliebt hatte und sich im rosaroten Dunst der Schwärmerei verlor, bei der sie ihn idealisierte. Nach sechs Jahren nun hatte sie das Gefühl, er sei ein anderer geworden.
Frank vertiefte sich in Bücher. Er las jede Menge, alte, die nach Secondhandladen rochen, und neue, die den süßlichen Sägemehlgeruch verströmten. Doch er erzählte ihr, die Wörter hüpften durcheinander, und er müsse denselben Abschnitt immer wieder lesen. Ihm war unwohl. Er machte sich Sorgen. Er war frustriert. Effy wusste das, aber sie arbeitete ständig mehr und war nicht imstande, ihm die Zeit zu widmen, die er brauchte. Sie fragte sich oft, ob es an ihr lag oder ob sie nur den Kontakt zueinander verloren hatten.
Kürzlich hatte er eine neue Matratze gekauft, weil Effy sich über einen steifen Nacken beklagt hatte. Das war eine nette Geste gewesen, doch jetzt lag er allein darauf – wieder einmal.
Effy würde den Förderantrag am nächsten Tag abgeben müssen. Daran konnte sie nichts ändern. Es gab Menschen, die darauf angewiesen waren, deren Leben davon abhing. Es war noch eine Menge zu tun, und alles blieb an ihr hängen. Das machte ihr Angst.
Frank war aufgefallen, dass sie seit ein paar Monaten nach Gutdünken Schmerztabletten schluckte und sich den Nacken massierte, wenn sie eins der vielen hektischen Telefonate führte. Diese Anrufe hören überhaupt nicht mehr auf, hatte er sich beschwert. Da hatte er allerdings recht: Das Telefon klingelte Tag und Nacht. Sie musste für die Leute erreichbar sein, wenn bei ihnen Tag war. Die Anrufe kamen nicht immer nur aus Afrika. Aufgrund ihrer Recherchen und Anfragen sprach sie mit Fachleuten in der ganzen Welt.
In ruhigen Momenten gestand sie sich, dass sie sich zu viel aufgeladen hatte. Doch das würde nicht ewig so bleiben. Sie hatte gehofft, Frank wäre stolz auf sie. Effy hätte nicht gedacht, dass die Beziehung nur wegen einer kleinen Phase harter Arbeit so schief laufen könnte. Sie schob die Nackenschmerzen auf die alte Matratze, er auf ihre Arbeitszeiten. Am Dienstag vor vierzehn Tagen hatten sie sich darüber gestritten, ganze vier Minuten lang, und Frank sagte, es komme ihm so vor, als hätte sie immer nur vier Minuten Zeit für ihn. Vier Minuten …
Frank hatte die Auseinandersetzung verloren, und daraufhin war er zu Westfield gelatscht und hatte eine neue Matratze bestellt. Obwohl er die wahre Ursache ihrer Nackenschmerzen kannte, blätterte er zweitausend Pfund für eine neue hin und hoffte, das werde die Beziehung kitten … irgendwie, weil Effy vielleicht sah, dass er sich bemühte. Weil sie sich auf einer fantastischen Matratze, die aus einer Fabrik im Himmel stammte, vielleicht wollüstig umschlungen herumwälzen würden wie in ihrer Anfangszeit. Und wenn Effy sähe, wie viel Geld er mit der gemeinsamen Kreditkarte auf den Kopf haute – mehr, als sie sich leisten konnten –, würde sie ihn wieder beachten. Eine passiv-aggressive Methode.
Effy seufzte nun ebenfalls, da sie die Gedanken an ihre Beziehung und deren Zerrüttung nicht abstellen konnte, und fuhr fort, das Online-Formular auszufüllen, während sein Seufzen weiterhin bis in die Küche drang.
Sie vermisste den Frank der ersten Jahre. Er war toll gewesen, und jetzt fragte sie sich, ob sie sich verzweifelt an die Liebe von früher klammerte, in der Hoffnung, sie könnte eines Tages wieder aufblühen.
Anfangs war Frank für sie Mr. Rhodes gewesen, weil er ein großer Fisch war, wie Anchorman Ron Burgundy es ausgedrückt hätte. Jemand, den man nicht gleich beim ersten Treffen mit dem Vornamen ansprach, nicht mal beim zweiten und dritten, vorausgesetzt, man erregte überhaupt dessen Interesse.
Als sie sich kennenlernten, war Effy Anfang zwanzig gewesen und hatte sich um die Designer-Kleidung und Accessoires bei Fotoshootings gekümmert. Er war neunundzwanzig, ein berühmtes Model, das sich einen Namen gemacht hatte und für Beratungsaufträge gefragt war: Die bedeutendsten Designer wollten bei den Shootings seine Meinung hören, und so war sie ihm natürlich während der Arbeit ab und zu über den Weg gelaufen.
Effy hatte damals jedoch noch kein besonderes Interesse an ihm. Sie respektierte ihn, ärgerte sich aber darüber, wie sich das Personal förmlich überschlug, wenn er bloß mal um einen Zahnstocher bat. Später gestand er ihr, gerade damit habe sie ihn beeindruckt: dass sie nicht zwei linke Hände und Füße bekam, wenn er den Raum betrat.
Als er ihr bei einem Fototermin für die Cosmopolitan in einem Lagerhaus in Hackney etwas Aufmerksamkeit schenkte, konnte sie es kaum glauben. Dann wollte er sich mit ihr fürs Wochenende verabreden, was ihr die Sprache verschlug. Effys Kolleginnen, die sie für Freundinnen gehalten hatte, waren hundsgemein neidisch und wandten sich deswegen von ihr ab. Man lud sie nicht mehr zu Umtrünken oder Geburtstagspartys ein, und das Klima wurde unangenehm.
Doch es entwickelte sich eine blühende Liebesbeziehung – Effy war bis über beide Ohren verknallt und sprang wie ein naiver Rucksacktourist ins unbekannte Gewässer. Sie war so bezaubert von Frank, dass sie glaubte, mit jeder schweren Zeit, die vielleicht auf sie zukäme, fertigzuwerden. Nie hätte sie sich vorgestellt, die Beziehung könnte schon nach ein paar Jahren derart den Bach runtergehen.
Frank sah noch immer sehr gut aus. Er schien mit dem Alter sogar attraktiver zu werden. In der wirklichen Welt war er noch jung, doch die verzerrte Sicht der Modebranche behauptete etwas anderes. Er hatte immer ein bisschen Bart getragen, und jetzt hatte er sich einen richtigen Schnauzbart wachsen lassen, der ihm sogar stand. Effy dachte oft, er habe sich entwickelt wie dieser Ryan Gosling in Wie ein einziger Tag und sei immer mehr er selbst geworden. Er war attraktiv und kleidete sich nach wie vor gut, immerhin, und seine berufliche Situation konnte nicht so schlimm sein, wenn Designer ihm immer noch zig Pakete schickten, weil sie hofften, ihn für ihre neueste Kollektion gewinnen zu können.
Frank arbeitete noch, aber nicht sehr viel. Er hatte ab und zu ein Fotoshooting, wurde jedoch allmählich von jüngeren Männern verdrängt. Wegen ihrer markanteren Gesichtszüge, schärferen Augen und knackigeren Hintern, wie er eines Morgens beim Frühstück verärgert erklärt hatte. In seinem Beruf eine unvermeidliche Entwicklung, fand Effy, die immer geglaubt hatte, ihm sei das ebenso klar. Sie akzeptierte das und wusste, das Leben ging weiter. Das frühere Streben sollte ersetzt werden durch neue Genüsse, durch andere Freuden, die länger Bestand hatten als ein faltenfreies Gesicht und haufenweise angebliche Freunde, von denen man nur die Handynummer hatte …
Wenn sie beide mal, was selten vorkam, zum Abendessen ausgingen, wurde Frank noch von vielen erkannt. Effy sah, wie die Leute an den anderen Tischen einander anstießen oder überlegten, wo sie ihn schon mal gesehen hatten, oder wie sie »unauffällig« ein Handyfoto machten. Manchmal kam sogar jemand zu ihnen und bat um ein Autogramm. Doch sie sah bei Frank ein leichtes Zucken am Kiefer, wenn er seinen Namen auf das hastig besorgte Stück Papier kritzelte (einmal hatte er auf einem Gipsarm unterschreiben sollen). Offenbar war das alles zu schmerzlich für ihn – er wollte sich mit der Veränderung in seinem Leben, der Tatsache, dass er nicht ewig jung und dynamisch sein konnte, nicht abfinden.
Frank arbeitete nicht viele Stunden in der Woche und war manchmal zwei, drei Wochen ohne Job, wurde aber für die wenigen extrem gut bezahlt und verfügte augenscheinlich über genügend Bargeld. Die übrige Zeit schlenderte er durch London und setzte sich in Cafés und Bibliotheken, wenn er in der richtigen Stimmung war (was nicht oft vorkam), oder er war niedergeschlagen und blieb im Bett wie an diesem Abend.
Effy hatte dabei ein schlechtes Gewissen und nahm ihm das übel. Ja, das tat sie wirklich.
Sie versuchte zu arbeiten, ihre Gedanken wanderten aber immer wieder von dem Antragsformular auf dem Bildschirm zum Schlafzimmer. Vielleicht sollten sie sich mal offen und ehrlich über ihre Beziehung unterhalten. Die Wahrheit war vermutlich, dass sie ihn nicht verlieren wollte, weil es zwischen ihnen früher so schön gewesen war. Eine ehrliche Aussprache konnte das Ende der Zweisamkeit bedeuten, und an der hing sie.
Sie schämte sich, das zuzugeben, doch insgeheim hoffte sie, er möge tatsächlich an einer Depression leiden. Nicht weil sie ihm etwas Schlechtes wünschte, sondern weil sie wollte, dass seine Apathie eine andere Ursache hatte als die, die sie befürchtete – nämlich dass sie ihn unglücklich machte, weil sie egoistisch ihren Traum verwirklichte und den Mann, den sie liebte, dafür vernachlässigte.
Effy tippte weiter und schob die bedrückenden Gedanken beiseite. Dann hörte sie ihn seufzen und sich im Bett umdrehen. »Verdammte Scheiße«, murmelte er.
Auf Effy wirkten die Seufzer wie ein Schrei nach Liebe: »Liebe mich, bitte, liebe mich doch!«, und ihr Magen verkrampfte sich unter ihren Schuldgefühlen. Sie legte den Stift hin, klappte Notizbuch und Laptop zu und erhob sich langsam vom Stuhl. Ihr Blick schweifte durch die Küche, die sehr schnell zu ihrem Büro geworden war. Überall lag Papierkram herum, dazwischen standen Kochtöpfe und Becher mit Stiften und Büroklammern. Die Uhr stand seit drei Wochen, weil die Batterie leer war. In meiner Welt gibt es keine Uhrzeiten mehr, wurde ihr gerade klar. Der Arbeitstag begann oder endete nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gab keinen Chef, der sie aufforderte, nach Hause zu gehen und sich einen schönen Abend zu machen. Es gab nur sie und ihre Aufgabe, und die endete nie.
Die große offene Küche, in der sie mit der Modeelite laute Partys gefeiert hatten, war nicht wiederzuerkennen. Inzwischen hätte sie einen neuen Anstrich nötig, genau wie die Beziehung zwischen Effy Jones und Frank Rhodes. Aber vielleicht war es dazu zu spät.
Leise ging Effy den Flur entlang in das dunkle Schlafzimmer. Der weiche Schein des Vollmonds drang durch die Vorhänge.
Da lag Frank zusammengerollt und starrte zum Fenster.
»Frank?«, fragte sie ruhig, fühlte aber schon das Brennen aufsteigender Tränen. Eigentlich eine sonderbare Art, ein Gespräch zu beginnen, so, als wüsste sie nicht, dass er im Zimmer war. Gedanken stürmten auf sie ein, die halb ihrem Ärger über ihn und halb ihren erdrückenden Schuldgefühlen entsprangen.
War das alles ihre Schuld? Hatte sie das angerichtet? Warum unterstützte er sie nicht? Warum konnte er sein Leben nicht auch mit neuen Ambitionen ausfüllen?
Frank drehte sich um und blickte sie an. Seine Augen glänzten im Mondschein. Er sagte nichts, kniff nur mürrisch die Lippen zusammen.
Effy setzte sich neben ihn aufs Bett. Die Matratze gab ein unangenehmes Knirschen von sich, weil sie schlecht war, obwohl sie so viel gekostet hatte.
»Wir sollten miteinander reden«, sagte Effy, nahm seine Hand und drückte sie. Seine Finger blieben schlaff und lagen warm und nutzlos zwischen ihren wie Knetgummi. Sie drückte sie noch einmal, spürte aber keine Reaktion.
»Ja, meinetwegen«, sagte er schließlich in niedergeschlagenem Ton.
Effy schaute auf seine nackte Brust. Es hatte mal eine Zeit gegeben, wo sie die Finger nicht voneinander hatten lassen können und ständig zu spät zu Verabredungen gekommen waren, weil sie sich selbst beim Verlassen des Hauses nicht hatten beherrschen können. Sie fühlte sich noch immer sehr zu ihm hingezogen, doch jetzt stand etwas zwischen ihnen. Gegenseitiger Groll, vermutete sie. Jeder Kontakt schien eine Riesenanstrengung zu sein.
Sie raffte sich auf und fragte: »Bist du depressiv, Frank? Meinst du, es liegt daran?« Statt zu antworten, seufzte er, und Effy merkte, dass sie das Geräusch enorm leid war. »Falls es so ist, bin ich für dich da. Ich werde dir zur Seite stehen. Dafür gibt es Hilfe. Es ist nicht mehr wie früher … Ich weiß, Männer reden nicht gern über so etwas, aber es wird auch nicht mehr so stark tabuisiert …«
»Nein, Effy, nein«, fiel er ihr harsch ins Wort. »Ich bin nicht depressiv, nicht so jedenfalls.« Er stützte sich auf die Ellbogen.
Effy sagte darauf nichts mehr. Sie nahm den Geruch des Zimmers wahr. Es roch anheimelnd, ein bisschen muffig vielleicht, aber auch nach Rasierwasser und frischer Bettwäsche. In dem Moment wurde ihr bewusst, wie sehr sie den Geruch vermissen würde, wenn sie miteinander Schluss machten, und ihr war noch mehr zum Heulen zumute.
»Ich weiß einfach nicht, was ich unseretwegen tun soll. Nichts ist mehr wie früher, seit du diesen Verein gegründet hast«, brummte er.
Er war voller Wut, das hörte sie, und es traf sie, wie abfällig er von »diesem Verein« sprach, in den sie ihr ganzes Herzblut steckte.
»Ich weiß, ich arbeite viel, Frank. Doch was tust du? Ich sehe nicht, dass du mich in irgendeiner Weise unterstützt. Du machst es mir sogar schwer. Es wird nicht immer so sein, sondern irgendwann in ruhige Routine übergehen, aber jetzt habe ich ständig ein schlechtes Gewissen …«
»Tja, vielleicht aus gutem Grund.«
Das tat weh. Spontan wollte sie ihn schubsen, ihn anschreien, doch dazu fehlte ihr die Energie. Sie fühlte sich mies.
Er sprach aus, was sie befürchtet hatte.
»Die Wahrheit ist, ich vermisse dich, wie du früher gewesen bist, Effy. Früher hast du zu einer vernünftigen Zeit Feierabend gemacht, und dann hast du mir gehört, und wir haben etwas Tolles unternommen. Weißt du das nicht mehr? Fehlt dir das gar nicht? Wann sind wir das letzte Mal richtig zusammen ausgegangen, Eff? Wann?« Er redete immer drängender, und seine Stimme schwankte.
Effy hatte Mühe, sich zu erinnern, und konnte die Frage nicht beantworten.
»Siehst du? Du weißt es nicht mehr. Ich kann dir sagen, dass es neun Monate her ist. Es war an deinem siebenundzwanzigsten Geburtstag. Und soll ich dir auch sagen, was passiert ist?«
Sie blieb stumm. Er war laut geworden, und die Erinnerung kam angeschlichen.
»Du kamst zu spät, Effy. Ganze anderthalb Stunden. Und dann bist du auch noch früher gegangen, weil du einen Geldgeber in den USA anrufen musstest, verdammt noch mal!«
Effy war sprachlos. Sie fing an, an der Matratzenkante zu knibbeln, die unter dem zerwühlten Laken hervorgekommen war. Seine Hand hatte sie längst losgelassen. »Du wusstest von Anfang an, dass ich das vorhatte, Frank. Gleich beim ersten Date habe ich dir von meinen Erfahrungen in Afrika erzählt. Dachtest du, ich lüge?«