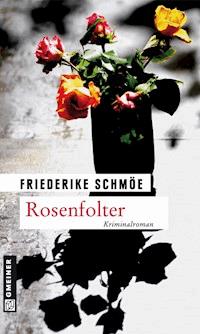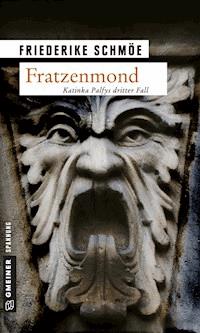Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kea Laverde
- Sprache: Deutsch
Alexa bekommt ein Herz transplantiert. Nun geschehen seltsame Dinge - lebt der Mann, der sterben musste, um sie leben zu lassen, in ihr weiter? Alexa forscht mit Ghostwriterin Kea Laverde nach und findet heraus, wer der Spender ist. Doch der ist an einem zweifelhaften Unfall gestorben ... Ein nachdenklicher, psychologisch ausgeklügelter Krimi über die Suche nach dem Ich und die Frage, ob man ein anderer werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friederike Schmöe
Ein Toter, der nicht sterben darf
Ein Fall für Kea Laverde
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Bob Senesac / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-4510-1
Zitat
Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.
Sprüche 4, 23
Prolog
Sie fühlte Erleichterung. Trauer. Einsamkeit. Frustration. Aber vor allem Erleichterung. Die Erleichterung dämpfte den Horror. Im Augenblick zumindest.
Adela hatte alles veranlasst. Sie hatte sich um die Formalitäten gekümmert, die Telefonate mit dem Bestattungsinstitut geführt und die Papiere unterzeichnet, die für die Überführung benötigt wurden. Nach ihrer Rückkehr war sie direkt vom Flughafen zu Ana und Cesário gefahren. Sie wollte es hinter sich bringen.
Ana und Cesário hörten einfach zu. Sie fragten wenig, nickten jedoch zustimmend, als es um die Entscheidung ging, die Adela in weniger als 20 Minuten getroffen hatte. Weil es so schnell gehen musste. Weil sie mit Begriffen wie Hirntod und Intensivbehandlung umgehen musste, die sie in ihrer Muttersprache kaum verstand, geschweige denn auf Englisch. Sie hatte »ja« gesagt, weil sie alles wollte, nur nicht noch mehr Tod, und weil die Argumente der Ärzte stichhaltig klangen. Das erklärte sie Ana und Cesário. Die nickten beide, und Ana sagte: »Dann ist jetzt alles gut.«
Nichts war gut. Adela hatte später im Internet recherchiert. Es war unglaublich, was sie da las, und wenn allein die Hälfte davon zutraf, bereute sie doch zutiefst, ihr Einverständnis gegeben zu haben. Sie hatte es ja nicht für sich gegeben. Sie hatte gesagt, was sie meinte, das Rui gewollt hätte. Doch während sie noch überlegte, während sie in dem Kokon aus Stille und Ungläubigkeit, in dem sie seit der Nachricht über Ruis Tod eingeschlossen war, versuchte, einen klaren, rationalen Gedanken zu produzieren, liefen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen. Ein ganzer Apparat wurde in Betrieb gesetzt. Das hatte sie nicht gewusst. Sie hatte es nicht wissen können und durfte sich daher keinen Vorwurf machen. Ganz allein hatte sie in einem absoluten Ausnahmezustand eine Entscheidung treffen müssen. Ohne in der Lage zu sein, die richtigen Fragen zu stellen. Natürlich hatte sie sich gewundert, warum pausenlos das Telefon klingelte, aber die Gespräche hatte sie nicht verstanden, und so blieb ihr nichts, als dem zu vertrauen, was man ihr sagte.
Es war nicht die Wahrheit. Auch keine Lüge, aber eben nicht ganz die Wahrheit.
Mit Ana und Cesário war sie zur Friedhofsverwaltung gefahren. Sie hatte eine ordentliche Summe zugeschossen, die sie niemals wiederbekommen würde, nicht, wie die Dinge momentan standen, mit der Krise und allem. Bei fast 40 Grad Hitze waren sie zu der Grabstätte gegangen, die sie sich würden leisten können. Sie – die Eltern. Sie hatten zu dritt beraten, ob die von der Friedhofsverwaltung vorgeschlagene Grabstätte in Ordnung war. Sie hatten so getan, als hätten sie eine Wahl.
Sie hatten sie nicht. Cesários Unterschrift auf dem Papier war krakelig, die Buchstaben stiegen steil nach rechts oben an, als wollten sie den endlosen Dokumenten ein für alle Mal entfliehen: Cesário Peres Oliveira.
Und heute die Beerdigung. Endlich, schoss es Adela durch den Kopf. Die Erschöpfung der vergangenen Tage wollte sie allmählich aufzehren, zusammen mit der Hitze, den wirren Nachtträumen, die am Morgen unsägliche Bilder in ihrem Kopf hinterließen. Bilder von spritzendem Blut und Ruis ausgeweidetem Körper, seinem aschgrauen Gesicht, den mit Mullbinden abgeklebten Augenhöhlen. Bilder von Formblättern, von zerquetschtem Blech und einem kahlköpfigen Mann, der etwas unterzeichnete, Bilder von einem gläsernen Besprechungsraum, in dem man ihr sagte: »Sie wollen doch sicher auch, dass …«, Bilder von einer Holzkiste, die in ein Flugzeug verladen wurde.
Vom Fluss wehte Wind herbei, schlängelte sich den Hang hinauf, so aufgeheizt, dass Adela meinte, in diesem Lufthauch Kastanien rösten zu können. Der Katafalk mit dem schwarzen Sarg wurde von vier Männern gezogen, bergab. Erreichte die Grabstätte. Die Männer nahmen die Mützen ab, und der Priester ging ein paar Schritte auf den Sarg zu. Adela blinzelte. Sie trug eine Sonnenbrille, die beinahe ihr ganzes Gesicht verdeckte. Gestern noch hatte sie geglaubt, die Tränen würden wie ein Sturzbach aus ihr herausschießen, aber da kam nichts. Keine Träne, nicht einmal ein trockener Schluchzer. Sie fühlte sich leer. Vollkommen leer. Dieses Vakuum tief in ihr schützte sie. Vor sich selbst. Vor dem Entsetzen über die Entscheidung, die sie getroffen hatte. Und vor dem, was zuvor geschehen war und worüber sie mit Rui nicht mehr hatte sprechen können.
Die Familienangehörigen nahmen Abschied, ruhig, mit blassen Gesichtern. Der Tod ist schlimm, doch schlimmer ist der Tod in der Fremde, dort, wohin das eigene Auge nicht reicht, dachte Adela. Dort, wo man eine andere Sprache spricht, dort, wo man ein Fremder sein wird für immer.
»Er ist nicht freiwillig weggezogen«, hörte sie eine Frau flüstern. »Er musste.«
So viele mussten. Adelas beste Freundin lebte nun in Brasilien. Ein anderer Freund in England. Wieder einer in Russland. Sie zogen um den Globus, eine neue Generation Weltentdecker, denen keine andere Lösung blieb, wollten sie nicht von morgens bis abends im Café sitzen, bei einem Garoto, und mit trägem Wippen des Fußes die Tauben vertreiben, von denen es in Lissabon genug gab. Mehr als genug.
Adela musterte die beiden Alten, die schmale, blasse Ana mit dem eng geknüpften Schleier, der sich vor ihrem Gesicht bauschte. Cesário, wurmstichig, gebeugt, der silberne Bart tadellos gestutzt. Sie hielten einander an den Händen, mit ratlosen Gesichtern. Beide hatten sich Hoffnungen gemacht. Auf Ansehen, darauf, stolz zu sein auf den Sohn, den einzigen, der es so weit weg, im Ausland, zu etwas gebracht hatte. Sie waren beide auf ihre Weise kosmopolitisch. Ana als Englischlehrerin. Cesário, der Ingenieur, der in Brasilien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Libyen und Marokko Brücken gebaut hatte. Sie wollten so gerne Enkelkinder. »Rui wäre der ideale Vater«, hatte Ana Adela vor ein paar Wochen anvertraut, »ein durch und durch guter Junge.«
Die Sonne brannte, weit unter ihnen glitzerte der Tejo im gleißenden Licht. Ein Schiff – ein einziges, die Krise! – schob sich nach Norden. Adela rückte an ihrem Hut. Sie verglühte beinahe in den schwarzen Sachen, doch das war nichts Besonderes, das kannte sie seit ihrer Kindheit. Sie hatte sich stets gefragt, wie Rui ohne diese gleißende, helle Sonne klarkam. Dort oben im Norden. Dabei hatte er ihr in seinen seltenen Mails immer geschrieben, wie sehr er das Spiel des Lichtes mochte. Dort, wo er zuletzt lebte.
Dort, wo er gestorben war.
Der Priester sagte seine Sätze auf, die Wörter schmolzen, bevor sie über seine Lippen kamen, und Cesário weinte. »Weiß Gott, ich bin alt, ich darf weinen«, hatte er gestern gesagt. »Ich bin ein alter Mann, und meine Trauer bringt mich um.«
Instinktiv spürte Adela, dass sie sich um Cesário keine Sorgen zu machen brauchte. Nicht mehr als üblich, wenn alte Eltern am Grab des einzigen Kindes standen. Bei Ana war sie nicht sicher; im Augenblick lebte sie ohnehin nur von einem Tag auf den anderen. Sie durften niemals erfahren, was sich wirklich abgespielt hatte. Dass es nicht um Moral gegangen war, sondern um ein Geschäft. Um Renommee, um Statistiken. Sie musste die Gefühle der Eltern schützen; aus dem, was entschieden war und sich nicht mehr ändern ließ, einen Trost machen.
Adelas eigene Gefühle hatten an einem Tag wie heute keine Rolle zu spielen. Sie tat, was von ihr gefordert wurde, und viel mehr als das. Ihre Hoffnungen versanken ebenfalls, sie vertraute sie dem Sarg an, denn an Rui mochte sie nicht denken. Nicht an die Reste von Rui, die in dieser Kiste lagen. Die in einer Flugkiste mit Zinkeinlage hergeflogen worden waren. Luftdicht, mit verlötetem Metalleinsatz. Lieber erinnerte sie sich im heißen Flimmern des Lichts an den lebendigen Rui. An seinen Heißhunger auf Pastéis de Nata, die sahnigen Törtchen, die in der berühmten Konditorei in Belém gemacht wurden. Eine Konditorei, die man im Sommer wegen der sich darin drängenden Touristen kaum mehr betreten konnte. Deswegen, hatte Rui oft behauptet, sei Lissabon eine Stadt für den Winter.
Sie wartete darauf, ihre Rose auf den Sarg legen zu dürfen, damit sie endlich gehen konnte, raus aus der Hitze. Vor ihren Augen malte die Sonne scharfkantige Spiegelungen zwischen die Grabstätten.
Als sie, ein Ave Maria murmelnd, sich umdrehte, nahm Cesário sie am Arm.
»Wir sehen uns gleich noch.« Sein Blick war eine inständige Bitte.
»Natürlich«, erwiderte Adela. »Natürlich.«
Aus dieser Verantwortung gab es kein Entrinnen.
17.6.2013
Kapitel 1
»Sie wollen das alles hier aufgeben?«
»Und wenn?«
»Ein perfekter Ort.« Der Makler grinste mich an. Ein falsches Grinsen.
»Ein perfekter Ort bei gutem Wetter. Letzteres ist in Deutschland leider nicht häufig. Sie haben alles, was Sie brauchen?«
»Sie hören von mir!« Er stieg in sein Auto. »Sofern Sie Ihre Meinung noch ändern, genügt ein Anruf.«
Ich zuckte die Achseln.
Ja, ich wollte mein Haus im Fünfseenland verkaufen. Es hatte seine Pflicht und Schuldigkeit getan.
Vor einigen Jahren war ich bei einem Terroranschlag schwer verletzt worden. Ein Mann hatte mich verlassen. Ich hatte einen Neuanfang gewagt, mich in einem interessanten neuen Betätigungsfeld verankert und die Liebe neu gefunden. Mit Hindernissen zwar, aber das war letztlich ein Qualitätsbeweis. Was heilen konnte, war geheilt, und dazu hatte ich diesen Ort gebraucht. Nun war es an der Zeit, weiterzuziehen.
Ich starrte den Hang zum Wald hinauf. Wolken klammerten sich an den Bäumen fest. Der Wind spielte mit dem Laub, zu kalt für Frühsommer. Bayern versank gerade in den Fluten seiner Flüsse, wie meist hatte es Passau böse erwischt. Ich sah mir die Bilder täglich im Internet an, weil meine beste Freundin Juliane – junge 80 Jahr alt – just in Passau weilte, als die Flut kam. Sie steckte dort fest, zusammen mit einer Yogalehrerin und ein paar anderen alten Damen, die sich mit Yoga und diversen heißen Diskussionen eine laue Woche hatten machen wollen. Um Juliane allerdings musste man sich keine Sorgen machen. Sie war auf Überleben eingestellt. Sie trotzte allem – und genoss, was sich ihr bot.
Ein Wagen jagte über die Straße, die durch Felder und Wiesen und auch an meinem Haus vorbeiführte. Man hatte sie im Herbst verbreitert. Einst ein Flurbereinigungsweg, jetzt eine Staatsstraße. Die Stadt rückte näher an meine Idylle. Immer mehr Leute kauften Baugrund in Ohlkirchen, dem nächsten Ort, ein Supermarkt würde in Kürze seine Pforten am Rand der Ortschaft öffnen. Einmal mehr ein Flachbau auf der grünen Wiese, mit viel Parkplatz und dem immer gleichen Warenangebot – eine Ausgeburt der Konsumödnis. Mein einst so lauschiges Ende der Welt war nur noch ein Vorzimmer der Metropole München. Die Zeit blieb eben nicht stehen.
Meine beiden Gänse waren im Frühling gestorben. Zuerst Waterloo, nach wenigen Wochen Austerlitz. Sie konnten beide nur miteinander. Einer ohne den anderen, das ging nicht. Die Natur behalf sich selbst.
Mich hielt hier also praktisch nichts mehr.
Und nun sind Sie eingeweiht. Sie wollten das alles gern wissen, oder? Zugegeben, wahrscheinlich waren Sie scharf auf die ausführliche Version, doch die gibt es nicht öffentlich, jedenfalls nicht von mir, fragen Sie Juliane.
Ach, Ihnen geht es um Nero!
Okay. Vor anderthalb Jahren hatte Nero, Hauptkommissar am LKA in München und mein Geliebter, einen Herzinfarkt. Obwohl er jobmäßig schon abgespeckt hatte, saugte der Stress ihn von innen her aus. Um einen auf Privatier zu machen, hält er sich für zu jung. Aber er ist Beamter und hat eine lange Liste beruflicher Pluspunkte gesammelt. Erst Ermittler, später Dozent für Netzwerktechnik und anderen Computerklimbim für die bayerische Polizei. Jetzt Berater für Burnout-Patienten unter den Kollegen.
Wir hatten ernsthaft vor, in naher Zukunft zusammenzuleben. Wenngleich nicht in seiner Wohnung in Schwabing und nicht hier im Fünfseenland. Ich musste einfach weiter. Ich habe Nomadengene, Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Mich fesselt es nicht an meine Scholle – eher an die Webseite einer weltweit operierenden Airline. Der Plan war, eine Bodenstation in München aufrecht zu halten, damit Nero seine Beratungen und Kurse anbieten konnte. Zeitweise. Gleichzeitig wollten wir andernorts die Zelte aufschlagen, um Neuland zu betreten. Meinen Beruf kann ich schließlich überall ausüben. Ich bin Ghostwriterin.
Besonders konkret waren unsere Pläne allerdings noch nicht. Ich ging davon aus, dass ich in einem halben Jahr ausziehen würde. Weg aus dem Fünfseenland und wahrscheinlich weg aus Deutschland. Ich hatte genug von grauen Wolken und Dauerregen. Von Polarnacht und gefrierender Nässe. Ich dachte, ehrlich gesagt, an Bali. Woran Nero dachte – daran verschwendete ich bislang kein Gehirnschmalz. Denken Sie, was Sie wollen: Natürlich machte ich mir was vor. Manche Vorhaben sollte man besser unter der Rubrik »Traum« verbuchen.
Ich schnappte mir meine Arbeitsunterlagen und stieg in den Spider. Geschäftstermine.
Kapitel 2
»Danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
Dagmar Umbach packte ihre Unterlagen zusammen und verließ das Sitzungszimmer. Sie hatte ihre Präsentation durchgehalten wie geplant und schützte nun ein wichtiges Kundengespräch vor, um schnell wegzukommen. Die Arbeitsgruppe würde auch ohne sie weitermachen, so wichtig war sie nicht. Sie hastete den Flur entlang, fuhr mit dem Lift in den 10. Stock und nickte ihrer Sekretärin kurz zu.
»Anrufe?«
»Zwei. Firma Stern in Rottweil. Und der Pressesprecher des Bürgermeisters.« Sie verdrehte die Augen. Sie war klein, mollig, trug das Haar wie Prinz Eisenherz und war die tüchtigste Sekretärin, mit der Dagmar Umbach es je zu tun gehabt hatte.
»In Ordnung, Frau Gary.« Eigentlich Susanna Müller-Gary. Mit Betonung auf »y«. Aber sie war mit Gary zufrieden.
Dagmar spazierte in ihr Büro und schloss die Tür. Tief unter ihr lag der Olympiapark von München, diese in die Jahre gekommene spinnennetzartige Konstruktion, die ihr schon als Kind gefallen hatte. Die grünen Hügel des Geländes wirkten im Dauerregen eher mürrisch; Dagmar mochte den Blick dennoch, die beiden Türme der Frauenkirche, die sich hinter dem Fernsehturm hochreckten. Manchmal, zu selten, sah sie die Alpenkette. Ihr Anblick gab Dagmar ein Gefühl von Erhabenheit; als ob sich ihr Job allein deshalb lohnte, weil XComMunich seinen Firmensitz im 8., 9. und 10. Stockwerk dieses prachtvollen Glasbaus besaß, und sie selbst so ein traumhaft gelegenes Büro.
Sie musste in Ruis Büro. Unbedingt. Obwohl sie den Gedanken hasste, in den Sachen eines Toten zu wühlen. Aber sie wollte mit Sicherheit wissen, dass wirklich nichts Kompromittierendes über sie zu finden war. Bei Rui wusste sie nie. Hatte sie nie gewusst. Er war ein Spaßvogel. Gut möglich, dass Fotos von ihr auf seinem Rechner waren.
Sie griff nach dem Telefonhörer.
»Frau Gary, haben Sie Antwort vom Rechenzentrum?«
»Ist bereits an Ihre Mailadresse weitergeleitet.«
Okay. Dagmar begann zu schwitzen, trotz des miesen Wetters – Juni, von wegen, der Mittsommer war so verregnet wie seit Jahren nicht mehr –, trotz der Klimaanlage. Sie öffnete ihre Inbox.
Das Rechenzentrum hatte ihre Anfrage mit Priorität beantwortet. Ihre Position war der von Rui übergeordnet. Wenn jemand an die Daten seines Rechners herankommen musste, dann sie. Ein Mitarbeiter der Computerloge, wie firmenintern über das Rechenzentrum gespottet wurde, gutmütig natürlich, hatte Ruis Passwort online zurückgesetzt und ein temporäres Passwort eingerichtet. Dazu war Papierkram nötig gewesen. XComMunich legte Wert darauf, den Mitarbeitern Privatsphäre und Diskretion zuzugestehen. Kreative Leistungen entstehen nicht unter Observation, sagte der Vorstand. Dagmar schnaubte.
Sie schrieb das Passwort auf einen Zettel. Sah auf die Uhr und griff nach ihrer Handtasche.
»Ich bin in der Kantine, Frau Gary.«
»Guten Appetit, Frau Umbach.«
15.7.2013
Kapitel 3
Juli. Endlich. Eine Ahnung von Sommer. Das Wasser aus den Hochwassergebieten war abgeflossen, doch manche Ortschaften an der Donau und in anderen Überschwemmungsgebieten hatten alle Hände voll damit zu tun, sich selbst und ihre Habe trockenzulegen. Juliane war wieder in Ohlkirchen, ziemlich aufgekratzt wegen ihres Abenteuers, mehrere Tage mitten in Passau ohne Strom und fließendes Wasser festgesessen zu sein.
»Du spinnst, Juliane«, sagte ich. Sie saß bei mir in der Küche. Einer richtigen Wohnküche mit allem, was man zum Kochen, Essen und Wohnen braucht.
»Doch, wirklich. Zurückgeworfen sein auf das Wesentliche. Sich keine Gedanken um Telefonanrufe, Handys oder Fernsehprogramme machen. Herrlich!«
»Als ob du dir je Gedanken über das Fernsehprogramm machen würdest.« Ich goss uns frischen Kaffee ein.
»Oh, aber ja!« Sie lachte mich an. Eine schmale Person, der man die 80 Jahre nicht abkaufen wollte, mit raspelkurzem Silberhaar und Kreolohrringen, die so lang waren, dass sie ihre Schultern streiften. Sie trug ein Shirt mit der Aufschrift »I’m in a blue mood«.
»Hast du wirklich den Blues?«
»Nicht die Bohne. Du?«
»Bei dem Wetter?«
»Macht es dir nichts aus? Das Abschiednehmen?«
»Du meinst: vom Haus?« Ich seufzte. Bislang war nichts entschieden. »Eigentlich nicht. Uneigentlich auch nicht, falls du fragen willst. Ich muss endlich mal was Neues machen, zu anderen Ufern aufbrechen.«
Wie von selbst legte sich meine Hand auf meine Seite. Dort, wo ich verletzt worden war. In Scharm El Scheich. Damals. Im Hardrock Café. Weil irgendwelche Spinner ihre Religionsneurosen nicht anders ausleben konnten. Neue Hüfte, eine Menge Narben. Ein fettes Trauma.
Sie musterte mich nachdenklich. Sie kannte mich gut genug.
»Ich könnte dein Haus kaufen.«
»Du?« Ich lachte. »Im Ernst, Juliane. Was willst du mit einem Haus?«
»Du meinst: In meinem Alter, da kommt man ohne Haus aus.«
»Quark. Ich meine, dass du immer wieder betonst, dir nichts ans Bein binden zu wollen, was dich behindert, wenn du einmal gehen willst.«
»Ich will aber noch nicht gehen.«
Sie war so vital. So energiegeladen. Anders als ich. Ich fühlte mich oft müde, fast lethargisch. Schob es auf die viele Arbeit, die ich in den vergangenen Monaten bewältigt hatte. So viele Memoiren, Pseudo-Biografien und anderen Selbstbeweihräucherungsquatsch hatte ich noch nie in einem halben Jahr geschrieben. Allein von der Menge der produzierten Seiten her war das Pensum hochgradig rekordverdächtig. Okay, es war mein Job. Eine Ghostwriterin fragt weder nach der Wahrheit noch nach der Motivation. Sie schreibt, gießt die Geschichte eines anderen Menschen in Form. Ich konnte etwas für die Qualität von Plot und Stil tun. Aber nichts für den Inhalt.
»Juliane, ich verkaufe nicht an dich.« Es wäre, als verkaufte ich mein Haus meiner eigenen Mutter. Was nicht geschehen würde. Frau Laverde war ganz bestimmt nicht interessiert an einem Haus in der Pampa. Wobei die Pampa allmählich zwangszivilisiert wurde. Doch meine Mutter lebte bei ihrem momentanen Lover in Bremen. Sie hielt den Mindestabstand ein. Das konnte mir nur guttun.
»Überleg’s dir. Die Hütte ist altengerecht. Kaum Treppen, ein großes Bad, sollte ich jemals auf einen Rollator angewiesen sein, komme ich in meiner Wohnung sowieso nicht mehr durch die Türen. Geschweige denn über die Schwellen.«
»Und wie kommst du an was zu essen? Hier draußen am Hang?«
»Mit einem Kurier? Glaubst du, in Ohlkirchen krabble ich auf allen Vieren durchs Treppenhaus, um dann über die Straße zum Bäcker zu kriechen?«
»Im Ernst: Denkst du an so was?«
»An Verfall? Krank werden? Sterben? Klar.«
Ich nickte.
Sie legte eine Hand auf mein Knie. »Glaub nicht, ich will dir ein schlechtes Gewissen machen. Du wirst nicht zuständig sein, mich zu pflegen oder so.«
»Himmel, Juliane …«
»Jedenfalls … ab und zu mit mir in den Biergarten, das ließe sich einrichten? Selbst wenn du mich im Rolli schieben musst?«
»Ließe sich sicher machen.« Ich schmunzelte.
»Womöglich besuche ich dich in Neuseeland oder wo immer du an Land gehst.«
»Ich fürchte, so weit werden wir nicht kommen. Der Plan sagt, dass Nero und ich gemeinsam gehen. Sollte er bereit sein, Bayern zu verlassen, wäre das ein Fortschritt. Aber dem Kontinent wird er bestimmt nicht den Rücken kehren.« Ich verschwieg lieber, dass das größte Hindernis zwischen mir und Neuseeland der beinahe 24-stündige Flug war. Das war die andere Seite. Die im Schatten. Die, über die ich nicht redete. Mit niemandem.
»Wenn es darum geht, dem Winter zu entkommen, wird ihm nichts anderes übrig bleiben.«
»Nero sieht es nicht so wie ich.«
»Hast du den Plan schon mit ihm durchgesprochen?«
»In Ansätzen.«
Sie beugte sich vor. »Kea, es geht um dein Leben. Nicht um Neros. Nero muss seine Sachen selber klarkriegen.«
Darüber hatten wir tausendmal gesprochen. Über meine Schuldgefühle wegen seines Herzinfarktes. Über die Panik, die mich in den Monaten danach wachgehalten hatte, dass ein zweiter, ein schlimmerer Infarkt ihn umbringen könnte. Dass ich der Auslöser war. Dass ich ihm den Kummer machte, der sein Herz in Scheiben schnitt. Juliane wollte mir begreiflich machen, dass Nero selbst die Verantwortung hatte, über seine Gesundheit zu wachen. Größtenteils war sein Stress beruflich bedingt, zum Glück hatte er hier abgespeckt. Aber ich kannte Nero gut genug: Er machte sich wegen allem einen Kopf, nahm sich die Dinge zu sehr zu Herzen. Auch mich und meine Launen. Was mich unter Druck setzte und widerspenstig werden ließ. Ich wollte mir selbst treu bleiben. Nicht eine von diesen Frauen werden, die alles für den geliebten Mann aufgeben, sogar ihre Träume. Ich wollte wachsen. Innerlich, spirituell. Dabei hing Nero manchmal wie ein Stein an mir. Ein wahrer Felsblock. Ich spürte, dass Nero mich mehr brauchte als ich ihn, und das war etwas, das ich schlecht ertrug.
»Ich weiß. Und das Schöne: Ich kann meinen Beruf überall ausüben.«
»Eben. Nutze es aus.«
»Dafür fallen die Sommerferien flach. Ich habe einen neuen Auftrag.«
»Oha!«
»Eine junge Frau, die nach einer Herztransplantation ihr Leben aufgeschrieben haben will.«
»Jung? Und ein ganzes Leben zum Aufschreiben?«
Ich trank einen Schluck Kaffee. Schwarz. Wie immer. »Sei nicht so überheblich!«
Juliane kicherte. »Ich versuche es. Hat sie Angst vor dem Tod?«
»Kann sein. Ich weiß es nicht, habe bloß am Telefon mit ihr geredet. Sie sagt, seit der Transplantation lebt sie irgendwie anders. Sie will reinen Tisch machen mit dem, was vorher war.«
»Kluger Ansatz.«
»Dazu bin ich da. Der Geist, der alles niederschreibt und Klarschiff macht. Wenigstens gedanklich.«
»Wenigstens? Ich denke, Klarheit in den Gedanken ist der erste Schritt zur Besserung.«
Ich stimmte ihr zu. In meinen Gedanken herrschte ein unbeschreiblicher Verhau. Alles lag drunter und drüber. Ein Durcheinander wie bei den Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten. So kam es mir vor: Ich hatte das Bedürfnis, einfach alles rauszuschmeißen und mit ein paar Basics neu anzufangen. Nicht nur über den Neuanfang zu brüten, sondern ihn anzupacken. Die meisten Menschen dachten ziemlich viel über ihr Leben nach, doch grübeln allein schaffte keine Veränderung.
»Sie klang ziemlich cool. Die neue Klientin.« Ich sah auf die Uhr.
»Dann los! Ich will dich nicht aufhalten.«
»Ich setze dich zu Hause ab, Juliane.«
Sie hatte nichts dagegen. Als ich im Zentrum von Ohlkirchen hielt und Juliane ausstieg, drehte sie sich um, schickte mir ein Küsschen durch die Luft. »Bali soll sehr schön sein!«
Kapitel 4
Denning. Eines von Münchens grünen Vierteln mit großen Gärten und Parks. »Senger« stand auf dem Messingschild an der Gartenpforte. Die Straße war eng. Eine Wohnstraße. Bis zur Leblosigkeit gepflegte Vorgärten, emaillierte Katzenschilder an den Zäunen. Irgendjemand hatte in Winkeln wie diesem immer Zeit, aus dem Fenster zu schauen, um zu kontrollieren, ob Leute etwas falsch machten. Passenderweise parkte mein Spider regelwidrig.
Ich klingelte. Eine Katze spazierte unter dem Gartentor durch und strich um meine Beine. Der Summer ging. Eine Dame erwartete mich an der Haustür. Sie war um die 60. Meine neue Klientin hatte ich mir anders vorgestellt.
»Womöglich habe ich mich in der Tür geirrt.«
»Nein, Sie sind richtig. Meine Tochter wartet schon auf Sie.« Sie trug das Haar kurz geschnitten, in so einer praktischen Art, die mich immer aufregte. Als fürchteten die Leute sich vor ihrem eigenen Haar. »Alexa!«, schrie sie ins Haus.
Ich hörte etwas rumpeln. Alexa Senger hatte mir am Telefon gesagt, dass ihr vor anderthalb Monaten ein Herz transplantiert worden war. Ich erinnerte mich an meine eigenen Operationen nach dem Terroranschlag. Damals hatte ich Monate gebraucht, um mich zu erholen. Sowohl von den Verletzungen als auch von der Behandlung. Alexa dagegen sprang vor mir die Treppen hinunter wie ein Rennpferd, das endlich zur Bahn geführt werden wollte.
»Hallo. Toll, dass Sie kommen konnten! Möchten Sie was trinken?«
»Ich habe hausgemachte Limonade«, schaltete ihre Mutter sich ein.
Es würde kein leichtes Gespräch werden. Überbehütende Mütter kamen in meinem beruflichen Erfahrungsschatz kaum vor. Denn üblicherweise meldeten sich Menschen bei mir, die sich längst von ihren Eltern abgenabelt hatten. Oder deren Eltern nicht mehr lebten.
Ich folgte Alexa in ein Wohnzimmer. Klavier, Katzenbaum, Sitzgruppe, moderne Kunst an den Wänden. Die Katze von vorhin sprang genau auf den Sessel, den Alexa mir anbot. Alexa schnappte das Tierchen und warf es auf den nächsten. »Seit ich im Krankenhaus war, hat sie sich miese Manieren angewöhnt.« Sie lachte. Ein fröhliches Lachen, breite Zähne. Ein wenig Lippenstift, Mascara, weiße Jeans. Sie trug das rote Haar zu einem kurzen Bob geschnitten, und das Tanktop, das Piercing in ihrer Nase und die um ihren Hals baumelnde winzige Taschenuhr signalisierten, dass ihre bevorzugte Stilrichtung der Steampunk sein musste. Die Mutter servierte Limonade, eine große Karaffe mit Eiswürfeln und Zitronenstücken.
»Stärken Sie sich. Dann entführe ich Sie. Einmal rund um den See? Gleich hier um die Ecke.«
»Alexa, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bei der Hitze …«, begann Frau Praktischer Haarschnitt.
Alexa achtete nicht auf den Einwurf. Sie schien innerlich zu brodeln, süchtig nach Bewegung zu sein. Fuhr sich durchs Haar, nahm das Glas in die Hand, musterte es, stellte es weg, schenkte ein, trank, fuhr sich durchs Haar. Sie hatte es eilig mit unserem Gespräch, und das war ein Phänomen, das ich allzu gut kannte. Manche Kunden kamen nicht in die Gänge, als hätten sie Angst vor dem Erzählen, sobald ich mit Diktafon und Block bei ihnen aufkreuzte. Sie hatten viel Zuwendung und Nachhelfen nötig, bevor sie den Mund aufmachten und loslegten. Im Extremfall besuchte ich einen Klienten mehrmals, bis er endlich einen Anfang fand. Andere hingegen verhaspelten sich ständig, weil die Schlingen der Erinnerung sich im Eiltempo entwirrten und ein Ereignis nach dem anderen in ihrem Innern losgetreten wurde. Alexa schien eindeutig zur zweiten Kategorie zu gehören. Solche Kunden sind mir persönlich die liebsten, obwohl in diesen Fällen das Erzählte oft ein großes Durcheinander ist und meine Hauptarbeit darin besteht, zu ordnen, was zusammenpasst. Oft gibt es Tränen. Bei Frauen habe ich damit kein Problem, bei Männern schon. Mitteleuropäische Sozialisierung.
Wir tranken unsere Gläser leer, dann sprang Alexa auf. »Los geht’s.«
Ich folgte ihr, als sie, die Ratschläge ihrer Mutter ignorierend, in ein paar weiße Chucks schlüpfte und die Haustür aufstieß.
»Puh. Endlich. Ich bin vor Kurzem erst aus der Reha gekommen. Lief alles gut. Die haben mich richtig gescheucht! Ein Spaziergang macht Ihnen doch nichts aus?«
Sollte sie auf meine barocke Figur anspielen, würde ich ihr verzeihen. Die wenigsten glauben es mir, vor allem nicht die ausgehungerten, antilopenhaften: Dabei bewege ich mich viel und gern. Obwohl ich 80 Kilo wiege und rund bin und nicht aussehe, als würde ich mich vorwiegend von Salat ernähren.
»Nein.«
»Ich bin so glücklich. Wie neugeboren. Vor der OP habe ich mich gerade mal drei Schritte weit geschleppt und schon gekeucht wie eine Lok. Habe zusätzlich Wasser in der Lunge mit mir rumgetragen. Im vergangenen November wurde es richtig fies. Ich bin aufgewacht, habe keine Luft mehr gekriegt. Eines Morgens, einfach so. Alles war anders. Ich war nicht nur müde und k.o., ich war am Ende.«
»Hört sich nicht gut an.«
»Mein Herz war riesengroß, sagte der Arzt. Aufgebläht, entzündet, vernarbt. Er hat mir gleich reinen Wein eingeschenkt: Ich werde nur mit einem Spenderherzen überleben.«
Wir gingen einen schmalen Pfad entlang, an einem Wäldchen vorbei, und kamen zu einem See. Ein typischer Münchner Minisee. Ein Schwanenpaar mit Nachwuchs und Millionen von Erdlingen beim Sonnenbad. Beim Planschen im Wasser. Beim Eisessen, Ballspielen, Dem-Hund-ein-Stöckchen-Zuwerfen, Skaten, Radeln und was man sonst alles an einem heißen Sommertag in und an einem Loch voller Wasser machen kann.
»Bisschen viel los, aber man wird nicht belauscht.« Sie rollte mit den Augen. »Alles hat sich angefühlt wie ein Albtraum. Als ich hörte, ich muss das Herz eines anderen bekommen …«
»Das hat Sie erschüttert?«
»Ich habe gedacht, wem kann ich das denn zumuten, ihm sein Herz zu nehmen. Blöder Gedanke, oder?«
»Ein aufregender Gedanke!«
»Ich habe eigentlich, obwohl es mir bereits zwei Jahre schlecht ging, immer gedacht, dass es nicht so weit kommt. Dass ich schon wieder fit werde.«
»Waren Sie die ganze Zeit im Krankenhaus?«
»Seit November. Bis zur Transplantation Anfang Juni. Als nächstes Reha. Und jetzt kann ich keine Klinik mehr von innen sehen.«
Wir schlenderten durch die Grüppchen der Sommerfrischler. Mir war heiß. Meine Tasche baumelte schwer über meiner Schulter. »Ich würde das Gespräch gern auf Band aufnehmen.«
»Okay. Klar. Also, im Krankenhaus. Ich habe eigentlich nichts Richtiges da machen können. War zu allem zu schwach. Selbst zum Lesen konnte ich mich nicht aufraffen. Meistens habe ich Musik gehört. Und Hörbücher. Meine Freunde haben mir Mutmach-CDs mitgebracht. Am liebsten allerdings hörte ich Musik. Shakira und Ina Müller und Diana King. Frauen mit Kraft in der Stimme. Das hat mich aufgemöbelt.«
»Sie waren also im Krankenhaus, um auf ein Spenderherz zu warten?« Ich hatte das Aufnahmegerät aus der Tasche geholt und trug es nun locker in der Hand.
»Vor allem, um zu überleben. Ich war als High Urgent gelistet. Die haben händeringend einen Spender gesucht. Wobei das falsch ausgedrückt ist. Letztlich ist es ein Computer, der ein neues Organ durchcheckt und überprüft, ob es mit den Werten der Leute auf der Warteliste übereinstimmt. Du kannst ja nicht irgendein Herz kriegen. Da muss die Blutgruppe stimmen und allerhand anderes Zeug. Außerdem sollte das Herz zu deiner Körpergröße passen. Vielleicht ein bisschen größer sein als das Herz, das du hattest, bevor es sich aufgeplustert hat wie ein Pfau.«
»Wurden Sie im Krankenhaus behandelt?«