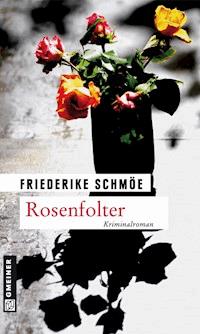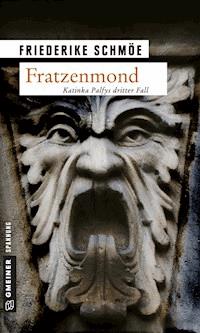Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Katinka Palfy
- Sprache: Deutsch
Privatdetektivin Katinka Palfy hat endlich ihren ersehnten ersten Fall an der Hand: In der Universität Bamberg, am Lehrstuhl des renommierten Romanisten Prof. Laubach, verschwinden CD-ROMs, Festplatten werden gelöscht und neue Dateien durch alte Versionen überspielt. Doktorand Carsten Stielke hat es am schlimmsten getroffen: Ihm wurde eine Diskette mit all seinen Doktorarbeitsdateien gestohlen. Eine harmlose Sache, denkt Katinka, und macht sich frisch ans Werk. Bald steckt sie jedoch zwischen den Fronten schräger und absonderlicher Lehrstuhlmitarbeiter fest, von deren Launen die Detektivin den Eindruck pathologischer Persönlichkeitsdefekte gewinnt. Anscheinend hat jeder ein dringendes Motiv, einen anderen um die Ergebnisse seiner Arbeit zu bringen. Eine Art akademischer Karneval mit ganz eigenen Spielregeln ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friederike Schmöe
Maskenspiel
Katinka Palfys erster Fall
Impressum
Alle Charaktere in diesem Kriminalroman sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit existierenden Personen und Handlungen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2005 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von sxc.hu
ISBN 978-3-8392-3176-0
Zitat
»Behüte mich, Herr, vor jenen, die mir wohlgesonnen sind …«
Mircea Dinescu
Vorspann
Ich liebe Fahnenmasten, Kirchtürme und sogar Baukräne …
Alles, was hoch ist, fasziniert mich.
Der Mensch strebt doch nach Höherem, nicht wahr? Mir gefällt sogar das Wort: Hoch. Dabei ist es nicht meine Art, allzu lange über Wörter nachzugrübeln. Ich beschäftige mich mit dem Greifbaren, Beweisbaren. Ich schätze, was objektivierbar ist. Ich agiere voller Vernunft.
Wenn ich die vier schlanken Domtürme betrachte, erfasst mich ein Schwindel. Aber keiner, der mich verwirrt oder aus der Fassung bringt, wie es so vielen von diesen Würmlein geht. Nein, mein Schwindel ist wie ein Wirbel, der mich empor trägt und hebt und dem Ziel entgegen treibt.
Ich habe mir viele Ziele gesetzt. Etliche habe ich erreicht. Für manche musste ich gemein kämpfen.
Es gab Leute, die mich kritisierten, bremsen wollten. Sie alle bedeuten mir nichts. Ich konzentriere mich auf meine Größe. Alle Mittel, die ich einsetze, sind anständige Mittel. Ich halte mich an die Strafgesetze. Was gut und böse ist, wird ja durch eine soziale und von mir aus kulturelle Übereinkunft festgeschrieben. Aber ich weiß genau, dass sich solche Übereinkünfte ändern können. Deswegen halte ich mich nur soweit an sie, wie ich es muss. Niemals, sage ich mir, niemals darfst du deine Ziele aus den Augen verlieren.
Diese Stadt ist eine heilige Stadt. Sie verleitet allerdings manchmal zum Träumen. Träume und Gefühle widerstreben mir. Ich halte mich an das, was ich selbst als zweckmäßig und nützlich für meine Ziele erkannt habe. Es fiele mir niemals ein, meine Absichten durch so etwas Banales wie Gefühle aus der Sphäre des Erreichbaren drängen zu lassen. Ich entwerfe einen Plan und führe ihn durch.
Nichts wird mich aufhalten.
Meine Güte, wie vernichtend dumm sind doch die meisten Menschen. Nutzlos und absolut unwichtig.
Selbstverständlich kann ich meine Gefühle im Zaum halten. Alles geschieht auf der Ebene der Tatsachen, der Messbarkeit. Ihr werdet sehen. Ehrgeiz? Ach, was! Ehrgeiz. Ich bin weder geizig noch scharf auf so etwas wie Ehre. Geiz hieße doch, dass die anderen mehr abbekommen könnten vom Kuchen als ich. Aber sie schaffen es ohnehin nicht. Ehre? Ich brauche sie nicht. Ich halte mich unter Kontrolle, überprüfe meine Pläne und befolge alle Strategien, die zu ihrem Erreichen führen könnten. Ich bin zielstrebig. Wie gut, dass wenigstens einige Leute das erkannt haben!
1. Katinka liebt Claude Monet
Sie stand auf der Schwelle eines impressionistischen Gemäldes. So könnte die Welt aussehen! Sie erinnerte sich an die vielen Diskussionsrunden ihrer Studienzeit, in denen schwerwiegende Fragen durchgekaut worden waren:Wie wirklich ist die Wirklichkeit?Katinka jedenfalls sah Klein-Venedig am Flussufer eindeutig so, wie Claude Monet es gesehen haben mochte: Verschwommen, skizzenhaft, geheimnisvoll. Viele kleine farbige Striche formten Fluss und Ufer. Das Licht schlich über die gekräuselte Wasseroberfläche und warf unbekümmerte Reflexe an die Wände der Fischerhäuser. Sanft tanzten die Schelche auf dem Wasser. Büsche und Bäume ließen ihr untertriebenes, helles Aprilgrün leuchten.
»Was sinnierst du?«, wollte Tom wissen und legte den Arm um Katinka.
»Ob Claude Monet wohl kurzsichtig war.«
»Setz deine Brille wieder auf, bevor du sie in die Regnitz schmeißt«, erwiderte Tom. Wie üblich verstand er nur die eine Seite von dem, was sie sagen wollte.
»Nein, im Ernst«, sagte Katinka und tastete nach dem Brillengestell, das sie auf der Brüstung abgelegt hatte. »Meinst du nicht, er hatte einen Augenfehler, und deshalb kam er überhaupt erst auf die Idee zu malen, wie er es getan hat?«
»Keine Ahnung«, brummte Tom desinteressiert. Er war eher auf etwas zu trinken aus und nicht in Stimmung, eine Debatte über Malerei zu führen. »Du könntest bei den Kunsthistorikern nachfragen.«
Typisch Tom. Als Computerfreak meinte er stets, dass sich Rätsel lösen ließen, wenn man Nullen gegen Einsen verrechnete. Mystisches kam ihm gar nicht in den Sinn. Katinka war zwar nicht gerade esoterisch angehaucht, aber einen gewissen Sinn für Spirituelles besaß sie dennoch. Ein Sehfehler schien ihr eine so wunderbare Erklärung für Monets Malstil: Wenn unsere Augen die Wirklichkeit machen, dachte sie, dann ist meine verzerrt, verzaubert und ziemlich unfertig.
Katinka setzte die Brille auf die Nase und blinzelte. Natürlich waren drei Dioptrien noch keine desaströse Kurzsichtigkeit. Irgendwo hatte sie gelesen, dass manche Fachleute Fehlsichtigkeit in dieser Größenordnung einfach als natürliche Abweichung von der Norm sahen. Diese Sicht der Dinge gefiel ihr ganz gut. Normalität war ihr schon immer suspekt gewesen. Nicht gerade ihr Lebensziel, normal genannt zu werden.
»Ich weiß, dass du Durst hast«, schnurrte Katinka, als sie sich endlich von Tom weiterziehen ließ. Tom, der Berliner, der in der fränkischen Provinz hängen geblieben war. Wie er behauptete, wegen der Frau, die er liebte, aber Katinka war sich nur zu bewusst, dass die Gastronomie und insbesondere das herausragende Angebot an heimischem Bier einen wesentlichen Anteil an Toms Wohnortwahl hatte. Sie selbst war eindeutig von den romantischen Momenten Bambergs gefangen, hatte sich deshalb die Stadt als Studienort ausgewählt und sie – außer für diverse Lehrgänge – nicht mehr verlassen.
Sie schlenderten durch den Durchgang des Alten Rathauses, wo ein Gitarrist in Begleitung eines schwarzen Zottelhundes Countrymusic aus seiner zwölfsaitigen Gitarre leierte. Wie immer warf Katinka einige Cent-Münzen in den Hut. Tom hob halb amüsiert, halb genervt die Augenbrauen.
»So toll spielt der nun auch wieder nicht«, sagte er, als sie am Café Bassanese vorbeigingen. Ein paar Leute saßen unter Gasheizern im Freien und genossen den Frühlingsabend.
»Ich weiß, was es heißt, wenn man eine berufliche Durststrecke durchmacht«, gab Katinka trotzig zurück.
»Himmelschimmel!«, rief Tom. »Ich weiß nicht, was du willst. Du hast dein Geschäft doch erst ein paar Monate.«
»Und noch nicht einen einzigen Auftrag.«
»Das dauert eben«, brummte Tom, aber Katinka spürte, dass er selbst nicht ganz überzeugt war. Während sie schweigend die Dominikanerstraße entlanggingen und die Auslagen in den Antiquitätengeschäften in Augenschein nahmen, fragte sie sich zum xten Mal selbstkritisch, ob die Idee, eine eigene Detektei für private Ermittlungen zu gründen, nicht doch ein Schuss in den Ofen gewesen war. Jetzt war sie Existenzgründerin – Katinka Palfy, private Ermittlungen – aber eine, die vom Geld ihres Freundes lebte. Das geht nicht gut, stöhnte Katinka in sich hinein, während sie an Bambergs berühmter Bierkneipe namensSchlenkerlavorbeiflanierten. Links über ihnen schob sich drohend der Dom zwischen die Häuser.
Katinka hatte Geschichte und Archäologie studiert, Fächer, mit denen kein vernünftiger Arbeitgeber etwas anzufangen wusste, wie ihr Vater ihr mehrere Male aus der Ferne mitgeteilt hatte. Er war Architekt in Wien, ein berühmter sogar, und deswegen lebte er die meiste Zeit des Jahres anderswo in der Welt. Manchmal mit Katinkas Mutter, seiner Ex-Frau, manchmal ohne sie. Bisher hatte Katinka seine breitgestreuten Angebote, sie mit Geld zu unterstützen, abgelehnt. Das konnte sie sich natürlich nur leisten, weil sie weitgehend auf Toms Kosten lebte.
Die Negativprognosen ihres Vaters wurden nach ihrem Examen Wirklichkeit. Da nützte auch das Prädikatmit Auszeichnungnichts, das sie für ihre ausnahmslos miteinsbenoteten Prüfungen bekommen hatte. Niemand heuerte Katinka als menschlichen Schaufelbagger an, um – O-Ton Ignaz Palfy – in der Wüste Gobi Steine auszubuddeln. Nach einem halben Jahr Tristesse beschloss Katinka, einen anderen Schnüffeljob zu erlernen. Nicht als Archäologin der Vergangenheit auf die Spur zu kommen, sondern den dunklen Seiten moderner Tage. Sie erwarb ihre Lizenz als Privatdetektivin, arbeitete zwei Jahre unter der Fittiche von Julius Liebitz, einem alten Hasen der Branche, und hatte sich zu Beginn des vergangenen Winters selbständig gemacht. Allerdings war es eine Sache, die formalen Voraussetzungen zu erfüllen, und eine andere, den Anforderungen des Alltags gewachsen zu sein. Seit sie Tag für Tag in ihrem winzigen Büro in der Hasengasse saß und auf Klienten wartete, hielt der Kleinmut in ihrem Herzen Einzug. Verbannt in die Untätigkeit, meldeten sich die Selbstzweifel. Kannst du das überhaupt? Hast du den Mut? Kriegst du das hin? Was, wenn dies oder jenes?
Eine Wespe summte als Dauerbegleiter in ihrem Kopf herum. Katinka spürte sie schon wieder herbeisummen. Müsstest mal wieder zum Friseur, schnarrte sie böswillig. Zu ihrem eigenen Entsetzen griff sich Katinka sofort an den braunen Haarschopf. Friseure waren teuer und sie hatte kein Geld. Zudem war die Wirkung eines Friseurbesuchs bei ihrem störrischen Haar nach zwei Wochen ohnehin wieder verpufft. Sie konnte sich allzu häufige Investitionen dieser Art also sparen.
Und was du da wieder anhast … immer in Jeans, raunte die Wespe und sauste um ihren Scheitel. Meinst du nicht, Tom fände ein Kleid netter? Was Hübsches, bisschen Schickes?
Es ist April, antwortete Katinkas Kopf der Kontrollwespe. Außerdem hasse ich Strumpfhosen. Ich kriege Krätze von ihnen. Und jetzt schwirr ab.
Sie schüttelte den Kopf, als müsste sie die fiese Wespe körperlich loswerden, und warf rasch einen ängstlichen Blick zu Tom. Wie üblich verliefen Katinkas innere Tragödien unter Ausschluss seiner Wahrnehmung. Tom ging selektiv vor. Lichtjahre zuvor hatte sie mit einem Typen namens Sven für einige Monate Bett und Tisch geteilt. Mit ihm war es genauso gewesen. Männer sind lineare Typen, dachte Katinka resigniert. Sie kriegen nur eins nach dem anderen mit. Aber vielleicht ist das auch ganz praktisch. Man kann ziemlich gut eine Menge vor ihnen verheimlichen.
Tom stieß die Tür zum Pizzini auf.
»Komm schon, Kat the Catey«, sagte er fröhlich. Die Aussicht auf ein spritziges Glas Frankenwein belebte ihn.
Sie betraten die enge, dunkle Weinstube und setzten sich an ihren Lieblingsplatz am Kachelofen. Tom griff sofort nach der Getränkekarte und bestellte sich einen Silvaner.
»Ich nehme das Gleiche«, sagte Katinka zerstreut. Tom hatte leicht reden. Er hatte sein Geschichtsstudium abgebrochen, aus Realitätssinn, wie er gerne betonte, und sich zum Programmierer weitergebildet. Auch er war Selbständiger, aber im Unterschied zu Katinka mit Arbeit eingedeckt. Mitunter schuftete er 12 Stunden täglich und mehr vor dem Bildschirm.
Ich gebe mir noch Zeit bis zu den Sommerferien, nahm sie sich vor, während sie die vielen unterschiedlichen Zeichnungen und Gemälde betrachtete, die an den Wänden hingen. Bis August. Wenn ich dann keinen Auftrag habe, sehe ich zu, dass ich einen Job bei einer größeren Detektei kriege. Und außerdem könnte ich zu Tom ziehen. Ich würde eine Menge Kohle sparen.
»Woran denkst du?«, fragte Tom.
Sieh an, grinste Katinka in sich hinein, er merkt, dass ein Kampf im Kopf abgeht.
»Ach, so jobmäßig.«
Sie war sich nicht im Klaren darüber, ob sie das Zusammenziehen gerade jetzt thematisieren wollte.
»Keine Panik«, sagte Tom, hob sein Glas und sah ihr tief in die Augen. »Du schaffst das. Trinken wir drauf. Auf Privatdetektivin Katinka Palfy.«
Katinka musste lachen. »Versprich mir, dass du nie mehr über meine beruflichen Abgründe lästerst.«
»Versprochen!«
Die Weingläser klirrten leise. Tom ist schon in Ordnung, entschied Katinka.
»Zum Wohl, Tom Dooley«, sagte sie. Sie nahm die Brille wieder ab. Im Moment wollte sie nicht scharf sehen.
2. Der Auftrag
Am nächsten Morgen erreichte Katinka halbwegs ausgeschlafen ihr Büro in der Hasengasse mit dem unbestimmten Gefühl, dass etwas geschehen würde. Frühlingszeit war Aufbruchszeit. Auf dem Weg durch die Lange Straße war sie mehrmals zwischen all den frühlingshaft bunt gekleideten Leuten stecken geblieben. Kaum grüßte der Lenz, schlichen die Leute wie die Schnecken und blockierten die Fahrradwege. Beinahe wäre Katinka mit einem Neufundländerhund zusammengestoßen, dessen Besitzer irgendwas von Tierschutz grummelte. Katinka gab eins drauf, vermied den sehnsuchtsvollen Blick in den Optikerladen gegenüber, wo sie vor immerhin schon drei Jahren ihre jetzige Brille gekauft hatte, verdrängte den Gedanken an Kontaktlinsen, die sie sich nicht leisten konnte, nahm den Weg durch die Austraße und bog endlich in die Hasengasse ein.
Nachlässig lehnte sie ihr Rad an die Wand, schloss auf und drückte gegen die Tür. Täglich schleifte sie mit dem gleichen heimtückischen Geräusch über den Boden.
15 Quadratmeter, ein Schreibtisch, Telefon, 2 Besuchersessel, ein Bürostuhl, rückenfreundlich, ein großer Terminplaner an der Wand, ein Hochglanz-Dalí-Poster, ein Plakat über eine Ausstellung der Harry-Potter-Illustratorin Sabine Willharm in der Villa Dessauer, ein Ikea-Kleiderständer und das obligatorische Regal mit juristischen Nachschlagewerken empfingen sie in der Hasengasse 2a. Katinka warf ihre Jacke in den kleinen Nebenraum, wo sich neben einem Spülbecken, Wasserkocher, einem Geschirrschränkchen und dem Faxgerät auch der Ausgang zum gemeinschaftlichen Korridor befand, an dessen Ende die Toilette lag, ein Etagenklo, übrig geblieben aus alter Zeit. Sie checkte Anrufbeantworter und Fax, aber natürlich hatte niemand angerufen oder geschrieben. Routinemäßig kontrollierte sie das Waffenschränkchen, in dem sie ihre Beretta 9000 S aufbewahrte, setzte dann Wasser auf, um sich einen Tee zu kochen, und machte es sich so gut es ging auf dem Schreibtischstuhl bequem. Seit einigen Wochen schon quälte sie sich durch einen Wälzer über moderne psychologische Gesprächsverfahren in der Ermittlungsarbeit. Das Buch war ihr von ihrem ehemaligen Mentor Julius Liebitz empfohlen worden. Eigentlich schätzte sie seine Meinung. Doch während Katinka nun die Seiten umblätterte, hatte sie immer mehr den Eindruck, nutzlose und obendrein völlig belanglose Ratschläge zu bekommen, um die sie nicht gebeten hatte. Sie stand auf dem Standpunkt, durch Intuition mehr Geheimnisse aufspüren zu können als durch unterkühlte Analyse, aber Tom war da ganz anderer Meinung. Er vertrat die Auffassung, dass das emotionslose Zerlegen eines Problems sein Verständnis nur fördere. Die Wahrnehmung durch Intuition könne ja dann folgen. Katinka blickte auf die Überschrift von Kapitel 3:Pathologische Persönlichkeitsveränderungen. Schon spürte sie, wie sie am liebsten wegdämmern würde. Der typische Sachbucheffekt. Frustriert legte sie das Buch weg und goss sich Tee auf.
Das Telefon klingelte.
Katinka starrte den Apparat entsetzt an. Noch niemand hatte diese Nummer in den letzten Wochen und Monaten gewählt. Tom und ihre Bekannten erreichten sie über ihr Handy. Katinka stellte die Tasse ab und merkte, dass ihre Hand zitterte.
»Palfy, private Ermittlungen, grüß Gott?«
»Hauke von Recken. Tag, Frau Palfy. Sie kennen mich noch?«
»Herr von Recken!« Katinka musste schlucken. Klar, sie kannte ihn noch, wie könnte sie ihn vergessen, noch dazu bei diesem Namen!
»Das ist wirklich eine Überraschung«, ergänzte sie. Allerweltssatz, stichelte die Kontrollwespe.
»Das freut mich zu hören«, reagierte er sonor mit seinem stark westdeutsch geprägten Akzent. »Wie geht es Ihnen?«
Katinka zögerte. Ihr ehemaliger Archäologieprofessor war ihr immer der sympathischste unter den Dozenten gewesen. Unprätentiös und weitgehend frei von Dünkel, was ihn deutlich von seinen akademischen Mitstreitern unterschied. Er hatte ihr nach dem Examen angeboten, zu promovieren, aber sie hatte nach einigen Nächten des Nachdenkens abgelehnt.
»Danke. Sehr gut. Und Ihnen?«
Sie hoffte, er würde ihrer Stimme die Irritation nicht anhören. Vielleicht sollte ich doch noch promovieren, überlegte sie, denn Zeit habe ich bei meiner momentanen Auftragslage ja mehr als genug.
»Auch gut. Aber tauschen wir keine Höflichkeiten aus. Sie kennen meine Einstellung: Es ist schade, dass Sie die Universität verlassen haben!«
»Ich nehme das als Kompliment«, erwiderte Katinka, die sich allmählich fasste. »Aber sicherlich rufen Sie nicht an, um mir meine Einstellung zur Welt des Elfenbeinturms unter die Nase zu reiben?«
Hauke von Recken lachte. Es war dieses unterschwellige, amüsierte Lachen, das er gerne und häufig zu Gehör brachte, und das Katinka, wie sie nun feststellte, richtig vermisst hatte.
»Selbstverständlich nicht. Wie sollte ich Sie jemals umstimmen? Sie sind ja hartnäckig wie ein gut durchgebratenes Steak.«
Auch seine Ausdrucksweisen hatte Katinka immer sehr witzig gefunden. Im Augenblick hatte sie allerdings den Eindruck, dass er in seiner versucht scherzhaften Selbstdarstellung übertrieb. Es konnte allerdings auch daran liegen, dass sie den Unijargon einfach nicht mehr gewohnt war.
»Nein, im Ernst, Frau Palfy«, machte er weiter. »Ich rufe Sie an in Ihrer neuen Eigenschaft als … Detektivin.« Er ließ sich das Wort auf der Zunge zergehen.
»Tatsächlich?« Katinka hielt den Atem an. In ihrer Fantasie sah sie schon ein paar Dozenten mit Messern im Rücken vor Hauke von Reckens Bürotür liegen. »Worum geht es denn?«
»An der Uni gibt es Probleme«, sagte der Archäologieprofessor. Katinka konnte förmlich vor sich sehen, wie er beim Telefonieren die Rundung seiner Fingernägel kontrollierte. »Nicht bei mir am Lehrstuhl, überhaupt nicht bei uns oder den Historikern … na ja, Sie kennen ja unsere kleine Welt.« Er pausierte gekonnt und steigerte Katinkas Spannung ins Unermessliche.
»Jedenfalls, ein Kollege von mir, Romanist, hat Schwierigkeiten an seinem Lehrstuhl. Es geschehen eigenartige Dinge dort.«
Katinka zog ihr Notizbuch zu sich heran und angelte einen Bleistift aus dem Gurkenglas mit Schreibutensilien.
»Welcher Lehrstuhl?«, fragte sie.
»Ich höre, Sie beißen an. Erinnern Sie sich? Bei den Ausgrabungspraktika? Ich musste nur eine ungefähre Beschreibung des Projektes abgeben, und schon waren Sie Feuer und Flamme.«
»Welcher Lehrstuhl?«, wiederholte Katinka. »Romanisten gibt es doch mehrere an der Uni, oder?«
»In der Tat«, antwortete Hauke von Recken. Er schien zu spüren, dass Katinka auf Plaudereien zu ihrer studentischen Vergangenheit keinen größeren Wert legte.
»Professor Doktor Milo Laubach«, sagte er, und Katinka schrieb sich den Namen rasch auf. »Er ist Linguist, hat für die Zauberfee der Literatur also wenig übrig. Milo ist eine sehr bekannte Figur unter den romanistischen Philologen dieser Welt. Er ist geschätzter Herausgeber einflussreicher Publikationen, Sie wissen schon. Kennen Sie ihn?«
»Noch nicht«, gab Katinka zurück. All diese Lobpreisungen waren ihr sofort suspekt. »Was genau sind die Probleme?«
»An seinem Lehrstuhl verschwinden Sachen«, sagte Professor von Recken. Katinka ließ enttäuscht den Bleistift sinken.
»Es verschwinden Sachen?«
»Ja, nicht Radiergummis oder die Kaffeekasse, sondern richtig wichtige Dinge. Datenbestände auf den Computern werden gelöscht, Disketten gestohlen, CDs unbrauchbar gemacht. Niemand kann sich vorstellen, wer dahinter steckt, und meinem Kollegen fehlt, wie soll ich sagen, ein wenig der Überblick«
»In welcher Hinsicht?«
»Er hat etliche Mitarbeiter«, sagte Hauke von Recken und räusperte sich. »Ich will das jetzt nicht kommentieren, aber Milo hat es offensichtlich geschafft, trotz Sparzwängen auf einige Fetttröge zuzugreifen. Er hat zwei Assistentenstellen, eine Vollzeitsekretärin, Projektmitarbeiter, Tutoren, studentische Hilfskräfte … alles, was wir anderen uns wünschen, aber nie bekommen.«
Katinka stöhnte im Stillen. Hier flammte sie wieder auf, die Akademikerneurose, Nervenplage ihrer Studienzeit. Subtile Anschuldigungen, Missgunst, Neid. Immer schwang in der Kritik, die vermeintlich auf die sachliche Ebene bezogen schien, persönliche Animosität mit und die Feststellung, selber der Beste zu sein, besser als alle anderen, wenn diese große Wahrheit auch noch nicht die Welt ausreichend zu durchdringen vermocht hatte.
»Professor Laubach hat seine eigenen Mitarbeiter im Verdacht, kommt aber nicht dahinter, wer Disketten stiehlt, ist das korrekt?«
»So habe ich es auch verstanden. Na ja, kürzlich tagte der Promotionsausschuss, dem ich als Vorsitzender angehöre.« Von Recken machte eine Kunstpause, um Katinkas Lob bezüglich seiner zahlreichen Aktivitäten einzusammeln, aber es kam nichts. Also fuhr er fort: »Laubach erzählte mir bei einem Kaffee, was sich bei ihm am Lehrstuhl tut. Er hat seine Räume ja auch so weit ab vom Schuss, an der Weide, gleich bei der Konzerthalle. Weit genug entfernt, um den guten Milo und seine Mannschaft nicht allzu oft zu Gesicht zu bekommen.«
»Ist dies ein Auftrag an mich?«
»Brauchen Sie einen?«, kam es zurück.
Katinka legte den Bleistift weg und zählte bis zehn, ehe sie antwortete. Mit einem Mal konnte sie nicht mehr verstehen, dass sie von Recken einmal besonders sympathisch gefunden hatte.
»Wer ist der Auftraggeber? Sie? Ich frage wegen der Rechnung.«
»Um Himmels willen!«, rief von Recken nun ehrlich erschrocken. »Selbstverständlich nicht. Ich habe Milo lediglich erzählt, dass eine meiner besten Absolventinnen«, er hielt wieder inne, aber Katinka reagierte nicht, »inzwischen lizenzierte Detektivin ist. Milo möchte verständlicherweise nicht zur Polizei gehen, so spektakulär ist das alles ja nicht.«
»Sie wollen sagen, es ist eine so langweilige Angelegenheit, dass ruhig eine Privatdetektivin daran üben kann«, entfuhr es Katinka. Nicht sehr professionell, hätte Tom jetzt gesagt.
»Aber, wo denken Sie hin! Frau Palfy! Nein, nein, so ist das keineswegs gemeint. Versetzen Sie sich in Laubachs Lage! Ein Lehrstuhlvertreter, der seine Leute nicht unter Kontrolle hat – peinlicher geht’s nicht. Milo hat viele Neider! Sie wissen doch, wie das ist: Manche üben ein richtig hartes Regime aus, andere lassen ihre Mannschaft machen, was sie will!«
Katinka blätterte angelegentlich in ihrem Notizbuch.
»Ich habe erst heute Nachmittag wieder einen Termin«, sagte sie schließlich. Von Recken sollte keinesfalls von ihrem mühsamen Weg in die Selbstständigkeit erfahren. »Ich kann bei Laubach vorbeigehen. Ist er jetzt in seinem Büro?«
»Er lehrt nur donnerstags und freitags. Er müsste also dort sein. Weide 18, im ersten Stock. Das finden Sie schon. Kein sehr repräsentatives Gebäude. Schauen Sie vorbei? Dann rufe ich Milo an und sage ihm, dass Sie kommen.«
Katinka verabschiedete sich und packte ihr Notizbuch in ihren Rucksack. Wenn sie nicht einmal eine Adresse fände, würde sie als Detektivin tatsächlich wenig taugen. Sie aktivierte den Anrufbeantworter, stellte die schmutzige Teetasse ins Spülbecken und schloss die Tür hinter sich ab.
Selbständig zu sein war immer ihr Traum gewesen, wegzukommen von Gremien und Kommissionssitzungen das vorderste Ziel, um ihre noch funktionstüchtigen Nerven zu retten. Katinka Palfy – private Ermittlungen stand auf einem simplen Computerausdruck, den Tom für sie ins Fenster geklebt hatte. Nun war sie also auf dem Weg zu ihrem ersten Auftrag – so es denn einer werden sollte. Während sie ihr Rad schnappte, fragte sie sich, warum der berühmte Romanist ausgerechnet an der Weide ein abgelegenes Domizil bezogen hatte, und nicht in den viel zentraler gelegenen, schön hergerichteten Gebäuden, die an die Austraße oder den Heumarkt angrenzten. Sie schob das Rad die Hasengasse hinunter durch das Tor, warf einen kurzen Blick auf das Hasenwappen links oben an der Mauer und schwang sich auf den Sattel.
Fünf Minuten später stand sie vor dem Universitätsgebäude Weide 18. Graugesichtig lag es gegenüber einer kleinen Grünanlage mit Spielplatz. Neben der breiten Eingangstür führte ein Tor auf einen schmuddeligen Hinterhof, auf dem einige Autos parkten. Was vom Asphalt zu sehen war, wirkte desolat, aufgesprungen, kaputt. Einige Fliederbüsche trotzten der Tristesse und schickten sich an, zu blühen. Die Atmosphäre erschien Katinka ganz und gar nicht akademisch. Sie schloss ihr Rad ab und stieß die Tür auf. Ein muffiger Geruch empfing sie in dem halbdunklen Treppenhaus. Hier wurde offensichtlich wenig geputzt und wenig gelüftet. Sie gab sich alle Mühe, die eigenartige Beklemmung abzuschütteln, die sie erfasste, als sie die Stufen in den ersten Stock hinaufstieg. Auf dem oberen Treppenabsatz blieb sie unvermittelt stehen.
Hier herrschte ein ganz anderes Klima als zwanzig Stufen weiter unten. Die Fenster waren auf Hochglanz geputzt, und saubere, hauchfeine Gardinen verschleierten den Blick auf die Fliederbüsche im Hof. Der Boden war gewienert worden, Katinka grinste ihrem Spiegelbild unter sich zu. In modernen Rahmen hingen Drucke an den Wänden – alle stellten irgendwelche verfremdeten Schriftzüge dar, französische und lateinische Wörter, die kalligrafisch verzerrt wurden oder sich ins Unendliche wiederholten. Ein Schwarzes Brett nahm die eine Seite des Korridors fast völlig ein. Ganz anders als die sonstigen Korkwände an der Uni hingen hier keine ausgebleichten Fresszettel von verzweifelten Zimmersuchern, sondern ordentliche Computerausdrucke mit den Ergebnissen von Prüfungen, Vortragsankündigungen und Hinweise auf Raumänderungen im Sommersemester.
Fünf Türen gingen von dem Korridor ab, und alle waren sie sperrangelweit geöffnet. Katinka ging einfach auf die mittlere Tür zu und klopfte an den Rahmen. In einem recht kleinen Raum saß eine Dame an einem Computer und tippte energisch.
»Morgen«, sagte Katinka.
»Sie wünschen?« Die Sekretärin drehte sich halbherzig in ihrem Schreibtischstuhl zur Tür und signalisierte durch permanente rückwärtsgewandte Blicke auf ihren Bildschirm, dass sie sich ungern stören ließ.
Katinka zog aus der Brusttasche ihrer Jacke ihre Karte und legte sie auf die Computertastatur. »Palfy, private Ermittlungen. Melden Sie mich bei Herrn Laubach an?«
»Der Herr Professor Laubach hat gerade noch eine Besprechung. Heute ist nämlich unser Jour Fixe.«
Katinka zuckte die Achseln.
»Ich habe nicht viel Zeit. Soweit ich weiß, liest Herr Laubach«, sie ließ absichtlich das Professor weg, »donnerstags und freitags. Es wäre nett, wenn Sie trotz Jour Fixe mal bescheid geben könnten. Sagen Sie Grüße von Professor von Recken.«
Die Sekretärin erhob sich etwas steif, mühte ein Lächeln auf ihre rotgeschminkten Lippen und sagte gezwungen geduldig:
»Ich will sehen, was ich tun kann.«
Katinka studierte das Namensschild neben der Tür.Anna-Beata Först, Sekretariat, stand darauf. Und in kleineren Buchstaben:Scheinausgabe nur freitags, 10 bis 11 Uhr. Donnerwetter, dachte Katinka, und lehnte sich an den Türrahmen. Die armen Studenten. Sie beobachtete, wie Frau Först zu dem hintersten Zimmer auf der rechten Seite ging und an die offene Tür klopfte. Sie war recht klein und dünn, bestimmt trug sie gerade mal Größe 36 oder lebte von Kindergrößen. Ihr rotgefärbtes kurzes Haar leuchtete im Gegenlicht. Sie erinnerte Katinka an Pumuckl, doch das strenge Kostüm und ihr bemüht vornehmes Gehabe machten den heiteren Eindruck wieder zunichte.
Frau Först kehrte um und marschierte auf klackenden Absätzen auf Katinka zu. Hinter ihr strömten Leute aus dem Zimmer des Professors und verteilten sich stumm auf die verschiedenen Zimmer. Keiner schloss eine Tür.
»Herr Professor Laubach erwartet Sie. Kommen Sie bitte mit.«
Sie hatte diese fränkische Art, bitte zu sagen, aber dabei einen militärischen Kommandoton an den Tag zu legen, der die zur Schau gestellte Höflichkeit Lügen strafte.
Katinka nickte und betrat das Büro des berühmten Professors.
Ein Koloss thronte auf einem ledergepolsterten Lehnstuhl hinter einem wuchtigen Schreibtisch. Der Professor war dick, sehr dick, und konnte anscheinend nur noch sitzen, indem er sich in seinem Spezialstuhl weit zurücklehnte. Auf seinem roten Gesicht glänzten Schweißperlen, und seine Glatze wurde von einem rostroten Kranz aus Resthaar eingerahmt.
»Grüß Gott«, sagte Katinka.
»Frau … Palfy? Grüß Gott. Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Frau Först, keine Telefonanrufe, bis ich Ihnen Bescheid gebe. Und die Tür zu.«
Zu Katinkas Verwunderung hatte er keine Donnerstimme, sondern eine samtige Sprechweise, mit der er die Wörter breitdrückte.
»Prof. von Recken rief mich heute früh an und erzählte mir, dass Sie Interesse an der Aufklärung einiger kleinerer Probleme haben«, begann Katinka und wischte mit einer kurzen Handbewegung all ihre wirren Gedanken beiseite.
»Frau Palfy«, unterbrach Professor Laubach. »Vielleicht hat von Recken genau das behauptet – kleinere Probleme. Leider muss ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, da sich diese vermeintlich kleineren Probleme allmählich auswachsen … sie werden sogar richtig unangenehm.«
»Erzählen Sie!« Katinka fischte ihr Notizbuch aus ihrem Rucksack.
»Seit einigen Wochen verschwinden an meinem Lehrstuhl Dinge. Beispielsweise die Ausgangspost. Ich diktiere Briefe, sehr häufig wichtige Schreiben, Frau Först wirft sie in den Ausgangspostkasten, aber sie kommen nie an. Ich glaube nicht mehr an die unzuverlässige Post oder an einen Spinner in der Poststelle der Universität.« Er kratzte sich die Glatze, wobei er seinen Arm verdrehte und von hinten auf seinen Kopf fasste. Es sah sehr skurril aus. »Ich habe den Eindruck, jemand von meinen Leuten greift in das Postausgangsfach und holt die Briefe wieder heraus.«
»Haben Sie jemanden im Verdacht?«, fragte Katinka, die sich eifrig Notizen machte.
»Nein. Es könnte jeder von meinen Leuten sein.«
Katinka betrachtete den billigen Werbekuli in ihrer Hand.
»An das Postfach kommt man einfach so ran?«
»Ja. Es ist nicht verschlossen. Ich habe inzwischen bei der Materialstelle einen verschließbaren Schrank geordert, aber Sie wissen ja, bis das genehmigt wird …«
Er wedelte mit seiner rechten Hand herum und kratzte erneut seine Glatze, während sein Blick sich nachdenklich auf den Hinterhof richtete.
»Wir arbeiten«, Laubach räusperte sich, »intensiv an einem Projekt zur romanischen Wortbildung. Ein umfassender Vergleich der romanischen Sprachen und ihrer Suffixe, Präfixe, also Nachsilben, Vorsilben …« Er verhedderte sich, als er versuchte, seine Fachausdrücke allgemeinverständlich wiederzugeben. »Da werden enorm viele Daten dokumentiert. Wir haben dazu ein sehr gutes, sehr geeignetes Computerprogramm, das uns ein Absolvent maßgeschneidert hat, Rumolt Lennert.«
Das wäre auch ein Auftrag für Tom gewesen, dachte
Katinka kurz.
»Meine Oberassistentin Fria Burgwart, mein Assistent Ludovic Montfort und eine Doktorandin Elfi Lodenscheidt arbeiten an dem Projekt. Nun passiert folgendes: Ab und zu, in unregelmäßigen Abständen, werden neue Dateien durch alte Versionen überspielt. Das ist katastrophal, verstehen Sie!« Laubach zerrte ein Stofftaschentuch größeren Ausmaßes aus seiner Hosentasche und wischte sich über die Glatze. Die roten Resthärchen standen nun struppig nach oben. Hilflos wedelte er mit seinen Händen vor seinem Gesicht herum. »Ich habe einfach keinerlei Ahnung, wer hinter all dem steckt, verstehen Sie? Keine Ahnung. Keine Beobachtungen. Nichts. Immerhin habe ich veranlasst, dass immer alle Türen geöffnet sind, wenn hier gearbeitet wird, aber natürlich sind abends oder nachts andere Gesetze am Wirken.«
Katinka schrieb etwas in ihr Notizbuch. Was meinte er mit andere Gesetze sind am Wirken?
»Was meinen Sie damit?«, fragte sie arglos.
»Jeder kann hier rein! Alle meine Mitarbeiter haben Schlüssel für die Haustür unten und für ihre Zimmer. Das sind drei: eines für die studentischen Hilfskräfte, eines für die Assistenten Burgwart und Montfort und ein Bibliothekszimmer. Den Schlüssel dafür bewahrt Fria Burgwart auf, übrigens auch den zum Sekretariat. Im Bibliothekszimmer befinden sich auch noch drei Computerarbeitsplätze«, fügte Laubach hinzu.
Katinka schwirrte der Kopf.
»Jeder Mitarbeiter kann in sein Zimmer, aber die Assistenten haben die Schlüssel zu allen anderen Räumen?«
»Ja«, antwortete Laubach mit einem Seufzer. »Nur nicht für mein Zimmer. Dieser Schlüssel ist im Sekretariat versteckt, und den Platz kennt nur Frau Först.«
»Also ist Ihr Büro am sichersten, kann man das so sagen?«
»Ja. Aus meinem Zimmer ist auch noch nie etwas verschwunden.«
Laubach blies die Luft aus seinen Nasenlöchern, es klang wie Meeresrauschen. »Ich habe bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein paar Freunde«, dozierte er weiter. »Deshalb bekam ich das ehrgeizige Projekt auch schon zweimal verlängert. Es ist auch ein Imperativ der Forschung, es ist«, er schnaubte wieder, »aber was erzähle ich Ihnen das. Sie sind Historikerin und Archäologin, hat Hauke mir gesagt.«
»Das ist richtig«, antwortete Katinka, während sie sich abmühte, eine gewisse Ordnung in ihre Notizen zu bekommen.
»Warum haben Sie nicht promoviert?«
»Das hatte verschiedene Gründe«, entgegnete Katinka. Wie oft hatte Julius Liebitz, ihr Mentor, sie daran erinnert, dass die Detektivin die Fragen stellte.
»Sie erinnern mich gewaltig an Rumolt Lennert«, sagte Laubach leutselig. »Komischer Name, nicht? Sein Vater war ein intimer Kenner des Mittelalters, und er liebte die Nibelungensage. Rumolt war der Küchenmeister, Sie kennen das ja sicher. Jedenfalls, der arme Junge hat jetzt diesen Namen. Und er plant, seinen Vater zu übertrumpfen: Er wettet, er lernt das gesamte Nibelungenlied auswendig – in Mittelhochdeutsch! Sein Vater«, fügte Laubach hinzu, »kann es auch auswendig. Aber in neuhochdeutscher Übersetzung.«
Katinka musste an sich halten, um nicht vor Verwunderung den Kopf zu schütteln. Laubach hielt soviel Eifer offensichtlich für verehrungswürdig.
»Ich brauche eine Liste aller Mitarbeiter. Wenn möglich auch ihrer Arbeitszeiten. Wie sieht es mit Putzfrauen aus?«
»Daran habe ich gleich am Anfang gedacht«, sagte Laubach. »Die Uni beschäftigt keine eigenen Putzfrauen, sondern mietet sich Putzkolonnen von Reinigungsfirmen. Die kommen alle aus Osteuropa, die Mädchen«, fügte Laubach hinzu. »Man kann sich nicht mal mit ihnen verständigen.« Er schüttelte den Kopf. Katinka starrte ihn verwundert an. Ein großer, berühmter Linguist, der an Sprachbarrieren scheiterte?
»Ich denke, die Putzfrauen würden womöglich die Kaffeekasse stehlen, aber doch nicht an unseren Datenbeständen herumfummeln«, machte Laubach weiter. »Außerdem sind die Computer alle mit einem Passwort geschützt.»
«Und das heißt«, sagte Katinka, »dass nur jemand überhaupt Daten verändern kann und alte Versionen über die aktuellen spielen kann, der das Passwort kennt.«
»Sie haben’s erfasst, Frau Detektivin«, sagte Laubach. »Es muss einer meiner Mitarbeiter sein, oder eine studentische Hilfskraft. Seit Beginn des Wintersemesters hatten wir sechsmal eine Manipulation, und jedes Mal ging die Arbeit von Wochen flöten.«
»Was ist mit dem Nibelungenverehrer?«
»Rumolt Lennert kommt nur, wenn es Probleme mit den PCs gibt. Genauer gesagt mit seinem Programm. Aber er kennt das Passwort nicht. Kümmern Sie sich drum. Und sprechen Sie mit Stielke. Er ist am schlimmsten dran.«
Laubach ging bei seiner Berichterstattung nicht gerade systematisch vor.
»Wer ist Stielke?«
»Carsten Stielke, unser Tutor. Er promoviert bei mir, und nun sind all seine Daten abhanden gekommen.«
»Um Himmels willen!«, entfuhr es Katinka. Sie hatte beim Abfassen ihrer Magisterarbeit unter der Vorstellung gelitten, ihr Computer könne abstürzen und all ihre Arbeit zunichte machen. Beinahe neurotisch geworden, hatte sie täglich Sicherheitskopien angefertigt.
Laubach nahm den Telefonhörer ab und sagte: »Frau Först, drucken Sie für Frau Palfy mal unsere Personalliste aus. Und alle sollen im Haus bleiben. Die Detektivin wird sich jetzt umhören. Ich will, dass sie mit jedem sprechen kann.«
Überrumpelt starrte Katinka Laubach an. So sollte es nicht laufen, dass ihr Auftraggeber festlegte, wann sie wen zu befragen hatte.
»Augenblick«, sagte Katinka, als Laubach aufgelegt hatte. »Kommen wir noch zum Geschäftlichen.« Sie nannte ihre Bedingungen und ärgerte sich, dass ihre Stimme plötzlich höher und irgendwie nervös klang.
»Ich zahle Sie privat, aus eigener Tasche«, sagte Laubach, der seine Brieftasche zückte. »Denn ich nehme an, dass die Verwaltung keinen Topf bereithält, um private Ermittler zu bezahlen!«
Katinka zog ihren Quittungsblock heraus, den sie kurz vor Weihnachten angeschafft, bis jetzt aber nicht benötigt hatte, und schrieb stolz den Betrag hinein. Frau Först klopfte.
»Hier die Liste, Herr Laubach. Ich würde dann in die Mittagspause …«
»Nichts da!«, unterbrach Laubach. »Sie bleiben, bis Frau Palfy mit Ihnen gesprochen hat.«
»Mit mir?« Anna-Beata Först wurde blass, und diese Gesichtsfarbe stach sich böse mit dem feuerroten Haar. »Aber ich …«
»Ich verdächtige Sie nicht!«, sagte Laubach ungeduldig. »Aber es muss alles seine Ordnung haben, nicht? Frau Palfy möchte nachher abhaken, was sie unternommen hat. Sie wissen doch.«
Katinka, die aufgestanden war und sich ihren Rucksack schwungvoll über die Schulter warf, hatte den Eindruck, Laubach spräche mit einem Kind, das ihm systematisch die Nerven tötete. Sie griff nach der Liste, die Frau Först immer noch in der Hand hatte.
»Ich werde mit jedem einzeln sprechen. In welchem Raum sind wir ungestört?«
»Frau Först zeigt Ihnen alles. Bis dann!« Laubach streckte Katinka seine Hand hin.
3. Laubachs Mitarbeiter
Fria Burgwart saß an dem schlichten Arbeitstisch mit Resopalplatte. Ihre Finger mit den abgekauten Nägeln strichen hektisch über ihr Dekolleté. Katinka wollte beinahe tröstend auf sie einreden, so bedauernswert sah sie aus. Das lange, dichte rote Haar hatte sie im Nacken zusammengebunden. Eine Menge Strähnen widersetzten sich dem Haargummi und spießten aus dem Pferdeschwanz hervor wie rote Stacheln. Ihr Sweatshirt schlotterte ausgeleiert um ihren dünnen Körper und erschien obendrein viel zu warm für das sonnige Wetter. Auf ihrem milchweißen Gesicht blühten lustige Sommersprossen. Aber Fria Burgwart schien gar nicht der Typ für Sommersprossen. Ihr Blick war stumpf und erschöpft, und wenn die Tatsache, von einer Detektivin befragt zu werden, sie nicht aufgeschreckt hätte, wäre sie wahrscheinlich einfach nur müde gewesen.
»Sie sind Oberassistentin?«, begann Katinka. Sie ignorierte halbwegs den staubigen Geruch im Zimmer. Konzentriert betrachtete sie Fria Burgwarts spitzes Gesicht.
»Ja«, hauchte sie.
»Wie lange arbeiten Sie denn schon bei Professor Laubach?«
»Vier Jahre.«
Katinka lächelte ihr Gegenüber gewinnend an. »Dies ist Ihr Dienstzimmer?«
Der Raum, in dem sie saßen, war groß, aber sehr dunkel. Nur ein kleines Fenster ließ Helligkeit herein. Auch die Regale, die sich an den Wänden entlang reihten, schienen das Licht zu schlucken. Laubach bewahrte hier wohl etliche aus der Bibliothek ausgelagerte Bände auf. An den Brettern klebten Zettel mit Signaturen und der Aufschrift Handapparat.
»Ja. Ich teile es mit Ludovic.«
»Ist er Franzose?«
»Ja, ist er. Er vertritt Helenas Stelle.«
Katinka verabscheute es, wenn Eingeweihte Außenstehenden gegenüber nur Vornamen erwähnten. Es suggerierte eine Nähe, die keine war. Rasch warf sie einen kontrollierenden Blick auf die Liste, die die Sekretärin ausgedruckt hatte.
»Helena Jahns-Herzberg befindet sich im Erziehungsurlaub?«
»Ja«, sagte Fria, und verfiel wieder in Schweigen.
»Sie arbeiten an dem romanischen Wortbildungsprojekt mit?«
»O ja«, rief Fria. »Hat Professor Laubach Ihnen davon erzählt? Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Ich arbeite unheimlich viel, investiere enorm viel Zeit. Aber es ist wirklich interessant, etwas ganz Besonderes, wirklich, und in der Fachwelt wird mit Spannung erwartet, wie unser Werk am Ende aussehen wird.«
»Zeigen Sie mir doch mal so eine Datenbank«, bat Katinka. Fria sprang sofort auf, Fachbezogenes schien sie aus ihrer Lethargie zu wecken. Sie war sehr groß, beinahe einen ganzen Kopf größer als Katinka. Doch ihre eingefallene, kraftlose Haltung ließ sie kleiner erscheinen, als sie eigentlich war. Umständlich stellte sie einen zweiten Stuhl neben die Computertischchen. Hochmoderne Flachbildschirme thronten auf den peinlich sauber aufgeräumten Arbeitsplatten.
»Wir zeigen eigentlich niemandem unsere Ergebnisse«, sagte Fria jetzt, als sie den Computer startete und abwartete, während Windows seine Oberfläche allmählich aufbaute.
»Ich bin ja nicht vom Fach«, entgegnete Katinka.
»Ja ja«, sagte Fria zerstreut. Sie zappelte mit der Maus auf dem Tisch herum, ungeduldig wartend, dass sie endlich ein kleines Karteikastensymbol anklicken konnte. »Ich meine ja nicht, dass es so was wie Spionage bei uns geben könnte. Aber in nicht ganz zwei Wochen findet unter Professor Laubachs Ägide ein Kolloquium statt. Wir bereiten es hier an unserer Universität vor, wissen Sie, und wir hoffen, die Universität Bamberg auf diese Weise mal wieder in die Schlagzeilen zu bringen.«
Hektisch klickte Fria auf ein Icon. Eine Passwortabfrage erschien. Katinka starrte gebannt auf Frias Finger, aber es war ihr unmöglich, abzulesen, was Fria eingab.
»Wir ändern das Passwort oft genug, aber es hat nichts geholfen. Wirklich eine Katastrophe. So, jetzt sehen wir hier«, ungeduldig wippte sie mit ihren Beinen und stieß dabei mit den Knien von unten gegen den Tisch, »verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Ihnen den gesamten Datenbestand zeigen, das wäre dieser Ordner …« Sie klickte herum und erging sich in Erklärungen, die Katinka beinahe schwindelig machten.
»Wo genau werden die aktuellen Daten durch alte Kopien ersetzt? Passiert das immer an der gleichen Stelle?«, wollte sie wissen.
»Fast«, antwortete Fria. »Für jede einzelne Sprache, die wir untersuchen, gibt es eine Datei. Allerdings arbeiten wir nicht an diesen Originaldateien, sondern jeder Kollege kopiert die Datei, die ergänzt werden soll, auf eine Diskette, verändert und erweitert die Daten den Analysen gemäß also nicht auf der Festplatte. Erst, wenn der Bearbeiter oder die Bearbeiterin fertig ist, druckt er oder sie die neue Version aus und kopiert dann die neue Datei über die alte. Anschließend wird die Diskette gelöscht.« Atemlos fügte sie hinzu: »Finden Sie das nicht auch nervig, wenn man immer mit gedachten Schrägstrichen sprechen muss? Der Bearbeiter Schrägstrich die Bearbeiterin, er Schrägstrich sie, ihm Schrägstrich ihr.« Fria fuchtelte mit ihren dünnen Fingern knapp vor dem Flachbildschirm herum, als wolle sie ihn abstauben.
»In der Tat!«, antwortete Katinka, wohl wissend, dass ihre Ansicht gerade nicht als modern galt. Sie fand nur, dass sprachliche Hässlichkeit der Sache der Frauen keinen Bonus einbrachte und den Blick auf Nebenschauplätze lenkte.
»Gut«, sagte sie zu Fria. »Das scheint mir ein sicheres System zu sein. Aber wie machen Sie die Sicherheitskopien?«
»Wir haben ein extra Speicherlaufwerk. Seitdem ein paar Mal Daten abhanden gekommen sind, haben wir auch jeden Abend eine CD gebrannt.«
»Dann kann Ihnen ja jetzt nichts mehr passieren, oder?«
»Das Brennprogramm funktioniert zur Zeit nicht«, sagte Fria. »Jemand hat daran manipuliert. Wir müssen es neu installieren, aber da brauchen wir jemanden vom Rechenzentrum, wegen der Lizenz.«
»Momentan können Sie also keine CDs herstellen? An keinem Computer?«
Fria schüttelte den Kopf und wischte sich ihre Hände an den Oberschenkeln ab.
»Ludovic ist zuständig für Absprachen mit dem Rechenzentrum. Bis jetzt hat sich nichts getan.«
»Was ist mit dem Speichermedium?«
»Funktioniert auch nicht.«
»Ach so?« Katinka zog die Augenbrauen hoch. »Schon ziemlich seltsam, wenn gleichzeitig verschiedene Speichermöglichkeiten ausfallen, oder?«
Fria lief knallrot an, wurde im nächsten Augenblick wieder weiß wie Milchreis und umklammerte ihren Hals mit den Händen.
»Das Motherboard ist an der Stelle kaputt«, sagte sie. Ihre Stimme klang ganz heiser.
»Motherboard? Mutterbrett?«
Katinka wusste durch Tom sehr genau Bescheid, aber sie wollte sehen, inwieweit sich Fria auskannte.
»Das Speichermedium hängt an einem USB-Anschluss. Und der befindet sich an der Rückseite des Computers. Was weiß denn ich«, sie ruderte wieder mit ihren dünnen Fingern herum, »aber genau dieser Anschluss ist kaputt. Gestört. Es wird kein Kontakt hergestellt. Nirgends.«
»Kann das nicht gerichtet werden?«
»Könnte, theoretisch«, stöhnte Fria und setzte die typisch akademische Leichenbittermiene auf. »Aber die Leute vom Rechenzentrum sind unterbesetzt und völlig überlastet. So schnell schicken die keinen.«
Katinka seufzte leise. Beim Staat würde sie niemals arbeiten können. Es gab einfach keine Konkurrenz, die allen Beteiligten Feuer unterm Hintern machen könnte. Dennoch kam es ihr eigenartig vor, dass bei einem solchen Problem nicht recht flott jemand zur Stelle war.
»Ich verstehe aber nicht, wieso Sie nicht die aktuellen Dateien relativ einfach wieder herstellen können – von den Sicherungen, egal ob auf einem extra Speichermedium oder …«
»Nein, alles ist kaputtgemacht worden«, jammerte Fria. »Der, der es gemacht hat«, atemlos holte sie Luft, »kennt das System eben sehr gut und zerstört nicht nur die Datei auf der Festplatte, sondern alle Sicherungen.«
»Was ist mit dem Papierausdruck?«
»Jedes Mal, wenn eine Datei vernichtet wurde, verschwand auch der Ausdruck aus dem Ordner.«
Katinka lehnte sich zurück. Der Stuhl quietschte, sie hatte den Eindruck, dass die Lehne wackelte. Jemand zerstörte nach Plan die Arbeit von Tagen oder Wochen. Jemand hatte Interesse, Laubachs ambitiöses Projekt zum Scheitern zu bringen.
»Wann hat das merkwürdige Treiben denn angefangen?«
»Am 17. November«, sagte Fria eifrig. »Elfi hatte das Programm gerade gestartet und bemerkte, dass sie vor einer Liste saß, die sie so vor drei oder vier Wochen das letzte Mal gesehen hatte. Sie …«
»Woran konnte sie das feststellen?«
»Es waren einfach weniger Einträge drin. Die Analysen vermehren sich ja, und das Programm gibt jeweils in der Fußleiste an, wie viele wir schon haben.«
»Die Liste befand sich einfach auf einem früheren Stand?«, fragte Katinka noch einmal nach, der sich die Gedanken allmählich überschlugen. »Es waren nicht absichtlich Fehler hinzugefügt worden oder so?«
»Um Gottes willen!«, rief Fria Burgwart und fixierte das Fenster. »Das wäre ja der absolute Albtraum, der GAU schlechthin. Nein, das wäre …«
Sie schwieg.
»Wo haben Sie die Schlüssel zu den anderen Räumen?«
Stumm wies Fria auf ein Schlüsselbrett an der Wand. Säuberlich mit Schildchen versehen baumelten die Sicherheitsschlüssel daran.
»Kann man sich nur von diesen beiden PCs in das Programm einloggen?«
»Nein, auch von den Arbeitsplätzen im Bibliothekszimmer und von Elfis Computer im Zimmer für die Hilfskräfte, das liegt gleich neben dem Sekretariat«, erwiderte Fria und sah unglücklich drein.
»Lässt sich nicht nachverfolgen, von welchem PC aus die Manipulationen vorgenommen wurden?«