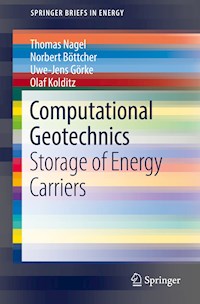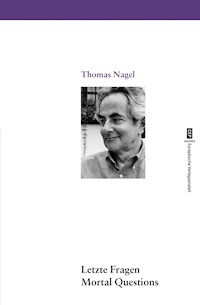15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit ist das Hauptwerk Thomas Nagels zur politischen Philosophie. Hervorgegangen aus seinen 1990 in Oxford gehaltenen Locke Lectures erkundet Nagel in diesem dichten Traktat den Konflikt zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit – zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv. Dieser Konflikt, den er als das Grundproblem der politischen Philosophie bezeichnet, lässt sich nicht auf Systemebene lösen, denn er hat seinen Ursprung darin, dass schon jede Person zwei Standpunkte einzunehmen in der Lage ist: den persönlichen und den überpersönlichen. Diesem unhintergehbaren Dualismus Rechnung zu tragen, ist die Aufgabe jeder politischen Lehre, die die Frage beantworten will: »Wie sollen wir in einer Gesellschaft miteinander leben?« Ein Klassiker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit ist das Hauptwerk Thomas Nagels zur politischen Philosophie. Hervorgegangen aus seinen 1990 in Oxford gehaltenen Locke Lectures, erkundet Nagel in diesem dichten Traktat den Konflikt zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit – zwischen dem einzelnen und dem Kollektiv. Dieser Konflikt, den er als das Grundproblem der politischen Philosophie bezeichnet, hat seinen Ursprung darin, daß schon jede Person zwei Standpunkte einzunehmen in der Lage ist: den persönlichen und den überpersönlichen. Diesem unhintergehbaren Dualismus Rechnung zu tragen ist die Aufgabe jeder politischen Lehre, die die Frage beantworten will: »Wie sollen wir in einer Gesellschaft miteinander leben?« Ein Klassiker.
Thomas Nagel ist Professor für Philosophie und Recht an der New York University. Zuletzt erschienen: Der Blick von nirgendwo (stw 2035) und Geist und Kosmos. Warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist (stw 2151).
Thomas Nagel
Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit
Aus dem Amerikanischen von Michael Gebauer
Suhrkamp
Titel der Originalausgabe:
Equality and Partiality.
First Edition was originally published in English in 1991. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.
Erstmals erschienen 1991 bei Oxford University Press. Die Übersetzung erscheint mit freundlicher Genehmigung von Oxford University Press.
Copyright © 1991 by Thomas Nagel
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2166.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© Thomas Nagel
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-74272-3
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorbericht
1 Vorrede
2 Zwei Standpunkte
3 Das Utopismusproblem
4 Legitimität und Einigkeit
5 Kants Maximenprobe
6 Moralische Arbeitsteilung
7 Egalitarismus
8 Konvergenzprobleme
9 Strukturprobleme
10 Gleichheit und Motivation
11 Optionen
12 Ungleichheit
13 Rechte
14 Toleranz
15 Grenzen: Der Globus
Namenregister
Für John Rawls,dem die Sache ein neuesAnsehen schuldet
Vorbericht
Die Abhandlung ist in der Zeit zwischen 1987 und 1990 entstanden, und ich bedanke mich hier gern für die großzügige Unterstützung, die ich in diesen Jahren durch den Filomen D’Agostino and Max E. Greenberg Faculty Research Fund des Juristischen Seminars der Universität von New York erfahren habe. Ein Teil des Materials stammt aus Vorlesungen, die ich 1989 als Thalheimer Lecturer an der Johns Hopkins University gehalten hatte, und der Hauptteil der vorliegenden Fassung kam dann 1990 im Rahmen der John-Locke-Vorlesungen an der Universität von Oxford zum Vortrag. Eine ursprüngliche Fassung des dritten Kapitels war bereits 1989 in der Zeitschrift Social Research unter dem Titel »What Makes a Political Theory Utopian?« publiziert worden, und das vierzehnte Kapitel ist zum Teil aus meinem 1987 in Philosophy and Public Affairs veröffentlichten Aufsatz »Moral Conflict and Political Legitimacy« hervorgegangen.
Das Buch ist das Ergebnis (und mein Diskussionsbeitrag zu) einer nach wie vor andauernden Erörterung ethischer und politischer Themen durch einen Kreis von Freunden und Kollegen. Wie es aus der Feder kam, wurde es jeweils dem Kolloquium für Recht, Philosophie und politische Theorie unterbreitet, das jeden Herbst von Ronald Dworkin, David Richards, Lawrence Sager und mir selbst am Juristischen Seminar der New York University abgehalten wird, und ich habe von den Reaktionen dieser Kollegen und anderer Teilnehmer eine Menge profitiert, unter ihnen vor allem von Frances Myrna Kamm. Die Probleme waren bereits in der langjährigen Korrespondenz und in Gesprächen mit Thomas M. Scanlon, Derek Parfit und John Rawls zur Sprache gekommen, und jeder dieser Philosophen hat einen merklichen und offenkundigen Einfluß auf mein Denken gehabt. Was meinen Lehrer Rawls betrifft, so erstreckt sich sein Einfluß mittlerweile – seit ich ehedem als Student an der Cornell University in seiner Einleitung in die Philosophie auftauchte, in der Thomas Hobbes’ De Cive einer der Texte war – auf den überwiegenden Teil meines Lebens.
Als ich im Frühjahr 1990 dann die Locke Lectures gab, hatte ich das große Glück, zwei Semester als Visiting Fellow am All Souls College zu einer Zeit verbringen zu können, als man in Oxford eine besonders günstige Konstellation politischer Philosophen und Moralphilosophen zu Gesprächspartnern vorfand. G.A. Cohen, Ronald Dworkin, Derek Parfit, T.M. Scanlon, Samuel Scheffler trafen sich mit mir zu wöchentlichen Diskussionsrunden unserer im Entstehen begriffenen Texte, und wir alle arbeiteten an verwandten Problemen. Diese Gespräche haben sich dann als besonders hilfreich erwiesen, als es galt, die endgültige Fassung der Abhandlung niederzuschreiben.
New York, im Januar 1991
T.N.
1Vorrede
Die Abhandlung, die ich hier vorlege, hat es mit einer Fragestellung zu tun, die nach meiner Überzeugung als das Grundproblem der politischen Philosophie gelten muß. Statt dieses Problem aber am Ende wieder einmal ›lösen‹ zu wollen, wird es mir um den Versuch gehen, zum einen begreiflich zu machen, worin es in Wahrheit besteht, und zum anderen, warum es nur unter erheblichen Schwierigkeiten überhaupt jemals einer Lösung zuführbar sein könnte. Ein solches Ergebnis muß nicht zwangsläufig zu pessimistischen Bedenken Anlaß geben, denn von jeher war die Einsicht in ein gravierendes Hindernis, das der Lösung eines Problems entgegenstand, zugleich auch eine notwendige Bedingung des Fortschritts. Und wie ich glaube, dürfen wir immerhin hoffen, daß es der Mensch in irgendeiner Zukunft einmal zu politischen und sozialen Institutionen bringe, die seinen so wetterwendischen Bildungsprozeß in die Richtung moralischer Gleichheit auch vorantreiben, ohne sich dabei über die hartnäckigsten Tatsachen der menschlichen Natur kurzerhand hinwegzusetzen.
Meine Überzeugung lautet nicht einfach nur, daß alle bis in unsere Tage konzipierten gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen ungenügend sind. Das könnte schließlich auch daran liegen, daß es alle real existierenden Systeme versäumen, ein bereits entworfenes Ideal, das uns immer schon als das richtige vor Augen stehen sollte, in die Tat umzusetzen. Vielmehr besteht ein tieferes Problem – und zwar eines, das auch theoretischer und nicht lediglich praktischer Natur ist: Wir besitzen nach wie vor erst gar kein anerkennenswertes politisches Ideal, und dies aus Gründen, die zur Dimension der praktischen und der politischen Philosophie entscheidend hinzugehören. Wiewohl das Problem, das noch keine Lösung gefunden hat, das geläufige ist, wie denn eine Aussöhnung des kollektiven Standpunkts mit dem Standpunkt des einzelnen eigentlich erreichbar sein soll, werde ich die Problematik gerade nicht in erster Linie als eine Frage nach dem Verhältnis der Person zur Gesellschaft angehen, sondern als ihrem Wesen und Ursprung nach ein Problem in bezug auf das Verhältnis eines jeden Individuums zu sich selbst. In diesem Ansatz findet sich eine definitive These über die Herkunft ethischer Gründe wieder, die ich mir seit langem zu eigen gemacht habe: Die Ethik wie auch die nötigen moralischen Fundamente politischer Theorie sind beide Male so zu begreifen, daß sie aus einer Polarität in der Persönlichkeit erwachsen und einer Differenzierung zweier Perspektiven geschuldet sind – der rein persönlichen Perspektive und der unpersönlichen –, die sich in jedem einzelnen von uns herausbildet. Der überpersönliche Standpunkt vertritt dabei den Anspruch der Kollektivität und verleiht ihm seine Überzeugungskraft für ein jedes Individuum. (Wäre er nicht vorhanden, würde es gar nicht erst zu einer Ethik kommen können, sondern einzig und allein zu Kollisionen, Kompromissen und der nur gelegentlichen Konvergenz rein persönlicher Perspektiven.) Nur weil ein menschliches Subjekt nicht immer bloß den eigenen Blickwinkel einnimmt, kann es im Zuge der persönlichen und der politischen Moral für die Ansprüche anderer überhaupt empfänglich werden.
Jede gesellschaftliche Institution, welche die Beziehungen unter Personen reguliert, ist von einer entsprechenden Ausgewogenheit des Kräftespiels im Ich abhängig, gleichsam ihrem Spiegelbild im Mikrokosmos. In der Proportion, die in der Innenwelt jedes Individuums zwischen der persönlichen und der unparteiischen Perspektive vorherrscht, spiegelt das Verhältnis sich wider, auf das die soziale Einrichtung einerseits angewiesen ist und das sie uns andererseits abverlangt. Soll eine Einrichtung Anspruch darauf erheben können, von den Menschen, die unter ihren Bedingungen zu leben haben, getragen und gefördert zu werden – soll sie mit anderen Worten Legitimität beanspruchen können –, muß sie sich auf eine bestimmte Form vernünftiger Stimmigkeit der Komponenten des von Natur aus fundamental polarisierten Ichs solcher Persönlichkeiten entweder immer schon stützen oder aber eine solche Form der Integration herbeiführen. Wohl handelt es sich oben um einen sehr globalen Dualismus, der sich über ein weites Feld ihrerseits komplexer Subregionen erstreckt, doch glaube ich, daß kein Denken über unsere gegenwärtige Materie ohne ihn auskommen kann.
Die schwierigsten Probleme in der politischen Philosophie gehen auf eine fortdauernde Diskrepanz in foro interno jedes einzelnen zurück, und keine äußerliche Lösung, die diese Konflikte nicht an ihrer Wurzel angeht, wird ihnen je angemessen sein können. Der impersonale Standpunkt im Individuum begründet, wie ich darlegen werde, ein machtvolles Verlangen nach uneingeschränkter Unparteilichkeit und Gleichheit, während die rein persönliche Perspektive individualistische Sonderinteressen und Bindungen erzeugt, die der Hinwendung zu diesen Idealen und ihrer Verwirklichung im Wege stehen. Und die Einsicht, daß dies für schlechterdings jeden gilt, konfrontiert den überpersönlichen Standpunkt dann mit weiteren Nachfragen, was dafür nötig sein wird, diese Menschen mit gleicher Rücksicht zu behandeln, Fragen, die dem Individuum im Gegenzug wiederum neue Konflikte bereiten.
Bereits die Moral des persönlichen Handelns beschert uns diese Probleme, doch gilt es im vorliegenden Buch zu verdeutlichen, daß ihre Bearbeitung auf das Feld des Politischen übergreifen muß, wo von den Verhältnissen des gegenseitigen Beistands oder aber Konflikts, die zwischen gesellschaftlichen Institutionen und den Beweggründen des einzelnen herrschen, schlechterdings alles abhängt. Es erweist sich schließlich, daß eine harmonische Synthese eines anerkennenswerten politischen Ideals mit annehmbaren Wertmaßstäben der Individualmoral nur sehr schwer zu erreichen ist. Wir können unserem Problem daher auch die folgende Fassung geben: Sobald wir es unternehmen, in ethischer Hinsicht vernünftige Normen eines persönlichen Lebens aufzudecken, um diese dann in einem weiteren Schritt mit fairen obersten Bewertungsmaßstäben gesellschaftlicher und politischer Institutionen zusammenzuführen und vereinigt zur Geltung zu bringen, scheint uns die Integration der beiden Wertmaßstäbe nicht auf befriedigende Weise gelingen zu können. Sie reagieren auf konträre Zwänge, die bewirken, daß sie auseinanderfallen.
Zu einem erheblichen Teil versuchen politische Institutionen und ihre theoretischen Legitimationsverfahren die Forderungen des überpersönlichen Standpunkts zu externalisieren. Doch sind sie allemal immer auf Personal angewiesen und von konkreten und besonderen Individuen ins Leben zu rufen und zu tragen, für welche die überpersönliche Perspektive jederzeit mit der subjektiven koexistiert, und diese Rücksicht muß sich bereits in ihrer Anlage niederschlagen. Meine These wird lauten: Nach wie vor ist keine Lösung für das Problem gefunden worden, Institutionen zu konzipieren, die zum einen dem Faktum, daß alle Menschen gleich wichtig sind, wirklich gerecht werden und zum anderen an Individuen nicht mit unerträglichen Postulaten herantreten – und den Grund dafür sehe ich zum Teil darin, daß für die Welt, in der wir leben, das Problem der richtigen Beziehung zwischen dem personalen und dem impersonalen Standpunkt eben noch ungelöst ist.
Bei näherem Nachdenken spüren die meisten dies auch. Wir leben in einer Welt, in der so uferlose wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten obwalten, daß einem dabei geistig übel werden muß, in einer Welt, deren Fortschritt in Richtung einer Ratifizierung wirklich allgemeingültiger Normen der Toleranz, der Freiheit der Persönlichkeit und der Erschließung humaner Möglichkeiten bedrückend langsam vonstatten geht und kaum Bestand hat. Dann und wann kommt es in dramatischen Schüben zu einem Aufschwung, und die Besserung der politischen Lage der Menschen im Osten Europas, die sich ereignet, während ich an diesem Buch arbeite, kann jemandem nur zu denken geben, der – wie sein Autor – bis heute auf die Ereignisse, die unser eigenes Jahrhundert dominiert haben, mit einem gepflegten defensiven Pessimismus im Hinblick auf die Zukunftsaussichten der Gattung reagiert hat. In der Tat wissen wir aber nicht, wie wir Menschen eigentlich miteinander leben sollen. Obschon die erklärte Bereitschaft ansonsten zivilisierter Leute, einander millionenfach in einem Atomkrieg abzuschlachten, zur Stunde nachzulassen scheint, da die politischen Gesinnungskollisionen, die diese Gefahr beständig geschürt haben, für den Augenblick an Brisanz verlieren, steht es selbst in den Teilen der Welt, die nicht unterentwickelt sind, – und auf jeden Fall in der Welt als ganzer – durchaus nicht so, daß die Probleme, durch die es zu dem extremen gesellschaftlichen und moralischen Widerspruch zwischen einem demokratischen Kapitalismus und einem autoritären Kommunismus gekommen war, aufgrund der Wettbewerbsunfähigkeit des letzteren etwa schon gelöst wären.
In Europa ist dem Kommunismus in unseren Tagen eine vielleicht endgültige Niederlage bereitet worden, und womöglich erleben wir es noch, irgendwann auch seine Abschaffung in Asien begrüßen zu können. Doch bedeutet das auf keinen Fall, daß der demokratische Kapitalismus etwa der Weisheit letzter Schluß wäre, wenn es gilt, menschliche Sozialbeziehungen zu regeln. Gerade beim aktuellen geschichtlichen Stand der Dinge tut es not, sich dessen zu erinnern, daß der Kommunismus sein Bestehen zu einem Teil einem eminent wichtigen Ideal der Gleichheit verdankt, das ein attraktives Ideal ist und bleibt, ganz gleich, wie schlimm die Verbrechen wie auch die wirtschaftlichen Katastrophen waren, zu denen es in seinem Namen gekommen ist. Demokratischen Gesellschaften ist es nicht gelungen, diesem Ideal etwas entgegenzusetzen: Das Ideal der Gleichheit bleibt ein Problem für die alten Demokratien des Westens, und auch für die neuen Demokratien, die nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im Osten Europas entstehen, wird es zu einem bitterernsten Problem werden. Politische Philosophie wird diesen Zustand von sich aus zwar nicht umgestalten können, doch hat sie – da einige augenscheinlich praktische Schwierigkeiten des gesellschaftlichen Lebens in Wahrheit aus Quellen stammen, die theoretischer und ethischer Natur sind – dennoch eine eigene Aufgabe zu erfüllen. Moralische Überzeugungen fungieren durchaus auch als Motor der politischen Dezision, und jedes Fehlen ethischer Einigkeit kann, wenn es schwerwiegend genug ist, sehr viel trennendere Auswirkungen haben als irgendein bloßer Interessenkonflikt. Wer dazu neigt, politischer Theorie prinzipiell den Kontakt zur Realität abzusprechen, wird sich in den heutigen Entwicklungen nicht mehr behaupten können: Gerade jetzt werden überall auf dem Globus ethische und politische Schlachten ausgefochten – und nicht selten mit echten Panzern.
Politische Theorie hat man sich als wirkliche Forschung zu denken: als ein Unternehmen, das menschliche Möglichkeiten entdeckt, zu deren allmählicher Verwirklichung die Entdeckung selbst wiederum motiviert und beiträgt. So ist sie jedenfalls in der Tradition von den meisten Protagonisten politischer Philosophie gesehen worden: Nach dem Selbstverständnis dieser Theoretiker war es ihr Geschäft, sich eine moralische Zukunft der Gattung vorzustellen und nach Möglichkeit zu ihrer Verwirklichung beizutragen; und da nicht zu vermeiden ist, daß man sich bei einem so verstandenen Unternehmen der Gefahr des Utopismus aussetzt, wird dieses Problem zu einem vorrangigen Aspekt unseres Themas.
Eine politische Lehre wird utopisch im pejorativen Sinne, sobald sie eine kollektive Lebensform ins Auge faßt, der aber der Mensch – die meisten wenigstens – in Wahrheit nicht gerecht werden könnte und durch keinen realisierbaren gesellschaftlichen und seelischen Umbildungsprozeß je zu entsprechen lernen könnte. Als ›Möglichkeit‹ für einige wenige und unerreichbarer Gegenstand der Bewunderung für die anderen mag sie gegebenenfalls noch einen gewissen ideellen Wert haben, doch eignet sie sich nicht als generelle Lösung der primären Frage jeder politischen Lehre: Wie sollen wir in einer Gesellschaft miteinander leben?
Schlimmer noch als motivationale Unmöglichkeit ist, daß auch die pure Illusion der Möglichkeit einer nach Lage der Dinge von der Motivation her unmöglichen Lebensform den einen oder anderen noch antreiben kann, sie mit autoritären Mitteln verordnen zu wollen, was dann endgültig unkenntliche Resultate nach sich zu ziehen pflegt. Ständig versuchen Gesellschaften, sich Subjekte zurechtzuschmieden, weil es diesen fortwährend mißlingt, sich mit irgendeinem vorgefaßten Muster vermeintlicher ›Möglichkeiten‹ für die Menschheit in Übereinstimmung zu bringen. Insofern ist politische Theorie eine empirische Disziplin, deren Hypothesen die Zukunft auch gefährden und deren Experimente äußerst kostspielig werden können.[1]
Während es wichtig ist, sich vor den Utopismen zu hüten, ist es indes nicht minder wichtig, ihren diametralen Widersacher zu meiden, den starrköpfigen Realismus. Zugegebenermaßen wird sich jede Theorie, die neue Möglichkeiten vorschlägt, der Gefahr bewußt sein müssen, daß diese Möglichkeiten rein imaginär sind. Die tatsächliche Menschennatur und die Grundverfassung der Antriebe des Menschen gehören auf jeden Fall zu unserem Untersuchungsgegenstand hinzu, und ein gewisser Pessimismus ist hier durchaus angebracht – schließlich haben wir reichlich Grund erhalten, die menschliche Natur zu fürchten. Doch dürfen wir keinesfalls die Hände in den Schoß legen in Anbetracht von Schranken, die sich lediglich der Niedrigkeit heutiger Beweggründe verdanken oder angesichts irgendeines weit übertriebenen Pessimismus in bezug auf die Möglichkeit einer Höherentwicklung der Gattung. Es bleibt unerläßlich, daß man sich auch dann schon den nächsten Schritt vorzustellen bemüht, wenn man noch nicht in die Nähe einer Verwirklichung der besten Lösungen gekommen ist, über die man bereits verfügt.
Bei diesem Unternehmen läßt es sich gar nicht vermeiden, daß wir die Intuitionen unserer je eigenen praktischen Urteilskraft aufzubieten haben, und man sollte dies auch keinesfalls bedauern. Um unseren Intuitionen prinzipiell trauen zu dürfen – insbesondere all jenen Einschätzungen, die uns sagen: daß etwas unrecht ist, wenngleich wir noch in Unkenntnis darüber sind, was genau nun eigentlich das Rechte wäre –, benötigen wir nicht mehr als die Überzeugung, daß unsere Fähigkeit, ethische Sachverhalte zu verstehen, entschieden weiter reicht als unsere Befähigung, die allgemeinen Grundsätze, die solchem Verstehen zugrunde liegen, auch wirklich auszubuchstabieren. Intuition kann zwar auch von Sitte, Eigennutz und – nicht zu vergessen – Theoriegläubigkeit korrumpiert sein, doch erstens muß sie es nicht zwangsläufig sein, und zweitens wird das intuitive Urteilsvermögen eines Menschen ihm häufig wirksame Indizien dafür an die Hand geben, daß seine ethische Theorie tatsächlich etwas ausläßt oder daß die eingewöhnten institutionellen Regelungen, die er aufgrund seiner Herkunft für selbstverständlich zu halten gelernt hat, womöglich durch und durch ungerecht sind. Intuitives Ungenügen ist eine unverzichtbare Quelle politischer Theorie. Es kann uns auch dann sagen, daß etwas verkehrt ist, wenn es uns damit nicht unbedingt schon sagt, wie dieser Defekt zu reparieren wäre; und oft liegt in ihm eine vernünftige Reaktion sogar auf solche Modelle zeitgenössischer politischer Praxis, die geradezu ideal sind, und zwar, wie ich glaube, gleichermaßen auf der Ebene der Theorie: Es sagt uns, wenig überraschend, daß wir die Wahrheit noch nicht gewonnen haben, und kann uns auf diesem Wege helfen, ein gesundes Mißfallen an der Beharrungskraft des Hergebrachten zu kultivieren, ohne in einen hoffnungslosen Utopismus der unkritischen Sorte zu verfallen.
Ich glaube, daß die Kollision persönlicher und unpersönlicher Standpunkte eines der drängendsten Probleme ist, die sich uns auf solche Weise zu erkennen geben. Sollte es uns nicht möglich sein, durch ethische Theorie und die entsprechende Anlage ethischer Institutionen unsere unparteiische Sorge um jeden einzelnen Menschen mit einer begründeten Position darüber zu vermitteln, welche Lebensweise man einem konkreten Individuum mit Vernunft zumuten kann, besteht keinerlei Hoffnung, überhaupt die Anerkennungswürdigkeit einer politischen Ordnung für alle begründen zu können. Solche Integrationsprobleme gehen mit der Faktizität unseres Menschseins wesentlich einher, und wir können unmöglich damit rechnen, daß sie je verschwinden werden. Und doch muß die Bemühung um eine Auseinandersetzung mit diesen Problemen in jeder politischen Theorie spürbar sein, die beanspruchen will, realistisch zu sein.
Was diese Aufgabe so schwierig macht, ist der Umstand, daß es das Ziel unserer politischen Theorie sein sollte, auf einer bestimmten Ebene letztlich der Einhelligkeit so nahe wie möglich zu kommen: einem Einvernehmen nämlich im Hinblick auf die Unterhaltung jener gesellschaftlichen Einrichtungen, in die man dann hineingeboren wird und die uns mit Zwangsmitteln auferlegt werden. Eine solche These mag als extravagant oder gar unverständlich erscheinen, insofern das Fehlen von Einvernehmlichkeit ja gerade das Wesen des Politischen auszumachen scheint, doch werde ich sie in diesem Buch verteidigen und zu erklären versuchen, in welcher Beziehung sie zur Kantischen Ethik und zu dem Grundgedanken eines hypothetischen Gesellschaftsvertrages steht, mit dem sich diese philosophische Ethik in der Sphäre des Politischen geltend macht.
Das unverfälschte Ideal politischer Legitimität beinhaltet, daß jeder einzelne Bürger den Gebrauch staatlicher Macht muß billigen können – nicht etwa unmittelbar oder bis in die letzten Einzelheiten, sondern kraft seiner prinzipiellen Zustimmung zu jenen Rechtsgrundsätzen, Institutionen und Verfahrensnormen, die festlegen, wie solche Herrschaft eingesetzt wird. Dergleichen verlangt die Möglichkeit eines hinreichend hohen Niveaus einvernehmlicher Affirmation, denn sobald es in einem Staat Bürger gibt, die wider die Art und Weise, auf die staatliche Macht gegen sie eingesetzt wird, ein berechtigtes Veto geltend machen können, wird dieser Staat illegitim. Es kann uns nur frustrieren, daß wir eine solche Einhelligkeit als Ideal anerkennen müssen, während wir auf der anderen Seite notgedrungen die komplizierten Gegebenheiten der menschlichen Motivation und der praktischen Vernunft hinzunehmen haben, doch ist nach meiner Auffassung nichts anderes als dies die Aufgabenstellung politischer Theorie. Wir müssen sowohl versuchen, dieser Anforderung eine ethisch sinnvolle Interpretation angedeihen zu lassen, als auch zusehen, inwieweit sie von unseren heutigen Institutionen überhaupt erfüllt werden könnte.
Es handelt sich um eine Aufgabe, die nicht bis ins Millennium hinausgeschoben werden darf, bis zu dem Tag, an dem die Konflikte etwa verschwunden wären und allen eine gemeinsame Zielvorgabe vor Augen stände. Die säkularisierte Version dieser verführerischen und gefährlichen Vision – einer Vision, die selbst noch das Ziel einer Einigkeit auf idealisierter Ebene unter den jeweils gegebenen Verhältnissen zurückweist und so lange auf Kampf um eines Endsiegs willen beharrt, als es überhaupt noch Klassen gibt, deren Interessen einander widerstreiten – macht das exorbitanteste Moment des ethischen Erbes aus, das der Welt von Karl Marx hinterlassen wurde. Harmonie bleibt ihr einer Zukunft vorbehalten, die nur zu vollbringen ist, indem man in der Gegenwart jede Harmonie zugunsten des politischen Krieges unversöhnlicher Interessen flieht.
Diese Auffassung ist zurückzuweisen und unser Eintreten für menschliche Gleichheit entschieden von ihr zu lösen. Das Ziel idealer Einigkeit ist an allen Stadien unserer Suche nach verbesserten menschlichen Lebensbedingungen beteiligt, gleichviel wie himmelweit man von endgültiger Gerechtigkeit jeweils noch entfernt ist. Wiewohl man sich überall dort, wo derlei Bestrebungen von den Subjekten noch nicht hinreichend allgemein geteilt werden, auch auf äußere Zwangsgewalt wird stützen müssen, kommt es einem Desaster gleich, wenn dieses Projekt aus der politischen Moral so lange ausgeschlossen bleibt, bis die Geschichte mit anderen Mitteln jenen mythologischen Endpunkt erreicht haben soll, an dem es sich angeblich mühelos zuwege bringen läßt.
2Zwei Standpunkte
Der überwiegende Teil unserer Welterfahrung wie auch der überwiegende Teil unserer Wünsche gehören unserer persönlichen Perspektive an: Wir sehen die Dinge gleichsam von hier aus. Doch besitzen wir darüber hinaus eine eigentümliche Befähigung, über die Welt auch in Abstraktion von unserer besonderen Stellung in ihr nachzudenken – davon abzusehen, wer wir selbst in ihr sind. Ja, es ist uns sogar möglich, noch weitaus radikaler von den Kontingenzen unseres Selbst zu abstrahieren: Verfolgen wir beispielsweise jene Art von Objektivität, die uns die Physik und die anderen Naturwissenschaften abverlangen, abstrahieren wir in Wahrheit sogar davon, daß wir Menschen sind. In der ethischen Theorie dagegen ist nichts weiter als jene Art der Abstraktion von unserer eigenen Identität wirksam, durch die wir in Abzug bringen, wir sind. Jeder von uns geht zunächst immer aus von einem typischen Gefüge je Anliegen, Wünsche und Interessen und ist in der Lage, wahrzunehmen, daß auch andere dies tun. In einem zweiten Schritt kann er dann in Gedanken von seiner besonderen Stellung in der Welt subtrahieren und einfach allgemein über all die Menschen nachdenken, um die es geht – ohne künftig noch den von ihnen, der er faktisch selbst ist, als auszusondern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!