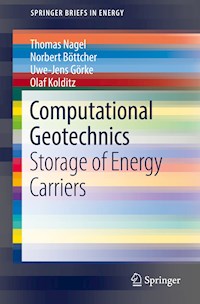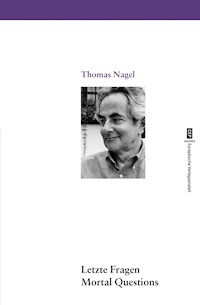
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei Thomas Nagels "Mortal Questions" handelt es sich um einen Bestseller der amerikanischen Philosophie, dessen Ausführungen zu grundlegenden Fragestellungen der Philosophie als Einführung in die Disziplin nach wie vor Geltung hat. Weite Bekanntheit hat Nagel auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes erlangt als Vertreter der Auffassung, dass Bewusstsein und subjektive Erfahrung nicht auf bloße Hirntätigkeit reduziert werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Thomas Nagel
Letzte Fragen Mortal Questions
Erweiterte Neuausgabe mit einem Schriftverzeichnis
Herausgegeben von Michael Gebauer
Titel der Originalausgabe: »Mortal Questions« © 1979 Cambridge University Press Die erste deutsche Übersetzung erschien 1984 unter dem Titel »Über das Leben, die Seele und den Tod«
Aus dem Amerikanischen von Karl-Ernst Prankel, Ralf Stoecker, Knut Emig, Tatjana Schaaf, Stefan Holler, Hans-Peter Schütt und Michael Gebauer.
Umschlag: Motiv: Thomas Nagel, © New York University
ISBN 978-3-86393-510-8
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de
Inhalt
Vorwort
Der Tod
Das Absurde
Moralische Kontingenz
Sexuelle Perversion
Massenmord und Krieg
Rücksichtslosigkeit im öffentlichen Leben
Die Strategie der Bevorzugung
Gleichheit
Die Fragmentierung des Guten
Ethik ohne Biologie
Hemisphärentrennung des Hirns und Einheit des Bewußtseins
Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?
Der Panpsychismus
Das Subjektive und das Objektive
Anhang
Das objektive Selbst
Menschenrechte und Öffentlichkeit
Schriften von Thomas Nagel
Biographische Notiz
Ausgewählte Bibliographie zu den Nagelschen Themen
Index
Ausgehend von der Diagnose, dass philosophische Irritationen auf ein grundlegendes Auseinanderfallen von individuellem Erleben und objektiver Realität reagieren, folgt Nagel der Einsicht der besten Vertreter der philosophischen Aufklärung, dass das legitime Streben analytischer Philosophie nach Klarheit und Präzision nicht zu Lasten der Behandlung der wichtigsten Fragen persönlicher Welt- und Selbsterfahrung gehen darf. Da hier Schlüsselfragen des persönlichen Lebens zu zentralen Themen der Philosophie führen, vermag »Letzte Fragen« auch den allgemeinen Leser gefangen zu nehmen.
Die vorliegende Ausgabe wurde gegenüber der amerikanischen Ausgabe, die bereits über 20 Auflagen erfahren hat, um einen längeren Essay über das Ich und einen neu verfassten Aufsatz über die Problematik der Menschenrechte erweitert.
Thomas Nagel, geboren 1937, Philosophieprofessor an der New York University School of Law. Zuvor Lehrtätigkeiten in Princeton und Berkeley, gehört zu den bedeutendsten lebenden Philosophen der Vereinigten Staaten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Philosophie des Geistes, Ethik und politischen Philosophie.
meinem Vater WALTER NAGEL dem Pessimisten und
Vorwort
Das Menschheitsunternehmen Philosophie umspannt eine schier uferlose Themenvielfalt, doch seit jeher galt seine Aufmerksamkeit zu einem beträchtlichen Teil dem vergänglichen Leben: Wie ist es zu verstehen, wie zu fuhren? Mit dem Leben werden es auch die in diesem Buch gesammelten Essays zu tun haben: seinem Ziel, seinem Sinn, seinem Wert, dem Bewußtsein und der Metaphysik des Bewußtseins. Philosophen analytischer Prägung haben diesen Fragen nur selten Beachtung geschenkt, denn es ist schwierig, klare und präzise Auskunft über sie anzubieten, und aus einem Gemisch von Tatsachen und Gefühlen diejenigen Schwierigkeiten zu destillieren, die abstrakt genug sind, um philosophisch untersucht werden zu können. Probleme dieser Art müssen mit Hilfe einer philosophischen Methode in Angriff genommen werden, die auf ein ebensogut persönliches wie theoretisches Verständnis abzielt und sich bemüht, beide Aspekte durch Einbettung der theoretischen Ergebnisse in ein Ganzes unserer Selbsterkenntnis zusammenzuführen. Ein solches Unternehmen birgt seine eigenen Risiken. Derart allgemeine und tiefe Fragen führen nur allzu leicht zu langatmigen und schwammigen Antworten.
In jeder theoretischen Disziplin kommt es zu einer Spannung zwischen Extravaganz und Borniertheit, Phantasie und argumentativer Strenge, Weitschweifigkeit und Präzision. Nicht selten verfällt man aus Furcht vor Exzessen des einen Extrems den Exzessen des anderen. Und eine Vorliebe für den erhabenen Gestus kann dazu führen, daß man die Forderung nach Strenge ungeduldig beiseite schiebt und das Unverständliche in Kauf nimmt. Doch in der analytischen Philosophie stellte sich dieses Problem in umgekehrter Form – die Schwächen einer Tradition sind meist die Kehrseite ihrer Stärken. Wohl wäre es alles andere als richtig, behaupten zu wollen, die angloamerikanische Philosophie gehe den großen Fragen aus dem Weg, denn zum einen gibt es schlechterdings keine tieferen und bedeutenderen Schwierigkeiten in der Philosophie als die metaphysischen, erkenntnistheoretischen und sprachphilosophischen Probleme, die im Brennpunkt ihrer theoretischen Aufmerksamkeit liegen. Und zum anderen war das Establishment analytischer Philosophen sehr aufgeschlossen für einige in jüngerer Zeit unternommene Versuche, ihm bislang unbekanntes Terrain begehbar zu machen. Gleichwohl hatte die Furcht vor Unsinn hier nach wie vor einen äußerst hemmenden Einfluß auf das Denken. Noch lange nach dem Abdanken des Logischen Positivismus neigte die analytische Philosophie dazu, sich mit übertriebener Vorsicht in dieses Neuland voranzutasten – und dabei mit dem neuesten technischen Rüstzeug zu überladen.
Es ist nur allzu verständlich, daß die Vorliebe für bestimmte Präzisionsmaßstäbe und Methoden zur Konzentration auf Probleme führt, die sich mit diesen Methoden voranbringen lassen. Als forschungsstrategische Entscheidung kann dies völlig rational sein. Aber oft führt die Entscheidung dann die ungesunde Tendenz mit sich, die Legitimität von Fragestellungen im Rückgriff auf die derzeit verfügbaren Lösungswege definieren zu wollen. Und diese Angewohnheit macht sich noch nicht einmal nur in den im engeren Sinne theoretischen Forschungsdisziplinen breit: Wir kennen sie unter Ismen wie »Pragmatismus« oder »Realismus« auch aus Kontroversen über politische und soziale Fragen. Sie gewährleistet zwar stets eine lässige Bequemlichkeit – die Möglichkeit, daß man genuine und wichtige Probleme erst gar nicht in den Blick bekommen könnte, wird ja von vornherein ausgeschlossen –, doch kommt sie in allen Fachgebieten, und insbesondere in der Philosophie, regelrechter Unzurechnungsfähigkeit gleich. Wer sich hingegen noch nicht dem Schwachsinn ausgeliefert hat, wird wissen, daß es nämlich gerade dann wirklich interessant wird, wenn neue Verfahren und zu ihnen passende Maßstäbe geschaffen werden müssen, damit sich auch solche Fragen behandeln lassen, die im Rahmen der bestehenden Untersuchungsmethoden nicht gestellt werden können. Bisweilen läßt sich ein volles Verständnis solcher Fragen erst erreichen, nachdem die entsprechenden Methoden erarbeitet worden sind, und es bleibt sicher wichtig, daß man bestrebt sein sollte, vage, obskure und unbegründete Behauptungen zu meiden und ein hohes Niveau der Rechtfertigung und Argumentation zu wahren. Aber andere Werte sind nicht minder wichtig, und manche von ihnen erschweren es, die Dinge in säuberlicher Ordnung zu halten.
Meine eigenen philosophischen Sympathien und Antipathien lassen sich ohne weiteres in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ich glaube, wir sollten eher den Problemen trauen als den Lösungen, eher Intuitionen als Argumenten und eher pluralistischer Dissonanz als der Harmonie eines Systems. Einfachheit und Eleganz können niemals den Glauben an die Wahrheit von etwas begründen, auch nicht an die Wahrheit einer philosophischen Theorie. Normalerweise sollten sie im Gegenteil den Verdacht auf sich ziehen, daß die betreffende Theorie womöglich nicht wahr ist. Denn wird irgendein schlagendes Argument für eine intuitiv unannehmbare Konsequenz angeboten, liegt stets die Vermutung nahe, daß die Argumentation einen bislang noch versteckten Fehler in sich birgt – wiewohl es zugestandenermaßen auch sein kann, daß der Zweifelnde sich über die Quelle seiner intuitiven Vorbehalte im Irrtum befindet. Wenn Argumente oder systematische theoretische Überlegungen zu Ergebnissen führen, die man intuitiv für ungereimt halten würde; wenn eine glatte Lösung des Problems unseren Glauben nicht zu verdrängen vermag, daß sich das Problem noch immer stellt; oder wenn der Nachweis, daß irgendeine Fragestellung kein genuines Problem zum Ausdruck bringt, unsere Neigung nicht zum Verschwinden bringen kann, die Frage nach wie vor zu stellen: immer dann muß an der betreffenden Argumentation etwas verkehrt sein, und eine weniger arbeitsscheue Beschäftigung mit der Sache wird unumgänglich. Oft wird das Problem neu zu formulieren sein, da eine schlüssige Beantwortung der Frage in ihrer ursprünglichen Form nach wie vor nicht das Gefühl zum Verschwinden bringt, daß hier ein Problem besteht. Weil in der Philosophie stets auch unsere Methoden selber in Frage stehen, ist es gerade in dieser Disziplin grundsätzlich vernünftig, dem intuitiven Gespür, daß ein Problem eben noch ungelöst ist, größten Respekt zu zollen. Dies gibt einem die Möglichkeit, sich dafür offen zu halten, die etablierten Lösungswege jederzeit zu verlassen.
Solcherlei Einschätzungen philosophischer Praxis gehen alle davon aus, daß Philosophie stets auch überzeugen muß, soll sie so etwas wie Verstehen überhaupt ins Leben rufen können. Damit meine ich, daß Philosophie entweder zu Überzeugungen Anlaß geben oder dazu führen muß, daß sie aufgegeben werden. Für Verstehen genügt es nicht, lediglich mit einem System konsistenter Behauptungen versorgt zu werden. Und für das Fürwahrhalten hat, ganz im Gegensatz zu bloßen Verlautbarungen, zu gelten, daß es niemals unserer willkürlichen Kontrolle unterworfen werden sollte, wie immer diese auch motiviert sein mag. Unser Überzeugtsein muß unwillkürlich erfolgen.
Natürlich werden Überzeugungen nicht selten willkürlich kontrolliert, manchmal werden sie gar erzwungen. Schlagende Beispiele hierfür sind uns aus Politik und Religion vertraut. Aber dem befangenen Denken begegnet man in seinen subtileren Erscheinungsformen auch in intellektuellen Kontexten, und eine besonders augenfällige Rolle spielt dabei namentlich der Hunger nach Gewißheit. Wen dieses Verlangen quält, der findet sich ungern damit ab, auch nur für kurze Zeit keine Meinung zu einem Thema zu haben, das ihn interessiert. Jemand mag seine Meinungen zwar häufig wechseln, sobald sich ihm eine passable Alternative einstellt, kann aber den Zustand, in dem er sich vorläufig des Urteils zu enthalten hätte, einfach nicht aushalten.
Dies kommt auf unterschiedliche Weisen zum Ausdruck, die in der Philosophie nur allzu vertraut sind. Zum einen begegnet uns hier der Hang zum systematischen Theoretisieren, eine Vorliebe für Theorien, die Schlußfolgerungen zu allem und jedem zulassen. Sodann finden wir eine gewisse Neigung zu lupenreinen Dichotomien vor, die zur Entscheidung zwischen einer richtigen und einer falschen Alternative nötigen. Und schließlich begegnet uns die Bereitschaft, eine Theorie allein schon deshalb für wahr zu halten, weil alle anderen gegenwärtig zu diesem Thema denkbaren Auffassungen bereits widerlegt worden sind. Nur ein ungezügelter Appetit auf Überzeugungen kann die Anerkennung einer Theorie aus solchen Gründen motivieren. Und eine letzte Zuflucht für jene, die damit unzufrieden sind, keine festen Meinungen zu einem Thema zu haben, denen es aber auch nicht herauszufinden gelingt, was wirklich wahr ist, besteht darin, kurzerhand festzulegen, daß es innerhalb der strittigen Gebiete ein Wahr und Falsch gar nicht gibt: Wir brauchen uns also erst gar nicht für eine Überzeugung entscheiden, sondern können entweder per Dekret behaupten, was wir wollen, solange wir dabei nur konsistent bleiben, oder über das Schlachtengetümmel irregeleiteter theoretischer Gegner hinauswachsen und es als unparteiischer Beobachter – wohl mit Interesse, aber aus sicherer Distanz – verfolgen.
In der Philosophie ist es keineswegs leichter als in anderen Disziplinen, Oberflächlichkeit zu meiden. Nur zu gern verfällt man auf sogenannte ›Lösungen‹, die vor der Tiefe und Schwierigkeit ihrer eigenen Ausgangsprobleme nicht standhalten. Dieser Tendenz kann man nur entgegensteuern, indem man sich unbeirrbar um genuine Antworten bemüht und während seines Ausschauhaltens auch eine längere Zeitdauer ohne Lösungen in Kauf zu nehmen bereit ist. Dafür muß man aber auf einen gepflegten Widerwillen gegen jedes bloße Beiseiteschieben bislang unerklärter Intuitionen zurückgreifen können und auf die Gewissenhaftigkeit, vernünftige Maßstäbe klarer Problemstellung und stimmiger Argumentation zu wahren.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es für manche philosophischen Probleme so etwas wie echte Lösungen nicht geben können wird. Ich vermute, daß dies auf die tiefsten und ältesten dieser Probleme wirklich zutrifft. Sie verweisen uns in der Tat auf Grenzen unseres Erkenntnisvermögens. Aber auch in solchen Fällen können wir ein wenig profundere Einblicke nur gewinnen, indem wir uns standhaft auf das Problem einlassen – anstatt es einfach fallenzulassen – und ein Verständnis dafür ausbilden, weshalb jeder neue Lösungsversuch nicht minder zum Scheitern verurteilt war als samt und sonders alle seine Vorgänger. Aus keinem anderen Grunde studieren wir ja durchaus auch die Schriften von Philosophen wie Platon und Berkeley, deren Antworten in unseren Tagen von niemandem mehr als glaubhafte Lösungen anerkannt werden. Ein Problem ist nicht schon deshalb ein Scheinproblem, weil man es nicht zu lösen vermag.
Die im vorliegenden Band versammelten Essays sind sowohl aus der Beschäftigung mit internen, themenspezifischen als auch mit externen, übergreifenden Fragen hervorgegangen. So disparat meine Essays auch ausgefallen sein mögen, eint sie gleichwohl ein Interesse an der Perspektive des persönlichen menschlichen Lebens und an ihrem prekären Verhältnis zu diversen impersonaleren Realitätsauffassungen; und diese Schwierigkeit – sie wird im vierzehnten Kapitel in allgemeiner Form angesprochen –, kommt in allen philosophischen Disziplinen auf: von der Ethik bis hin zur Metaphysik. Die Frage nach der Stellung der Subjektivität in einer objektiven Welt motivierte gleichermaßen meine Aufsätze zur philosophischen Psychologie, meinen Essay über das Absurde und meine Beschäftigung mit moralischem Glück oder Pech. Sie stand im Zentrum meiner Interessen, seit ich begann, über Philosophie nachzudenken und bestimmt ebenso wesentlich die Probleme, mit denen ich mich auseinandersetze; wie die besondere Art des Verständnisses, das ich dabei erreichen möchte.
Einige der Essays wurden in einer Zeit geschrieben, während der die Vereinigten Staaten von Amerika an einem verbrecherischen Krieg beteiligt waren, den sie auf verbrecherische Weise führten. Das hat seinerzeit meine Sensibilität für die Absurdität meiner Beschäftigung mit rein theoretischen Fragestellungen gesteigert. Die Staatsbürgerschaft erweist sich als eine überraschend starke Bindung, selbst für diejenigen von uns, deren patriotische Gefühle nur sehr schwach ausgeprägt sind. Voller Entsetzen und Wut lasen wir tagtäglich die Zeitung und verspürten dabei andere Empfindungen als die Gefühle, die sich einzustellen pflegen, wenn man von den Verbrechen des Auslands liest. Diese Betroffenheit war es auch, die dazu führte, daß sich in den späten sechziger Jahren immer mehr Philosophen mit professionellem Ernst gesellschaftlichen Fragen zuwandten.
Philosophischer Kritik der Sozialpolitik haftet indessen noch eine ganz andere Art von Absurdität an. Ohne Frage können moralische Urteilskraft und ethische Theorie für politische Problembereiche ebensogut Geltung beanspruchen wie für Schwierigkeiten der Individualethik, doch bleiben sie auf dem Feld des Politischen bemerkenswert unwirksam: Sobald es um handfeste und machtvoll verteidigte Interessen geht, will es einem immer unmöglicher scheinen, noch etwas durch Argumente verändern zu wollen, die an so etwas wie Anstand, Menschlichkeit, Mitgefühl oder Gerechtigkeitssinn appellieren, und seien sie noch so zwingend. Von nun an müssen sich solche Argumente auch noch gegen all die primitiven moralischen Regungen durchsetzen, die mit Ehre, Vergeltung und Autoritätshörigkeit einhergehen und sich in unsererem Zeitalter eine derart wichtige Rolle anmaßen, daß es mit einem Mal nicht mehr ratsam erscheint, in seinen politischen Appellen noch aggressives Handeln verdammen und Altruismus oder Humanität verlangen zu wollen. Schließlich setzt die Wahrung der Ehre allenthalben voraus, daß man zur Aggression bereit und dazu in der Lage ist, Regungen der Humanität in sich zu unterdrücken. Doch ist der Ehrbegriff freilich flexibel genug: Gerade er könnte dereinst vielleicht auch einmal so erweitert werden, daß er konkrete Anforderungen an die moralische Integrität mit einschließt. Im Hier und Jetzt allerdings ist das moralische Bewußtsein der Öffentlichkeit von diesem moralischen Profil noch weit entfernt.
Ich bleibe daher pessimistisch im Hinblick auf theoretische Ethik als eine Art öffentlicher Dienstleistung. Nur unter sehr besonderen Bedingungen, von denen ich mir noch kein allzu deutliches Bild machen kann, vermögen ethische Argumente mit einem Mal auch auf das konkrete Handeln von Menschen Einfluß zu gewinnen. Diese Bedingungen sind es, die man in einem Durchgang durch Geschichte und Psychologie der Moralen einmal zu untersuchen hätte – zwei besonders wichtige, wiewohl unzureichend entwickelte Forschungsgebiete, die nach Nietzsche in der Philosophie kaum noch beachtet wurden.
Mit Sicherheit hat es nicht ausgereicht, bloß die Ungerechtigkeit eines Handelns und die Illegitimität einer politischen Praxis drastisch vor Augen zu führen. Menschen müßten auch soweit sein, daß sie auf die Argumente hören, und solche Bereitschaft läßt sich durch kein bloßes Argument herstellen. Ich sage dies nur, um ausdrücklich zu betonen, daß das Geschäft der Philosophie, selbst wenn sie sich mit den brennendsten gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, allemal theoretisch bleibt, und philosophische Schriften nicht etwa an ihrer praktischen Wirkung zu messen sind. Philosophie wird stets mit großer Wahrscheinlichkeit wirkungslos bleiben und könnte allein aufgrund der Publizität ihrer Themen noch keinen Vorrang vor Forschungen beanspruchen, die für die gesellschaftlichen Probleme irrelevant sind, deren Weltverständnis dafür aber einen weitaus größeren theoretischen Tiefgang erreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nun wichtiger ist, die Welt zu verändern oder sie zu verstehen, doch Philosophie jedenfalls gehört zu den Disziplinen, die man allemal besser an ihrem Beitrag zum Verständnis als am Einfluß auf den Gang der Dinge messen sollte.
Der Tod
Warum eigentlich ist es schlimm zu sterben, wenn der Tod doch das Ende unserer Existenz ist, unwiderruflich und in alle Ewigkeit?
Die Meinungen in dieser Frage gehen auffallend weit auseinander. Für manche Menschen ist der Tod etwas Schreckliches, andere hingegen haben am Tod als solchem nichts auszusetzen, obwohl auch sie sich wünschen, daß er im eigenen Fall nicht zu bald eintritt, und wenn, dann kurz und schmerzlos. Während die Vertreter der einen Anschauung die der anderen schlicht für blind halten, da sie doch das Nächstliegende nicht erkennen, sehen andererseits diese in jenen nur die bedauernswerten Opfer einer Verwirrung. Die eine Seite kann geltend machen, daß das Leben alles ist, was wir haben, und sein Verlust das schlimmste Übel, das wir überhaupt erleiden können. Die andere Seite führt an, dagegen spreche doch aber gerade, daß der Tod diesen vorgeblichen Verlust ja seines Subjekts beraubt. Sobald wir erkennen, daß der Tod nicht etwa ein unvorstellbarer Zustand einer Person ist, die womöglich nach wie vor existiert, sondern an sich schlicht – nichts, werden wir auch einsehen, daß ihm weder eine positive noch eine negative Valenz zugeschrieben werden kann.
Ich will die Frage ausklammern, ob wir in irgendeiner Weise unsterblich sind oder es überhaupt sein könnten. Deshalb werde ich mich für mein Teil mit dem Wort »Tod« oder verwandten Ausdrücken im folgenden auf den endgültigen Tod beziehen, auf jenen wirklichen Tod, der alle Formen bewußten Weiterlebens ausschließt. Ich werde diskutieren, ob der Tod an sich selbst etwas Schlechtes ist, wie groß dieses Übel gegebenenfalls ist, und von welcher Art. Dafür sollte sich sogar jemand interessieren, der an irgendeine Form der Unsterblichkeit glaubt, denn zwangsläufig hätte unsere Einstellung zu ihr zu einem Teil von unserer Einstellung zum Tod abzuhängen.
Ist der Tod ein Übel, dann nicht etwa aufgrund positiver Qualitäten, die wir ihm zuschreiben könnten, sondern allein aufgrund dessen, was er uns raubt. Die Schwierigkeiten, mit denen ich fertig zu werden versuche, entstehen im Umfeld der natürlichen Ansicht, daß der Tod deswegen ein Übel ist, weil mit seinem Eintreten all das Gute ein Ende hat, das uns das Leben bietet. Wir brauchen nicht im einzelnen darauf einzugehen, was hier mit dem Guten gemeint ist; wir sollten lediglich festhalten, daß einiges dazugehört – Wahrnehmen, Wünschen, Handeln und Denken –, das allgemein genug ist, um für das menschliche Leben als solches konstitutiv zu sein. Es ist eine weit verbreitete Ansicht, daß es sich hierbei um vorzügliche Himmelsgaben handelt, ungeachtet der Tatsache, daß es eventuell einer ausreichenden Anzahl einzelner Übel gelingen könnte, den Vorteil dieser Gaben aufzuwiegen, und daß sie Bedingungen für Freud und Leid gleichermaßen sind. Das, glaube ich, will gegebenenfalls die Bekundung ausdrücken, es sei schon gut, nur am Leben zu sein, gleichgültig wie entsetzlich das ist, was man durchmacht. Im großen und ganzen handelt es sich darum, daß es auf der einen Seite Komponenten gibt, die zu einem besseren Leben führen, wenn man sie der Erfahrung hinzufügt, und andererseits Komponenten, die der Erfahrung hinzugefügt das Leben schlechter machen. Was aber übrig bleibt, wenn man von diesen Komponenten absieht, ist eben nicht bloß neutral, es ist entschieden positiv. Deshalb ist das Leben lebenswert, selbst wenn sich die üblen Erlebnisse häufen und die guten so dürftig sind, daß sie allein keinen Ausgleich schaffen können. Den Ausschlag zum Positiven gibt dann die Erfahrung selbst, und nicht einer ihrer Inhalte.
Ich möchte hier nicht darauf eingehen, welchen Wert das Leben oder der Tod einer Person für andere haben können, und auch nicht, welches ihr objektiver Wert ist, sondern mich beschäftigt, welchen Wert der Tod für die Person selbst hat, die sein Subjekt ist. Das scheint mir der primäre Aspekt des Problems, aber auch der schwierigste zu sein. Ich möchte nur noch zwei Beobachtungen anfügen: Erstens kommt der Wert des Lebens und seiner Inhalte nicht dem bloßen organischen Überleben zu. Fast jedermann wäre es ceteris paribus egal, ob er auf der Stelle tot wäre oder nur in ein Koma fiele, das zwanzig Jahre später, ohne daß er je wieder erwacht wäre, mit dem Tod endete. Zweitens kann das Gute am Leben wie das meiste Gute durch die Zeit vervielfacht werden: je länger, desto besser. Dieser Prozeß muß keineswegs kontinuierlich vonstatten gehen (obwohl das etliche soziale Vorteile hätte). Manch einer fühlt sich von der Möglichkeit angezogen, die Körperfunktionen längere Zeit auszusetzen oder den Körper einzufrieren, um danach das bewußte Leben wieder aufzunehmen, und der Grund hierfür ist, daß er es aus der Innenperspektive einfach als Fortsetzung seines jetzigen Lebens bemerken würde. Angenommen, diese Techniken wären eines Tages weit genug entwickelt, könnte etwas, das von außen wie ein dreihundert Jahre dauernder Winterschlaf aussieht, vom Subjekt selbst lediglich als scharfer Bruch in der Kontinuität seiner Erlebnisse empfunden werden. Damit leugne ich natürlich nicht, daß auch dies seine Schattenseiten hätte. Freunde und Angehörige würden längst tot sein; die eigene Sprache könnte sich gewandelt haben; unsere komfortable Vertrautheit mit der eigenen Kultur, Geographie und Gesellschaft wäre dahin. Und doch würden diese Schwierigkeiten den grundsätzlichen Vorteil eines nunmehr fortdauernden, wenngleich diskontinuierlichen Daseins nicht aufheben.
Wenden wir uns statt den guten Seiten des Lebens den schlechten des Todes zu, so ändert sich die Lage vollständig. Es mag zwar problematisch sein, angeben zu wollen, was wir im einzelnen am Leben für wünschenswert halten, doch wird es sich dabei wesentlich um bestimmte Zustände, Bedingungen oder Aktivitätsformen handeln. Wir finden es gut, am Leben zu sein, gewisse Dinge zu tun und bestimmte Erlebnisse zu haben. Doch sofern der Tod ein Übel ist, ist es eher der Verlust des Lebens als irgendein Zustand, tot, nicht mehr existent oder bewußtlos zu sein, an dem wir etwas auszusetzen haben.1 Diese Asymmetrie ist entscheidend. Ist es gut, am Leben zu sein, kann man dieses Gut einer Person zeit ihres Lebens zuschreiben. Mithin war Bach darin reicher als Schubert, einfach weil er länger lebte. Beim Tod hingegen handelt es sich nicht um ein Übel, von dem Shakespeare bis heute eine erheblichere Portion einstecken mußte als Proust. Ist der Tod etwas Schlechtes, fällt es nicht leicht zu sagen, wann jemand eigentlich unter dem entsprechenden Nachteil leiden sollte.
Es gibt zwei weitere Anzeichen dafür, daß wir am Tod nicht bloß auszusetzen haben, daß er lange Perioden der Nichtexistenz einschließt. Wie gesagt würden erstens die meisten von uns ein zeitweiliges Aussetzen des Lebens, selbst für eine beträchtliche Zeitspanne, nicht schon per se für ein vergleichbares Unglück erachten. Sollte es dereinst einmal möglich werden, Menschen einzufrieren, ohne daß sich dadurch ihr bewußtes Leben verkürzte, wäre es im Grunde unangebracht, einen zu bedauern, der auf diese Weise eine Zeitlang aus dem Verkehr gezogen würde. Zweitens gilt ebensogut, daß keiner von uns existierte, bevor er geboren (oder gezeugt) wurde, daß jedoch kaum jemand dies jemals als Unglück empfindet. Davon wird später noch zu reden sein.
Das Faktum, daß wir uns den Tod nicht als einen unglückseligen Zustand denken, gestattet es uns, eine ebenso merkwürdige wie verbreitete Vermutung über die Ursache unserer Angst vor dem Tode zurückzuweisen. Nicht selten hört man, der Fehler all derer, die etwas gegen den Tod einzuwenden hätten, bestehe in dem Versuch sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Man versichert, daß just dieses Unvermögen, die logische Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens einzusehen – die schlicht daher rührt, daß es da gar nichts vorzustellen gibt – das Moment sei, das zu der Überzeugung führt, der Tod sei ein mysteriöser und deshalb furchterregender künftiger Zustand. Doch kann diese Diagnose unmöglich richtig sein, und der Grund dafür ist der folgende: Es ist nicht minder unmöglich sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, vollständig ohne Bewußtsein zu sein, wie sich vorzustellen, tot zu sein (obwohl man sich aus der Außenperspektive freilich mühelos vorstellen kann, in einem dieser beiden Zustände zu sein), und doch haben zahllose Menschen, die allerhand gegen den Tod haben, in der Regel gegen den Zustand der Bewußtlosigkeit nichts einzuwenden (jedenfalls solange damit keine entscheidende Einbuße in der Gesamtdauer ihres wachen Lebens verbunden ist).
Soll die Auffassung überhaupt einen guten Sinn ergeben, daß es schlecht ist zu sterben, so deshalb, weil das Leben etwas Gutes ist und der Tod der entsprechende Verlust oder Mangel. Zu sterben ist nicht etwa schlecht aufgrund positiv damit einhergehender Qualitäten, sondern aufgrund des negativen Sachverhalts, daß da vormals etwas Wünschenswertes war, das uns der Tod genommen hat. Ich möchte nun zu den ernsthaften Schwierigkeiten übergehen, die diese Hypothese mit sich bringt, zu Schwierigkeiten, die sich in Angelegenheiten des Verlusts und Mangels im allgemeinen und der Frage des Todes im besonderen ergeben.
Wir haben es im Wesentlichen mit drei Arten von Problemen zu tun. Zum ersten könnte man bezweifeln, daß für einen Menschen überhaupt etwas schlecht sein kann, ohne ihm wirklich unangenehm zu sein. Man mag insbesondere bezweifeln, daß es Übel gibt, die rein darin aufgehen, daß Gutes fehlt oder verloren geht, dabei aber niemanden voraussetzen, dem der Verlust etwas ausmacht. Zum zweiten tauchen im Zusammenhang mit dem Tod eine Reihe besonderer Schwierigkeiten auf, die damit zusammenhängen, wie man das vermeintliche Unglück überhaupt einem Subjekt zuschreiben kann. Es ist sowohl zweifelhaft, wer sein Subjekt ist, als auch, wann es vom Tod betroffen sein soll. Solange eine Person existiert, ist sie ja noch nicht gestorben, und wenn sie gestorben ist, existiert sie nicht mehr. Mithin scheint es erst gar keinen Zeitpunkt geben zu können, zu dem wir das Übel, das der Tod doch sein soll, seinem bedauernswerten Subjekt zuschreiben können. Und eine dritte Schwierigkeit betrifft die oben erwähnte Asymmetrie zwischen unseren Einstellungen gegenüber posthumer und pränataler Nichtexistenz: Wie kann die erstere schlecht sein, letztere aber nicht?
Man sollte sich jedoch über folgendes im klaren sein: Wären dies wirklich stichhaltige Einwände dagegen, im Tod ein Übel zu sehen, dann müßten sie sich auch auf viele andere vermeintliche Übel anwenden lassen. Die erste Art von Einwänden wird in allgemeiner Form durch das Sprichwort ausgedrückt: »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«. Das würde bedeuten, daß wir sogar von jemandem, der von seinen Freunden betrogen, hinterrücks verspottet und von denselben Leuten, die ihm freundlich ins Gesicht lächeln, verachtet wird, solange nicht sagen können, er sei unglücklich, wie er nicht darunter leidet. Ebensogut würde es besagen, daß derjenige nicht gekränkt wird, dessen letzter Wille vom Testamentsvollstrecker mißachtet oder über den nach seinem Tod das Gerücht verbreitet wird, das literarische Werk, das ihn berühmt gemacht habe, sei in Wahrheit von seinem Bruder verfaßt worden, der im Alter von achtundzwanzig Jahren in Mexiko gestorben sei. Es scheint mir die Frage angezeigt, welche Annahmen es in Sachen dessen, was gut oder schlecht ist, eigentlich sein sollten, die zu derart drastischen Einschränkungen führen?
Alle diese Fragen haben etwas mit der Zeit zu tun. Zweifellos gibt es Dinge (darunter mancherlei Freuden und Schmerzen), die für einen Menschen einfach aufgrund des Zustands, in dem er sich zu dieser Zeit befindet, gut oder schlecht sind. Doch gilt dies nicht von allem und jedem, das wir als gut oder schlecht für einen Menschen erachten. Häufig müssen wir erst seine Geschichte kennen, um sagen zu können, ob etwas ein Unglück für ihn ist oder nicht, vor allem, wenn es sich darum handelt, daß sich seine Situation verschlechtert oder daß er einen Verlust oder Schaden erlitten hat. Ja, in einigen Fällen ist es hierfür sogar ziemlich uninteressant, wie es ihm momentan gerade geht – so etwa im Falle des Mannes, der sein Leben damit vergeudet, quietschvergnügt nach der Spargelsprache zu suchen. Wer die Meinung vertritt, daß nur Zustände einer Person, die ihr mit Angabe eines Zeitpunkts zugeschrieben werden können, gut oder schlecht seien, könnte solchen Problemfällen natürlich dadurch Rechnung tragen wollen, daß er auf die Freuden oder Leiden hinwiese, die durch diese komplizierteren Fälle verursacht würden. Dieser Ansicht zufolge wäre es schlecht, etwas zu verlieren, verraten, betrogen und verspottet zu werden, weil der Betroffene darunter leidet – so er davon erfährt. Wir sollten uns aber fragen, welche Vorstellungen davon, was für den Menschen welchen Wert hat, es uns erlauben würden, mit diesen problematischen Fällen statt dessen auf direktem Wege fertig zu werden. Das hätte unter anderem den Vorteil, daß wir erklären könnten, warum einer eigentlich leidet, wenn er erfährt, wie glücklos er ist, und es auf eine Weise erklären könnten, die dieses Leiden als gerechtfertigt erscheinen ließe. Denn für gewöhnlich sagt man ja, daß das Aufdecken eines Verrats uns unglücklich macht, weil es schlecht ist, verraten zu werden, und nicht etwa, daß es schlecht ist, verraten zu werden, weil die Entdeckung uns unglücklich macht.
Deshalb scheint es mir einen Versuch wert zu sein, die Ansicht zu untersuchen, daß das Subjekt fast jeden Glücks oder Unglücks eine Person ist, die nicht durch den kategorischen Zustand, in dem sie sich im betreffenden Augenblick befindet, sondern durch die Geschichte ihres Lebens und all das, was ihr in diesem Leben möglich ist, identifiziert wird – so daß sich zwar das Subjekt räumlich und zeitlich exakt lokalisieren ließe, nicht aber unbedingt auch alles Gute und Schlechte, das ihm widerfahren kann.2
Diese Überlegungen lassen sich gut am Beispiel einer Privation veranschaulichen, die fast so schwer wiegt wie der Tod. Angenommen eine intelligente Person verletzte sich am Gehirn so stark, daß sie den Geisteszustand eines zufriedenen Säuglings zurückfällt. Alle ihr noch bleibenden Bedürfnisse können von einem Pfleger befriedigt werden, sie hat also keine Sorgen. Nahezu jedermann würde diesen Vorgang als schreckliches Unglück ansehen, und zwar nicht nur für ihre Verwandten und Freunde oder für die Gesellschaft, sondern in erster Linie für sie. Damit ist freilich nicht gesagt, daß ein zufriedener Säugling etwa unglücklich ist. Das Subjekt des Unglücks ist vielmehr die intelligente erwachsene Person, die in diesen Zustand zurückgefallen ist. Sie ist es, die wir bedauern, obgleich ihr dieser Zustand natürlich nichts ausmacht. Ja, es regen sich sogar gewisse Zweifel, ob wir dann überhaupt sagen können, daß es sie immer noch gibt.
Sobald aber jemand davon überzeugt ist, ein solcher Mensch sei Opfer eines Unglücks geworden, lassen sich hiergegen dieselben Einwände vorbringen, die im Zusammenhang mit dem Tod erhoben wurden: Der betreffende Mensch leidet ja nicht unter seinem Zustand. Es ist derselbe Zustand, in dem er sich im Alter von drei Monaten befunden hatte, nur daß er jetzt etwas größer ist. Damals haben wir ihn nicht bedauert, warum bedauern wir ihn eigentlich jetzt? Und wie dem auch sei, wen bedauern wir eigentlich? Den intelligenten Erwachsenen gibt es ja nicht mehr, und für ein Wesen, wie wir es jetzt vor uns haben, besteht alles Glück dieser Erde in einem vollen Magen und einer trockenen Windel.
Geht diese Einrede fehl, dann aufgrund einer irrigen Annahme über die zeitliche Beziehung zwischen dem Subjekt des Unglücks und den für das Unglück verantwortlichen äußeren Umständen. Hören wir also auf, uns ausschließlich auf das überdimensionale Baby vor uns zu konzentrieren, und denken wir an den, der er einmal war, und daran, wer er in diesen Tagen hätte sein können, dann ist sein Rückfall in diesen Zustand und der abrupte Abbruch seines natürlichen Erwachsenenlebens der klare Fall einer Katastrophe.
Das sollte uns davon überzeugen, daß es aus der Luft gegriffen ist, all das, was gut oder schlecht für einen Menschen sein kann, auf nichtrelationale Eigenschaften der Person, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeschrieben werden können, beschränken zu wollen. In Wahrheit würden wir mit einer solchen Restriktion nicht nur Fälle hochgradiger Degeneration wie den oben geschilderten ausschließen, sondern darüber hinaus auch einen Großteil dessen, was über jemandes Erfolg oder Mißerfolg und all jene anderen Charakteristika seines Lebenslaufes entscheidet, die Prozesse sind. Ja, wir können sogar noch weiter gehen: Es gibt Güter oder Übel, die irreduzibel relational sind – Merkmale der Beziehung zwischen äußeren Umständen und einer in der gewohnten Weise raumzeitlich bestimmten Person –, die weder zu ihren eigenen Lebzeiten eintreten müssen noch an demselben Ort, an dem sie sich befindet. Zum Leben eines Menschen gehört vieles, das sich außerhalb der Grenzen seines Körpers und Geistes abspielt, und zu dem, was ihm widerfährt, kann auch mancherlei gehören, das sich außerhalb der Grenzen seiner Lebensdauer abspielt. Beispielsweise werden diese Grenzen bisweilen überschritten, wenn jemandem das Unglück widerfährt, getäuscht, verachtet oder betrogen zu werden. (Sollte sich diese Position als haltbar erweisen, können wir auch mühelos erklären, was unrecht daran ist, ein Versprechen zu brechen, das man am Sterbebett gegeben hat: Es ist eine Kränkung des Verstorbenen. Bisweilen ist es möglich, in der Zeit nur eine andere Form von Distanz zu sehen). Das Beispiel psychischer Degeneration zeigt, daß es manchmal vom Kontrast zwischen der Wirklichkeit und alternativen Möglichkeiten abhängt, ob etwas ein Übel ist. Für einen Menschen kann etwas nicht nur schlecht (oder gut) sein, weil er fähig ist zu leiden (oder sich zu erfreuen), sondern weil er auch Hoffnungen hat, die in Erfüllung oder nicht in Erfüllung gehen könnten, und Anlagen, die er entfalten oder nicht entfalten könnte. Ist der Tod ein Übel, werden wir uns an diesen Aspekt zu halten haben, und es sollte uns dann erst gar nicht stören, daß man das Übel nicht länger innerhalb des betreffenden Lebens zu lokalisieren vermag.
Stirbt jemand, so ist alles, was von ihm übrig bleibt, sein Leichnam. Nun kann ein Leichnam zwar zu Schaden kommen, ganz wie ein Möbelstück, doch wäre es völlig unangemessen, einen Leichnam zu bedauern. Bedauern kann man aber den Menschen. Er hat sein Leben verloren, und wäre er nicht gestorben, würde er dieses Leben heute noch immer führen und im Besitz all dessen sein, was es an Gutem ermöglicht. Wenden wir die Überlegung, die wir im Falle unseres Debilen angestellt haben, auf den Tod an, so können wir zwar ziemlich klar die räumliche und zeitliche Lokalisierung dessen, der den Verlust erlitten hatte, angeben, nicht aber so leicht die seines Unglücks. Wir müssen uns mit der Feststellung zufrieden geben, daß sein Leben aus und vorbei ist und es auf ewig bleiben wird. Dieses Faktum, und nicht etwa irgendein Zustand, in dem er sich jetzt befindet oder einst befand, macht sein Unglück aus, wenn es denn eines ist. Wenn es sich indes um einen Verlust handelt, muß es allemal jemanden geben, der ihn erleidet und der mithin existieren und einen genauen Ort in Raum und Zeit haben muß, selbst wenn dies für den Verlust nicht gilt.
Das Faktum, daß Beethoven keine Kinder hatte, mag uns veranlassen, ihn zu bedauern, und mag traurig für die Welt sein, aber niemand kann sagen, es sei ein Unglück für die möglichen Kinder, die er nicht gehabt hat. Ich glaube, jeder von uns ist glücklich zu schätzen, das Licht der Welt erblickt zu haben, aber solange es unmöglich ist, von einem Embryo oder erst recht von einem noch nicht verschmolzenen Paar von Keimzellen zu sagen, sie hätten Glück oder Pech, solange kann man auch nicht davon sprechen, daß es ein Unglück sei, nicht geboren zu werden. (Solche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle, wenn es zu entscheiden gilt, ob Abtreibung oder Empfängnisverhütung womöglich etwas mit Mord zu tun haben könnten.)
Diese Überlegungen erlauben es nun, das Problem der zeitlichen Asymmetrie zu lösen, auf das Lukrez hingewiesen hat. Ihm fiel auf, daß niemand es beunruhigend findet, über jene Ewigkeit zu grübeln, die seiner eigenen Geburt voranging. Diese Feststellung schien ihm zu beweisen, daß es irrational sei, den Tod zu fürchten, da dieser doch nichts weiter sei als das Spiegelbild der dem Leben vorausliegenden Unendlichkeit. Das ist jedoch schlicht nicht wahr, und was beide Sachverhalte voneinander unterscheidet, liefert uns auch die Erklärung dafür, warum wir sie mit gutem Grund unterschiedlich behandeln. Es stimmt zwar, daß niemand in dem Zeitraum vor seiner Geburt oder nach seinem Tod existiert. Doch die Zeit nach unserem Tod ist die Zeit, die uns der Tod raubt. Wären wir nicht gestorben, wären wir zu dieser Zeit ja noch am Leben. Deshalb führt der Tod stets zum Verlust irgendeiner Lebensspanne, die sein Opfer noch erlebt hätte, wäre es nicht zu dieser oder einer früheren Zeit gestorben. Wir wissen nur zu genau, wie es für ihn gewesen wäre, wenn ihm dieses Leben noch geblieben wäre, das er verloren hat, und es bereitet uns keinerlei Mühe, denjenigen zu identifizieren, der diesen Verlust erlitten hat.
Aber es ist nicht möglich zu sagen, die Zeit vor der Geburt sei ebensogut eine Zeit, die dieser Mensch erlebt hätte, wäre er nur früher geboren worden. Denn abgesehen von einem unerheblichen Spielraum, der sich durch die Möglichkeit vorzeitig eintretender Wehen ergibt, hätte er gar nicht früher auf die Welt kommen können als zu der Zeit zu der er geboren wurde: Jeder, der wesentlich früher als er geboren worden wäre, wäre ein anderer gewesen. Folglich gilt für die Zeit vor seiner Geburt keineswegs, daß das zu späte Eintreten der Geburt etwa schuld daran war, daß er sie nicht erlebt hat. Gleichgültig wann einer das Licht der Welt erblickt, verliert er dadurch keine Sekunde seines Lebens.
Die Zeitrichtung ist entscheidend, sobald wir einem Menschen oder überhaupt einem Individuum Möglichkeiten zuschreiben. Verschiedene mögliche Leben einer einzelnen Person können, ausgehend von einem gemeinsamen Anfang, divergieren, aber sie können schwerlich aus unterschiedlichen Anfängen in einem gemeinsamen Ende zusammentreffen. (Im letzteren Fall würde es sich nicht um eine Reihe verschiedener möglicher Leben ein und desselben Individuums handeln, sondern um eine Reihe verschiedener möglicher Individuen, deren Leben gegen ein gemeinsames Ende konvergierten.) Wir können uns also für jedes identifizierbare Individuum unzählige mögliche Fortsetzungen seines Lebens vorstellen und uns immerhin vor Augen führen, wie es für dieses Individuum wäre, unendlich lange weiterzuexistieren. Wie unausweichlich es auch immer sein mag, daß dieser Fall nie eintreten wird, besteht doch diese beständige Möglichkeit als die Möglichkeit, daß das Gute am Leben kontinuierlich fortdauert (wenn sein Leben tatsächlich so gut ist, wie wir unterstellt haben).3
Es stellt sich mithin die Frage, ob die Nichtverwirklichung dieser Möglichkeit in jedem Falle ein Unglück sein muß, oder ob dies davon abhängt, was vom Weiterleben überhaupt noch zu erhoffen war. Das scheint mir die in Wahrheit gravierendste Schwierigkeit für die Position zu sein, daß der Tod jederzeit ein Übel sei. Selbst wenn es uns gelänge, das Befremden abzuschütteln, ob man überhaupt von einem Übel reden kann, wenn das Unglück nie erlitten wird oder einer Person nicht zu Lebzeiten zugeschrieben werden kann, bliebe nämlich noch die Frage, wie aussichtsreich dann eine Aussicht zum mindesten zu sein hat, damit als Unglück aufgefaßt werden kann, daß sie nicht verwirklicht wird (oder als Glück, falls es sich um die Aussicht auf etwas überaus Schlimmes gehandelt hat). Gewöhnlich gilt Keats' Tod im Alter von nur vierundzwanzig Jahren als eine Tragödie, nicht aber Tolstois Tod als Zweiundachtzigjähriger. Obwohl beide bis in alle Ewigkeit tot sind, wurde Keats ja vieler Lebensjahre beraubt, die Tolstoi noch beschieden waren. Keats mußte also ganz eindeutig einen komparativgrößeren Schaden erleiden (obwohl dies freilich nicht der Sinn von »größer« ist, mit dessen Hilfe unendliche Quantitäten normalerweise in der Mathematik verglichen werden).
Indessen kann so nicht bewiesen werden, daß Tolstoi etwa nur einen unbedeutenden Verlust erlitten hat. Denn womöglich verhält es sich lediglich so, daß wir erst dann Protest einzulegen pflegen, wenn das Unausweichliche noch durch üble Dreingaben unnötig vermehrt wird. Jedenfalls nimmt die Tatsache, daß es entschieden schlechter ist, mit vierundzwanzig als mit zweiundachtzig Jahren zu sterben, dem Tod eines Zweiundachtzigjährigen nichts von seinem Schrecken – ebensowenig wie dem Tod eines Achthundertsechsjährigen. In Frage steht dann, ob wir eine Beschränkung, die wie die Sterblichkeit für eine Spezies normal ist, überhaupt für ein Unglück erachten können. Blind oder fast blind zu sein, ist für den Maulwurf schließlich kein Unglück und wäre es auch nicht für den Menschen, würde es von Natur aus zur Beschaffenheit seiner Spezies gehören, daß er nicht sehen kann.
Das Mißliche hieran ist, daß uns das Leben immer schon vertraut macht mit all dem Guten, das der Tod uns dann raubt. Wir sind deshalb, im Unterschied zum Maulwurf, der die Fähigkeit zu sehen erst gar nicht würdigen kann, in der Lage, den Wert dieses Guten zu erkennen. Lassen wir die Zweifel beiseite, ob es sich überhaupt um etwas Gutes handelt, und gestehen wir außerdem zu, daß das Ausmaß des Guten zu einem Teil davon abhängt, wie lange es andauert, verbleibt uns die Frage, ob gesagt werden kann, daß der Tod, völlig gleichgültig wann er eintritt, sein Opfer der im relevanten Sinne möglichen Fortsetzung seines Lebens beraubt.
Die Problemlage ist doppeldeutig. Aus der externen Perspektive besehen haben menschliche Wesen unbestreitbar eine natürliche Lebenserwartung und können unmöglich wesentlich älter werden als hundert Jahre. Doch das interne Bewußtsein, das jemand von seinem eigenen Erleben hat, schließt gerade nicht diese Vorstellung ein, daß die Natur seinem Leben eine Grenze gesetzt hat, vielmehr konkretisiert sich ihm das Dasein des Individuums als eine virtuell endlose Zukunft mit den gewohnten Wechselfällen von Gutem und Schlechtem, die ihm in der Vergangenheit so erträglich erschienen sind. Nun da er durch eine geradezu überflüssige Verkettung natürlicher, historischer und sozialer Kontingenzen auf die Welt gekommen ist, findet er sich als das Subjekt eines Lebens wieder, dem eine unbestimmte und nicht mit Notwendigkeit befristete Zukunft offensteht. Wie unvermeidlich der Tod auch sei, löscht er aus dieser Perspektive auf abrupte Weise all das mögliche Gute aus, das andernfalls in unbestimmtem Umfange hätte eintreten können. Daß unser Tod normal ist, hat damit offenbar nicht das Mindeste zu tun, denn aus der Tatsache, daß ein jeder von uns unausweichlich nach ein paar Dutzend Jahren sterben wird, folgt ja keineswegs, daß es nicht gut wäre, weiterzuleben. Gesetzt, es sei unausweichlich für uns alle, vor unserem Tod in Agonie zu verfallen – in eine sechs Monate anhaltende physische Agonie. Würde diese Aussicht auch nur um ein Jota weniger unangenehm aufgrund irgendeiner Unausweichlichkeit? Und warum sollte es sich dann mit dem beschriebenen Verlust eigentlich anders verhalten? Bei einer mittleren Lebenserwartung von tausend Jahren wäre es ja nachgerade eine Tragödie, im Alter von nur achtzig Jahren zu sterben. Vielleicht steht es so, daß diese Tragödie unter unseren heutigen Bedingungen nur um einiges verbreiteter ist. Gibt es kein Alter, von dem an es sich nicht mehr zu leben lohnt, mag es sein, daß uns allen ein schlechtes Ende bevorsteht.
Übersetzt von Karl-Ernst Prankel, Ralf Stoecker und Michael Gebauer.
Das Absurde
Die meisten beschleicht hin und wieder das Gefühl, das Leben sei absurd, und einige Menschen haben dieses Gefühl ständig und mit großer Intensität. Allein, die Gründe, die man für gewöhnlich anführt, um diese Überzeugung zu rechtfertigen, sind gelinde gesagt unzureichend: Sie können gar nicht wirklich erklären, weshalb das Leben absurd ist. Warum machen sie sich dennoch als der natürliche Ausdruck unseres Gefühls geltend, daß es sich in der Tat so verhält?
I
Vergegenwärtigen wir uns ein paar typische Reflexionen. Oft hört man, daß nicht das Mindeste dessen, was wir so alles tun, in einer Million Jahren nicht egal sein wird. Wenn dem so ist, läßt sich der Spieß aber doch ebenso leicht umdrehen, und dann ist auch nicht das Mindeste dessen, was in einer Million Jahren sein wird, heute von Bedeutung. Unter anderem wäre es dann insbesondere auch egal, daß alles von dem, was wir heute tun, dereinst egal sein wird. Ja, und selbst wenn es so wäre, daß unser heutiges Tun jemandem in einer Million Jahren tatsächlich nicht egal Sein würde? Dann bliebe noch immer die Frage, warum hierdurch etwas, das uns heute beschäftigt, davor bewahrt würde, absurd zu sein: Was könnte es uns denn nützen, wenn etwas davon in einer Million Jahren für jemanden nicht egal wäre, wenn noch nicht einmal der Tatbestand, daß es heute nicht egal ist, ausreichte, unser Tun vor Absurdität zu retten?
Die Frage, ob etwas, das wir heute tun, in einer Million Jahren bedeutend ist, markiert nur dann die entscheidende Differenz, wenn seine Bedeutsamkeit in einer Million Jahren von seiner Bedeutsamkeit schlechthin abhängt. Stellt man jedoch von vornherein in Abrede, daß irgend etwas dessen, was sich in unseren Tagen zuträgt, in einer Million Jahren von Bedeutung ist, begeht man eine Petitio principii gegenüber dieser zweiten Frage: Man verneint sie immer schon. Denn in diesem Sinne kann man gar nicht sicher sein, daß es in einer Million Jahren egal ist, ob (zum Beispiel) heute jemand glücklich oder unglücklich ist, wenn man nicht immer schon sicher ist, daß es schlechthin egal ist.
Was wir vorbringen, wenn wir anderen die Absurdität unseres Lebens vor Augen führen wollen, kann häufig auch mit Raum oder Zeit zu tun haben: Schließlich sind wir doch alle nur winzige Staubkörnchen in den unendlichen Weiten des Alls; die Spanne unseres Lebens ist doch selbst nach erdgeschichtlichen, ganz zu schweigen von kosmischen Maßstäben nicht mehr als ein bloßer Augenblick; ja, wir werden doch alle jeden Moment tot sein. Aber natürlich kann keine dieser evidenten Tatsachen zur Folge gehabt haben, daß unser Leben absurd geworden ist, wenn es denn absurd ist. Nehmen wir dafür einmal an, wir lebten ewig. Wäre denn ein Leben, das bei einer Dauer von siebzig Jahren absurd ist, bei ewiger Dauer – nach Adam Riese – nicht: unendlich absurd? Und falls unser Leben bei unserer jetzigen Größe absurd ist, warum wäre dieses Leben weniger absurd, wenn wir statt dessen das ganze Universum ausfüllten (sei's, weil entweder wir größer, oder sei's, weil das Universum kleiner wäre als jetzt)? Derlei Reflexionen über uns kurzlebige Zwerge scheinen uns irgendwie in engem Zusammenhang mit dem Gefühl zu stehen, das Leben sei sinnlos, doch bleibt dabei völlig im Dunkel, worin dieser Zusammenhang überhaupt bestehen könnte.
Ein drittes und nicht minder inadäquates Argument bringt vor, daß, weil wir ja alle einmal sterben werden, jede Rechtfertigungskette notgedrungen in der Luft hängen muß: Man lernt und arbeitet, um Geld zu verdienen, um sich damit Obdach, Nahrung, Kleidung und Vergnügen leisten zu können, um sich jahrein, jahraus also am Leben zu halten, vielleicht auch um eine Familie zu ernähren, eine Laufbahn einzuschlagen – aber was dann? All das, um dann letztendlich welchen Zweck zu erreichen? Das ganze ist eine kunstvoll gestaltete verschlungene Reise und führt doch – nirgendwohin! (Zugegeben, all das hat Auswirkungen auf das Leben anderer, aber dann wiederholt sich das Problem ja nur, da auch sie sterben müssen.)
Auch dem läßt sich mancherlei entgegnen. Erstens geht das Leben nämlich nicht nur in einer Reihe von Aktivitäten auf, von denen jede eine weitere, spätere bezweckt. Rechtfertigungsketten finden im wirklichen Leben immer wieder ein Ende, und die Frage, ob sich der Lebensprozeß als ein Ganzes rechtfertigen läßt, spielt für die Endgültigkeit dieses Endens nicht die mindeste Rolle. Es bedarf schlicht keiner weiteren Rechtfertigung dafür, daß es vernünftig ist, gegen Kopfschmerzen eine Aspirintablette zu nehmen, die Ausstellung eines bewunderten Malers zu besuchen oder ein Kind daran zu hindern, den heißen Herd anzufassen. Auch ohne weiteren Kontext oder zusätzlichen Zweck sind derlei Handlungsweisen nicht sinnlos.
Selbst wenn jemand noch weitere Rechtfertigungen für all das im Leben liefern wollte, was gewöhnlich als durch sich selbst gerechtfertigt angesehen wird, müßten auch diese irgendwo ein Ende finden. Könnte nichts eine Rechtfertigung liefern, ohne seinerseits durch etwas anderes gerechtfertigt zu sein, das nicht minder gerechtfertigt wäre, ergäbe sich ein Regreß ins Unendliche – und keine Rechtfertigungskette könnte jemals vollendet werden. Schlimmer noch: Könnte keine endliche Kette von Gründen etwas rechtfertigen, was würde eine unendliche Kette dann überhaupt leisten, bei der jedes Glied durch etwas außer ihr gerechtfertigt sein müßte?
Weil also Rechtfertigungen nun einmal irgendwo ein Ende haben müssen, ist nichts damit gewonnen, daß bestritten wird, daß sie enden, wo sie anscheinend enden, nämlich im Leben – und auch nichts damit, daß man versucht, die Vielzahl von meist trivialen Alltagsrechtfertigungen unseres Handelns unter einem einzigen, leitenden Lebensplan zu einen. Wir sind schon mit viel weniger zufrieden. In der Tat erhebt dieses Argument, indem es den Rechtfertigungsprozeß entstellt, bloß eine hohle, nichtssagende Forderung. Indem man insistiert, daß all die Gründe, die uns das Leben bietet, nicht vollständig sind, suggeriert man, alle einmal endenden Gründe seien unvollständig. Das macht es dann aber unmöglich, überhaupt noch Gründe anzuführen.
Dem Anschein nach sind die üblichen Argumente mithin als Argumente zum Scheitern verurteilt. Und dennoch glaube ich, daß sie etwas auszudrücken suchen, das sich zwar nur mit Mühe sagen läßt, im Grunde genommen aber zutreffend ist.
II
Im Alltag ist eine Situation absurd, sobald in ihr eine spürbare Diskrepanz zwischen Anspruch oder Erwartung und der Realität gegeben ist: Jemand hält eine weitschweifige Rede zugunsten eines Antrags, der bereits angenommen ist; ein Gewohnheitsverbrecher wird Vorsitzender einer bedeutenden Wohlfahrtsorganisation; telefonisch machen Sie eine Liebeserklärung – und zwar der Zeitansage; man schlägt Sie zum Ritter, und es senkt sich Ihre Hose.
Bemerkt jemand, daß er in eine absurde Situation geraten ist, wird er sie gewöhnlich zu verändern suchen, sei es, daß er seine Erwartungen modifiziert, sei es, daß er die Realität besser mit ihnen in Einklang zu bringen versucht, oder sei es, daß er sich der Situation einfach vollständig entzieht. Nicht immer sind wir bereit oder in der Lage, uns vollständig aus einer Situation zu winden, deren Absurdität uns klar geworden ist. Aber für gewöhnlich ist eine Veränderung denkbar, die diese Lebenslage zumindest von ihrer Absurdität befreit, ob wir diese Veränderung nun tatsächlich bewirken, ja auch nur bewirken könnten, oder nicht. Das Gefühl, das Leben im ganzen sei absurd, kommt auf, wenn wir – möglicherweise nur sehr vage – übersteigerte Ambitionen oder Sehnsüchte in uns wahrnehmen, die, untrennbar mit dem Gang eines menschlichen Lebens verbunden, es zugleich unausweichlich absurd machen – unausweichlich, es sei denn durch die Flucht aus dem Leben selbst.
Viele Menschen führen zeitweilig oder dauernd ein absurdes Leben, aus den vertrauten Gründen, die mit ihren besonderen Ambitionen, Lebensumständen und persönlichen Bindungen zusammenhängen. Soll es nun aber einen philosophisch relevanten Sinn von Absurdität geben, muß er sich auf eine vollkommen allgemeine Beobachtung zurückführen lassen, auf die Beobachtung, daß für uns alle in irgendeiner Hinsicht Anspruch und Realität unausweichlich aufeinanderprallen. Ich werde zu zeigen versuchen, daß diese Bedingung in der Tat erfüllt ist, da der Ernst, mit dem wir unser Leben führen, und die Tatsache, daß es uns jederzeit frei steht, all das, was wir ernst nehmen, als willkürlich oder zweifelhaft anzusehen, miteinander in Widerspruch geraten.
Kein Mensch kann ohne ein Mindestmaß an Energie und Aufmerksamkeit leben und ohne Entscheidungen zu fällen, die zeigen, daß für ihn einiges wichtiger, anderes unwichtiger ist. Daneben ist es uns jedoch möglich, jederzeit eine Außenperspektive gegenüber unserer eigentümlichen Lebensführung einzunehmen, aus der heraus dieser Ernst dann restlos unbegründet erscheint. Diese beiden unverzichtbaren Perspektiven kollidieren in uns, und das ist es, was das menschliche Leben absurd werden läßt. Es wird absurd, weil wir die Augen vor jenen Zweifeln verschließen müssen, von denen wir wissen, daß wir sie nicht ausräumen können – absurd, weil wir ihrer ungeachtet mit kaum verminderter Ernsthaftigkeit weiterleben.
Diese Analyse gilt es in zweierlei Hinsicht abzusichern: im Hinblick auf erstens die Unvermeidlichkeit des Ernstes und zweitens die Unumgänglichkeit des Zweifels.
Wir nehmen uns ernst, ob wir nun ein ernstes Leben führen oder nicht, und unabhängig davon, worum es uns in erster Linie geht: ob um Ruhm, Vergnügen, Tugendhaftigkeit, Luxus, Erfolg, Schönheit, Gerechtigkeit, Erkenntnis, unser Seelenheil oder ums pure Überleben. Nehmen wir auch andere Menschen ernst und widmen wir uns ihnen, so vervielfacht sich das Problem nur. Das menschliche Leben ist voll von Anstrengungen, Plänen und Überlegungen, von Erfolg und Mißerfolg. Mit mehr oder minder großer Tatkraft oder Trägheit führen wir unser Leben.
Die Situation wäre eine gänzlich andere, würden wir nicht über jene Fähigkeit verfügen, einen Schritt beiseite zu treten und den Prozeß zu reflektieren, sondern uns bloß von Impuls zu Impuls treiben lassen, bar jeden Bewußtseins unserer selbst. Aber Menschen lassen sich nicht bloß von Impulsen leiten: Sie sind vernunftbegabt, sie reflektieren, wägen Folgen gegeneinander ab und fragen sich, ob das, was sie tun, auch der Mühe wert ist. Es geht nicht nur darum, daß ihr Leben voller Einzelentscheidungen ist, die in übergreifenden, zeitlich strukturierten Aktivitäten einen Zusammenhang bilden: Sie treffen zudem auch im weitesten Rahmen Entscheidungen darüber, was man tun und was man lassen soll, wo Prioritäten bei den verschiedensten Zielen zu setzen sind, und ein welcher sie sein oder letztlich werden wollen. Einige sehen sich mit diesen Fragen konfrontiert, wenn es von Zeit zu Zeit darum geht, weitreichende Entscheidungen zu fällen, bei anderen spielen sie nur eine Rolle, wenn sie ihren aus zahllosen Alltagsentschlüssen hervorgegangenen Lebensweg reflektieren. Sie entschließen sich, eine bestimmte Person zu heiraten, irgendeinen Beruf zu ergreifen, Mitglied im Country Club zu werden oder sich der Resistance anzuschließen – oder fragen sich auch nur, warum sie ihren Job als Vertreter, Hochschullehrer oder Taxifahrer eigentlich nicht einmal an den Nagel hängen sollten – um dann nach einer Weile ertraglosen Reflektierens eben wieder mit dem Grübeln aufzuhören.
Auch wenn es die unmittelbaren Bedürfnisse des täglich gelebten Lebens sein mögen, die sie von Handlung zu Handlung motivieren, sind es doch die Menschen selbst, die zulassen, daß das Leben diesen Gang geht, indem sie sich der allgemeinen Lebensweise und den Verhaltensmustern unterordnen, innerhalb derer solche Motive erst ihren Ort haben, oder vielleicht auch nur, indem sie sich überhaupt ans Leben klammern. Sie stecken Unmengen an Energie, Risikobereitschaft und Denkanstrengung in beliebige Kleinigkeiten. Man vergegenwärtige sich bloß einmal, worüber der normale Mensch sich so alles den Kopf zerbricht: über sein Aussehen, seine Gesundheit, sein Sexual- und Gefühlsleben, seinen Beitrag zum Allgemeinwohl, sein Selbstbild, die Qualität seiner familiären Bindungen und Beziehungen zu Freunden oder Arbeitskollegen, sein berufliches Können, und schließlich auch über die Welt selbst und das Geschehen in ihr. Ein menschliches Leben ist ein Ganztagsjob, und jeder von uns widmet sich ihm jahrzehntelang mit der größten Intensität.
Weil dieser Tatbestand so klar auf der Hand liegt, fällt es uns schwer, ihn für besonders aufregend oder wichtig zu halten. Ein jeder von uns lebt das eigene Leben – lebt es mit sich vierundzwanzig Stunden am Tag. Was sollte er denn sonst tun? Etwa das Leben eines anderen leben? Doch verfügen Menschen über die besondere Gabe, einen Schritt beiseite zu treten, und aus solcher Distanz dann auch sich selbst und ihren Lebensweg mit dem gleichen Staunen zu mustern, mit dem sie auch den hindernisreichen Weg einer Ameise durch den Sand verfolgen. Ohne sich der Illusion hinzugeben, es könnte ihnen gelingen, ihre ganz besondere und höchst idiosynkratische Ausgangslage zur Gänze hinter sich zu lassen, können sie diese immerhin sub specie aeternitatis beobachten, und die gebotene Ansicht ist ernüchternd und belustigend zugleich.
Dieser so entscheidende Schritt beiseite ist nun keinesfalls die – vergebliche – Suche nach noch einem weiteren Glied in der Rechtfertigungskette. Was sich gegen jenen Einwand sagen ließ, war bereits ausgesprochen: Rechtfertigungen finden ein Ende. Doch eben dies ist es, was dem universellen Zweifel sein Objekt verschafft. Wir vollziehen den Schritt beiseite, um dann zu entdecken, daß das gesamte System des Infragestellens und Rechtfertigens, das unseren Entscheidungen zugrunde liegt und ohne das unser Anspruch auf Rationalität in sich zusammenfiele, auf Verhaltensweisen und Reaktionen beruht, die wir ihrerseits niemals in Frage stellen, von denen wir auch nicht wüßten, wie man sie stützen sollte, ohne dabei in einen Zirkel zu geraten, und an denen wir selbst dann noch festhalten, wenn sie solcherart in Zweifel gezogen werden.
Was wir indessen, ohne Gründe mitzubringen und auch ohne Gründe nötig zu haben, tun oder wollen (all jene Dinge, die allererst festlegen, was für uns ein Grund sein kann und was nicht), markiert stets einen Angriffspunkt für den Skeptizismus. Wir betrachten uns aus der Außenperspektive, und mit einem Mal wird uns die ganze Kontingenz und Eingeschränktheit unseres Sinnens und Trachtens klar. Nehmen wir diese Perspektive ein und erkennen unser Tun als kontingent, entbindet uns das nicht vom Leben, und hierin liegt unsere Absurdität: Nicht in der Tatsache, daß wir aus dieser Außenperspektive heraus beobachtet werden können, sondern darin, daß wir sie selbst einnehmen können, ohne damit schon aufzuhören, diejenigen zu sein, deren letzte Belange so von oben herab taxiert werden.
III
Man kann alledem zu entgehen versuchen, indem man nach übergeordneten letzten Belangen sucht, denen gegenüber man dann keinen Schritt mehr beiseite treten kann – dieser Strategie liegt die Überlegung zugrunde, daß es zum Absurden kommt, weil es die in Wirklichkeit unerheblichen, unbedeutenden und auf den einzelnen beschränkten Dinge sind, die wir ernst nehmen. Wer seinem Leben auf diesem Wege Sinn verleihen will, wird gewöhnlich eine Rolle oder Funktion im Gefüge eines größeren Ganzen vor Augen haben. Er sucht seine Erfüllung im Dienst an Gesellschaft oder Staat, an der Revolution oder dem Gang der Geschichte, am Fortschritt in den Wissenschaften – oder an der Religion und der Herrlichkeit Gottes.
Aber eine Funktion im Gefüge eines größeren Ganzen kann Sinn nur dann stiften, wenn dieses Ganze bereits seinerseits Sinn hat. Und dieser Sinn muß uns einsichtig sein, er muß von uns verstanden werden können, andernfalls kann ja noch nicht einmal der Anschein aufkommen, wir hätten gefunden, was wir suchten. Nehmen wir einmal an, wir fänden heraus, daß wir nur deshalb auf die Welt gekommen und in ihr aufgewachsen sind, weil es irgendwelche fremdartigen Wesen mit einer besonderen Vorliebe für Menschenfleisch gibt, deren Grundnahrungsmittel wir bilden und nach deren Plänen wir, noch bevor wir alt und zäh sind, in Koteletts verwandelt werden sollen. Selbst wenn wir entdeckten, daß die Spezies Mensch obendrein von solchen menschenfressenden Viehzüchtern einzig zu diesem kulinarischen Zweck erschaffen wurde, würde dergleichen unserem Leben aus zwei Gründen noch immer keinen Sinn verleihen: Erstens bliebe uns nach wie vor im Dunkel, wie wichtig denn nun das Leben dieser fremden Wesen ist; und zweitens wäre nicht klar, wie der zugegebenermaßen schmackhafte Sinn, den unser Leben für sie hat, diese Wesen für uns überhaupt wichtig machen könnte.
Ich gestehe gern zu, daß das nicht die übliche Art und Weise ist, einem höheren Wesen zu dienen. So erwartet man etwa, Gottes Herrlichkeit in einer Weise zu erschauen und ihrer teilhaftig zu werden, die dem Hühnchen in Ansehung der Herrlichkeit eines Coq au vin gewiß auf immer versagt bleiben wird. Dasselbe gilt für den Dienst am Staat, einer politischen Bewegung oder der Revolution. Menschen, die ein Teil eines erheblicheren Ganzen sind, können im Laufe der Zeit das Gefühl bekommen als sei dieses größere Ganze auch ein Teil ihrer selbst. Diese Menschen kümmern sich nicht mehr vorrangig um ihre persönlichen Eigenarten und Belange, sondern identifizieren sich in so hohem Maße mit dem umfassenderen Unternehmen, daß sie sich durch ihre Funktion darin befriedigt fühlen.
Dennoch läßt sich auch jedes dieser globaleren Anliegen in der gleichen Weise und aus denselben Gründen in Zweifel ziehen wie die persönlichen Ziele des einzelnen. Es ist genauso legitim, in diesen höheren Zwecken die letzte Rechtfertigung zu sehen, wie sie schon eher, irgendwo im Leben des einzelnen anzusiedeln. Aber das alles ändert nichts an der Tatsache, daß die Rechtfertigungen dort enden, wo wir bereit sind, sie enden zu lassen – dort, wo wir die Suche nach weiteren Rechtfertigungen für überflüssig halten. Können wir gegenüber unseren persönlichen, individuellen Belangen einen Schritt beiseite tun und sie in Zweifel ziehen, warum sollten wir uns nicht ebenso von der Geschichte der Menschheit distanzieren können oder von den Wissenschaften oder den sozialen Errungenschaften oder dem Reich, der Macht und der Herrlichkeit Gottes? Was hindert uns daran, auch all dies in Zweifel zu ziehen? Erweckt etwas den Anschein, als könne es uns Sinn, Rechtfertigung und Wichtigkeit bieten, so nur aufgrund des Faktums, daß wir von einem gewissen Punkt an einfach keiner Gründe mehr bedürfen.
Was dazu führt, daß der Zweifel an unseren beschränkten persönlichen Belangen niemals ganz auszuräumen ist, läßt auch den Zweifel an den höheren, umfassenderen Zwecken nicht verstummen, die uns doch gerade darin bestärken, das Leben für sinnvoll zu halten. Hat der fundamentale Zweifel erst einmal sein Werk begonnen, läßt er sich nicht mehr zur Ruhe bringen.
Camus behauptet im Mythos von Sisyphos, das Absurde komme auf, weil diese Welt es nicht schaffe, unser Verlangen nach Sinn zu befriedigen. Das legt den Gedanken nahe, die Welt könnte dieses Verlangen prinzipiell befriedigen, wäre sie nur anders beschaffen. Aber wir haben gerade gesehen, daß das keineswegs der Fall ist: Es hat nicht den Anschein, als sei eine Welt vorstellbar, eine Welt, zu der auch wir gehörten, in der es keine unausräumbaren Zweifel gäbe. Folglich entsteht die Absurdität unserer Situation auch nicht durch die Kollision unserer Ansprüche mit der Welt, sondern durch eine Kollision in uns selbst.
IV
Man könnte einwenden, daß es den Standpunkt gar nicht gibt, auf dem einem angeblich solche Zweifel kommen – daß wir bei dem Schritt beiseite, der uns so ans Herz gelegt wird, schlicht den Boden unter den Füßen verlieren, und uns überhaupt keine Grundlage mehr bleibt, von der aus wir noch die unbefangenen ›vorkritischen‹ Antworten und Reaktionen werten können, um deren Prüfung es uns hier geht. Bleiben wir bei unseren gewöhnlichen Standards für Wichtigkeit und Unwichtigkeit, dann lassen sich die Fragen nach dem Sinn dessen, was wir mit unserem Leben anfangen, auch in der gewöhnlichen Weise beantworten. Geben wir diese Standards indessen auf, werden auch diese Überlegungen für uns sinnlos sein müssen, weil wir dann die Vorstellung davon, daß etwas Sinn hat, jeglichen Inhalts beraubt haben – und mithin auch die Vorstellung davon, daß etwas egal ist.
Aber diesem Einwand liegt ein falsches Verständnis dessen zugrunde, was den Schritt beiseite eigentlich ausmacht. Er soll uns ja nicht darüber aufklären, was wirklich