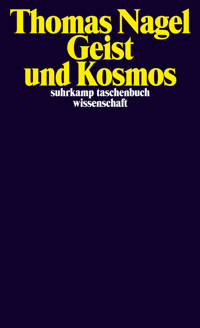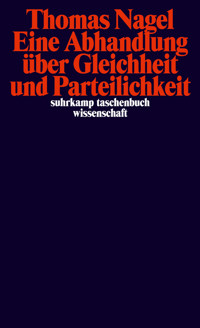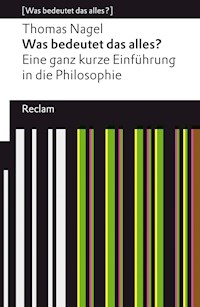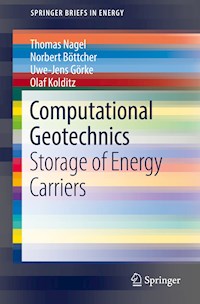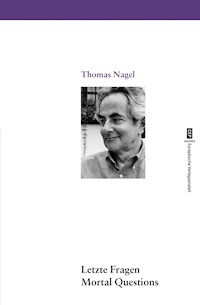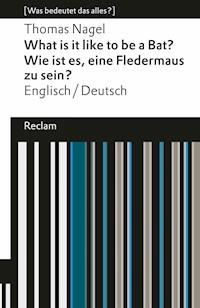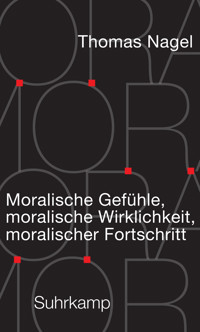
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gibt es von uns Menschen und unseren Gefühlen unabhängige moralische Wahrheiten? Können wir sie erkennen? Und gibt es in der Menschheitsgeschichte einen moralischen Fortschritt hin zu diesen Wahrheiten? Das sind die großen Fragen, denen sich der weltberühmte amerikanische Philosoph Thomas Nagel in seinem neuen Buch widmet.
Nagel setzt sich mit aktuellen Forschungen der Moralpsychologie, der Kognitionswissenschaft und der Evolutionären Psychologie auseinander, die unseren Zugang zu moralischem Wissen sowie die Rolle, die Gefühle dabei spielen, empirisch untersuchen. Solche subjektivistischen und reduktionistischen Darstellungen der Moral können ihn jedoch nicht überzeugen – eine Alternative bietet der moralische Realismus. Dieser sieht sich allerdings mit dem historischen Wandel der Moral konfrontiert, die nicht die zeitlose Gültigkeit wissenschaftlicher Wahrheiten besitzt. Vielmehr sind moralische Wahrheiten auf ganz spezifische Weise mit historischen Entwicklungen verknüpft, wie Nagel in diesem ebenso konzisen wie tiefschürfenden Buch zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Thomas Nagel
Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt
Aus dem Amerikanischen von Karin Wördemann
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Moral Feelings, Moral Reality, and Moral Progress bei Oxford University Press.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin,2024© Oxford University Press 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-78227-9
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
I
Bauchgefühle und moralisches Wissen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
Moralische Wirklichkeit und moralischer Fortschritt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Register
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
7
Vorwort
Dieses kurze Buch enthält zwei Aufsätze, die thematisch zusammenhängen und Fragen behandeln, die mich schon geraume Zeit beschäftigt haben. Am Anfang des ersten Aufsatzes, »Bauchgefühl und moralisches Wissen«, stand ursprünglich eine Dewey Lecture an der Harvard Law School im Jahr 2015. Gegen Ende dieser Vorlesung machte ich einige Bemerkungen über moralischen Fortschritt. Unter den Zuhörern befand sich auch T. M. Scanlon, der anschließend in der Diskussion eine Frage zu der von mir angeführten Idee stellte, was in mir den Gedanken weckte, dass ich mehr darüber sagen müsste. Das Ergebnis war dann der Aufsatz »Moralische Realität und moralischer Fortschritt«, mein Beitrag zu einem Symposium, dessen Anlass die Vergabe des Lauener Prize an Scanlon im Jahr 2016 war. 2018 trug ich beim NYU Kolloquium zur Rechtsphilosophie, politischen Philosophie und Sozialphilosophie, das von Samuel Scheffler und Jeremy Waldron geleitet wurde, eine umfassend erweiterte Behandlung des Themas vor. Eine weitere Fassung hielt ich 2019 als Jerusalem Lecture in Moral Philosophy an der Hebrew University. Bei all diesen Anlässen gab es Kommentare und Kritik, für die ich mich hier bedanke.
Beide Aufsätze befassen sich mit der Theorie moralischer Erkenntnis und mit den Mitteln unseres Zugangs zur moralischen Wahrheit; beide beschäftigen sich mit dem moralischen Realismus und mit dem Widerstand 8gegen subjektivistische und reduktionistische Ansätze zur Moral; und in beiden geht es um die historische Entwicklung moralischer Erkenntnis. Der zweite Aufsatz schlägt zudem einen Ansatz zur historischen Entwicklung moralischer Wahrheit vor, dem zufolge sie mit der naturwissenschaftlichen Wahrheit nicht deren Zeitlosigkeit teilt. Das verhält sich deshalb so, weil moralische Wahrheit auf Gründen beruhen muss, die für all jene Individuen, für die sie gelten, zugänglich sein müssen, und eine solche Zugänglichkeit hängt von historischen Entwicklungen ab. Die Folge ist, dass nur einige Fortschritte in der moralischen Erkenntnis Entdeckungen dessen sind, was immer schon wahr gewesen ist.
Der erste Aufsatz wurde am 3. Juni 2021 in der London Review of Books veröffentlicht. Der zweite war bisher unveröffentlicht, lediglich die vorausgegangene, kürzere Version anlässlich der Vergabe des Lauener Prize erschien in: Markus Stepanians und Michael Frauchiger (Hg.), Reason, Justification, and Contractualism. Themes from Scanlon, Berlin u. Boston: De Gruyter 2021.
T. N.
New York im Oktober 2022
9
I
Bauchgefühle und moralisches Wissen
1.
Der Philosoph Stuart Hampshire diente während des Zweiten Weltkriegs beim britischen Militärgeheimdienst. Als wir an der Princeton University Kollegen waren, erzählte er mir von folgendem Vorfall, der sich kurz nach der Landung der Alliierten in der Normandie ereignet haben muss. Die französischen Résistancekämpfer hatten einen wichtigen Kollaborateur gefangen genommen, von dem man annahm, er verfüge über Informationen, die den Alliierten nützlich sein könnten. Hampshire wurde zu ihm geschickt, um ihn zu verhören. Als er dort eintraf, teilte ihm der Leiter dieser Einheit der Résistance mit, er könne den Mann gern verhören, aber wenn das erledigt wäre, würden sie ihn erschießen: Das würden sie mit diesen Leuten immer machen. Dann ließ er Hampshire mit dem Gefangenen allein. Der Mann sagte Hampshire sofort, er würde keinerlei Aussagen machen, es sei denn, Hampshire würde ihm eine Überstellung an die Briten garantieren. Hampshire antwortete ihm, eine solche Garantie könne er ihm nicht geben. Der Mann verschaffte ihm also keine Informationen, bevor er von den Franzosen erschossen wurde.
Ein anderer Philosoph, dem ich diese Geschichte er10zählte, bemerkte trocken, dies zeige nur, dass Hampshire eine sehr schlechte Wahl für diese Aufgabe gewesen sei. Aber ich erzähle das hier nicht, um festzustellen, ob Hampshire das Richtige tat, als er es unterließ, den Gefangenen unter diesen Umständen zu belügen. Ich möchte vielmehr ein lebensnahes Beispiel für die Stärke eines bestimmten Typs der unmittelbaren moralischen Reaktion geben. Denn selbst diejenigen, die der Meinung sind, dass Hampshire diesem Mann, der den sicheren Tod vor Augen hatte, aus gewichtigen instrumentellen Gründen ein falsches Versprechen auf dessen Überleben hätte geben sollen, können die Stärke der Schranke nachempfinden, mit der Hampshire konfrontiert war. Es ist ein Beispiel für die Art von moralischer Spontanreaktion, die in der neueren Literatur zur empirischen Moralpsychologie eine wichtige Rolle spielt. Ich vermute, wenn man zu diesem Zeitpunkt einen Gehirnscan bei Hampshire gemacht hätte, wäre eine erhöhte Aktivität im ventro-medialen präfrontalen Cortex sichtbar geworden.
Man hat viel intellektuelle Mühe darauf verwandt, die schützenden Grenzen zu beschreiben, von denen Menschen umgeben sind, Grenzen, von denen uns die gewöhnliche Moral sagt, wir dürften sie nicht überschreiten. Normalerweise sind die Beispiele, die unsere Intuitionen hervorrufen sollen, künstlicher angelegt als das eben geschilderte – wie in dem berühmten Trolley-Problem. Doch das Phänomen ist real und gehört unausweichlich zur menschlichen Moral. Mich interessiert nun die Fra11ge, wie man entscheidet, welche Autorität diesen moralischen Urteilen oder Wahrnehmungen oder Intuitionen einzuräumen ist – welche Denkungsart kann uns dazu veranlassen, sie entweder als richtig und grundlegend zu bejahen oder uns von ihnen zu lösen, so dass wir sie als bloße Äußerlichkeiten ohne praktische Gültigkeit betrachten; oder welche Denkungsart wird uns vielleicht auch von diesen Urteilen abrücken lassen, ihnen jedoch einen gewissen Einfluss in unserem Leben zugestehen, der aber nicht grundlegend ist und sich von anderen Werten ableitet. Dieses Problem ist schon eine ganze Weile gesehen worden, und vieles von dem, was ich dazu sage, wird bekannt sein. Die neuere Diskussion legt allerdings einen ganz anderen Blick nahe.
Es handelt sich hier um eine Frage der moralischen Epistemologie – nicht um eine erkenntnistheoretische Frage der Art, wie sie sich stellt, wenn wir überlegen, wie wir auf eine generelle Skepsis hinsichtlich der Moral oder der Werte reagieren sollen, sondern um eine epistemologische Frage, die dem moralischen Denken innewohnt. Es gibt eine altehrwürdige Tradition des Skeptizismus zu der Frage, ob irgendwelche moralischen Urteile oder die Intuitionen, die sie stützen, als richtig oder unrichtig betrachtet werden können anstatt bloß als Gefühle einer besonderen Art, die wir in der Sprache der Moral ausdrücken. Ich beabsichtige hier nicht, in diese umfangreiche Debatte einzusteigen. Ich werde vielmehr mit der Annahme fortfahren, dass es sinnvoll ist, herausfinden zu wollen, was wirklich 12richtig und falsch ist, und dass moralische Intuitionen einen prima facie Anhaltspunkt für diese Untersuchung liefern. Das Problem, das ich diskutieren möchte, entsteht, weil es für einige unserer stärksten Intuitionen verschiedene mögliche Erklärungen gibt, und zwar sowohl moralische als auch kausale Erklärungen, die im Fall ihrer Richtigkeit den Anspruch dieser Intuitionen auf maßgebliche Autorität untergraben würden – den Anspruch nämlich, dass diese Überzeugungen als Wahrnehmungen der moralischen Wahrheit für bare Münze genommen werden sollten. Infragestellungen dieser Art stellen uns vor die Aufgabe, eine Möglichkeit zu finden, uns so zu verhalten, wie es mit dem besten Verständnis unserer selbst von außen betrachtet im Einklang steht – als biologische, psychologische, soziale oder geschichtliche Produkte.
Die Frage hat große rechtliche und politische Bedeutung, weil viele Rechte und Schutzbestimmungen für das Individuum in liberalen konstitutionellen Regierungssystemen, die der Ausübung kollektiver Macht entgegenstehen, zunächst wie intuitive Grenzen dieses Typs erscheinen. Religionsfreiheit, Freiheit des Denkens und Redens, Vereinigungsfreiheit, sexuelle und reproduktive Freiheit, Schutz der Privatsphäre, Verbot von Folter und grausamer Bestrafung werden allesamt von einem unmittelbaren Gefühl dafür getragen und teils identifiziert, wie Menschen behandelt und nicht behandelt werden sollten, ein Zwang, der Kosten-Nutzen-Kalkülen vorausgeht.
13Auch wenn es möglich ist, mehr oder weniger plausible konsequentialistische Rechtfertigungen für strikte gesetzliche Vorschriften zu konstruieren, die solche Schutzrechte verkörpern – Rechtfertigungen unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Kosten und Nutzen –, ist das nicht der moralische Aspekt, unter dem diese sich selbst unmittelbar zeigen. Die Verletzung eines individuellen Rechts ist offenbar an sich falsch und nicht lediglich als die Überschreitung einer gesellschaftlich wertvollen, strengen allgemeinen Regel falsch. Die Frage ist, ob dies nicht eine Täuschung ist – eine natürliche Illusion, die in unserer moralischen Psychologie vorgesehen ist. Obwohl Hampshires unüberschreitbare Grenze im Zusammenhang mit einer individuellen Entscheidung auftrat, wird sie ähnlich wie jene Grenze empfunden, die den Staat daran hindert, Folter anzuwenden, um Informationen abzupressen, selbst wenn sie sich gegen seine Feinde richtet und aus Gründen der nationalen Sicherheit erfolgt. Und wie wir in jüngster Zeit gesehen haben, ist die Schranke gegen Folter keineswegs unangefochten.
2.
Ich habe große Sympathie für den klassischen Intuitionisten W. D. Ross, wenn er sagt: »Und wenn man uns auffordert, unser faktisches Erfassen des Richtigen und Falschen auf Geheiß einer Theorie aufzugeben, dann 14scheint das so zu sein, als würde man die Leute dazu auffordern, ihre faktische Erfahrung des Schönen auf Geheiß einer Theorie zu verleugnen, die besagt: ›Schön genannt werden kann nur, was diese oder jene Bedingungen erfüllt‹.«[1] Dennoch ist es wohl unvermeidlich, sich in Reaktion auf die tiefsitzenden Meinungsverschiedenheiten, die im Zusammenhang mit diesem Gegenstand wiederholt auftauchen, in die Theorie hineinzubegeben.
John Rawls gab dem Prozess, mit dem man seine moralischen Gedanken ordnet, indem man allgemeine Grundsätze an wohlerwogenen Urteilen im Hinblick auf bestimmte Fälle prüft und beide einander angleicht, bis sie mehr oder weniger gut zusammenpassen, die Bezeichnung »Überlegungs-Gleichgewicht«.[2] Von diesem Prozess werden bestimmte Urteile nicht wie Gegebenheiten behandelt, die unumstößlich sind, noch werden allgemeine Grundsätze wie selbstverständliche Axiome behandelt, so dass er nicht konservativ sein muss: Er kann durchaus zur radikalen Neufassung einiger wohlerwogener Urteile führen, mit denen der Prozess einsetzt. Aber er muss intuitive Werturteile zum Ausgangspunkt nehmen, und um manche jener Urteile als fehlerhaft aufzugeben, muss er sich auf andere verlas15sen – gerade so, wie wir uns auf Belege der Wahrnehmung verlassen müssen, wenn wir manche wahrgenommenen Erscheinungen als Täuschungen verwerfen. Ich denke, es gibt keine Alternative zu dieser Methode, Antworten auf moralische Fragen zu suchen, bei der wir trotz Meinungsverschiedenheiten etwas Vertrauen wahren können.