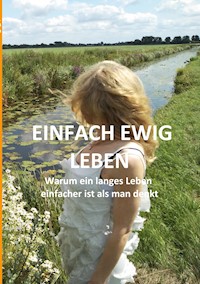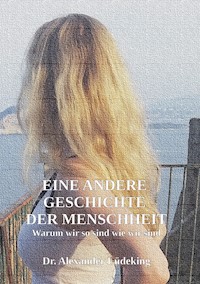
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das hier vorliegende Buch erklärt Ihnen, warum wir als Mensch tun was wir tun, ob wir nun wollen oder nicht. Dabei ist "Eine andere Geschichte der Menschheit" ein erfrischend ungewöhnliches Buch. Zum einen kann man die einzelnen Kapitel zum Thema "Menschliches Verhalten" wie ein Sachbuch einzeln und in beliebiger Reihenfolge lesen, zum anderen kann man aber auch dem Textverlauf folgen und sich von einer Rahmengeschichte durch das Buch führen lassen. Egal welchen Weg Sie wählen, am Ende werden Sie viel über sich und ihre Mitmenschen gelernt und die eine oder andere Überraschung erlebt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung der Rahmenhandlung
Einleitung
Das Ende
Zeit
Das Mädchen
Der Anfang
Der Vortrag
Ein Essen
Körper und Geist
Die Krone der Schöpfung
Die Evatheorie
Eine Italienreise
Artikel 1
Rangordnung
Artikel 2
Territorien
Via München
Artikel 3
Aggression & Gewalt
Artikel 4
Kooperation
Artikel 5
Mitgefühl
Bella Italia
Der innere Takt
Evolution & Selektion
Epigenetik
Der innere Trieb
Artikel 6
Der zerlegte Trieb
Artikel 7
Das Konzert der Triebe
Artikel 8
Leben
Ankunft in Neapel
Der göttliche Funke
Artikel 9
Die Grenzen der Selbstkontrolle
Artikel 10
Gewohnheiten
Artikel 11
Ritenbildung
Bewusstsein
Neue alte Bilder
Emotionen
Artikel 12
Wie entsteht ein Mensch?
Artikel 13
Anders, aber gleich
Artikel 14
Besitz
Erster Abend in Neapel
Artikel 15
Ruhe und Stress
Krankheit & Krebs
Artikel 16
Faulheit
Artikel 17
Das pure Glück
Artikel 18
Die verdammte Depression
Sucht & Drogen
San Gennaro in Neapel
Artikel 19
Gut und Böse
Artikel 20
Der freie Wille
Artikel 21
Der Glaube
Gott und die Welt
Artikel 22
Die Seele
Der Junge
Der Tod
Der Fischmarkt
Artikel 23
Wirtschaft
Die Lüge
Procid
Sind wir nicht alleine?
Artikel 24
Die Liebe
Die 1:1-Verteilung von Mann & Frau
Artikel 25
Der perfekte Lebenspartner
Die fünf Geschlechter der Menschen
Familie
An der Amalfiküste
Artikel 26
Die Menschenrassen
Artikel 27
Die Gruppe
Artikel 28
Synchronisation
Artikel 29
Der Krieg
Eine Wanderung
Die Entscheidung
Artikel 30
Zusammenfassung der Rahmenhandlung
„Die neuzeitlichen Wissenschaften haben den Menschen mit der Macht griechischer Götter versehen. Seine moralische Ausstattung ist davon jedoch bisher unberührt geblieben.“
Während eines Besuches im „Völkerkundlichen Museum Hamburg“ hat die junge Verlegerin S. eine Begegnung, die ihr Leben nachhaltig aus der Bahn werfen wird. Ein unbekannter Mann tritt mit einer Kaufofferte für den gesamten Planeten Erde an sie heran. Und der angebotene Kaufpreis hat es in sich. Er ist das geglückte Leben für alle Menschen. Keine Krankheiten, kein Hunger, keine Gewalt und keine Not soll es mehr geben. Jedoch gibt es eine nicht ganz unerhebliche Einschränkung. Die Begegnung endet mit der Aufforderung, sich über den Verkauf des Planeten Gedanken zu machen und binnen einer Jahresfrist eine Entscheidung zu fällen. Über Monate hinweg verdrängt S die fantastisch anmutende Begegnung aus ihrem Kopf, bis sie bei einem beruflichen Termin einen Vortrag des Anthropologen Dr. K hört. Dieser vertritt die provokante Auffassung, dass die Menschheit, ihrer Moral bedingt, an einem Scheideweg steht. Aber K ist nicht nur ein herausragender Wissenschaftler. Während eines Abendessens kommen sich die beiden näher. Am Ende beschließen sie, Hals über Kopf eine gemeinsame Reise anzutreten. S nutzt nun die Zeit mit K, um Antworten auf ihre zahlreichen Fragen zu erhalten. Ein intensiver Dialog beginnt. Auf der italienischen Insel Procida scheint sich alles zum Guten zu wenden. Die Entscheidung von S zugunsten der Menschheit verfestigt sich. Doch dann passiert das Unerwartete.
Einleitung
Dieses Buch besteht aus drei Ebenen, von denen jede Ebene den Umfang des Buches erweitert. Die Kernebene sind die einzelnen Kapitel zum menschlichen Verhalten und als solche kenntlich im Inhaltsverzeichnis aufgeführt. All diese Kapitel sind für sich einzeln und ohne Kenntnisse der anderen Kapitel zu lesen und zu verstehen. Die zweite Ebene besteht aus der Reisebeschreibung der beiden Protagonisten. Diese zieht sich chronologisch durch das Buch und erstellt einen Handlungsstrang, dem man bis zum Ende des Buches folgen kann. Als dritte Ebene existiert die Rahmengeschichte. Diese ist zur besseren Kenntlichmachung in kursiven Zeichen geschrieben. Sie stellt eine Eingangsfrage, die man sich beim Lesen des Buches immer wieder durch den Kopf gehen lassen kann: Würden Sie das Schicksal der Menschheit in Ihre Hände nehmen?
Doch fangen wir mit einer kurzen Einführung in die Geburtsstunden von Moral und Kooperation an. Wir schauen also auf den Anfang einer langen Reise.
Am Anfang der Erdgeschichte bestand unserer Planet aus einer Gesteinsmasse und einer umgebenden Uratmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Das war vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Im Zentrum der Erde befand sich eine Schmelze aus Eisen und heißem Gestein, und auf dieser Schmelze trieben wie Eisberge auf dem Meer die leichteren Gesteine. Erst als die Masse der Erde durch ständigen Meteoritenbeschuss auf das heutige Maß zunahm und damit ihre Gravitation einen Schwellenwert überstieg, konnte der Sonnenwind die Atmosphäre nicht mehr ständig wegblasen und eine neue Atmosphäre, gebildet aus dem, was Vulkane ausspien, formte sich. Diese zweite Uratmosphäre enthielt vor allem Wasserdampf, Stickstoff und Schwefelverbindungen. Langsam kühlte diese erdumspannende Dampfglocke ab und kleine Wassertröpfchen kondensierten an Staubpartikeln. Zunächst war die Erde jedoch noch so heiß, dass die Tröpfchen noch während sie fielen wieder verdunsteten, lange bevor sie den Boden erreichten. Erst als die Erde weiter abkühlte, bildeten sich die ersten Pfützen aus siedend heißem Wasser auf unserem Planeten. Das war vor etwa 3,9 Milliarden Jahren. Die junge Erde besaß aber noch keine wirklichen Senken und so stieg der Wasserspiegel, gespeist von einem sintflutartigen Regen, gleichmäßig an und bedeckte schließlich die gesamte Erde in Form eines einzigen großen Ozeans. Ein wahrhaft blauer Planet mit einem Meer, aus dem nur die höchsten Vulkane als Feuer speiende Inseln herausragten. Dieses Urmeer kühlte weiter ab, bis vor etwa 3,5 Milliarden Jahren die ersten Einzeller entstanden. Von nun an konnte die Evolution mit den ihr gegebenen Prinzipien und Möglichkeiten anfangen, am Leben zu wirken.
Als erste moralische Entwicklung der Evolution kann man wohl die Verbindung zweier einzelliger Organismen zu einem neuen, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch immer einzelligem Organismus betrachten. Dies gilt unter der Prämisse, dass wir eine Kooperation zweier unabhängiger Organismen zu einem gemeinsamen Vorteil als Grundlage der Moral betrachten. Unter diesen Voraussetzungen stellen wir fest, dass Moral keine kulturelle Erfindung des Menschen ist, sondern vielmehr ein biologisches Prinzip. Der Gedanke der sogenannten Endosymbiontentheorie (Theorie der inneren Zusammenarbeit) ist dabei erstmals von dem Botaniker Andreas Franz Wilhelm Schimper im Jahr 1883 veröffentlicht worden, also schon vor dem Hintergrund der Darvinschen Theorie von der Entstehung der Arten aus dem Jahr 1858 zu sehen. Dieser Endosymbiontentheorie folgend, hat vor etwa 1,5 Milliarden Jahren ein Einzeller einen anderen Einzeller aufgenommen, ohne ihn, wie sonst üblich, zu verdauen. Vielmehr hat sich aus den Fähigkeiten beider Einzeller ein neues Leben entwickelt, das fortan über die Fähigkeiten beider vormals selbstständiger Organismen verfügte. Ein solcher Zugewinn an Fähigkeiten setzt nun zwei Dinge grundlegend voraus: Erstens muss der neu entstandene Organismus über die Möglichkeit verfügen, diese neue Vielzahl von Fähigkeiten auch mit ausreichend Energie in Form von Nahrung zu versorgen: und zweitens muss eine gegenseitige Abhängigkeit diese neue Verbindung stabilisieren, damit sie sich nicht wieder lösen kann. Damit haben wir die beiden Grundfesten der Kooperation und damit der Moral geschaffen. Von nun an ist der Weg frei für komplexeres Leben und, am Ende der Reise, für die Entstehung des Menschen. Menschen wie Du und Ich.
Der nächste große Wurf sollte nun der Zusammenschluss mehrerer einzelliger Organismen zu einem mehrzelligen Organismus werden. Vor etwa 0,8 Milliarden Jahren war die Evolution bereit für diesen entscheidenden Schritt. Alle heutigen vielzelligen Lebewesen stammen somit von Einzellern ab. Dabei ist es interessant, dass dieser Prozess bei unterschiedlichen Entwicklungssträngen der Evolution wohl etwa 27 Mal unabhängig voneinander erfunden wurde. Alleine dies zeigt den ungeheuren Nutzen, den eine Kooperation Einzelner in der Entwicklung des Lebens ausmachen kann. Erfolg ist über jeden Zweifel erhaben. Jedoch, die Entwicklung vom Ein- zum Vielzeller ist nur möglich, wenn die ursprünglich unabhängigen Zellen zusammenarbeiten. An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass Moral im Sinne der Kooperation kein allgemeingültiges, allein Segen bringendes Prinzip ist. Während all dieser Entwicklungen existierten weiterhin egoistische Einzeller und tun es auch heute noch. Es ist nur ein neues System, das eine höhere Komplexität ermöglicht und dadurch die Möglichkeiten schafft, neue Lebensräume und andere Energiequellen zu erschließen.
Einen Ableger der Entstehung von mehrzelligem Leben aus einzelnen Zellen sehen wir heute noch beim Menschen. Die Samenzellen des Mannes verschmelzen mit der Eizelle der Frau und neues Leben entsteht. An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass natürlich kein neues Leben entsteht, sondern zwei Leben sich symbiotisch zusammenschließen um fortan gemeinsam weiter zu bestehen. So ist es eigentlich biologisch korrekt. Wir sehen also in der Befruchtung der Eizelle sowohl die Symbiose als auch die Mehrzelligkeit, entsprechend unseres Milliarden Jahre alten Erbes, immer wieder aufs Neue erblühen.
Aber gehen wir weiter in der Entwicklung der Kooperation. Wenn sich mehrere mehrzellige Organismen zu größeren Verbänden zusammenfinden, dann können Kolonien entstehen. Eine Kolonie ist dabei ein Verband von Einzelindividuen der gleichen Art, die sich an einem bestimmten Ort vergesellschaften und oft in physischem Zusammenhang stehen. Ein solches Prinzip finden wir zum Beispiel bei den Schwämmen. Nach einer ungeschlechtlichen Vermehrung im Sinne einer Knospung verbleibt das neue Individuum angeheftet an das Ursprungstier. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Duldung. Dieses Duldungsprinzip finden wir auch bei Brutkolonien der Vögel. Inwie-weit eine Duldung auch schon eine erste Kooperation von Einzelindividuen darstellt, kann ich an dieser Stelle nicht abschließend sagen.
Ein Schwarm stellt nun die nächste Entwicklungsstufe dar. In einem Schwarm kennen sich die einzelnen Individuen nicht. Es besteht sozusagen kein persönliches Interesse aneinander. Sie interagieren nur nach drei grundlegenden Regeln miteinander. Erstens: Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst. Dieses Verhalten sorgt für den Zusammenhalt der Gruppe. Zweitens: Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt. Hierdurch werden Kollisionen vermieden und ein Mindestabstand eingehalten. Drittens: Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn. In einem Schwarm haben wir also die einfachste Art der Kooperation einer Gruppe von Individuen die nicht direkt verwandt sind, die nur mit den drei genannten Regeln auskommt.
Als höchster Schritt der Kooperation unter Individuen ist wohl die Staatenbildung innerhalb einer Art zu nennen. Damit eine Gemeinschaft von Tieren einer Art als Staat bezeichnet werden kann, müssen vor allem vier Bedingungen erfüllt sein: kooperative Brutpflege durch mehrere Individuen; gemeinsame Nahrungsbeschaffung und deren Verteilung; Aufteilung des Verbandes in fruchtbare und unfruchtbare Individuen und das Zusammenleben mehrerer Generationen. Staatenbildende Organismen gibt es in mehreren verschiedenen Tiergruppen. So kommt diese nicht nur bei Bienen, Wespen und Ameisen, sondern auch bei Termiten, Pflanzensaugern, Käfern, Fransenflüglern, Krebsen und sogar bei den Säugetieren vor, namentlich bei den Nacktmullen. Im Falle eines Staates haben wir sicher den höchsten Grad der Kooperation erreicht, in dem das Individuum vornehmlich dem großen Ganzen dient und eigene Bedürfnisse und Interessen in den Hintergrund stellt. Eine menschliche Gesellschaft würde ich jedoch noch nicht als einen Staat im biologischen Sinne bezeichnen.
Eine parallele Entwicklung zur Koloniebildung, zum Schwarmverhalten und der Bildung von Staaten basiert nun auf der verstärkten Brutpflege von Tieren. Hier sehe ich die Basis der menschlichen Gesellschaften. Eine erste Brutpflege ließ sich bei krebsähnlichen Gliedertieren vor etwa 500 Millionen Jahren nachweisen. Diese trugen ihre Eier unter ihrem Panzer mit sich durch die Welt. Wenn wir aber auf die Säugetiere als Keimzelle des Menschen schauen, dann sollten wir uns für den Übergang vom Ei, und der damit verbundenen Dotterproduktion hin zur Muttermilch interessieren. Seriöse Forschungen datieren den Übergang ungefähr in den Zeitraum von 300 bis 150 Millionen Jahren vor unserer Zeit.
Die ersten Milch produzierenden Säugetiere, zu denen auch der Mensch zählt, mussten zumindest eine Zeitlang zweigleisig fahren, wie die Eier legenden Schnabeltiere aus Australien es noch heute tun. Zwar legen diese Säugetiere ihre Jungen einerseits, wie althergebracht, im Ei; andererseits verwöhnen und schützen sie ihre Schlüpflinge dann aber noch eine Weile intensiv und füttern sie mit ihren Milchdrüsen. Erst im Laufe der Zeit ersetzten die verschiedenen nachfolgenden Säugetiermodelle die Phase im Ei mehr und mehr durch einen Aufenthalt im Beutel oder dem Mutterleib. Damit einher ging auch eine tiefgreifende Umstellung der Brutpflege. Diese immer intensiver werdende Brutpflege führte am Ende zu der Bildung menschlicher Gesellschaften. Innerhalb dieser Gesellschaften sind die Individuen durch ein unsichtbares Netz schon sehr eng miteinander verwoben und Moral ist ihr Kitt, jedoch kann jedes Individuum nach wie vor selbst entscheiden die Gruppe auch wieder zu verlassen.
Diese lange Entwicklung, immerhin etwa 3,5 Milliarden Jahre, führte am Ende zu der Formulierung der Menschenrechte durch die Vollversammlung der Vereinigten Nationen im Jahre 1948. Ein langer Weg aber ein beachtliches Ergebnis.
Das Ende
„Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, Ist wert, dass es zugrunde geht.“
Mephistopheles in Faust
Sein Name war Alfredo Hernandez de Villa, aber was bedeuten Namen noch, wenn niemand mehr da ist, der sie ausspricht. Er hatte das 94. Lebensjahr erreicht und war der letzte seiner Art. Nicht einmal hatte eine Krankheit ihn ans Bett gefesselt oder ein Unfall seinem Leben eine schlimme Wendung gegeben. Keinen Krieg hatte er durchstehen müssen, und überhaupt spielte Grausamkeit und Barbarei in seinem Leben keine Rolle. Nur aus den Erzählungen und Geschichten der Alten wusste er von diesen Dingen. Er hatte gut gelebt und er war glücklich. Doch jetzt war auch seine Zeit gekommen.
Er stand über den Wolken. Wie es so oft der Fall war auf seiner Insel, lag eine Wolkendecke über dem Meer und versperrte die Sicht auf die Nachbarinsel. Jedoch bildete sich just direkt vor ihm eine Lücke, die den Blick freigab auf die endlosen Weiten des Atlantiks und welche die ersten Strahlen der Sonne passieren lassen würde. Als Kind hatte er oft den steilen Pfad erklommen, um auf diesem Plateau den Ausblick über den Norden der Insel und die Weite des Meeres zu genießen. Bei dem Gedanken an seine jungen Jahre überkam ihn zum ersten Mal seit Tagen wieder das Gefühl der Einsamkeit.
Damals war die Insel noch voller Leben gewesen. Die Alten saßen in den Straßencafés und sprachen über die Zeit, während die Kinder durch die Gassen tobten und den Hunden hinterherjagten. Nun war alles still. Nur noch der Wind und die Geräusche der Tiere waren zu hören. Er war alleine. Heute, das wusste er, würde die Menschheit aufhören zu existieren. Er hegte keinen Groll, noch verspürte er Bedauern. Dann durchdrangen die ersten Strahlen der Sonne das Wolkenfeld und tauchten das Meer in ihr warmes, strahlendes Licht.
Zeit
„Der Aufbau des Menschlichen erfolgte über hundert Jahrtausende, vielleicht über einen Zeitraum von mehr als einer Jahrmillion. Massiver Selektionsdruck einer noch feindlichen Natur hat diesen frühen Menschen über ungezählte grausame Schicksale herausgebildet, das Bewusstsein hell gemacht, und ihn seine Welt richtig interpretieren lassen.“
Rupert Riedl
Von unseren ersten, noch sehr wackeligen Schritten der Glasherstellung bis zur Entwicklung des digitalen Fotoapparates vergingen etwa 3000 Jahre. Die Natur benötigte hingegen zur Entwicklung des menschlichen Auges zwei Milliarden Jahre. Das relativiert die Wunder der Natur. Denn sie ist der wahre Besitzer der Zeit. Nehmen wir nur einmal einen erdachten Organismus, der pro Tag einen Millimeter zurücklegt. In einem Jahr schafft er somit 36 cm Wegstrecke. Aber hätte der Weg zu Beginn der Entstehung des Lebens vor 4,5 Milliarden Jahren begonnen, dann hätte unser Organismus die Erde bereits 38-mal umrundet. Zeit ist ein mächtiger Faktor, der sich unserer beschränkten Vorstellungskraft weitestgehend entzieht.
Das Mädchen
Nichts an ihr war besonders. Sie war nicht umwerfend schön, wenngleich sie diese natürliche Schönheit durchaus besaß. Regelmäßig drehten sich die Männer auf der Straße nach ihr um. Der Typ Mann, der genau jene authentische Schönheit bewunderte, die sie ausstrahlte. Schönheit auf den zweiten Blick. Sie kleidete sich nicht auffällig, sondern folgte ganz ihrem eigenen Stil. Sie war nie ein Wunderkind gewesen. Nicht in der Schule und auch nicht in irgendeinem anderen Bereich. Aber jeder, der sie zum ersten Mal sah, war auf eine gewisse Art von ihr berührt. Es war, als blicke man auf das endlose Meer. Eigentlich sieht man nur Wasser und doch sieht man auch jene fernen Länder hinter dem Horizont, von denen man immer geträumt hat. Man sieht fremde Kulturen und weiße Segel, die sich im Wind blähen. Und man sieht eine glückliche Familie. Und noch etwas sieht man. Oder besser: man sieht es nicht. Es ist nur eine Ahnung. Das Wissen darum, dass unter dieser blau schimmernden Oberfläche eine weitere Welt existiert, die voller Geheimnisse und Wunder ist. Helle Geheimnisse und auch dunkle. Vielleicht war es das Wissen um genau diese dunklen Geheimnisse, welche man erahnte, wenn man S zum ersten Mal begegnete. Eine versteckte Traurigkeit. Jedoch verschwand dieses Bild sofort, wenn S anfing sich zu bewegen und zu reden. Ihre Bewegungen hatten etwas Leichtes und ihre Rede war voller intelligentem Humor, der jede düstere Ahnung sofort Lügen strafte. Wenn sie mit ihren zahlreichen Freunden durch das Hamburger Nachtleben streifte, war es ihr Lachen, das als erstes auffiel. Es war das freie Lachen eines Kindes, das sein Glück kaum fassen kann. Alle liebten dieses Lachen und sie dafür, dass sie es ihnen schenkte. Und auch wenn man es vorher schon bemerkt hatte, so wurde es nun ganz deutlich. Sie war alles in einem. Beste Freundin, Schwester, Mutter und unüberwindbare Autorität. Nicht dass sie einmal das eine und dann das andere war. Sie war immer alles.
Vielleicht war es auch diese Eigenschaft, die sie in ihrem Beruf als Marketingleiterin eines bekannten Hamburger Verlagshauses so erfolgreich machte. Sie verstand die Menschen und wusste, was sie gerne lesen würden. Die Kinder, die Familien und die Alten. Sie waren ja alle in ihr vereint. Mit dieser Eigenschaft war sie die Karriereleiter regelrecht hochgefallen. Was sie anfasste, wurde ein Erfolg. Sie war jetzt 34 Jahre alt und doch hatte sie es bereits bis in die Position der stellvertretenden Geschäftsführerin gebracht. Und das war auch genau die Position, in der sie sich immer gesehen hatte. Frei in der Gestaltung, aber ohne die Verantwortung der allerletzten Entscheidung. Im Gegensatz zu vielen anderen Managern verehrten sie die Leute, mit denen sie zusammenarbeitete. Sie selbst bezeichnete sich immer als hart aber fair, Mutter der Kompanie wäre jedoch wohl näher an die Wahrheit herangekommen. Zumindest hätte das ihre Schwester gesagt, die sie oft in der Mittagspause besuchte, da sie nicht weit entfernt arbeitete und nichts lieber tat, als mit ihrer großen Schwester Zeit zu verbringen. Beide liebten sich abgöttisch, auch wenn ihr Leben nicht unterschiedlicher hätte verlaufen können. S lebte allein und in erster Linie zog sie ihre Energie aus ihrer Arbeit, die ihr alles bedeutete. Ihre Schwester hingegen hatte früh geheiratet und war, als die finanzielle Situation dies zuließ, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern sogleich aufs Land gezogen. Ihre Arbeit hatte sie immer als lästiges Übel wahrgenommen und entsprechend erfolglos war ihre Karriere verlaufen. Sie hatte sich ganz für ihre Familie entschieden und alles diesem Ziel untergeordnet. S hatte keine Kinder und auch keinen Mann, geschweige denn einen festen Freund. Es gab zwar immer mal wieder Männer in ihrem Leben, aber diese verschwanden nach einer gewissen Zeit auch wieder. Auf diese Tatsache angesprochen, antwortete sie immer, dass sie ihre Freiheit zu sehr liebte. Die Zeit mit ihren Freunden und die Nachmittage mit einem guten Buch in einem der zahlreichen Cafés der Stadt. Sie genoss die Ruhe in ihrer Wohnung, von der man, wenn man sich ganz auf die rechte Seite ihres Balkons stellte und leicht auf die Zehenspitzen ging, einen kleinen Blick auf die Außenalster erhaschen konnte. Nicht weniger zu schätzen wusste sie die wilden Nächte der Stadt mit ihren Partys und Konzerten. Hätte man sie gefragt, so hätte sie gesagt, sie sei glücklich. Zu ihren Eltern hatte sie ein freundschaftliches Verhältnis, wenngleich man sich nicht allzu oft sah. Aber so war das eben. Ähnlich verhielt es sich mit ihrem politischen Engagement. Natürlich wählte sie die Grünen und natürlich war sie auch Mitglied bei Amnesty International und Greenpeace, aber wirklich aktiv war sie nie geworden. Irgendwie hatte ihr immer die Zeit gefehlt. Und wenn das Lachen verklang, war es wieder da. Das Gefühl, aufs Meer zu schauen.
Der Anfang
An einem warmen Frühlingstag durchschreitet eine junge Frau, wir nennen sie einmal S, wenig interessiert die weitläufigen Ausstellungsräume des „Völkerkundlichen Museums“ in Hamburg. Entrückt und abwesend wirkt sie auf die anderen noch anwesenden Besucher. Keines der Exponate fesselt ihren Blick. Von Zeit zu Zeit bleibt sie ohne ersichtlichen Grund stehen, als sei die Welt um sie herum zum Stillstand gekommen. Plötzlich wird sie von einer ihr fremden Person, nennen wir sie X, angesprochen, die ihren Namen kennt.
X: Guten Tag. Hätten Sie einen kleinen Moment Zeit für mich?
S dreht sich erstaunt um: Entschuldigung, ich war mit den Gedanken gerade sehr weit weg. Um was geht es denn?
X: Es geht um einen Kaufvertrag.
S: Einen Kaufvertrag? Dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Bitte lassen Sie mich alleine.
X unbeirrt: Wir würden gerne die Erde von Ihnen kaufen.
Stille -
S: Die Erde? Habe ich Sie da gerade richtig verstanden?
X: So ist es. Ich vertrete eine Spezies, die gerne die Erde käuflich erwerben würde. Hierzu möchten wir der Menschheit ein ausgesprochen attraktives Angebot unterbreiten. Und Sie sind uns gegenüber der legitimierte Repräsentant der gesamten Menschheit. Sozusagen unser exklusiver Verhandlungspartner. Ihre Entscheidung werden wir respektieren.
S: Entschuldigung, aber ich habe für derlei Späße im Moment wirklich kein Verständnis.
X beharrlich: Aber nein, es gibt keine Späße. Ich verstehe jedoch Ihre Bedenken und bin entsprechend bereit, meine Legitimation unter Beweis zu stellen. Haben Sie einen Wunsch, den Ihnen niemand erfüllen kann? Etwas ganz und gar Unmögliches? Als Zeichen unseres guten Willens erfüllen wir Ihnen diesen Wunsch gerne. Ich weiß zum Beispiel, dass Ihre Schwester schwer an Krebs erkrankt ist. Dürfen wir hier behilflich sein?
S: Nur wenn Sie dann auch die Sonne im Norden aufgehen lassen.
X: Wenn Sie das wünschen, gerne.
S: Sie verstehen sicher, dass mir dieser Spaß jetzt zu weit geht.
S dreht sich um und geht -
X: Warten Sie!
S stoppt, schaut über die Schulter -
X: Wenn es Ihrer Schwester morgen wieder gut geht, gerade so, als wäre nie etwas geschehen, dann würde ich mich freuen, Sie hier am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit wieder zu treffen.
S wendet sich endgültig ab und geht. -
Am darauf folgenden Tag im Museum: Gleicher Raum, etwas anderes Licht. X steht regungslos da und wartet. S betritt den Raum, emotional sichtlich erregt. -
X: Ich freue mich aufrichtig, Sie zu sehen.
S mustert X lange von oben bis unten. Dann bricht es aus ihr heraus. -
S: Ich war heute Morgen im Krankenhaus, so wie ich es jeden Tag seit nunmehr sechs Wochen fest in meinen Tagesablauf verankert habe. Bei meiner Schwester sind keine Tumore mehr nachweisbar. Das aktuelle CT war negativ, genau wie die Blutwerte. Sie ist heute Mittag als vollständig genesen entlassen worden. Und die Sonne ging im Norden auf. Die Zeitungen waren voll davon!
X: So wie ich es Ihnen vorhergesagt habe. Ich wusste, Sie würden mir sonst niemals Glauben schenken. Ich denke, Sie haben nun den Beweis, dass wir keine Späße machen. Unser Angebot ist real.
S: Wer sind Sie?
X: Wie ich bereits gestern erwähnt habe, vertrete ich eine fremde Spezies in ihrem Kaufinteresse gegenüber der Menschheit, betreffend ihres Planeten.
S: Ich soll Ihnen also im Namen der Menschheit die Erde verkaufen?
X: Genau so ist es.
S: Das ist mehr als schwer zu glauben.
X: Ich bin in der Lage, auch Ihre letzten Zweifel zu beseitigen.
S: Eine verrückte Geschichte, aber erzählen Sie bitte. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich mich auf irgendetwas einlassen werde. Ich möchte nur gerne die ganze Geschichte hören.
X: Nun gut. Es ist im Prinzip ganz einfach. Die Spezies, die ich vertrete, möchte gerne in der Zukunft Ihren Planeten nutzen. Nur ist eine Koexistenz mit der Menschheit leider nicht möglich. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. Daher bleibt uns nur der Weg des Kaufs. Natürlich könnte meine Spezies den Planeten auch gegen Ihren Willen einfach in Besitz nehmen, aber ein solches Vorgehen verstieße gegen die ethischen Grundvorstellungen unserer Gesellschaft. Somit streben wir eine Art Tauschgeschäft an. Wir bieten Ihnen ein Paradies für die aktuellen Generationen im Tausch für Ihren Planeten. Konkret hieße das: etwa hundert Jahre ohne Schmerz, Hunger und Krieg, sowie die Erfüllung beinahe aller Wünsche eines jeden Individuums, solange diese nicht im Widerspruch mit den Wünschen anderer Individuen stehen. Alles Leid auf diesem Planeten würde von heute auf morgen verschwinden. Kein Hunger, keine Krankheiten, keine Schmerzen, keine seelischen Leiden, keine Unterdrückung, keine Versklavung, keine Bevormundung. Wir würden all diese Übel beseitigen. Ein Menschheitstraum würde wahr. Ein echtes Paradies entstünde. Im Gegenzug müssen wir jedoch die Fortpflanzungsfähigkeit der Menschen ab dem Zeitpunkt Ihrer Entscheidung unterbinden. Man könnte von einer globalen Sterilität sprechen. Kein Mensch käme dadurch zu direktem Schaden. Jedoch würde die Menschheit natürlich in Folge zahlenmäßig kontinuierlich abnehmen.
S: Eine abenteuerliche Geschichte. Sie verstehen aber sicher, dass ich Ihnen nicht die ganze Erde verkaufen könnte – selbst wenn ich Ihnen glaube – was ich nicht tue. Und selbst wenn das Angebot noch so verlockend wäre. Wer bin ich, eine solche Entscheidung zu fällen?
X: Es ist Ihnen vielleicht nicht direkt bewusst, aber natürlich fällen Sie jeden Tag Entscheidungen eben diesen Ausmaßes. Es ist für jeden Menschen ein geradezu alltäglicher Akt. Wir brauchen gar nicht so weit zu gehen uns denjenigen Menschen zuzuwenden, die mit einem einzigen Knopfdruck ihren Planeten für alle Zeiten unbewohnbar machen würden. Ein jeder Mensch fällt jeden Tag unendlich viele Entscheidungen, die das Schicksal, auch ein endgültiges, Ihres Planeten betreffen. Den meisten Menschen ist dies nur nicht direkt bewusst. Jede Handlung, für die Sie sich entscheiden, summiert sich mit den Handlungen aller anderen Menschen und führt so zu einer Veränderung. Sie tolerieren Dinge, unterstützen Strömungen und Moden oder fügen sich in Situationen. Und am Ende formen Sie durch Ihr Verhalten auch ganz direkt die neuen Generationen. Jeder Mensch bestimmt ganz aktiv die Zukunft seines Planeten. Und niemand fragt dabei nach einer Erlaubnis. Jeder bestimmt immer für alle. Es ist also ein ganz natürlicher Vorgang. Einzig die Dimension ist eine etwas andere. Daher sage ich Ihnen: Machen Sie sich Gedanken über die Menschen und dann entscheiden Sie. Wir werden keinen Zwang auf Sie ausüben. Sollten Sie uns jedoch nach einem Jahr keine Entscheidung mitgeteilt haben, werden wir annehmen, dass Sie dem Verkauf zustimmen.
S: Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen keinen Glauben schenken.
X: Das verstehe ich. Wir werden uns aber zu gegebener Zeit noch einmal bei ihnen melden. Ich bin sicher, Sie werden dann bereit sein, unser Angebot zu überdenken. An dieser Stelle ist meine Aufgabe erst einmal beendet. Ich habe meine Botschaft überbracht.
X verabschiedet sich und verlässt den Raum. S steht noch eine Weile nachdenklich vor der Darstellung einer frühneuzeitlichen Menschensiedlung. Dann wendet auch sie sich zum Gehen. -
Der Vortrag
Während eines beruflichen Aufenthaltes in Berlin, übernachtet die junge Verlegerin S im besten Hotel der Stadt. Normalerweise schläft sie bei einer Freundin aus Studientagen, aber diese hat Besuch und das Gästezimmer ist belegt. So kam es, dass S, während sie durch die Lobby ihres Hotels hastet, um den Termin mit einer großen Einzelhandelskette noch rechtzeitig wahrzunehmen, die Ankündigung eines Vortrages auf der Anzeigentafel bemerkt. Ohne genau zu wissen warum, stoppt sie kurz entschlossen und wendet sich dem Plakattext zu. Im Rahmen eines Kongresses wird Dr. K einen Vortrag halten mit dem Thema „Die innere Moral des Menschen“. Da ist sie wieder, die Erinnerung an ihre seltsame Begegnung im Museum. Die Universität ist keine 10 Minuten entfernt, also folgt S ihrem Impuls und beschließt an dem Vortrag teilzunehmen. Am Tag des Vortrages isst sie eine Kleinigkeit im Hotelrestaurant, ohne jedoch recht bei der Sache zu sein. Dann, als die Zeit schon Eile gebietet, ruft sie ein Taxi und fährt die recht kurze Strecke zur nahe gelegenen Universität. Dort angekommen, findet sie schnell einen Platz in der ersten Reihe und wartet gespannt auf den Vortragenden.
K betritt den Raum und beginnt sogleich mit seinen Ausführungen. -
Wir wollen im Folgenden die Welt nicht zu sehr schwarz malen. Über unsere heutige Gesellschaft gibt es, neben vielen Problemen, auch sehr viel Gutes zu berichten. So leben über sechs Milliarden Menschen zum Teil auf sehr engem Raum auf diesem Planeten zusammen. Dies unter teilweise schwierigen Bedingungen, aber in der Regel erstaunlich friedfertig. Niemand würde jedoch ernsthaft behaupten, dass wir schon im Paradies angelangt sind. Im Gegenteil könnte es sogar so sein, dass wir die besten Tage bereits erlebt haben. So müssen wir aufgrund der aktuellen Situation und den vielfältigen und gravierenden Problemen, die uns in der nahen Zukunft erwarten, in Betracht ziehen, dass der Zenit schon überschritten wurde und das ganze System wieder ins Chaos zu kippen droht. Dies möchte ich Ihnen nachfolgend an einigen Beispielen verdeutlichen.
Armut
Pro Sekunde nimmt die Weltbevölkerung um ca. 2,4 Menschen zu, das heißt, es werden 2,4 Menschen mehr geboren als sterben. Pro Tag sind somit 210 000 Menschen mehr zu versorgen. Keine leichte Aufgabe. Zieht man die Armutsgrenze bei zwei US-Dollar pro Tag, gelten bereits 2,7 Milliarden Menschen und damit fast die Hälfte der Weltbevölkerung als arm. Historisch gesehen hat es noch nie eine Zeit gegeben, in der nicht Menschen verhungert sind. Hier wird klar, dass wir einer generellen Knappheit an Ressourcen gegenüberstehen. Die Zahl der hungernden Menschen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, steigt jedoch langsamer als die Bevölkerung: 1990 waren es etwa 822 Millionen, im Jahr 2008 etwa 963 Millionen Menschen. Am 19. Juni 2009 berichtete die BBC, dass nun offiziell eine Milliarde Menschen hungern. Das ist etwa jeder siebte Mensch auf der Erde. Jedes Jahr sterben etwa 8,8 Millionen Menschen, hauptsächlich Kinder, an Hunger, was einem Todesfall alle drei Sekunden entspricht (Stand 2007). Und dabei ist es besonders bemerkenswert, dass Länder, die von einer Hungersnot betroffen sind, oftmals wesentlich mehr Nahrungsmittel exportieren, als intern gebraucht würden, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. So war es auch der Fall bei der großen Hungersnot 1984/85 in Äthiopien.
Kriege
Selbst nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind weltweit mindestens 25 Millionen Menschen durch Kriege gestorben. Im 20. Jahrhundert starben somit circa 100 bis 185 Millionen Menschen durch kriegerische Gewalteinwirkung.
In der historisch belegten Menschheitsgeschichte haben knapp 14.400 Kriege stattgefunden, denen ungefähr 3,5 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind. Kriegsähnliche Verhaltensweisen lassen sich sehr zahlreich schon im Tierreich beobachten. So führen rivalisierende Staaten (vor allem Ameisenstaaten) Kriege um Gebiete und Nahrung. Manche Ameisen-, Wespen-, Bienen- und Hornissenarten überfallen andere Staaten, um sie ihrer Rohstoffe und Nahrungsmittel zu berauben. Hierbei stellen sie implizit sehr genaue Rechnungen darüber auf, ob sich der Überfall in materieller Hinsicht lohnt – also der Verlust eigener Individuen durch den zu erwartenden Gewinn an Ressourcen in einem günstigen Verhältnis steht. In der menschlichen Welt finden gerade zeitgleich 47 Kriege statt. Mir scheint, die Menschen haben recht, wenn sie sagen, nur die Toten hätten das Ende des Krieges gesehen.
Genozid
Hier kann man den Massenmord der Australier an den Aborigines nennen, genauso wie den Völkermord der Maoris auf den Chatham-Inseln, begangen im Jahre 1835. Massenmord an den Beothuk-Indianern durch die Franzosen im Jahre 1497, Massenmord an den Karibik-Indianern durch die Spanier (1492), der Mord an den Indianern in Mittel- und Südamerika durch die spanischen Eroberer (1498), der Mord an den Protestanten durch die französischen Katholiken im Jahre 1574 in Frankreich; der Mord der „Amerikaner” an den Indianern in den USA, der über 2 Jahrhunderte dauerte. Ebenso der Vollzug des Genozids der Buren, ausgeübt an den Buschmännern sowie Hottentotten in Südafrika im Jahre 1652. Als prominentestes Beispiel verübten die Nazis einen Genozid an den Juden, Zigeunern, Polen sowie Russen mit mehr als 6 Millionen Toten. Auch Sansibar sollte man nicht ganz verschwinden lassen, denn dort wurden die Araber durch die Schwarzen in unvorstellbarer Weise misshandelt. Genauso erging es den Kommunisten sowie Chinesen durch die Indonesier im Jahre 1965. Einer der grausigsten und unvorstellbarsten Völkermorde ereignete sich jedoch 1994 in Ruanda, als in nur knapp 100 Tagen Angehörige der Hutu-Mehrheit fast eine Million Männer, Frauen und Kinder der Tutsi-Minderheit abschlachteten. Es ist unglaublich, aber wahr: Sogar noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 55 Fälle von Genozid verübt. Zehn Millionen Menschen waren die Opfer.
Sklaverei
Heute existieren mehr Sklaven, als insgesamt zur Zeit des amerikanischen Sklavenmarkts aus Afrika geraubt wurden, schreibt Kevin Bales. Nach seiner Schätzung werden über 27 Millionen Menschen "gewaltsam versklavt und gegen ihren Willen zum Zweck der Ausbeutung gefangen gehalten". Und ihre Zahl steigt wieder beständig. Es handelt sich um Opfer von Menschenhandel und Zwangsarbeit. In Indien, Bangladesch und Pakistan leben demnach die meisten Zwangsarbeiter. Aber auch in den Industrieländern leben insbesondere Frauen als Zwangsprostituierte unter sklavenähnlichen Umständen. Darüber hinaus werden im Baugewerbe, in Haushalten und in der Landwirtschaft Arbeitskräfte illegal und ohne Rechte beschäftigt. Man vermutet alleine an die 3.000 Haushaltssklaven in Paris, und eine ähnliche Situation kann man auch für andere westliche Großstädte annehmen. Doch wir wollen ja eigentlich über Moral reden.
Moral
Oft höre ich Menschen sehnsuchtsvoll von dem verlorenen Paradies reden. Aber was ist, oder vielleicht sollte man besser sagen, war denn des Menschen Paradies in Wahrheit? Evolutionsbiologisch und geschichtlich war es keineswegs ein Leben ohne Gewalt und Sünde. Diese traten wahrscheinlich sogar in wesentlich höherer Frequenz auf, als das heute der Fall ist. Der Unterschied zwischen dem Paradies und unserer heutigen Lebenswirklichkeit liegt vielmehr darin, dass wir uns im Paradies, wie schwerwiegend unser Vergehen auch war, keinerlei Vorwürfe gemacht haben. Dies kann man sich in etwa so vorstellen wie einen Löwen, der, egal wie grausam seine Handlungen auch sein mögen, niemals ein schlechtes Gewissen haben wird. Das heißt ganz konkret, dass das Böse im Paradies wohl wesentlich häufiger anzutreffen war, wir es aber, entsprechend dem Löwen, noch nicht als solches wahrnehmen konnten. Wir waren nicht gut, wir waren nur blind für unsere Grausamkeit. An dieser Stelle möchte ich Konrad Lorenz zitieren:
„Es liegt somit eine tiefe Wahrheit im Symbol der Früchte vom Baume der Erkenntnis. Erkenntnis, die dem begrifflichen Denken entsprang, vertrieb den Menschen aus dem Paradies, in dem er bedenkenlos seinen Instinkten folgen und tun und lassen konnte, wozu die Lust ihn ankam.“
Doch was hat das alles mit Moral zu tun? Nun, Intelligenz braucht nicht notwendigerweise Moral, und Moral braucht nicht notwendigerweise Intelligenz. Wir kennen moralisches Verhalten auch von vielen Tieren, denen wir alles zusprechen würden, nur nicht eine sprühende Intelligenz. Und somit kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt, dass Intelligenz nicht automatisch Moral gebiert, sondern „nur“ die Verpflichtung zur Moral.
Generell lässt sich eine notwendige Existenz von Moral evolutionsbiologisch viel eher als ein Ergebnis der Gruppenbildung denn der Entstehung von Intelligenz erklären. Große Gruppen geben Sicherheit und erlauben eine effiziente Arbeitsteilung. Jeder Einzelne muss weniger leisten und erhält dafür mehr. Ein Traum! Auch unter biologischen Gesichtspunkten. Aber ohne Moral kann eine größere Gruppe nicht existieren. Moral ist der Klebstoff, der die Gruppe zusammenhält. Man kann also erwarten, dass die biologische Selektion „scheinbar“ selbstlose Hilfe, unter Gruppenmitgliedern fördert, denn Gruppen, deren Mitglieder sich untereinander hilfsbereit verhalten, setzen sich gegenüber einzelnen Individuen, aber auch anderen, nicht moralischen Gruppen durch. Sie sind ganz einfach produktiver und somit erfolgreicher.
Nun erscheint die Zusammenarbeit von Gruppenmitgliedern untereinander als eine sehr positive Entwicklung der Evolution. Allerdings ergibt sie evolutionsbiologisch nur dann Sinn, wenn es auch andere Gruppen gibt, denen gegenüber man sich entsprechend durchsetzt. Das „Überleben des am besten Angepaßtesten“ wird also zu einem „Überleben der besten Gruppe“. Also warum führen Menschen trotz ihrer Moral Kriege? Auf der Basis meiner Ausführungen lautet die Antwort: Moral fördert selbstloses Verhalten nur innerhalb einer Gruppe, nicht zwischen Gruppen, weil sie ausschließlich dem Wohl der Gruppe dient, und auch nur darauf ausgelegt ist, nicht per se der ganzen Menschheit. Zudem beurteilen verschiedene Menschen das Verhalten einer Person moralisch oft unterschiedlich, wenn sie sich in verschiedenen moralischen Gruppen befinden. Unsere unzähligen Religionskriege mögen hier als prominente Beispiele dienen. Und in genau diesem Zusammenhang kann Moral ein scharfes Schwert des Krieges werden. Nämlich genau dann, wenn die Moral die Gruppe stärkt, sie aber keineswegs einen Krieg gegen eine andere Gruppe verhindert. Im Gegenteil kann sie diesen sogar erst hervorrufen.
Moral würde nur dann zu Frieden zwischen allen Menschen führen, wenn sich alle Menschen als zu einer moralischen Gruppe gehörig betrachteten. Eine weltumspannende Bedrohung von außen könnte die Menschheit vielleicht kurzfristig vereinen. Ein drohender Meteroiteneinschlag mag an dieser Stelle als Beispiel dienen oder eine verheerende Seuche. Die resultierende moralische Einheit aller Menschen wird jedoch nicht stabil bleiben, denn mit der Größe einer Gruppe steigt die Tendenz ihrer Mitglieder, egoistisch zu handeln, was dazu führt, dass sie am Ende wiederum in Kleingruppen zerfallen. Wir schauen hier also auf einen dynamischen Prozess, der die Bildung einer Supergruppe effektiv verhindert.
So unterliegt auch die Gruppengröße einer natürlichen Selektion. Hierbei ist das entscheidende Moment nicht die absolute Anzahl an Mitgliedern der Gruppe, sondern die Fähigkeit zur Kontrolle des moralischen Verhaltens der einzelnen Gruppenmitglieder. So kann man davon ausgehen, dass letztendlich ausschließlich die persönliche Kontrolle der Gruppenmitglieder untereinander den Zusammenhalt gewährleistet. 50 Personen kann man hierbei als maximale biologisch funktionierende Gruppengröße annehmen. Größere Gruppen müssen sich somit hierarchisch aufbauen, indem einzelne Mitglieder der obersten Gruppe wiederum Einzelpersonen aus der hierarchisch folgenden Gruppe kontrollieren. Ein Blick in die Geschichte macht dies deutlich. So etablierte sich z.B. im Mittelalter auf der religiösen Seite die katholische Kirche und auf der säkularen Seite das System des Adels entsprechend erfolgreich. Heutzutage suchen wir nach tragfähigeren Alternativen, welche sich aber nicht so einfach erschließen.
Viele Ideologien, als prominentestes Beispiel sei hier der Kommunismus genannt, sind gescheitert und es herrscht weltweit eine Ratlosigkeit unbekannten Ausmaßes. Nunmehr müssen wir uns selbst erkennen. Hierzu ist es jedoch nötig, erst einmal zu wissen, welche ererbten Vorprogrammierungen uns dabei in unserer heutigen Welt im Wege stehen und welche wir, als ihre ebenfalls ererbten Gegenspieler nutzen können. Kurz: Wie können wir unser Erbe zu unseren Gunsten nutzen, statt nur dessen Spielball zu sein?
Vielleicht wird dies an einer kleinen Geschichte klarer: Ein alter Mann erzählte einst seinem Enkel: „In meinem Herzen leben zwei Wölfe. Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens und der Verzweiflung. Der andere ist der Wolf des Lichtes, der Lust, der Hoffnung, der Lebensfreude und der Liebe. Beide Wölfe kämpfen oft miteinander.“ Daraufhin fragt der Enkel: „Welcher Wolf gewinnt?“ – „Derjenige, der mehr gefüttert wird“, entgegnet der alte Mann.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, werde ich diese jetzt gerne beantworten.
S hat dem Vortrag gebannt zugehört, auch wenn sie nicht alles wirklich verstanden hat. Aber am Ende ist es vor allem die eine Frage, die bleibt. Sie steht auf und stellt ihre Frage. -
S: Würden Sie sagen, dass der Mensch im Grunde gut ist, oder denken Sie, er ist eher böse?
K zögert kurz, ehe er neben das Rednerpult tritt, hinter welchem er die gesamte Zeit des Vortrages gestanden hat. Dann lächelt er S freundlich an.-
K: Im Grunde ist diese Frage von einem Wissenschaftler nicht zu beantworten. In jedem Fall können wir sagen, dass der Mensch generell zu Kooperation, Mitleid und Gemeinwohl in der Lage ist. Inwieweit er diese Eigenschaften nutzt, ist aber individuell unterschiedlich und wird maßgeblich von der Gesellschaft, in der er lebt, bestimmt. Im schlimmsten Fall ist er aber mit Sicherheit das gefährlichste Raubtier, das zurzeit diesen Planeten bewohnt.
Gibt es weitere Fragen?
Es werden noch weitere Fragen gestellt, S ist jedoch in Gedanken versunken und hört nicht mehr wirklich zu. Alsbald endet die Veranstaltung und die Zuhörer verlassen den Vortragssaal. Im Vorraum stehen kleine Gruppen zusammen und unterhalten sich. K triff dort auf S und fragt, ob er ihre Frage wirklich beantwortet habe. S zögert kurz, dann verneint sie es. -
S: Ich fand Ihren Vortrag sehr spannend. Aber wenn Sie mich konkret darauf ansprechen, am Ende ist meine Frage noch immer offen.
K: Wie schon gesagt, ist das eine Frage, die man in fünf Minuten nicht beantworten kann. Aber wenn es Sie wirklich interessiert, dann können Sie mich gerne zum Essen begleiten. Wenn ich in Berlin bin, gehe ich nach meinem Vortrag immer zu meinem Lieblingsitaliener gleich hier um die Ecke. Dort könnte ich etwas weiter ausholen. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde Ihre Frage nicht letztendlich beantworten können, aber vieles im Zusammenhang mit Ihrer Frage wird Ihnen klarer werden. Vielleicht werden Sie dann ihre Frage anders stellen.
S zögert erneut. Aber die Chance auf einen derart befruchtenden Gedankenaustausch gewinnt am Ende die Oberhand. Die Neugier hat gesiegt.-
S: Gerne.
Ein Essen
K und S nehmen an einem Fenstertisch am Rande des Restaurants Platz. Beide bestellen Getränke und etwas zu essen von der erlesenen Karte. Als der Kellner den Wein bringt, zwinkert er K kurz zu. Dann füllt er sein Glas mit einer Probe des Weines und schaut ihn fragend an. K nimmt sein Glas und reicht es S mit der Bitte, sie möge den Wein probieren, da er selbst nicht viel von diesen Dingen verstünde. Sie nimmt das Glas, kippt es in einem Zug hinunter, stellt das Glas schwungvoll auf dem Tisch ab und nickt dem Kellner zustimmend zu. Als der Kellner daraufhin etwas verdutzt schaut, hört K zum ersten Mal ihr unbeschreibliches Lachen. Der Kellner, noch immer leicht irritiert, schenkt Wein nach und entfernt sich dann schmollend.-
K: Na, Sie haben ja eine herzlich direkte Art.
S: Ich bin einfach kein Freund dieser Spiele. Und ich liebe es, sie spontan ad absurdum zu führen. So etwas macht mir Freude.
K: Darf ich Ihnen jetzt eine Frage stellen? Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie sich für dieses Thema interessieren?
S ausweichend: Nein eigentlich nicht. Ich habe die Ankündigung des Vortrages in meinem Hotel gesehen und mich spontan entschieden teilzunehmen. Aber mich interessiert doch sehr, warum man sich als Wissenschaftler gerade mit diesem Thema beschäftigt.
K: Vielleicht die Suche nach dem Sinn des Lebens? Sozusagen die Mutter aller Fragen. Vielleicht ist es auch die Suche nach der Antwort auf genau Ihre Frage. Ist der Mensch gut oder ist er böse? Können wir ins Paradies zurückkehren? Oder ist uns dieser Weg für immer verstellt? Ich habe ja am Anfang meines Vortrages darauf hingewiesen, dass das Paradies nur existierte, weil wir nicht wahrnehmen konnten, dass wir böse waren. Man könnte ganz plakativ sagen, wir wurden zu schlau, um weiterhin im Paradies zu leben. Aber zurück können wir nicht mehr. Stellt sich also nur die Frage, ob wir mit unserem Intellekt in der Lage sind, einen neuen Weg zur Unschuld zu finden. Vielleicht suche ich genau das. Den Weg durch den Schmerz hindurch zu einer neuen Unschuld. Im Prinzip ist die Frage, ob der Mensch aufgrund seiner biologischen Verhaltensprogrammierung überhaupt in der Lage ist, Lebensumstände zu entwickeln, die es ihm dann ermöglichen, mit einem reinen Gewissen ein ganzes Leben zu durchschreiten. Dazu fällt mir noch eine lustige Anekdote ein: Ich war in Lübeck in einer Bar. Auf dem Weg zur Toilette las ich dort an der Wand den Spruch: Sei schlau, bleib dumm! Eigentlich eine sehr prägnante Formulierung des Problems. Aber so einfach ist es natürlich dann auch wieder nicht.
S: Entschuldigung. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns duzen? In meinem Lebensumfeld ist das so üblich und ich empfinde es als ausgesprochen angenehm.
K: Keineswegs. In der Wissenschaft geht es mittlerweile auch eher zwanglos zu.
S: Danke. Kann man denn das Verhalten von Menschen überhaupt untersuchen? Ich stelle es mir schwierig vor, mit Menschen zu experimentieren.
K: Das stimmt. Viele Dinge, die wir ohne weiter nachzudenken mit Tieren anstellen, sind beim Menschen als Versuchsperson nicht vorstellbar. Trotzdem können wir mit geschickten Experimenten schon sehr viel herausfinden. Und wir können sehr viel durch die „Vergleichende Verhaltensforschung“, also durch die Untersuchung an natürlichen Tierbeständen, erschließen. Viele grundlegende Prinzipien sind so aufgedeckt worden. Im Anschluss kann man dann schauen, ob diese auch auf den Menschen zutreffen.
Körper und Geist
„Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.“ Schopenhauer
S: Wenn du über das menschliche Verhalten nachdenkst, welchen Bereich findest du dann am interessantesten? Bei mir ist es ja die Frage, ob der Mensch gut oder böse ist. Das scheint aber für dich gar nicht das Entscheidende zu sein. Was ist nun für dich die wichtigste Frage?
K: Das kann ich dir sofort sagen. Es ist die Suche nach den Steuerungsmechanismen, die von unserem Körper ausgehen. Welcher Art sie sind und wie viel Spielraum sie uns lassen.
S: Meinst du, inwieweit der Geist den Körper steuern kann? Also wie schnell wir auf etwas reagieren können?
K: Nein, ich meine damit, wie viel Spielraum der Körper dem Bewusstsein gibt.
S: Der Körper dem Bewusstsein? Das musst du mir näher erklären.
K: Nimm einmal das Beispiel deiner Atmung. Wenn du nicht drüber nachdenkst, hat dein Körper die Kontrolle und bestimmt, wie du atmest. Du kannst aber auch ganz bewusst einatmen, ausatmen oder aber den Atem anhalten. Du hast also scheinbar die völlige Kontrolle über deine Atmung. Du kannst flach atmen, wenn etwas stinkt, oder tief einatmen, wenn du den Duft des Waldes nach einem Regenschauer aufsaugst. Aber versuch einmal den Atem anzuhalten – an einem Punkt wird der Atemimpuls schier unüberbrückbar, und dennoch kannst du ihm bis zu einem gewissen Punkt widerstehen. Du kannst diesen Punkt sogar durch gezieltes Training immer weiter hinauszögern. Hast du den Atem nun besonders lange angehalten, dann musst du im Anschluss erst einmal besonders kräftig atmen, um den Mangel auszugleichen.
S: Ich glaube, der Rekord liegt bei über vierzehn Minuten. Aber was willst du damit sagen?
K: Am Ende musst du doch atmen. Ob langsam oder schnell – oder nur alle vierzehn Minuten. Und ich denke, so ist es mit allen Dingen im Leben. Wir können unser Leben modellieren – nicht aber grundlegend umkrempeln. Wir können eine Begierde vertagen, aber nicht beseitigen. Wir können eine Schuld eingehen, müssen sie aber im Anschluss wieder begleichen.
S: Eine Freundin sagt im Zusammenhang mit guten Vorsätzen immer, sie sei nun mal ein Dampfkessel mit tausend Löchern. Wenn sie mit zehn Fingern einige Löcher verschließt, dann dampft es halt aus den anderen etwas mehr raus.
K: Ja, so ähnlich sagt es einer meiner Freunde auch. Er meint, die Summe aller Laster sei stets konstant und man solle nicht das Risiko eingehen, durch die Unterdrückung eines bekannten, kontrollierbaren Lasters Raum zu schaffen für ein neues, das vielleicht viel schlimmer ist.
S: Ist es denn so?
K: Ich kann dir nur sagen, was ich darüber denke. Immer ist es ein Problem der Menschen, dass sie sich vermeintlich nicht im Griff haben. Sie wollen abnehmen, das Rauchen aufhören oder aber viel mehr Sport treiben und ganz generell gesund und verantwortungsvoll leben. Aber irgendwie gelingt es dann doch nicht. Entweder greift man wieder zur Zigarette, oder aber man fängt an, so hemmungslos Dinge in sich hineinzustopfen, dass die Pfunde durch die Decke schießen.
S: Du meinst Selbstkontrolle?
K: Ja, aber aus der ganz praktischen Perspektive betrachtet. Also meine erste These wäre, wenn der Körper etwas will, dann beharrt er darauf. Er formuliert keine Bitten, sondern erteilt Befehle. Im Umkehrschluss gilt ebenfalls, was er nicht will, das wird er mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Er, der Körper, weiß nun nichts von den Beschlüssen des Geistes. Und ohne den Körper mit ins Boot zu holen, kann das Bewusstsein beschließen, was es will. Es wird keinen Erfolg haben.
S: Du willst damit sagen, dass der logische Beschluss, dieses oder jenes zu tun, erst einmal an der Lage nichts ändert?
K: Genau. Es ist natürlich der erste Schritt einer jeden Veränderung, aber wenn danach nicht auch noch der Körper von dem tollen Gedanken überzeugt wird – dann wird es wohl eher nichts mit den hehren Ideen.
S: Manchmal folgt mir eine ganze Herde an Schweinehunden und hält mich von meinen eben noch euphorisch gefassten Beschlüssen ab, aber manchmal klappen Veränderungen auch ganz toll.
K: Das sehe ich genauso. Ein super Beispiel ist sicher das Joggen. Generell lehnt der Körper Bewegungen ab, die nicht zu einem Ziel führen, an dem ein leckeres Essen oder Vergleichbares wartet. Wenn man aber lange genug läuft, dann erfährt man plötzlich ein Hochgefühl, und schnell wird man süchtig nach den täglichen zehn Kilometern. Plötzlich will der Körper den Sport. Der Geist hat eine Umwelt erschaffen, in der der Körper mit ihm an einem Strang zieht.
S: Ich kenne das Gefühl. Ich jogge auch immer um die Alster. Interessant dabei ist, dass mein Körper kurze Distanzen ablehnt, lange Distanzen aber tatsächlich belohnt.
K: Genau. Und ich frage mich nun, ob wir überhaupt langfristig Vorhaben umsetzen können, wenn die körperliche Belohnung ausbleibt. Es ist ja nicht nur so, dass wir Belohnung erfahren können, sondern auch ganz klar Ablehnung. Ich habe als Kind eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Wie alle Kinder habe ich Süßigkeiten geliebt. Irgendwann habe ich dann die Rechnung bekommen: Ein Loch im Zahn, unten links. Und immer wenn Süßes daran kam, tat es weh. Aber macht ja nix. Dann kauen wir eben rechts. Mit dem Ergebnis, dass ich dann ein Loch auf der rechten Seite bekam. Jetzt hatte ich die Wahl, entweder Zahnarzt oder auf Süßigkeiten verzichten. Zahnarzt war nicht sehr verlockend. Und seither habe ich kein Verlangen mehr nach Süßem. Mein Körper hat es mir mit negativen Signalen abgewöhnt. Und danach wollte ich es auch wirklich nicht mehr. Bis heute.
S: Ich kenne ein schönes Beispiel für den umgekehrten Fall. In jungen Jahren war ich immer ein Langschläfer. Ich habe mich regelrecht in die Kissen gekrallt. Als ich dann meinen ersten Job hatte, musste ich einfach früh aufstehen. Am Anfang war das die Hölle. Aber dann habe ich einen Bäcker um die Ecke entdeckt, der einen super Kaffee und unglaublich leckere Franzbrötchen hatte. Es hat nicht lange gedauert und ich habe mich morgens regelrecht auf das Aufstehen gefreut. Das war eine tolle Erleichterung für mich.
K: Belohnung und Strafe. Die alte Idee. Aber immer auf der Ebene des Körpers und nicht auf der logischen bewussten Ebene. Ich denke, die Idee der bewussten Einsicht des Menschen kann als gescheitert zu den Akten gelegt werden. Alle Religionen haben genau das versucht. Sicher haben sie eine positive Wirkung gehabt, aber der durchschlagende Erfolg war es nicht. Ich habe da immer die schwäbischen Maultaschen vor Augen. Die mittlerweile populärste Herkunftslegende ist die Geschichte der Zisterziensermönche. Im 17. Jahrhundert bekamen die Mönche ein großes Stück Fleisch geschenkt. Unglücklicherweise allerdings mitten in der Fastenzeit. Was nun? Zunächst wurde das Fleisch klein gehackt und mit vielen Kräutern und Spinat aus dem Klostergarten vermischt, damit die etwas grünliche Masse nicht mehr als Fleisch zu identifizieren war. Um sicherzugehen, dass der Herrgott auch wirklich nichts bemerkt, umhüllten die Mönche die Masse zusätzlich noch mit einem Nudelteig. Daher auch der volkskundliche Name: Herrgottsbescheißerle. Ist die Lust geweckt, bahnt sie sich ihren Weg.
S: Mir fällt dazu ein, dass man in der Fastenzeit ja durchaus Fisch essen durfte. Also wurde kurzerhand alles, was im Wasser schwamm, zum Fisch erklärt. Mit dem Resultat, dass die Biber kurz vor der Ausrottung standen.
K: So sind sie die Menschen.
S: Sollte man dann nicht ganz bewusst an diesem Punkt ansetzen? Sozusagen den Körper in die richtige Richtung locken?
K: Ja, definitiv. Nur leider nutzen besonders diejenigen Menschen genau diese Mechanismen, die etwas verkaufen wollen. Zucker, Fett und Salz im Übermaß in Lebensmitteln. Fastfood. Prominente in der Werbung. Falsche Versprechen in der Politik. So treiben wir langsam aber sicher in die genau falsche Richtung. Langfristig angelegte Befriedigungen verlieren ihren Reiz, wenn die Versprechen nicht eingehalten werden und die kurzfristigen Reize im Überfluss angeboten werden. Das ist jetzt vielleicht etwas aus dem Rahmen, aber es hat einmal ein Experiment gegeben, in dem eine Elektrode direkt in das Belohnungszentrum einer Ratte eingepflanzt wurde. Sobald sie nun in ihrem Käfig einen Schalter drückte, floss ein geringer Strom, der zu einem wunderbaren Hochgefühl führte. Die Ratte hat fortan nichts anderes mehr gemacht, als immer wieder den Taster zu drücken, bis sie verdurstet ist. Glück kann also auch tödlich sein.
S: Und nun?
K: Es gibt einen Mechanismus, der im Gegensatz zu Tieren bei Menschen besonders stark ausgeprägt ist. Die Geschichte der Menschheit wäre anders verlaufen ohne ihn. Ich rede von der Belohnungsverzögerung. Umgangssprachlich auch Hoffnung oder Vorfreude genannt. Hier liegt ein großes Versprechen versteckt. Aber wir müssen erst noch über andere Dinge reden, bevor wir die Tragweite dieses Mechanismus verstehen können.
Das Essen kommt und K fängt an zu erzählen.-