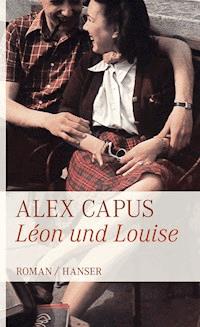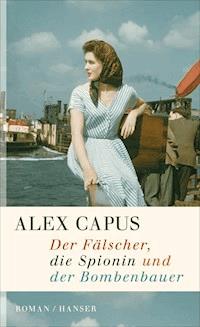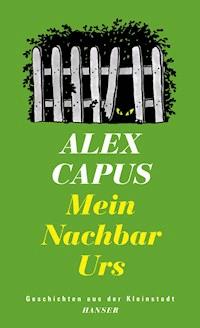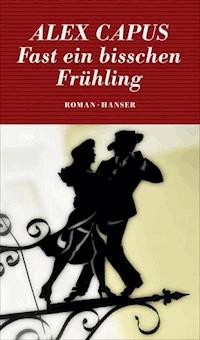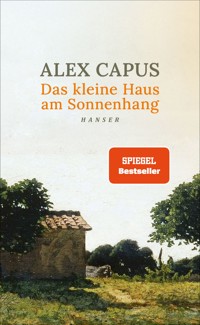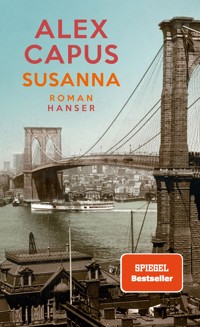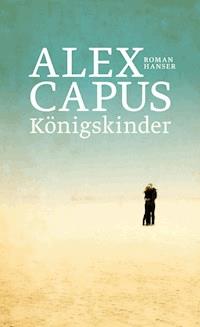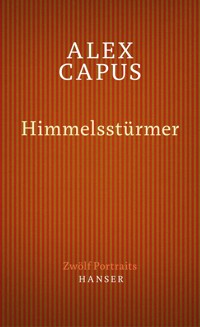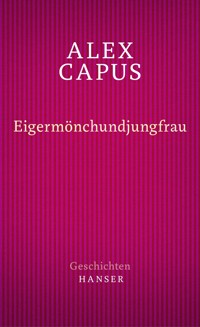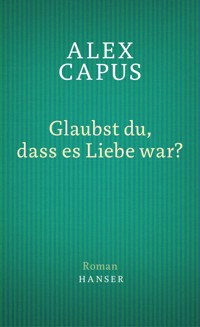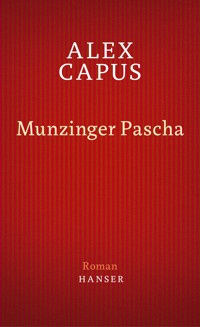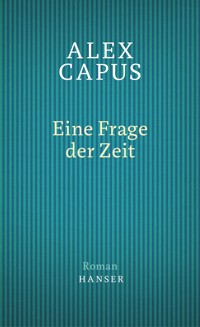
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unglaubliche, doch wahre Geschichte: 1913 beauftragt Kaiser Wilhelm II. drei norddeutsche Werftarbeiter, ein Dampfschiff in seine Einzelteile zu zerlegen und am Tanganikasee südlich des Kilimandscharo wieder zusammenzusetzen. Der Monarch will damit seine imperialen Ansprüche unterstreichen. Zur gleichen Zeit beauftragt Churchill den exzentrischen, aber liebenswerten Oberstleutnant Spicer Simson, zwei Kanonenboote über Land durch halb Afrika an den Tanganikasee zu schleppen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, liegen sich Deutsche und Briten an seinen Ufern gegenüber. Keiner will, aber jeder muss Krieg führen. Alle sind sie Gefangene der Zeit und jeder hat seine eigene Art, damit fertig zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine unglaubliche, doch wahre Geschichte: 1913 beauftragt Kaiser Wilhelm II. drei norddeutsche Werftarbeiter, ein Dampfschiff in seine Einzelteile zu zerlegen und am Tanganjikasee südlich des Kilimandscharo wieder zusammenzusetzen. Der Monarch will damit seine imperialen Ansprüche unterstreichen. Zur gleichen Zeit beauftragt Winston Churchill den exzentrischen, aber liebenswerten Oberstleutnant Spicer Simson, zwei Kanonenboote über Land durch halb Afrika an den Tanganjikasee zu schleppen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, liegen sich Deutsche und Briten an seinen Ufern gegenüber. Keiner will, aber jeder muss Krieg führen vor der pittoresken Kulisse des tropischen Sees. Alle sind sie Gefangene der Zeit, in der sie leben, und jeder hat seine eigene Art, damit fertig zu werden.
Alex Capus
Eine Frage der Zeit
Roman
Carl Hanser Verlag
Nachspiel
Blind und irr vor Erschöpfung kletterte Anton Rüter den Bahndamm hinauf, dem er seit der Morgendämmerung entgegengelaufen war. Zwischen den Büscheln harten Buschgrases raschelten Schlangen und Echsen, hoch über ihm brannte die Sonne, und hinter ihm lag das Hochland Ostafrikas, das nun, zu Beginn der Regenzeit, über Hunderte von Kilometern überschwemmt war. Zehn Tage lang hatte er allein die geflutete Steppe durchwandert. Nachts hatte er sich an Bäume gelehnt und knietief im Wasser stehend stundenweise geschlafen; manchmal war er auch, umschwärmt von Wolken von Stechmücken, auf die Spitze eines Termitenhügels geklettert und hatte sich wie ein Hund zusammengerollt. Gegessen hatte er die rohen Kadaver ertrunkener Tiere, die sich in den Ästen gestürzter Bäume verfangen hatten, und getrunken das brackige Wasser, durch das er gewatet war. Sein Haar war filzig, der Bart lang, die nackten Beine waren übersät mit Dschungelgeschwüren. Seine Uniform, die in Fetzen an ihm herunterhing, war ein phantastisches Sammelsurium aus den Schlachtfeldern, über die er geflohen war. Die Jacke hatte er einem toten belgischen Askari abgenommen, die kurze Hose einem rhodesischen Sergeanten, den Tropenhelm einem südafrikanischen Offizier. Die Sandalen hatte er selbst geschustert aus den Überresten seiner eigenen Stiefel.
Nun lag er bäuchlings zwischen den Gleisen und presste das Gesicht auf den rostroten Schotter, horchte ins ohrenbetäubende Gekreisch der Zikaden und wagte es nicht, auf die andere Seite des Damms hinunterzuspähen. Anton Rüter wusste nicht, worauf er hoffen sollte. Falls sich, was er befürchtete, auch hinter dem Gleis bis zum Horizont das wüste, überschwemmte Grasland hinzog, würde er an Hunger und Entkräftung sterben. Wenn dort aber ein Eingeborenendorf lag, würde man ihn totschlagen wie einen Hund. Und falls er auf Soldaten stieß, würde man ihn erschießen, hängen oder bestenfalls in Ketten legen.
Da stach ihm ein Geruch in die Nase — der Duft von heißem Haferbrei. Anton Rüter schnupperte, ungläubig erst noch, dann voller Gier. Kein Zweifel, seine von langem Hunger geschärften Sinne täuschten ihn nicht. Das war Haferbrei, vermutlich ohne Zucker und Salz zwar, wie ihn die Briten mochten, und höchstwahrscheinlich mit Wasser statt mit Milch zubereitet — aber unbestreitbar Haferbrei. Er hob den Kopf, fasste mit beiden Händen die glühend heiße Schiene und zog sich vorwärts — und als er am Rand des Bahndamms anlangte, hatte er keinen Blick für den Trupp «King’s African Rifles», der einen Steinwurf entfernt am Rande eines Wäldchens ihr Lager aufgeschlagen hatten. Er nahm keine Notiz von den fünf Panzerautos, den Minenwerfern, Maschinengewehren und den Bergen von Munitionskisten, er ignorierte die dreißig sauber gekämmten Männer in ihren tadellosen Uniformen, die ihre Zelte aufschlugen, Proviant ausluden, im Schatten der Bäume ruhten. Nur für eines hatte Anton Rüter Augen — das war der duftende Kupferkessel, der fahrlässig unbewacht abseits der Zelte am Waldrand über einem Feuer hing. Er rappelte sich auf und stürzte hinunter, griff sich den Kessel und torkelte dem Wäldchen entgegen, hörte nicht die überraschten Ausrufe der Engländer, auch nicht das Bellen der Hunde und das Pfeifen der Pistolenschüsse, verschwand im schützenden Dunkel zwischen den Bäumen und fiel nach wenigen Schritten samt Kessel und Haferbrei in eine Bachschlucht hinunter, die er im dichten Unterholz nicht hatte sehen können. Als er zerschunden, zerschlagen und verbrüht vom heißen Haferbrei am Grund der Schlucht wieder zu sich kam, verkroch er sich unter dem Wurzelstock eines umgestürzten Baumes, lauschte dem Hundegebell und den Stimmen der Männer, und da sie nicht näher zu kommen schienen, leckte er sich den Haferbrei vom Leib in der Gewissheit, dass man ihn über kurz oder lang finden würde. Dann schlief er ein und vergaß den Kessel und die Pistolenschüsse, die Hunde und den Bahndamm und das endlose Wasser und überhaupt alles, was er in den letzten vier Jahren erlebt, erduldet und getan hatte.
1 Nachts kamen die Flusspferde
Es ist ja nicht so, dass der Mensch sich in jedem Augenblick seines Lebens darüber Rechenschaft gibt, wie wichtig oder belanglos die Dinge sind, die er so treibt, während die Zeit vergeht. Jeder rührt seinen Teig, schleppt seinen Stein, striegelt sein Pferd. Man hat Zahnschmerzen und macht Pläne, isst Suppe und geht sonntags spazieren; und ehe man es sich versieht, ist eine Pyramide gebaut, eine Millionenstadt mit Brot versorgt, ein Zarenreich gestürzt. Große Taten, unsterbliche Werke — die vollbringt man nicht im Vollgefühl ihrer Bedeutsamkeit; man mag sich nicht unablässig selbst befragen. Sonntags vielleicht, und an Silvester. Aber doch nicht bei der Arbeit.
Schiffbaumeister Anton Rüter zerbrach sich gewiss nicht den Kopf über die historische Bedeutsamkeit des Augenblicks, als ihn die Fabriksirene der Papenburger Meyer Werft am 20. November 1913 kurz nach halb elf Uhr zur Schiffstaufe rief. Eine Pause war eine Pause. Es würde Ansprachen und Branntwein für alle geben, und dann Tabak in jenen langen, holländischen Tonpfeifen, die die Werft für solche Anlässe kistenweise auf Lager hielt. Er durchmaß mit sparsamen Schritten den Maschinenraum des nagelneuen Schiffes, schob vorsichtig am Dampfregler und lauschte dem Gleiten der Kolben, dem Summen der Räder und dem Zischen der Ventile. Während draußen die Kapelle des Papenburger Turnvereins «Heil dir im Siegerkranz» spielte, kontrollierte er die Spannung des Stromgenerators, warf einen Blick in die Feuerluken und vergewisserte sich, dass der Frischwasserhahn offen war. Er war stolz auf das Schiff. Die Götzen war sein Schiff — das größte und schönste Schiff, das je in Papenburg gebaut worden war. Rüter hatte sich das Schiff ausgedacht, er hatte die ersten Pläne gezeichnet und zehn Monate lang den Bau geleitet, und die wichtigsten und heikelsten Arbeiten hatte er eigenhändig ausgeführt. Seit der Kiellegung hatte er seine Tage im Gerippe des Schiffsrumpfs verbracht, und oft auch die Nächte; wenn er wach war, hatten seine Gedanken um das Schiff gekreist, und wenn er schlief, hatte er von ihm geträumt. Und jetzt war es fertig. Die Maschinen liefen rund, der Dampfdruck war stabil. Darüber, dass er das Schiff gleich nach der Taufe wieder in seine kleinsten Einzelteile zerlegen würde, grübelte Anton Rüter nicht nach. Das war nun mal seine Aufgabe, und technisch würde es keine Schwierigkeiten geben. Er wischte sich mit einem Lappen die Hände ab und stieg hinauf aufs Hauptdeck.
Die Götzen lag schwarzweißrot über die Toppen geflaggt, mit zischenden Dampfmaschinen, rauchendem Schornstein und frei in der Luft drehenden Schiffsschrauben auf der Helling und schien klar zum Stapellauf. Man hätte nur die Haltetrossen durchschlagen müssen, dann wäre sie über die Backbordseite von den Pallen heruntergerutscht, auf den ölgetränkten Holzbohlen der Ablauframpe in den Turmkanal geglitten und hätte — wie bei seitlichen Stapelläufen üblich — auf der ganzen Länge ihres Rumpfes eine mannshohe Flutwelle ausgelöst, die am gegenüberliegenden Ufer auf die Wiese geschwappt wäre unter Mitnahme des gesamten Fischbestandes, weshalb die Kinder des Städtchens mit großen Weidenkörben bereitgestanden wären, um die im Gras zappelnden Fische einzusammeln. Dann wäre das Schiff durch den Sielkanal in die nordwärts fließende Ems geglitten, über den Dollart an den ostfriesischen Inseln vorbei und hinaus auf die Nordsee, seiner Bestimmung entgegen.
Aber diesmal standen die Kinder nicht auf der Wiese, denn sie wussten seit Monaten, dass man die Götzen nicht zu Wasser lassen würde. Im ganzen Städtchen war bekannt, dass das Reichskolonialamt ein Schiff bestellt hatte, das sich auseinandernehmen und andernorts wieder zusammensetzen ließ, sozusagen im Baukastensystem; jedermann wusste, dass Anton Rüter die Götzen in fünftausend Holzkisten verpacken und tief im Innern Afrikas, südlich des Kilimandscharo und nahe bei den Nilquellen im sagenumwobenen Mondgebirge, wieder zusammenbauen würde. Während der ganzen Bauzeit war den Werftarbeitern klar gewesen, dass sie sich gleich nach der Taufe wieder über das Schiff hermachen würden wie die Termiten, und dass sie jede Schraube, die sie anzogen, bald wieder lösen, und jede Planke, die sie verlegten, wieder entfernen würden. Trotzdem hatte Rüter unzählige Male dazwischengehen müssen, weil einer aus handwerklichem Pflichtgefühl Fugen kalfaterte oder aus Gewohnheit die Platten dauerhaft nietete, statt sie provisorisch zu verschrauben.
Rüter warf einen letzten prüfenden Blick über die hölzernen Planken des Hauptdecks und hinauf zum rauchenden Schornstein, an dem fahl das messingne Steamrohr und die Dampfpfeife glänzten. Gleich würde der alte Meyer in Begleitung von drei Berliner Herren im Automobil vorfahren; das Kolonialamt hatte verlangt, das Schiff unter Dampf stehend inspizieren zu können, bevor es in seine Einzelteile zerlegt wurde. Unter dem Dröhnen der Fabriksirene strömten die Angestellten aus den rußgeschwärzten Backsteinbauten heraus zur Helling, aus der Gießerei, der Maschinenfabrik, der Kesselschmiede, der Kupferschmiede und der Tischlerei. Sogar die Buchhalter und die Sekretärinnen vom Bürogebäude eilten herbei und die Fuhrleute und die Pferdeknechte aus den Stallungen. Manche suchten zu viert oder fünft hinter einem Bretterstapel Schutz vor der eisigen Nordseebrise, andere lehnten an verwitterten Scheunenwänden oder machten es sich auf behelfsmäßigen Sitzbänken oder auf Holzkisten bequem. Sie schlugen die Kragen hoch und steckten sich Zigaretten an, bohrten die Fäuste in die Hosentaschen und beobachteten die Möwen, die unter niedrig grauem Himmel im Wind spielten.
Rüter stieg übers Fallreep hinunter auf das Kopfsteinpflaster. Er vergewisserte sich, dass alle Pallen sauber verkeilt und die Trossen gespannt waren, und in letzter Sekunde versteckte er noch rasch einen Besen, der am Rumpf der Götzen lehnte, hinter einem Bretterstapel. Pünktlich um halb elf Uhr beschrieb Meyers schwarze Benz-Limousine einen weiten Bogen über den Platz, bahnte sich einen Weg durch die versammelte Belegschaft und kam neben dem Fallreep zum Stillstand. Rüter erwog einen Augenblick, hinzuzueilen und die Beifahrertür aufzureißen, hinter der er seinen Dienstherrn ausgemacht hatte, beschloss dann aber, das Türenaufreißen dem Chauffeur zu überlassen und die Berliner Beamten, die in Zylinder, Frack und mit Gehstock aus dem Fonds des Wagens stiegen, in respektvollem, aber selbstbewusstem Abstand zu erwarten. Er beobachtete, wie die Herren die Götzen einer ersten Musterung unterzogen, und schloss aus ihren haltlos schweifenden Blicken, dass sie von Schiffbau keine Ahnung hatten. Er straffte die Schultern in der Erwartung, ihnen gleich vorgestellt zu werden; aber dann schritten sie an ihm vorbei, als wäre er ein Sägebock oder eine Zimmerpalme, und der Chef nickte ihm nur zu und tätschelte ihm im Vorbeigehen leichthin die Schulter. Rüter atmete aus, trat einen Schritt beiseite und beobachtete, wie die Männer das Fallreep hinaufstiegen. Kaum waren sie hinter der Reling verschwunden, gab die Götzen Laut. Erst dröhnte das Signalhorn zum Beweis, dass es funktionierte. Dann rasselten die Ankerketten, erhöhten die Dampfmaschinen fauchend und zischend den Dampfdruck, dass Rüter besorgt die Brauen hob. Die Lichter gingen an und aus, dann drehten sich die zwei Dampfladewinden und gehorchte das Ruderblatt am Heck den Befehlen der Dampfrudermaschine. Die Herren tauchten am Bug auf und warfen prüfende Blicke nach links und rechts, dann erschienen sie am Brückendeck, betätigten hier einen Hebel, kippten da einen Schalter und fuhren dort mit dem Finger über messingblitzende Armaturen, und dann beugten sie sich übers Heck, um einen Blick auf die sachte rotierenden, golden glänzenden Schiffsschrauben zu werfen.
Anton Rüter bewunderte die vornehme Gelassenheit, mit der Werfteigner Joseph Lambert Meyer seine Gäste dirigierte, und die aristokratisch zurückhaltende Vertraulichkeit, mit der er ihnen technische Auskünfte erteilte. Es war dieselbe befehlsgewohnte Sanftheit, mit der er auch seine Arbeiter führte, und gegen die sie alle wehrlos waren. Rüter kannte den alten Meyer länger als irgendeinen Menschen sonst auf der Welt. Im ersten Drittel seines Lebens war er Kind gewesen, die übrige Zeit Arbeiter in der Meyer Werft. Aufgewachsen als Waise bei einem Onkel, der draußen im Moor Torf stach, hatte er schon als Zehnjähriger während der Schulferien Geld verdient in der Meyerschen Tischlerei, in der Schmiede und in der Gießerei. Seither waren zwanzig Jahre vergangen, und Rüter hatte bei Meyer jedes Handwerk, das im Schiffbau zur Anwendung kam, gründlich gelernt. Zwar hatte er nur sechs Jahre die Grundschule besucht, und ein Ingenieurstudium war nie in Frage gekommen; aber wenn es hätte sein müssen und man ihm genügend Zeit gelassen hätte, wäre er imstande gewesen, ein Schiff wie die Götzen ganz allein zu bauen. Er konnte Pläne lesen und zeichnen, er konnte den Zeitaufwand für diese oder jene Arbeit schätzen, Kosten berechnen, effiziente Abläufe festlegen und Risiken abwägen — und die Meyer Werft kannte er besser als der alte Meyer selbst. Er wusste, welchen Lüftungsschieber er ziehen musste, wenn der Gießereiofen zu bullern anfing, und bei welcher Last der Drehkran zu kreischen begann, und mit welchem Büromädchen der Prokurist eine Romanze unterhielt, und welcher Pferdeknecht jeden Samstag einen halben Sack Hafer stahl. Die Werkzeuge der Schlosserei waren ihm derart vertraut, dass sie sich seinen Händen angepasst hatten, oder vielleicht war es umgekehrt — jedenfalls waren alle Werkzeuge seine Werkzeuge, und im Grunde genommen war die ganze Schlosserei seine Schlosserei. Auch die Gießerei war seine Gießerei, und die Tischlerei war seine Tischlerei, und die Lehrlinge waren seine Lehrlinge, und überhaupt war die ganze Meyer Werft seine Werft, und der alte Meyer war sein alter Meyer. Gegenüber dem Chef hegte er ein Gefühl loyaler Zugehörigkeit, das nicht eigentlich Zuneigung, sondern eher kannibalischer Einverleibungsgier entsprang; am liebsten hätte er den vornehmen grauen Spitzbart des alten Meyer für sich gehabt, ebenso dessen sanfte Stimme und die hohe Stirn und den schwermütigen Blick; er hätte wie jener einer Dynastie von Werfteignern angehören wollen, die seit Jahrhunderten in Papenburg Schiffe baute, und er hätte ebenfalls die königliche Schiffbauschule in Grabow besucht haben wollen, und er hätte gern auf dem Werftgelände in einer Villa gewohnt. Da er aber jener Welt nie angehören würde, legte er großen Wert darauf, sich nicht zu ihrem Affen zu machen; er wollte keine weißen, gestärkten Stehkragen tragen und kein Grammophon mit Wagner-Schallplatten besitzen, und er wollte auch nicht, dass seine Töchter, die zwei, drei und fünf Jahre alt waren, jemals Chopin spielten und Französisch lernten. Er wollte, dass sein blaues Arbeitskleid morgens sauber war und abends schmutzig, und er war Vorturner im Arbeiterturnverein, und seine Töchter waren zuständig für die Kaninchen im Stall hinter dem Haus, und seine Frau puderte sich höchstens an hohen Feiertagen, und wenn ihre Cousine aus Hamburg zu Besuch kam. Vor ein paar Jahren, als er Anfang zwanzig gewesen war, hatte er zuweilen davon geträumt, eine von Meyers Töchtern zu heiraten und Einlass in die Familie zu finden. Einen Sommer lang hatte er den Hals nach weißen Sonnenschirmchen, rosa Taftkleidern und zarten, geschnürten Bottinen verdreht, und als Meyers jüngste Tochter im Herbst zurück ins Internat nach England fuhr, hatte er ihr zwei oder drei Briefe geschrieben. Jetzt war er froh, dass er die Briefe nie abgeschickt, sondern im folgenden Frühjahr die Kapitänstochter Susanne Meinders geheiratet hatte, mit der ihn seit der Kindheit eine tiefe, unverbrüchliche Kameradschaft verband. Zwar hatte Susanne deutlich breitere Fesseln und keine plötzlichen Ohnmachtsanfälle, und es war ihr auch nicht gegeben, auf interessante Art an der Welt zu leiden. Aber sie hatte ihre ersten Lebensjahre mit den Eltern auf See verbracht, und sie konnte anhand der Sterne navigieren und wusste, wie es in den Hafenvierteln von Portsmouth, Sankt Petersburg und Valparaiso aussah.
Auf einem Gruppenbild, das am Tag der Schiffstaufe entstand, posiert Rüter vor einer Bretterwand — ein kräftiger Handwerker mit wilhelminischem Schnurrbart, der mit verschränkten Armen und weit aufgerissenen Augen darauf wartet, dass der Fotograf unter seinem schwarzen Tuch hervorkommt und Entwarnung gibt. Betrachtet man sein jugendlich rundes Gesicht unter der bereits gelichteten, mit zwei langen Querfalten gefurchten Stirn, so glaubt man eine ahnungsvolle Schicksalsergebenheit zu erkennen. Gut möglich, dass er am Vorabend seiner Afrikareise um die Gefahren einer langen Schiffsreise, um die Unerbittlichkeit des äquatorialen Klimas und die Brutalität des kolonialen Alltags weiß; vielleicht hat er sogar schon vom geradezu lächerlich sadistischen Erfindungsreichtum gehört, den Gott bei der Schaffung der Tropenkrankheiten unter Beweis gestellt hat. Trotzdem wird er die Reise tun, weil er sie tun muss. Die Götzen ist sein Schiff, und Joseph L. Meyer zählt auf ihn. Rüter ist von allen tüchtigen Schiffbaumeistern der jüngste, von allen zuverlässigen der kräftigste, von allen erfahrenen der klügste. Wenn er die Götzen nicht nach Afrika bringt, wer dann?
Eines Abends, als die Kleinen im Bett waren, wollte er die Angelegenheit mit seiner Frau Susanne besprechen. Sie ist ein großes, starkes und kluges Weib, und er hält große Stücke auf ihre Meinung. Susanne ließ die Zeitung sinken, die sie gerade las, und musterte ihn aufmerksam. Dann nahm sie ihr kurzes Tabakpfeifchen aus dem Mund, das sie sich jeden Abend gönnte, sagte laut und deutlich: «Mach das!» und vertiefte sich wieder in die Zeitung. Anton Rüter verstand, was sie ihm damit sagte. Sie sagte ihm erstens, dass er die Reise nach Afrika nicht scheuen solle, weil ihm sonst das Leben fad werde; zweitens, dass er sich um sie keine Sorgen zu machen brauche, weil sie in der Zwischenzeit ein Dach über dem Kopf, ausreichend Kohle im Schuppen und Geld auf der Sparkasse haben werde; drittens, dass die Kinder die Abwesenheit ihres Vaters, den sie wochentags sowieso kaum zu Gesicht bekamen, leicht verschmerzen würden; viertens, dass sie mit dem Geld, das er übers Jahr verdiente, das Haus abzahlen und zwei Fahrräder kaufen könnten. Und dass es dann fünftens vielleicht sogar für zwei Wochen Ferien auf Borkum reichte. Er verstand das alles und war ihr dankbar.
Nach einer halben Stunde war die Inspektion des Schiffes beendet, die vier Herren gingen wieder von Bord. Dann folgten die Ansprachen. Joseph Meyer stieg als Erster auf die improvisierte, mit schwarzweißrotem Krepp geschmückte Redekanzel. Er dankte den Berliner Herren mit viel zu leiser Stimme für ihr Vertrauen, dankte den Arbeitern für ihren Einsatz, wünschte der Götzen auf ihrer ungewöhnlichen Reise nach dem dunklen Erdteil gute Fahrt und übergab das Wort dem Inspektor des Reichskolonialamts. Dieser überbrachte Grüße Seiner Kaiserlichen Majestät und ließ den Kaiser hochleben, und während die vierhundert Werftarbeiter pflichtschuldig «Hoch! Hoch! Hoch!» riefen, stieg mit gerafften Röcken Joseph Meyers Gattin aufs Podest, nahm die angeritzte Sektflasche zur Hand, die mit einer Schnur am Ladebaum des Schiffes befestigt war, und schleuderte sie gegen den Bug, wo sie auf Anhieb ordnungsgemäß glücksbringend zerschellte.
Der Photograph unten auf dem Kopfsteinpflaster drückte den Auslöser in genau jenem Augenblick, da der Schaumwein wie Feuerwerk vor dem schwarzen Schiffsrumpf zersprühte. Während der Flaschenhals an der Schnur auspendelte und die Ehrengäste vom Podium hinunterstiegen, sah er sich nach einem nächsten Bildmotiv um, entdeckte am Fallreep Anton Rüter und nötigte diesen, zusammen mit den zwei Arbeitern, die ihn nach Afrika begleiten würden, vor einer Bretterwand zu posieren, worauf das bereits erwähnte Gruppenbild entstand.
Zu Rüters Linken ist der Handwerksbursche Hermann Wendt zu sehen, mit dreiundzwanzig Jahren der Jüngste der Gruppe. Er bietet der Kamera die Stirn mit der selbstbewussten Gelassenheit des Mechanikers, für den es keine unlösbaren Probleme gibt. Er ist es gewohnt, dass die Dinge rund laufen. Wenn eine Schwierigkeit auftaucht, ist das kein Grund zur Aufregung, sondern Anlass zum Nachdenken. Man sucht nach dem Fehler, behebt ihn und kontrolliert anschließend, ob alles wieder rund läuft. Und wenn etwas endgültig kaputt und nicht mehr zu gebrauchen ist, macht man deswegen keinen Aufstand, sondern legt’s eben beiseite. Nach dieser Methode verfährt er nicht nur in mechanischen Dingen, sondern in sämtlichen Bereichen des menschlichen Lebens. Mit seinem Vater, unter dessen Dach er noch immer wohnt, versteht er sich gut; er weiß, worüber sie miteinander reden können, und worüber sie schweigen müssen. Seine Finanzen hat er im Griff; hundert Mark im Monat verdient er, ein bisschen weniger gibt er aus. Mit den Mädchen kommt er bestens klar; Nein ist Nein, und Ja ist Ja, und wenn’s nicht mehr geht, geht’s eben nicht mehr. Er hat im Arbeiterkulturverein Marx und Engels gelesen und sich für deren uhrwerkhafte Geschichtstheorie, für das Ticktack von These, Antithese und Synthese begeistert. Der Gewerkschaft beitreten will er deswegen aber nicht gerade, denn wenn es um seinen Lohn geht, bespricht er das doch lieber selbst mit dem alten Meyer, der ihn bisher immer sehr anständig behandelt hat; und wenn die proletarische Revolution sowieso historisch unausweichlich bevorsteht, sieht Hermann Wendt nicht ein, weshalb er zu deren Herbeiführung seine spärliche Freizeit opfern soll. Die Afrikareise schreckt ihn nicht. Er wird dort runterfahren, ein Jahr für dreifachen Lohn arbeiten und fast nichts ausgeben, und dann heimkehren. Falls es in Afrika heiß ist, wird er eben schwitzen. Wenn’s keine anständigen Betten gibt, wird er sich eines zimmern. Und wenn das Essen komisch schmeckt, wird er’s trotzdem essen. Natürlich kann es passieren, dass man krank wird, oder dass einen eine Schlange beißt, so was ist lästig. Aber machen kann man nicht sehr viel dagegen, also lohnt es sich nicht, darüber nachzudenken. Wenn er heimkommt, wird er mit dem Geld ein Haus bauen, heiraten und Kinder haben. Das Grundstück hat er schon ausgewählt. Es liegt weitab vom Städtchen im Wilden Moor. Ziemlich weitab am Splittigkanal, das stimmt schon, Elektrizität gibt es dort draußen noch keine. Dafür ist es billig. Der Strom wird dann schon kommen, die Stadt wächst rasch. Welche Frau er heiraten wird, weiß er noch nicht.
Am rechten Bildrand steht Nieter Rudolf Tellmann, mit vierundvierzig Jahren beinahe doppelt so alt wie der junge Wendt, verheiratet und Vater von vier halbwüchsigen Kindern. Sein Haar ist schütter, die Wangen sind hohl, der Blick geht skeptisch zur Seite. Er ist einer, der sonntags gern zur Jagd geht, in aller Frühe mit dem Gewehr allein hinaus ins Moor. Dass er viel geschossen hätte über die Jahre, kann man nicht sagen. Alle paar Monate der Form halber ein Moorhuhn vielleicht, oder ein Karnickel. Meist sitzt er nur einfach so an diesem oder jenem verschwiegenen Plätzchen auf einem Baumstrunk, das Gewehr, das womöglich nicht mal geladen ist, quer über den Schoß gelegt. Dann raucht er Zigaretten, kratzt sich gedankenvoll am Hals und betrachtet den Wandel der Jahreszeiten. Er hat sich nun wirklich nicht vorgedrängt, als der Chef einen Nieter für die Expedition suchte. Da gab’s sieben oder acht Kollegen, die wollten unbedingt fahren, wegen des Geldes. Gedrängelt haben sie wie die Schulbuben auf der Kirmes und großmäulige Reden gehalten, sind mit geschwollenem Kamm heimstolziert und haben vor ihren versammelten Familien den Anbruch herrlicher Zeiten verkündet; aber dann strömte ihnen über Nacht das Blut in den Gehirnkasten zurück und kam ihnen dieser oder jener Gedanke, und am folgenden Morgen haben sie sich kleinlaut in der Kesselschmiede verkrochen, sich an ihren Glühöfen und elektrischen Laufkränen zu schaffen gemacht und von Afrika nichts mehr hören wollen. Als dann der Chef in seiner Not den Tellmann ins Büro rief und ihm die Dienstreise händeringend antrug, brachte der es nicht über sich, rundheraus Nein zu sagen. Also rechnete er abends mit der Frau alles nochmal durch. Die Hypothek fürs Haus wäre man auf einen Schlag los. Die Aussteuer für die Älteste, die Schulbücher für die Kleinen, das Lehrjahr für den Großen in Bremen. Hinten raus in den Garten könnte man ein Zimmer anbauen für die Schwiegermutter, die ist in letzter Zeit ein bisschen alt und wunderlich geworden in ihrem windschiefen Fachwerkhäuschen draußen im Obermoor; das wird allmählich gefährlich. Kürzlich hat sie sich auf dem Heimweg nach dem Einkaufen verirrt, man musste sie suchen und fand sie lang nach Einbruch der Nacht an einer Böschung im Krummen Meer, weinend wie ein Kind, mit schmutzigen Röcken und zerrissenen Strümpfen. Entweder man baut ein Zimmer an, oder sie muss ins Altenheim. Geld kostet beides. Und was ist schon so ein Jährchen, das geht rasch vorbei. Je älter man wird, desto rascher. Und was die Jagd betrifft, soll Afrika nicht übel sein.
Als zum Abschluss der Zeremonie der Pfarrer das Schiff einsegnete und sämtliche anwesenden Papenburger niederknieten und die Hände zum Gebet falteten, warfen Wendt, Rüter und Tellmann einander ironische Blicke unter gerunzelten Stirnen zu, wackelten unschlüssig mit den Köpfen und scharrten mit den Füßen. Alle drei neigten nämlich, wie das unter Katholiken üblich ist, mehr oder weniger offen zum Atheismus im Vertrauen darauf, dass ihr milder und verzeihender Gott, falls es ihn letztlich eben doch geben sollte, ihnen am Jüngsten Tag die Leugnerei schon nachsehen werde; und falls Er wider Erwarten seine Barmherzigkeit verweigern sollte, würde es eben die Jungfrau Maria voll der Gnade richten.
Wenn Rüter, Tellmann und Wendt trotzdem niederknieten, geschah dies aus Höflichkeit gegenüber dem Pfarrer sowie aus Rücksichtnahme auf die religiösen Gefühle des Nebenmannes; konnte man denn wissen, ob der nicht vielleicht heimlich doch fromm war, trotz seiner ketzerischen Reden? Freilich war allen dreien bewusst, dass sie beim Niederknien streng genommen falsches Zeugnis ablegten. Aber auch diese Sünde würde Gott, wenn es ihn denn gab, ihnen nicht ewig krumm nehmen. Und sowieso war das alles im Augenblick egal. Wichtig war jetzt die Schiffstaufe. Wichtig war nicht, ob Rüter, Wendt und Tellmann an Gott glaubten. Wichtig war auch nicht, ob Gott an Rüter, Wendt und Tellmann glaubte. Wichtig war, dass Gott an das Schiff glaubte, und dass er ihm seinen Segen gewährte. Die drei Männer warfen sich auf die Knie, zerknüllten ihre Mützen in den Fäusten und warteten ergeben darauf, dass der Pfarrer zu einem Ende käme.
* * *
Zur gleichen Zeit lebte am anderen Ende Afrikas, im äußersten Westen des Kontinents, jener Mann, der schon bald den Auftrag erhalten sollte, nach Deutsch-Ostafrika zu fahren und mit einer Dreipfund-Kanone ein deutsches Dampfschiff zu versenken. In jenem November 1913 aber hatte er davon noch keine Ahnung, sondern steuerte ein kleines, verrußtes Dampfboot über den Gambia-Fluss. Er hielt sich immer dicht am Ufer, an der schweigenden Wand ineinander verschlungener Mangroven entlang, hinein ins Herz der Finsternis. Das Wasser floss zäh und war brackig braun, das Land menschenleer und derart flach, dass das Salzwasser des Atlantischen Ozeans zweihundert Kilometer tief in den Flusslauf eindrang. Bei Flut standen die Mangroven metertief unter Wasser, bei Ebbe rieselten unzählige Rinnsale und krochen Scharen von Taschenkrebsen und anderen phantastischen Geschöpfen durch den faulig riechenden Schlamm. Die Männer an Bord des Dampfbootes hielten scharf Ausschau nach Sandbänken, verborgenen Felsen und gefallenen Bäumen, die braun in braun und messerscharf in den Strom ragten und den Bootsrumpf der Länge nach aufschlitzen konnten. Weiter flussaufwärts wurde das Land trocken, der Mangrovenwald lichtete sich. Die ersten Ölpalmen tauchten auf, dann Affenbrot-, Mahagoni- und Kalebassenbäume, hin und wieder Drachenblut-, Ebenholz- und Wollbäume. Gelegentlich zeigte sich ein Buschbock am Ufer, manchmal turnten Schimpansen in den Bäumen. Löwen, Giraffen und Elefanten gab es seit ein paar Jahren — seit britische Großwildjäger die Gegend entdeckt hatten — keine mehr. Das Boot kam nur langsam voran, denn die Dampfrohre waren undicht, die Antriebswelle war verbogen und die Schraube schrundig. Aber das war egal, denn Eile hatte keiner, und die Reise hatte wohl einen Zweck, aber kein Ziel und kein Ende. Seit bald drei Jahren quälte sich das Dampferchen über den Gambia-Fluss, und die Männer an Bord wussten, dass es nie wieder anderes Wasser unter dem Kiel haben würde. Während der Mittagshitze gingen sie stundenlang vor Anker. Dann dösten die vier schwarzen Matrosen in ihren Hängematten, die zwei Offiziere schossen Krokodile oder spielten Schach unter dem Schattendach, und der Kommandant übertrug seine Daten vom Notizbuch auf die Karte. Nachmittags um vier tranken sie Tee, denn sie waren Briten. Dann kroch das Boot nochmal zwei Stunden den mäandernden Fluss hinauf, den Stromschnellen hinter Fatoto entgegen, manchmal auch flussabwärts ins Mündungsdelta, wo der ewige Modergeruch des Dschungels einer frischen atlantischen Brise wich. Am Abend, wenn sich Milliarden Insekten aller Größen über dem Wasser sammelten, ging das Boot in einer ruhigen Flussbiegung vor Anker. Nachts kamen die Flusspferde, um sich an seinem Rumpf zu scheuern. Dann geriet das Boot ins Schaukeln, unter dem Sonnendach trudelten die Petroleumlampen, der Brandy in den Gläsern schwappte über, und die Männer fluchten, griffen zu den Gewehren und schossen den walfischartig breiten Rücken hinterher, die grunzend und prustend in die Nacht abtauchten.
So hat sich Leutnant Geoffrey Spicer Simson seine Karriere nicht vorgestellt. Wenn die Welt ein gerechter Ort wäre, würde er jetzt nicht an seiner Ruderpinne sitzen, sondern hoch oben auf der Kommandobrücke eines Schlachtschiffs stehen; er würde über drei- oder vierhundert tadellose Navy-Matrosen gebieten, und er würde seine Befehle von Churchill persönlich empfangen, und sein Schiff wäre blitzblank und würde mit fünfundzwanzig Knoten auf den Ozeanen dieser Welt kreuzen. Stattdessen befehligt er ein Dampfboot mit einer kleinen Messingpfeife obendran, das vorne und hinten leckt und vielleicht mal seetüchtig war, und das irgendwann im letzten Jahrhundert auf den Namen Rose getauft wurde. Spicer kennt die Rose gut, denn er hat sie 1911 eigenhändig von England nach Afrika gebracht. Schon auf jener Fahrt hat ihm das Boot eine erste Demütigung angetan, weil er die freie Atlantikfahrt nicht wagen durfte und stattdessen durch die Kanäle Frankreichs nach Marseille kriechen musste, von dort immer brav die Küste entlang über Gibraltar und Dakar bis nach Bathurst in Gambia, wo er seine Ehefrau Amy in einem Pavillon im Gouvernementsviertel unterbrachte und sich dann aufmachte, im Auftrag der britischen Handels- und Kriegsmarine den Lauf des Gambia-Flusses zu kartographieren. Seither sind fast tausend Tage vergangen, und Spicer dümpelt noch immer über den brackigen Fluss, und seine Truppe besteht nicht aus dreihundert Navy-Soldaten, sondern aus vier schlaksigen, in Lumpen gehüllten Negerjungs, die ständig albern lachen und in unverständlichem Wolof palavern, und aus zwei unrasierten, fiebergeschüttelten Iren, denen längst alles egal ist.
Geoffrey Spicer Simson war ein kräftiger Mann mit breiten, runden Schultern, hellgrauen Augen und kurzgeschorenem Haar. Am Kinn ließ er sich ein militärisch knappes Bärtchen stehen, um Nase und Mund hatten sich tiefe Falten tapfer verheimlichter Bitterkeit eingegraben. Es ist wahr, dass seine berufliche Laufbahn unglücklich verlaufen war, und dass er, der mit seinen bald achtunddreißig Jahren vielleicht der älteste Leutnant der königlichen Marine war, schon sehr lange auf eine Beförderung wartete. In den bald drei Jahren, die er nun in Gambia aushielt, war er nicht müde geworden, auf dem Korrespondenzweg in London Empfehlungen einzuholen und diese umgehend zurück nach London an diese oder jene Stabsstelle zu schicken. Wenn bedeutende Persönlichkeiten die Kolonie besuchten, so bemühte er sich um eine Audienz, verbrachte ganze Tage im Offiziersklub und die Abende bei allen möglichen gesellschaftlichen Anlässen, soweit er zu ihnen Zugang hatte. Dabei bemühte er sich um würdiges Auftreten — im Umgang mit Ranghöheren sowieso, und gegenüber Rangniedrigeren erst recht. Während der Konversation beim Essen zwang er sich, nicht mit den Händen zu fuchteln, sondern alle zehn Fingerspitzen — nicht aber die Handteller — sorgsam auf die Tischplatte zu legen. Unablässig ermahnte er sich, beim Reden nicht die Augen aufzureißen, denn das taten nur Unteroffiziere. Ein richtiger Kommandant betrachtete die Welt und seine Untergebenen gelassen unter halbgeschlossenen Lidern hervor, und er wendete den Kopf nicht ruckartig wie ein Huhn, sondern langsam, ganz langsam. Von gewissen Marotten aber, die bei einem Offizier der britischen Krone als sehr originell erscheinen mussten, konnte er nicht lassen. So war er dafür berüchtigt, bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten seinen Oberkörper zu entblößen, der reich tätowiert war mit Abbildungen von Schlangen, Schmetterlingen und vorchristlichen Bauwerken. Bedauerlicherweise hatte er sich auch eine näselnde Sprechweise angewöhnt, die er für vornehm hielt, und wenn er in Gesellschaft auftrat, prahlte er mit seinen Abenteuern in fernen Ländern, erzählte absonderliche Witze und ließ sich selten davon abhalten, mit schwankender Stimme Seemannslieder vorzutragen. Er war Fachmann auf allen Gebieten und stets gern bereit, auch ausgewiesene Experten an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Er hatte das Mündungsdelta des Yangtse im Alleingang kartographiert, als erster Seemann überhaupt dessen berüchtigte Stromschnellen bezwungen und dabei ein paar chinesische Dschunken ins Schlepptau genommen, die es ohne seine Hilfe nie geschafft hätten. Bei der Gelegenheit hatte er nebenbei fließend Chinesisch gelernt und auch noch allerlei Schlachten gegen chinesische Piraten bestanden. Er hatte in Kanada eine riesige Goldmine gefunden und in Melanesien Menschenfressern die englische Nationalhymne beigebracht, er hatte Roald Amundsen zum Südpol begleitet und war schon öfters zum Nachmittagstee im Buckingham Palace gewesen.
In seinem ganzen Wesen ließ Spicer eine ausgeprägte Wertschätzung der eigenen Person erkennen, verbunden mit regelmäßig wiederkehrenden, quälenden Selbstzweifeln. Er lebte, wenn nicht im Bewusstsein, so doch in der Hoffnung, dass er irgendwann etwas Großartiges vollbringen werde, das ihn zuhanden der Nachwelt auszeichnen würde vor allen übrigen Sterblichen. Wenn ihm im gesellschaftlichen Verkehr bei aller Prahlerei eine gewisse Schüchternheit anhaftete, so deshalb, weil er ahnte, dass nicht die ganze Welt über seine außergewöhnlichen Qualitäten auf dem Laufenden war. Gelegentlich kam es vor, dass die Idee von einem schöneren, saubereren Dasein in ihm nach Worten drängte, aber er fand sie nicht. Diese Hilflosigkeit machte ihn wütend, und diese Wut ließ er dann aus an wehrlosen Kellnern und Dienstboten und empfand böse Freude dabei, gefolgt von bitterer Reue und umso stärkerer Sehnsucht nach der großen, erhabenen Tat.
Aber davon wussten seine Vorgesetzten nichts. Sie sahen nur den tätowierten Prahlhans, und so verliefen Spicers Bemühungen alle im Sande und wurde er bei jeder Beförderungsrunde immer wieder aufs Neue übergangen. Spicer erklärte sich diese anhaltenden Misserfolge mit Willkür und Vetternwirtschaft seiner Vorgesetzten, ließ dabei aber außer acht, dass ihm in seiner bald zwanzigjährigen Marinelaufbahn tatsächlich einige ziemlich schlimme Missgeschicke unterlaufen waren. Während der Kanalmanöver 1905 beispielsweise hatte er die Idee zur Ausführung gebracht, zwischen zwei Zerstörern ein Stahlseil zu spannen und so nach U-Booten zu fischen, worauf sich tatsächlich ein Periskop im Seil verfing und das dazugehörende U‑Boot — ein britisches, kein feindliches — beinahe gesunken wäre. Ein anderes Mal wollte er während eines Manövers die Wehrhaftigkeit der Verteidigungsanlagen im Hafen von Portsmouth testen und lief mit seinem Schiff am Strand auf. Dafür musste er sich ein erstes Mal vor dem Militärgericht verantworten; ein zweites Mal wurde er gemaßregelt, als er mit seinem Zerstörer ein Landungsboot rammte und mehrere Matrosen ums Leben kamen. Es glich deshalb eher einer Verbannung als einer Beförderung, als er 1911 mit dem Titel eines Director of Hydrographic Survey nach Gambia geschickt wurde. Dies umso mehr, als von Anfang an klar war, dass seine kartographischen Messungen niemals von wirtschaftlichem oder militärischem Nutzen sein würden; der Gambia-Fluss führte vom Atlantischen Ozean durch die Mangrovensümpfe direkt in die unwirtlichen Wüsten des Sahel, in die sich kaum je ein Europäer verirrte. Auf dem Fluss verkehrten außer den Eingeborenen lediglich ein paar Kautschukdampfer, und auch die blieben seit der Kautschuk-Krise aus. Spicer ertrug die Sinnlosigkeit seiner Arbeit mit soldatischer Disziplin, tuckerte jeweils zwanzig oder dreißig Tage über den Fluss und ruhte sich dann eine Woche lang in Bathurst im Bungalow seiner Frau aus, immer in der Hoffnung, dass irgendwann die dienstliche Abberufung nach London eintreffen möge.
2 Bitterer Honig
Als Anton Rüter in Daressalam eintraf, machte ihm von allen Naturerscheinungen Deutsch-Ostafrikas nur eine einzige wirklich Eindruck: Das war die Frau des Gouverneurs. Er versuchte seine Enttäuschung zu verbergen, aber es ließ sich nicht leugnen: Bisher war die Reise unspektakulär, um nicht zu sagen langweilig verlaufen. Die Eisenbahnfahrt von Papenburg nach Marseille in überheizten Zügen mit beschlagenen Fenstern war eine Qual gewesen, ebenso die Durchquerung des winterlich trüben Mittelmeers mit dem Reichspostdampfer Feldmarschall, in dessen Laderaum sich die ersten neunhundertachtzig Seekisten mit Bauteilen der Götzen stapelten. Es waren nur wenige Passagiere an Bord, und weil es ohne Unterlass regnete und das Schiff heftig stampfte und schlingerte, verkrochen sich alle in ihre Kabinen. In Port Said legte die Feldmarschall einen Kohlestopp ein, und mitten im Suezkanal wich von einer Stunde auf die andere die winterliche Kälte tropischer Hitze. Im Roten Meer leisteten Delphine dem Schiff Gesellschaft und sorgten mit ihren Kapriolen für Unterhaltung, und gelegentlich ahnte man den schwarzen Schatten einer Meeresschildkröte, die pfeilschnell vor den Schiffsmotoren floh. Hin und wieder setzte der Regen aus. Dann lagen die Papenburger auf dem Sonnendeck in ihren Liegestühlen und betrachteten das ölige, träge Meer und die gleichförmige Düsternis der afrikanischen Küste.
Als das Schiff am 10. Januar 1914 die Gewürzinsel Sansibar hinter sich ließ und endlich westwärts Kurs auf das Festland nahm, vorbei an Bagamoyo, der alten arabischen Hafenstadt, dem Ziel zahlloser Sklaven- und Elfenbeinkarawanen aus den tiefsten Tiefen Afrikas, auf deren Marktplatz sich in früheren Zeiten Massai-, Suaheli- und Bantukönige mit arabischen Kaufleuten aus Dschidda, Schiffbauern aus Kuwait, Stoff- und Gewürzhändlern aus Bombay und Piraten aus Schanghai getroffen hatten — als die Feldmarschall also fünfhundert Seemeilen südlich des Äquators glücklich die Lücke im Riff fand und in die Bucht von Daressalam einfuhr — da war auch das eine Enttäuschung. Was Anton Rüter sah, war ein schmaler Streifen nassen Sandstrandes, der sich in weitem Bogen um die Bucht erstreckte, gesäumt von einer langen Reihe grauer Kokospalmenstämme, hinter denen eine Handvoll Kolonialbauten hervorlugten — aber dazwischen ästen keine Drachen, dahinter standen keine feuerspuckenden Vulkane, und am Himmel stand nicht plötzlich eine zweite Sonne, die die Schwerkraft der Erde aufgehoben hätte. Am Ankerplatz lagen keine chinesischen Dschunken und keine arabischen Dhaus, sondern der britische Handelsschoner Sheffield neben dem deutschen Kreuzer Königsberg, leuchtend weiss-gelb und nass, die Geschütztürme sorgfältig verpackt zum Schutz vor dem ewigen Regen. Man konnte die Baracken der Zollanlagen mit ihren rostigen Wellblechdächern sehen, auf die ohrenbetäubend der Regen trommelte, und die Gehwege waren schlammig schwarz von der vielen Kohle, die unterwegs zu den Kohlebunkern Tag für Tag verloren ging.
Als die Feldmarschall an der Landungsbrücke anlegte und die Matrosen die Festmacherleinen warfen, stand Anton Rüter an der Reling, verfolgte das Geschehen und wunderte sich, wie vertraut ihm alles war. Neu und ungewohnt war nur die brüllende Hitze und die atemberaubende Luftfeuchtigkeit, und dass alles, was er anfasste, heiß war: Die Reling war heiß. Wenn er einen Schritt zurücktrat und sich an die stählerne Schiffswand lehnte, war auch die heiß. In seiner Kabine war erst recht alles heiß. Die Zahnpaste war heiß. Das Wasser des Kaltwasserhahns war heiß. Auch die Bettlaken und das Kopfkissen waren heiß und ewig feucht von seinem Schweiß. Die Atemluft war heiß. Das Meerwasser, mit dem die Schiffsjungen das Deck schrubbten, war heiß. Sogar der Regen war heiß. Rüter ahnte, dass es für ihn eine ganze Weile nichts Kühles auf der Welt mehr geben würde; bald würde er die Erfahrung machen, dass in den Tropen noch nicht mal die Toten erkalten konnten, bevor ihnen das Fleisch von den Knochen fiel. Neu und ungewohnt war weiter, dass ihm rund um die Uhr der Schweiß in wahren Bächen von der Stirn in die Augen, über die Wangen in die Mundwinkel, übers Kinn und auf die Brust rann, sich in der Bauchfalte sammelte und über die Schenkel bis hinunter in die Schuhe troff, und dass jeder kleine Deckspaziergang ihn an den Rand der Erschöpfung brachte, und dass ihm schon das Ausbreiten und Zusammenfalten seiner Baupläne eine körperliche Anstrengung war. Aber exotischen Zauber hatte das keinen. Das war nicht romantisch, sondern nur unangenehm.
Die Hafenarbeiter legten die Trossen um die Poller, richteten das Fallreep und nahmen erste Gepäckstücke entgegen. Plötzlich brüllte jemand einen militärischen Befehl, dann gab es Stiefelgetrappel und klackende Koppel und noch einen Befehl, und dann präsentierten beidseits der Landungsbrücke zwölf Askari, also Negersoldaten, und zwei weiße Unteroffiziere im strömenden Regen ihre Gewehre. Sie waren triefend nass und trugen sandfarbene Uniformen mit blauen Wadenbändern und rote Mützen mit weißen, aufgenähten Reichsadlern. Rüter war fasziniert. Die einzigen Neger, die er bis dahin zu Gesicht bekommen hatte, waren jene auf den Kakaodosen und auf der Sammelbüchse der katholischen Afrikamission gewesen. Einmal hätte er beinahe welche aus Fleisch und Blut gesehen, auf der Landesausstellung in Oldenburg im Sommer 1905, bei der Somalikrieger mit Tanz und Gesang aufgetreten waren; aber dann war der Alterspräsident des Papenburger Arbeiterturnvereins in den japanischen Weiher mit den Koi-Fischen gefallen und die halbe Jugendriege hatte verdorbenes Erdbeereis erbrochen, weshalb man auf die Somalikrieger verzichtet und vorzeitig die Heimreise angetreten hatte.
Es vergingen fünf Minuten, in denen der Arzt, die Hafenbeamten und die Hotelboten zur Feldmarschall heraufeilten; und als Anton Rüter seine Aufmerksamkeit wieder den Schwarzen auf der Landungsbrücke zuwandte, stellte er fest, dass diese gar nicht schwarz waren, sondern vielmehr braun, und zwar noch nicht mal sonderlich dunkelbraun, und dass ihr Anblick, hatte man sich erst an die Hautfarbe gewöhnt, nichts Exotisches mehr hatte, sondern ein ganz alltäglicher war. Denn die Hafenarbeiter nahmen keine wunderlich fremdländischen Verrichtungen vor, sondern hantierten mit den Tampen und schleppten Kisten und Säcke, wie das Hafenarbeiter in jedem Hafen überall auf der Welt nun mal tun. Und die Soldaten trommelten sich nicht mit den Fäusten auf die Brust, rollten nicht mit den Augen und streckten keine tätowierten Zungen heraus, sondern standen brav im Regen stramm, machten nach Soldatenart unwirsche Gesichter und wurden scharf beobachtet von ihren zwei rotgesichtigen Korporalen, die wahrscheinlich Hochstetter oder Wörns oder Finkelhuber hießen.