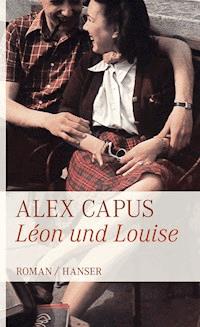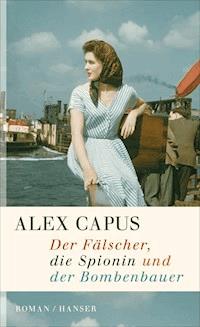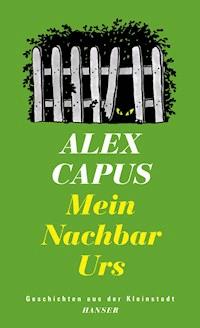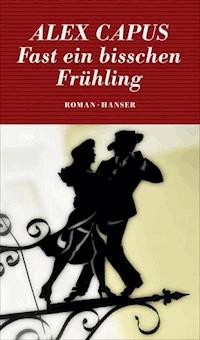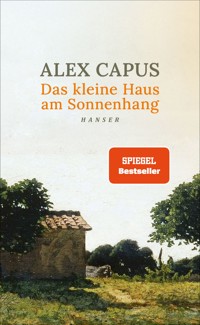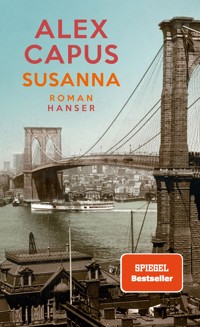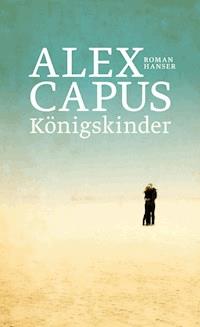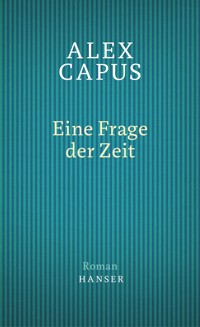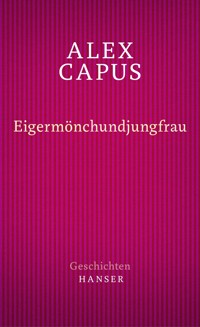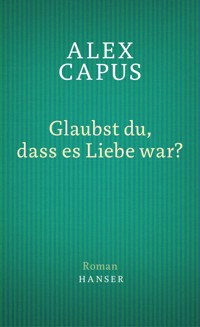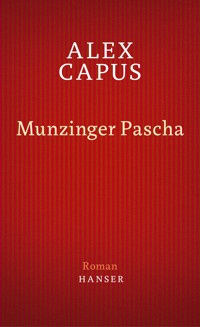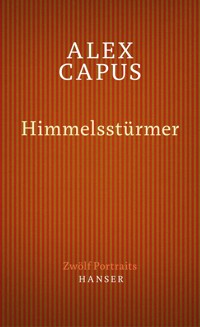
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Himmelsstürmer: kleine Leute, die auszogen, um in der großen Welt ihr Glück zu suchen. Das Berner Dienstmädchen Marie Grosholtz erlangte als Madame Tussaud Weltruhm. Der Neuenburger Jean-Paul Marat zettelte mit Danton und Robespierre die Französische Revolution an. Der Aarauer Uhrmachersohn Ferdinand Hassler vergrößerte die USA auf Kosten Kanadas. Ein Berner namens Pauli baute das erste lenkbare Luftschiff der Welt. Alex Capus erzählt von Menschen, die an ihre Fähigkeiten glaubten – und, trotz Niederlagen, ihren Träumen unbeirrbar folgten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Capus’ Helden sind uneheliche Kinder gefallener Dienstmädchen, leiden an bösen Stiefmüttern, fixen Ideen und körperlichen Gebrechen, sie müssen Hungersnöte, Kriege und Revolutionen überstehen. Trotzdem — oder gerade deshalb — ziehen sie aus, die Welt zu erobern. Das Berner Dienstmädchen Marie Grosholtz erlangt als Madame Tussaud Weltruhm. Der Neuenburger Jean-Paul Marat zettelt mit Danton und Robespierre die Französische Revolution an. Der Aarauer Uhrmachersohn Ferdinand Hassler vergrößert die USA auf Kosten Kanadas.
Wie immer erzählt Alex Capus spannend und amüsant von Menschen, die zäh, geschickt und unbeirrbar zuversichtlich an ihre Fähigkeiten und Träume glauben, die Zeitläufe nutzen und sich durch Niederlagen und Fehlschläge nicht entmutigen lassen.
Alex Capus
Himmelsstürmer
Zwölf Portraits
Carl Hanser Verlag
Vorwort
Ich will nicht behaupten, dass Christoph Kolumbus Schweizer gewesen sei — aber ziemlich sicher bin ich schon. Denn zur gleichen Zeit, da dessen Stammvater aus dem Nichts in Genua auftauchte, hatten am Genfer See die Ritter von Colombey ihre Besitztümer verkauft und waren mit unbekanntem Ziel verschwunden, verdrängt vom ungleich mächtigeren Herzog von Savoyen — und wenig später ließ sich vor den Toren Genuas ein gewisser Giacomo Colombo nieder. Daraus zu schließen, dass es ausgerechnet ein Schweizer gewesen sei, der Amerika entdeckte, ist ein wenig kühn und auf den ersten Blick nicht sonderlich bedeutsam. Hauptsache, Kolumbus hat Amerika entdeckt und uns Zugang zur Tomate, zur Glühbirne und zum Geist der Unabhängigkeitserklärung verschafft. Aber wenn jemand es unternähme, die DNA des Entdeckers, dessen Nachfahren im Dunstkreis der reichen Herzogin von Alba in Madrid leben, mit dem Erbgut der Einwohner Colombeys am Genfer See zu vergleichen, würde ich den Resultaten mit größtem Interesse entgegensehen.
Die Ritter von Colombey lebten vom transalpinen Handel: Seide und Gewürze aus Genua wurden in die Städte des Nordens gebracht, in entgegengesetzter Richtung transportierte man Wolle, Käse, Leder und Eisenwaren. Das Städtchen Olten, in dem ich lebe, liegt an jenem Handelsweg, und die Terrasse des Restaurants «Stadtbad» bietet einen schönen Ausblick auf die Aare, über die viele Jahrhunderte lang die Kähne der Kaufleute hinunter zum Rhein und weiter nach Köln und Amsterdam fuhren. Mag also sein, dass Kolumbus’ Ahnen hier in Olten Station gemacht haben und sich im städtischen Bad — also im «Stadtbad», der ältesten Gaststube der Stadt — den Reisestaub vom Leib wuschen.
Wenn diese Terrasse ein Gefährt für Zeitreisen wäre, könnte ich hier allerhand schöne Beobachtungen machen. Ich könnte Bertolt Brecht über den Aareweg gehen sehen, der im Hotel Bornhof eine Nacht verbrachte und über Olten schrieb: «Ein trostloser Ort.» Im Herbst 1916 würde ich Lenin sehen, der im Hotel Aarhof die zwei russischen Zahnarztgehilfen des Doktor Siegrist traf, die laut Einwohnerregister gleich neben meinem Haus an der Elsastraße 11 wohnten, vielleicht auch Rosa Luxemburg, die vor der Lastwagenfabrik Berna die Arbeiter aufgestachelt haben soll, und am 20. Juni 1878 Friedrich Nietzsche, der auf der Oltner Froburg das Alpenpanorama betrachtete und sich hernach ins Gästebuch eintrug. Ich sähe die Auswandererkähne auf ihrem Weg nach Le Havre und Amsterdam, dann ein Berner Dienstmädchen namens Marie Grosholtz unterwegs nach London, das als Madame Tussaud weltberühmt werden sollte, oder den zehnjährigen Mozart, der hier im Frühjahr 1766 ein kleines Stück flussaufwärts vorbeikam, und das amerikanische Kampfflugzeug, das im Wald zerschellte, und das Luftschiff Eduard Spelterinis, das hinter dem Engelberg verschwand. Ich sähe napoleonische Soldaten und römische Legionäre, Kreuzritter und Kelten, Langobarden und die weiß bemalten UN-Panzer, die nachts auf Tiefladern der Deutschen Bahn nach Jugoslawien transportiert wurden.
Ich sitze gern hier und schaue hinunter auf den Fluss, und ich liebe mein Städtchen sehr. Aber ich bilde mir nicht ein, dass es sich in irgendeiner Weise auszeichne vor den anderen fünftausend großen und kleinen Städten Europas. Fast jede Stadt liegt an einem Fluss, über den einst Wikinger, Träumer und Himmelsstürmer zogen, und überall hat es uneheliche Kinder gefallener Dienstmädchen gegeben, die an bösen Stiefmüttern, fixen Ideen und körperlichen Gebrechen litten, und zahllos sind die bettelarmen Burschen und Mädchen, die während Hungersnöten, Kriegen und Seuchen ausgezogen sind, die Welt zu erobern. Vielleicht war Kolumbus ja gar nicht Schweizer, sondern Korse, Ostfriese oder Bosnier, das will ich gar nicht ausschließen — jedenfalls nicht, bis die DNA-Analysen vom Genfer See vorliegen.
Wenn ich das Treiben auf meinem Fluss betrachte, kommt es mir vor, als ob hier jeder, den es je gegeben hat, irgendwann vorbeigekommen sei und jeder mit jedem bekannt war oder zumindest jeder einen kannte, der einen kannte, der mit dem anderen zu tun hatte; kommt hinzu, dass wir alle die Enkel unserer Ahnen und die Großeltern unserer Nachfahren sind. Jedenfalls glaube ich fest daran, dass alle Menschen Brüder sind — das ergibt sich allein schon aus der gentechnisch belegten Tatsache, dass sechzehn Millionen heute lebende Männer direkte Nachfahren Dschingis Khans sind, oder dem unleugbaren Umstand, dass meine Tante Nayid — also die Ehefrau des zweitältesten Bruders meines Vaters — eine Urgroßnichte des vorvorlezten Schahs von Persien war; oder aus dem historisch nachweisbaren Faktum, dass ich selbst einmal im Vortrieb des neuen Lötschberg-Eisenbahntunnels mit Prinz Charles ein Schwätzchen gehalten habe. (Er sagte: «It is rather noisy, isn’t it?» Und ich antwortete: «It is indeed, Your Royal Highness.») Wir sind alle Brüder und Schwestern, und alles hängt mit allem zusammen, und deshalb ist alles von Bedeutung — die kleinste unserer Taten, die geringste unserer Unterlassungen. Daran glaube ich, und das ist mir ein steter Trost und ein großes Vergnügen.
Olten, auf der Sonnenterrasse des «Stadtbad», im Februar 2008
1 Madame Tussaud
Um 1765 konnte man, falls uns niemand angelogen hat, in den Gassen der alten und mächtigen Stadt Bern ein vierjähriges Mädchen namens Marie sehen, das Wäsche zur Aare trug, Brot beim Bäcker besorgte und Brennholz die Treppe hochschleppte. Sie unterschied sich in nichts von den anderen Kindern, die zu Hunderten durch die Kramgasse, die Gerechtigkeitsgasse und die Judengasse wuselten und von denen die meisten bald an Cholera, Tuberkulose, Diphtherie oder schlechter Ernährung sterben würden. Marie aber überstand ihre Kindheit dank Glück, robuster Gesundheit und zärtlicher Fürsorge und lebte ein märchenhaft langes Leben. Sie zog in die Welt hinaus und ging in den prächtigsten Schlössern der Welt ein und aus, schmachtete im finstersten Verlies und entkam, nachdem ihr der Henker schon den Kopf geschoren hatte, nur knapp der Guillotine. Und als sie schließlich hochbetagt starb, war sie weltberühmt als die geschäftstüchtigste Künstlerin aller Zeiten.
Dabei hatte alles ganz schlecht angefangen. Ihre Mutter hieß Anna Walder, war Dienstmädchen in Straßburg und erst siebzehn Jahre alt, als sie ungewollt schwanger wurde, angeblich von einem achtundzwanzig Jahre älteren Frankfurter Söldner namens Joseph Grosholtz, der aber kurz vor der Geburt des Kindes seinen Kriegsverletzungen erlegen sein soll. Jedenfalls war die Mutter allein, als die Wehen einsetzten. Und als die kleine Marie am 7. Dezember 1761 in der Kirche zu Sankt Peter getauft wurde, waren laut Taufregister weder die Mutter noch der Vater anwesend, sondern nur ihre Hebamme und der Kirchendiener, der gleichzeitig als Taufpate fungierte. Derart in Armut alleingelassen, mussten das Kind und seine Mutter, die selbst noch ein Kind war, unausweichlich in der Gosse landen, aus dem Haus gejagt von ihrem Brotherrn und verstoßen von den Familienangehörigen, die sie irgendwo haben mochte, worauf beide ziemlich bald gestorben wären, ohne der Nachwelt die geringste Spur zu hinterlassen.
Diesmal aber nahmen die Dinge nicht den üblichen Gang, denn es trat ein rettender Engel auf. Philipp Curtius war vierundzwanzig Jahre alt und adlig, stammte aus Stockach am Bodensee und praktizierte als Arzt. Irgendwo, irgendwann muss er Anna Walder begegnet sein, vielleicht kurz nach Maries Geburt, möglicherweise aber auch mehr als neun Monate zuvor. In späteren Jahren behaupteten manche, eigentlich sei Curtius Maries leiblicher Vater gewesen und nicht Grosholtz — denn Letzterer sei im März 1761, also in den Tagen, da Marie aller Wahrscheinlichkeit nach gezeugt wurde, gar nicht in Straßburg gewesen, sondern mit General Würmser auf den Schlachtfeldern des Siebenjährigen Krieges. Nun ist zwar auf den Soldlisten des Generals kein Soldat namens Grosholtz zu finden, und auch Curtius’ Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Empfängnis ist unbekannt, aber es spricht doch einiges dafür, dass damals der junge Doktor und nicht der alte Soldat an Annas Seite war. Siebzig Jahre später jedenfalls schrieb Marie in ihren Memoiren, dass Curtius zur Stelle gewesen sei, als ihre Mutter in Not war, und sie beide nach Bern führte und in einem Haus unterbrachte, in dem er seine Arztpraxis eröffnete.
Das kann tatsächlich so gewesen sein.
Sonderbar ist nur, dass in den Annalen der Stadt Bern die Namen Curtius und Grosholtz nie registriert wurden, weder im Hintersässenregister noch in der Volkszählung von 1764. Entweder also hat sich die junge Familie heimlich und ohne Wissen der Obrigkeit in Bern niedergelassen — was schwierig, aber nicht unmöglich gewesen wäre —, oder Marie hat im hohen Alter ihre Berner Kindheit einfach erfunden, um ihrer Vita eine schweizerisch-neutrale Herkunft zu geben. Unbestreitbar wahr ist aber, dass Curtius ihr zeitlebens in väterlicher Zärtlichkeit zugetan blieb, treu bei Anna Walder blieb und nie eine andere Frau heiratete. Tief blicken lässt schließlich auch, dass er, als es ans Sterben ging, das Mädchen zu seiner Alleinerbin bestimmte.
Mag also sein oder nicht sein, dass Marie aufgewachsen ist in der Zähringerstadt, die über die Jahrhunderte reich geworden war dank der Steuern, welche die Obrigkeit bei den Bauern erhob, und dank dem Sold junger Männer, die man in fremde Kriegsdienste geschickt hatte. Immer höher und mächtiger erhoben sich auf der Halbinsel an der Aare die grauen Sandsteinpaläste der Patrizier, immer prächtiger wurden ihre Sommerresidenzen, die sie außerhalb der Stadtmauern errichten ließen. Die Männer der herrschenden Familien trugen weiß gepuderte Perücken und die Frauen weit ausladende Reifröcke; sie prunkten mit silbernen Tabatièren, zarten Seidenschirmchen und kostbaren Möbeln, die sie in Paris bei den Hoflieferanten des Sonnenkönigs bestellt hatten. Und wer etwas auf sich hielt, sprach nicht Berndeutsch wie die Bauern, sondern Französisch.
Je höher die von Wattenwyls, Tscharners, Graffenrieds, Steigers und von Steigers sich über das Volk erhoben, desto eifersüchtiger wachten sie über ihre Privilegien. Die Stadt, deren Tore im Mittelalter stets offen gestanden hatten, verschloss sich mehr und mehr allem Fremden gegenüber. Ihre Bürger regierten nicht mehr in republikanischer Freiheit, sondern beugten sich der Diktatur des Geldadels in einem Klima von Angst und Unterdrückung. Begehrten draußen in den Dörfern die Bauern gegen zu hohe Steuern auf, wurden ihre Anführer gevierteilt und deren Körperteile zur Warnung weit übers Land verteilt an die Scheunentore genagelt; wenn in der Stadt ein Bürger ungehörige Gedanken aussprach oder auch nur gotteslästerlich fluchte, wurde er zu Galeerenhaft in venezianischen Diensten verurteilt. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der als junger Mann in Bern Hauslehrer bei der vornehmen Familie Karl Friedrich Steigers war, schrieb entsetzt nach Preußen, «dass in keinem der Länder, die ich kenne, nach Verhältnis der Größe so viel gehängt, gerädert, geköpft, verbrannt wird als in diesem Kanton.»
Man kann sich vorstellen, dass in dieser selbstgefälligen und fremdenfeindlichen Stadt dem jungen, ortsfremden Doktor Curtius, falls er tatsächlich hier war, die Patienten nicht gerade in hellen Scharen zuströmten. Also beschäftigte er sich damit, zu Studienzwecken Modelle menschlicher Organe in Wachs anzufertigen. Bald modellierte und verkaufte er auch Miniaturen ganzer menschlicher Körper beiderlei Geschlechts, und schließlich ging er aus kommerziellen Gründen dazu über, die Figuren in erotische Beziehung zueinander zu setzen, wofür besonders die Herren eines gewissen Alters und eines gewissen Standes lebhaftes Interesse zeigten. Im Herbst 1765 muss es gewesen sein, dass Curtius Besuch erhielt von Prinz Louis-François de Bourbon-Conti, einem Cousin Ludwigs XV. Ob sich der Bourbone für die naturgetreuen Nachbildungen von Lungen und Lebern interessierte oder eher für die pikanteren Exponate, ist unbekannt. Jedenfalls war er von Curtius’ Kunstfertigkeit derart beeindruckt, dass er ihn einlud, seine Wachsfiguren auch in Paris zu zeigen, und ihm eine monatliche Pension sowie eine elegante Wohnung an der vornehmen Rue Saint-Honoré anbot. Dieser nahm an und zog in die Lichterstadt — vorerst ohne die kleine Marie und ihre Mutter.
Philipp Curtius kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Paris war in jenen Tagen die aufregendste Stadt der Welt. Noch herrschten die Bourbonenkönige in obszöner Pracht- und Machtentfaltung, aber unter der Oberfläche absolutistischer Herrschaft gärte die Freiheit. Rousseau schrieb «Du contrat social», Voltaire dachte über die beste aller Welten nach. Diderot hielt die Flamme der Aufklärung hoch, de Sade und Casanova zertrümmerten die Dogmen von Sitte und Moral. Und nach und nach tauchten jene auf, die wenige Jahre später das marode Ancien Régime zum Einsturz bringen sollten: Mirabeau, Lafayette, Robespierre, Danton, Marat, Benjamin Franklin.
Bei seiner Ankunft aber musste Curtius feststellen, dass es in Paris schon über hundert Wachsfigurenkabinette gab und er sich anstrengen musste, wenn er gegen die Konkurrenz bestehen wollte. Erst konzentrierte er sich auf die Produktion erotischer Miniaturen, die reißenden Absatz fanden und sich rasch in den Boudoirs und Salons der guten Gesellschaft verbreiteten; bald aber ging er dazu über, die Berühmtheiten des Tages in Wachs zu verewigen. Allmählich wurde Curtius nun seinerseits berühmt für seine Wachsfiguren, die so lebensecht aussahen, als würden sie im nächsten Augenblick husten, auflachen, davonrennen oder nach dem Kutscher rufen. Wer immer gerade Stadtgespräch war, wurde in Curtius’ Salon de Cire in Wachs gegossen: Madame du Barry, die Kurtisane des Königs, der Räuber Cartouche, der Würger Lesobre oder der Postillonmörder Lefèvre, dann natürlich die königliche Familie, erst Ludwig XV., dann Ludwig XVI., Marie Antoinette und ihre Kinder.
Nach zwei Jahren hatte sich Curtius soweit etabliert, dass er Marie und ihre Mutter nachkommen lassen konnte. Was für einen Eindruck die Rue Saint-Honoré auf die sechsjährige Marie gemacht haben mag, kann man nur ahnen. Tag und Nacht wimmelte es hier von grell geschminktem, vergnügungssüchtigem Volk, es gab Puppen- und Schattentheater, blutige Tierkämpfe mit Stieren, Wölfen und Hunden, Schwertschlucker und seiltanzende Affen, dann auch Handaufleger, Wahrsager, Magnetisten und Mesmeristen sowie Lustknaben und Huren jeder Couleur. Das Straßenpflaster war knietief bedeckt mit Pferdedung und menschlichen Exkrementen; zu Fuß ging hier nur, wer sich keine Kutsche leisten konnte. Die Pferdekutschen der Grandseigneurs preschten im Galopp durch die engen Gassen, und wenn gewöhnliches Volk unter die Hufe geriet, was Tag für Tag geschah, ließen die Herren nicht einmal anhalten — es sei denn, um nachzusehen, ob ein Pferd sich verletzt habe.
In die Rue Saint-Honoré kamen die wohlhabenden Bürger von Paris, um ihr Geld zu verjubeln, und die Adligen, weil es ihnen am Hof von Versailles zu steif und zu förmlich zuging. Dass Marie in dieser eitlen Welt, in der nur Schönheit, Herkunft und Etikette etwas galt, gesellschaftliche Erfolge feierte, kann man sich schwer vorstellen. Als Tochter eines Dienstmädchens gehörte sie zur Kaste der Unberührbaren. Erschwerend kam hinzu, dass ihrem Französisch zeitlebens ein starker alemannischer Akzent anhaftete, was in Paris seit jeher als unverzeihlicher Fauxpas galt. Und dann war sie auch noch ein hageres, hoch aufgeschossenes und flachbrüstiges Mädchen mit einem vorsichtig abwartenden Temperament und einer Hakennase, in das sich niemand auf den ersten Blick verliebt hätte.
Also streunte Marie nicht auf der Straße herum, sondern beobachtete scharf die Menschen, die sie sah, und machte sich im Kabinett ihres Beschützers nützlich. Schon als kleines Mädchen lernte sie zeichnen und modellieren, Wachs gießen und kolorieren, und an den fertigen Figuren pflanzte sie mit unendlicher Geduld und sicherer Hand Haar um Haar in das Wachs, jede einzelne Wimper, jedes Barthaar, die Brauen. Nach einiger Zeit fertigte sie ihre ersten Wachsfiguren allein an, und mit sechzehn Jahren war sie Curtius handwerklich ebenbürtig und dessen gleichberechtigte Geschäftspartnerin. Erstaunlich rasch entwickelte sie einen sicheren Instinkt für die Sensationslust des Publikums, und bald entschied sie gemeinsam mit ihrem Lehrmeister, den sie übrigens «Onkel» nannte, welche Tagesprominenz man in Wachs verewigen musste, um möglichst viele Schaulustige in ihren Salon zu locken.
Ein verlässlicher Publikumsmagnet war die königliche Familie: Ludwig XVI. und Marie Antoinette beim Frühstück, Prinzessin Elisabeth beim Flachsspinnen, Kronprinz Louis Joseph im Jagdkostüm. Und da über die Jahre Doktor Curtius’ Kabinett berühmt geworden war bis hinaus nach Versailles, konnte es nicht ausbleiben, dass auch die Bourbonen die Ausstellung besuchten und dort gleichsam sich selbst gegenüberstanden. Will man Maries Memoiren Glauben schenken, war besonders Prinzessin Elisabeth, die jüngste Schwester des Königs, ein schwermütiges, dickes und zutiefst religiöses Mädchen von vierzehn Jahren, sehr beeindruckt von ihrem wächsernen Konterfei. Will man ihr weiter glauben, so lud die Prinzessin Marie nach Versailles ein, damit sie ihr Unterricht in der Kunst des Wachsmodellierens erteilte. Und will man ihren Erinnerungen wirklich blindlings folgen, so nahm Marie die Einladung im Herbst 1780 nicht nur an, sondern wurde auch gleich zur besten Freundin der Prinzessin, bezog im Nordflügel des größten Schlosses der Welt ein Zimmer neben Elisabeths Schlafgemach und wohnte dort acht Jahre lang, um die königliche Familie im Umgang mit Wachs zu unterrichten und in der übrigen Zeit intimen Umgang mit den Bourbonen zu pflegen.
Man kann das glauben, wenn man will, aber man muss nicht. Das Parkett von Versailles war ein Ort strengster Benimmregeln, auf dem der geringste Verstoß mit sofortiger Ächtung bestraft wurde. Wer damit nicht vertraut war, musste allein schon das Gehen neu lernen: immer schön gleiten, niemals die Füße heben. Weitaus komplexer und schwieriger zu beachten aber waren die Vorschriften betreffend Begrüßungszeremonien, Konversation, Nahrungsmittelaufnahme sowie Kleidung, Frisur und Schminke. Dass sich in dieser Welt ein ungebildetes Berner Dienstmädchen, das zwar gut zeichnen, modellieren und rechnen, aber nur fehlerhaft lesen und schreiben konnte, auch nur eine Stunde ohne Skandal hätte halten können, erscheint kaum vorstellbar. Und selbst wenn die Prinzessin sich Marie zu ihrer privaten Unterhaltung als bäurisches Maskottchen gehalten hätte, so hätte ihr Name auf der Salärliste der fünfundzwanzigtausend Lakaien, die in Versailles in Lohn und Brot standen, aufgeführt sein müssen. Der «Almanach de Versailles» aber, der auf zweihundert Seiten sämtliche Boten und Speichellecker bis hin zum königlichen Hinternwischer mit Namen, Vornamen und Funktion auflistet, erwähnt zwischen 1780 und 1788 Marie Grosholtz kein einziges Mal.
Das will nicht heißen, dass sie Versailles nicht von innen gekannt hat. Gut möglich, dass sie Prinzessin Elisabeth ein paar Tage in der Wachsgießerei unterrichtete und dass die beiden beispielsweise Duplikate von Reliquien herstellten; denn die Prinzessin hing dem Glauben an, dass die Gebeine von Heiligen auch dann Wunder wirken, wenn sie nur als wächserne Kopien vorliegen. Undenkbar ist aber, dass die Bourbonin mit dem Berner Dienstmädchen Hand in Hand über Blumenwiesen spazierte, wie Marie in ihren Memoiren behauptet, und die beiden ganze Wochen in Elisabeths privatem Lustschlösschen in Montreuil verbrachten, um einander die intimsten Geheimnisse anzuvertrauen. Das ist nicht möglich, das hätte am Hof niemand zugelassen. Die Lakaien nicht, und der König schon gar nicht.
Sehr wahrscheinlich ist aber, dass Marie Grosholtz und Philipp Curtius alle paar Wochen die zweistündige Kutschenfahrt hinaus nach Versailles unternahmen, um Anschauungsmaterial für ihre Wachsfiguren zu gewinnen. Denn das Schloss war nicht nur dem Hochadel zugänglich, sondern auch dem gemeinen Volk, das an gewissen Tagen bis in die Speisesäle vorgelassen wurde. In hellen Scharen rannten Kleinbürger, Kutscher und Wäscherinnen über die Treppen, um dabei zu sein beim «Grand Couvert», dem zeremoniellen Diner der königlichen Familie, und sich alles ganz genau anzuschauen: das Besteck aus massivem Gold, das chinesische Porzellan, die hundert Schweizer Gardisten mit ihren roten Hosen und weißen Hutfedern, die im Karree den Tisch umstanden. In ihren Memoiren beschreibt Marie das alles sehr eindringlich und detailgetreu — aber eines wird bei ihren Beschreibungen doch klar: dass ihre Perspektive nicht die eines Familienmitglieds bei Tisch war, sondern die einer Schaulustigen, die zwischen den Hellebarden der Schweizer Gardisten hindurchlugte.
Ende 1788 machten Marie Grosholtz und Philipp Curtius nach dreizehn sehr erfolgreichen Geschäftsjahren eine neue Erfahrung: Sie mussten erstmals die Eintrittspreise senken, damit weiterhin Besucher in die Ausstellung kamen. Die Leute hatten kein Geld mehr. Der Sommer 1788 war heiß und außergewöhnlich trocken gewesen, und kurz vor der Ernte hatte ein ungeheurer Hagelschlag das wenige, das noch auf den Feldern stand, vernichtet, weshalb im Herbst die Preise für Getreide und Brot in nie gekannte Höhen schossen. Die Menschen gerieten in Not, Hunger machte sich breit, und nur noch wenige konnten es sich leisten, Geld in der Rue Saint-Honoré zu verjubeln. Dann folgte ein bitterkalter Winter. Monatelang lag das Land unter Schnee und Eis, das Brennholz wurde knapp. In Versailles war die Kälte einfach nur lästig, weil der Hammelbraten auf dem Weg aus der Küche zur königlichen Tafel lau wurde. In Paris aber verhungerten und erfroren die Menschen. Getreidetransporte mussten von militärischen Konvois begleitet werden, Bäckereien erhielten Polizeischutz. Um die schlimmste Not zu lindern, wollte Finanzminister Necker die Brotsteuer abschaffen. Aber der König, der alles verfügbare Geld für Versailles brauchte, legte sein Veto ein. Das Volk murrte, Rebellion lag in der Luft.
Am Sonntag, dem 12. Juli 1789, konnte Marie Grosholtz die Revolution hören, wie sie trampelnd, krakeelend und singend die Rue du Temple heraufkam, laut und immer lauter wurde und schließlich vor dem Salon de Cire haltmachte. Drei- oder fünftausend Menschen standen vor der Tür, und sie verlangten die Wachsbüste von Finanzminister Jacques Necker. Curtius öffnete die Tür und war schlau genug, ihnen die Büste ihres Helden auszuliefern, und obendrein gab er ihnen das Abbild des Duc d’Orléans mit, der im Volk ebenfalls beliebt war. Die Demonstranten schmückten die Wachsköpfe mit schwarzem Krepp und zogen weiter, den Tuilerien entgegen, wo es zu einer Straßenschlacht mit königlichen Soldaten kam. Zwei Tage später stürmten die Aufständischen die Bastille und eroberten die Schwarzpulvervorräte der Schweizer Garde — und damit hatten sie Paris erobert. Curtius notierte stolz: «Ich kann also sagen, dass sich der erste Akt der Revolution chez moi ereignet hat.»
Da der Wind nun gedreht hatte, musste auch der Salon de Cire sich neu orientieren. Marie ging jetzt wohl nicht mehr so oft hinaus nach Versailles, sondern suchte ihre Modelle unter den prominenten Republikanern der Hauptstadt. Und in der Ausstellung wurden sämtliche Exponate, die an das Königshaus erinnerten, eilig durch revolutionäre Souvenirs ersetzt. Mirabeau nahm den Platz von Louis XVI. ein, ein Modell der Bastille ersetzte jenes von Schloss Versailles, und hinzu kam das blutverschmierte Hemd eines getöteten Schweizer Gardisten.
Curtius seinerseits schloss sich sofort der Nationalgarde an und war schon beim Sturm auf die Bastille dabei, wenn auch nicht ganz an vorderster Front. Da er als «Vainqueur de la Bastille», wie er seine Briefe nun stolz unterzeichnete, vertrauten Umgang mit den Republikanern pflegte, kam das komplette Triumvirat der Revolution — Robespierre, Marat, Danton — regelmäßig in die Rue du Temple zu Besuch, und zwar nicht nur tagsüber als Ausstellungsbesucher, sondern auch abends zum Essen im privaten Kreis. Will man Maries Memoiren Glauben schenken, so hat sie mit Robespierre geflirtet und mit Danton gestritten. Und was Jean-Paul Marat betraf, der sozusagen ein Landsmann von ihr und unweit von Bern, in Boudry am Neuenburger See, geboren und aufgewachsen war, so hat sie ihm mehrmals Unterschlupf gewährt, als er wegen seiner frechen Zeitungsartikel polizeilich gesucht wurde.
Marie Grosholtz im Alter von siebzehn Jahren, unbekannter Künstler (Madame Tussaud’s Archives).
2 Jean-Paul Marat
Ein paar Monate nach dem Sturm auf die Bastille tauchte also ein Landsmann bei Marie Grosholtz auf, mit dem sie sich anfangs gut verstand. Mit Jean-Paul Marat konnte sie Deutsch reden, und er war am Neuenburger See unweit von Bern zur Welt gekommen. Erst bewirtete sie ihn bei ihren abendlichen Gesellschaften, dann versteckte sie ihn im Keller vor der Polizei. Und als er tot war, modellierte sie ihn in Wachs für den Salon de Cire.
Ihn nicht entsetzlich zu finden fällt schwer. Um den krumm gewachsenen Leib trug er Pistolen und ein Schwert, um den Schädel einen in Essig getränkten Turban. Seine Haut war gelb überkrustet von juckenden Ausschlägen, von denen er nur Linderung fand, wenn er seine Tage und Nächte im Bad verbrachte. Er war ein brillanter Redner und Zeitungsschreiber im Dienst der Revolution, und seine Liebe zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war so groß, dass er das Volk in deren Namen zu Massakern aufrief.
Jean-Paul Marat litt an einer schlimmen Hautkrankheit. Seine Ärzte sagten, er habe die Krätze oder Skrofeln, möglicherweise beides; die heutige Medizin würde wohl eine allergische Überreaktion des Immunsystems diagnostizieren, vielleicht Neurodermitis in Kombination mit Schuppenflechte, und zusätzlich eine Wachstumsstörung. Er wurde nie größer als fünf Fuß, und sein Hals war derart schief, dass man meinen konnte, der Kopf sei auf der rechten Schulter festgewachsen. Von frühester Kindheit an muss es ihn derart entsetzlich gejuckt haben, dass er sich nächtelang im Bett wälzte und die Haut aufkratzte, bis er blutete. Wenn dann endlich der Morgen graute, war er müde und gereizt, angriffslustig und hochfahrend.
Zur Welt gekommen ist er am 24. Mai 1743 im Winzerstädtchen Boudry am Neuenburger See zwischen weißen Kalkfelsen und schwarzen Tannenwäldern. Sein Vater Juan Salvador Mara war ein ehemaliger Mercedariermönch aus Sardinien, der sich wegen Steuerzahlungen mit der Obrigkeit zerstritten hatte und vor dem langen Arm des Papstes ins calvinistische Genf geflohen war. Dort hatte er den reformierten Glauben angenommen und eine Bürgerstochter namens Louise Cabrol geheiratet. Mit ihr war Mara senior dann — erst der Sohn sollte dem Familiennamen ein gut französisches T hinzufügen — nach Boudry am Neuenburger See gezogen, wo er Arbeit als Zeichner von Blumenmustern in der Indienne-Baumwolldruckerei Clerc & Cie fand. Ein paar Wochen später kam Jean-Paul, der erstgeborene Sohn, zur Welt.
Da die Dorfkinder mit dem krummen und gelb überkrusteten Buben nicht spielen wollten, blieb er allein in der Obhut der Mutter, oder er verbrachte seine Tage in der Areuseschlucht, wo er im kühlen Bach Linderung von seinem Juckreiz fand. Mag sein, dass sich dort sein eigenbrötlerischer und rechthaberischer Charakter entwickelte und dass der schiefe Zwerg, gekränkt und gedemütigt, sich im Schatten der Tannen ausmalte, wie er es allen zeigen, unsterbliche Taten vollbringen und zu Ruhm und Ehre gelangen würde. Vier Jahrzehnte später schrieb er, dass er von klein auf getrieben gewesen sei von «amour-propre» und «faim de la gloire». Dieses blumige Französisch aus dem 18. Jahrhundert wörtlich zu übersetzen wäre unfair; in heutigem Deutsch hieße das wohl, dass Marat ein ernsthaftes Kind war, das im Leben etwas Gutes, Wahres und Schönes leisten wollte.
Am Collège in Neuenburg war er ein unauffälliger Schüler, der den Pflichtstoff ohne Begeisterung erledigte, für sich allein aber Rousseau und Montesquieu las. Als er elf Jahre alt war, gab ihm ein Lehrer eine Strafe, die er ungerecht fand. Diese Demütigung kränkte ihn so sehr, dass er zwei Tage nichts aß und nicht mehr zur Schule ging; dem vom Vater verhängten Hausarrest entzog er sich durch einen Sprung aus dem Fenster, bei dem er sich eine Platzwunde an der Stirn zuzog.
Niemand weiß, welchen Verlauf sein Leben genommen hätte, wenn er weniger einsam und weniger hässlich gewesen wäre und nicht so an Juckreiz gelitten hätte. Vielleicht wäre er am Neuenburger See geblieben und hätte ein geruhsames Leben als Winzer, Weinhändler oder Arbeiter in der Baumwollmanufaktur geführt. Gewiss hätte die Französische Revolution auch ohne ihn stattgefunden und König Ludwig XVI. auf der Guillotine geendet, und Napoleon wäre in jedem Fall nach Russland aufgebrochen. Aber möglicherweise wäre die Republik etwas später ausgerufen worden, und vielleicht hätte es auf dem Weg dorthin ein paar Massaker weniger gegeben.
Getrieben von seiner «faim de la gloire», verließ Jean-Paul kurz nach dem sechzehnten Geburtstag das Elternhaus und zog in die Welt hinaus, um nie mehr an den Neuenburger See zurückzukehren. Später behauptete er, dass er allein aufs Geratewohl zu Fuß tausend Kilometer durch Frankreich gewandert sei und in Bordeaux, als ihm das Reisegeld ausging, eine Stelle als Hauslehrer beim vornehmen Reeder Pierre-Paul Nairac angenommen habe.
Das wird nicht ganz so gewesen sein.