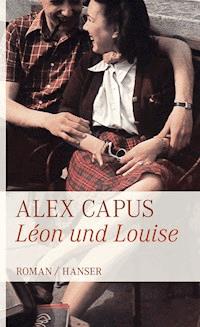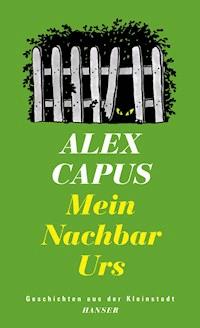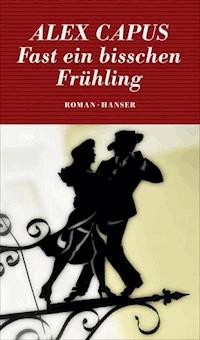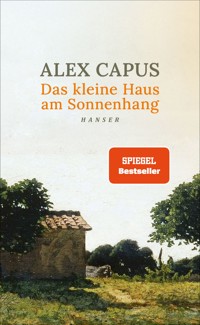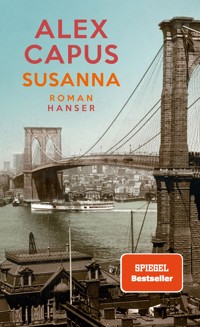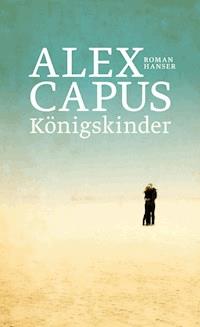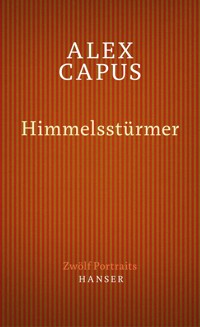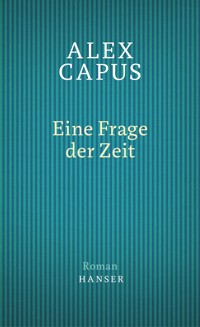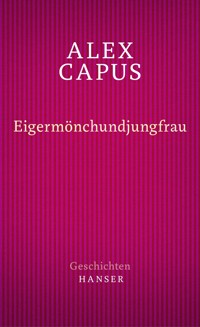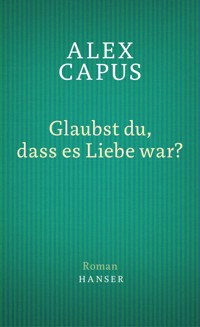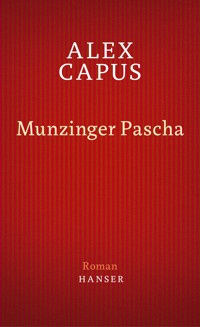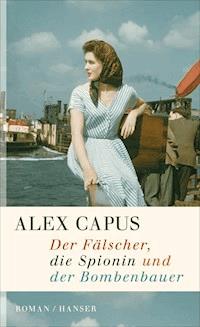
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von drei Helden wider Willen erzählt Alex Capus in seinem neuen Roman: Vom Pazifisten Felix Bloch, der nach 1933 in den USA beim Bau der Atombombe hilft. Von Laura d’Oriano, die Sängerin werden will und als alliierte Spionin in Italien endet. Und von Emile Gilliéron, der mit Schliemann nach Troja reist und zum größten Kunstfälscher aller Zeiten wird. Nur einmal können die drei einander begegnet sein: im November 1924 am Hauptbahnhof Zürich. Doch ihre Wege bleiben auf eigentümliche Weise miteinander verbunden. Capus treibt seinen Erzählstil des faktentreuen Träumens zu neuer Meisterschaft. Heiter und elegant, lakonisch und zart folgt der Erfolgsautor aus der Schweiz den exakt recherchierten Lebensläufen seiner Helden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
ALEX CAPUS
Der Fälscher, die Spionin
und der Bombenbauer
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24427-6
© Carl Hanser Verlag München 2013
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie, © Bert Hardy / Getty Images
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf der Seite: www.alexcapus.de
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Emile Gilliéron
1885–1939
Laura d’Oriano
1911–1943
Felix Bloch
1905–1983
Erstes Kapitel
Ich mag das Mädchen. Mir gefällt die Vorstellung, dass sie im hintersten Wagen des Orient-Express in der offenen Tür sitzt, während silbern glitzernd der Zürichsee an ihr vorüberzieht. Es könnte Anfang November 1924 sein, an welchem Tag genau, weiß ich nicht. Sie ist dreizehn Jahre alt und ein großgewachsenes, hageres, noch ein wenig ungelenkes Mädchen mit einer kleinen, aber schon tief eingefurchte Zornesfalte über der Nase. Das rechte Knie hat sie angezogen, das linke Bein baumelt über dem Treppchen ins Leere. Sie lehnt am Türrahmen und schaukelt im Rhythmus der Gleise, ihr blondes Haar flattert im Fahrtwind. Gegen die Kälte schützt sie sich mit einer Wolldecke, die sie vor der Brust zusammenhält. Auf dem Zuglaufschild steht »Constantinople–Paris«, darüber prangen goldene Messingbuchstaben und das Firmenzeichen mit den königlich-belgischen Löwen.
Mit der rechten Hand raucht sie Zigaretten, die im Wind rasch verglühen. Wo sie herkommt, ist es nichts Ungewöhnliches, dass Kinder rauchen. Zwischen den Zigaretten singt sie Bruchstücke orientalischer Lieder – türkische Wiegenlieder, libanesische Balladen, ägyptische Liebeslieder. Sie will Sängerin werden wie ihre Mutter, aber eine bessere. Niemals wird sie auf der Bühne ihr Dekolleté und die Waden zu Hilfe nehmen, wie die Mutter das tut, auch wird sie keine rosa Federboa tragen und sich nicht von Typen wie ihrem Vater begleiten lassen, der stets ein Zahnputzglas voll Brandy auf dem Piano stehen hat und jedes Mal, wenn die Mutter ihr Strumpfband herzeigt, augenzwinkernd ein Glissando hinlegt. Eine echte Künstlerin will sie werden. Sie hat ein großes und weites Gefühl in ihrer Brust, dem sie eines Tages Ausdruck verleihen wird. Das weiß sie ganz sicher.
Noch ist ihre Stimme dünn und heiser, das weiß sie auch. Sie kann sich selbst kaum hören, wie sie auf ihrem Treppchen sitzt und singt. Der Wind nimmt ihr die Melodien von den Lippen und trägt sie ins Luftgewirbel hinter dem letzten Wagen.
Drei Tage ist es her, dass sie in Konstantinopel mit den Eltern und ihren vier Geschwistern in einen blauen Wagen zweiter Klasse gestiegen ist. Seither hat sie viele Stunden in der offenen Tür verbracht. Drinnen im Abteil bei der Familie ist es stickig und laut, und draußen ist es mild für die Jahreszeit. In diesen drei Tagen hat sie auf ihrem Treppchen den Duft bulgarischer Weinberge geschnuppert und die Feldhasen auf den abgemähten Weizenfeldern der Vojvodina gesehen, sie hat den Donauschiffern gewinkt, die mit ihren Schiffshörnern zurückgrüßten, und sie hat in den Vorstädten von Belgrad, Budapest, Bratislava und Wien die rußgeschwärzten Mietskasernen mit ihren trüb erleuchteten Küchenfenstern gesehen, in denen müde Menschen in Unterhemden vor ihren Tellern saßen.
Wenn der Wind den Rauch der Dampflok nach rechts trug, saß sie in der linken Tür, und wenn er drehte, wechselte sie auf die andere Seite. Wenn ein Schaffner sie aus Sicherheitsgründen zurück ins Abteil scheuchte, tat sie, als ob sie gehorchen würde. Kaum aber war er weg, stieß sie die Tür wieder auf und setzte sich aufs Treppchen.
Am dritten Abend waren die Schaffner kurz vor Salzburg von Abteil zu Abteil gegangen, um eine außerfahrplanmäßige Routenänderung bekanntzugeben. Der Zug würde nach Innsbruck abbiegen und Deutschland südlich durch Tirol und die Schweiz umfahren; seit belgisch-französische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschiert waren, gab es für den belgisch-französischen Orient-Express auf der gewohnten Route über München und Stuttgart kaum mehr ein Durchkommen. Die Fahrdienstleiter der Reichsbahn stellten absichtlich die Weichen falsch oder verweigerten der Lokomotive Kohle und Wasser, und in den Bahnhöfen ließ die Polizei sämtliche Passagiere aussteigen und nahm nächtelange Ausweiskontrollen vor, und wenn die Reise dann endlich weitergehen konnte, stand bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof oft ein herrenloser Viehwagen oder Rundholztransporter auf der Schiene, den aufs Abstellgleis zu schieben kein Mensch im gesamten Deutschen Reich die Befugnis hatte, solange nicht die formelle dienstliche Einwilligung des rechtmäßigen Besitzers vorlag. Und diesen auf dem ordentlichen Dienstweg zu ermitteln, konnte äußerst zeitaufwendig sein.
Nach der Einfahrt in Tirol war es dunkel und kühl geworden, beidseits hatten sich Felswände himmelan getürmt und waren bedrohlich näher gerückt. Als das Mädchen sich auf den Rücken hätte legen müssen, um die Sterne am Nachthimmel sehen zu können, war sie ins Abteil gegangen und hatte sich schlafen gelegt in der muffigen Geborgenheit der Familie. Früh am Morgen aber, als der Zug sich endlich am Arlberg vornüberneigte und talabwärts Fahrt aufnahm, war sie mit ihrer Wolldecke zum Treppchen zurückgekehrt und hatte beobachtet, wie die Täler sich weiteten, die Berggipfel zurückwichen und im Sonnenaufgang erst den Dörfern und Bächen, dann den Städten und Flüssen und endlich den Seen Platz machten.
Die Eltern haben sich längst an den Eigensinn der Tochter gewöhnt, schon als kleines Mädchen hat sie draußen auf dem Treppchen gesessen. Während der zweiten oder dritten Bagdad-Tournee zwischen Tikrit und Mosul muss es gewesen sein, dass sie zum ersten Mal durch den Seitengang zur Ausgangstür lief, um die Kraniche am Ufer des Tigris besser sehen zu können; auf der Rückreise hatte sie sich wiederum aufs Treppchen gesetzt und war nicht loszureißen gewesen vom Anblick moskitoverseuchter Reisfelder, öder Steppen und rotglühender Gebirge. Seither sitzt sie immer auf ihrem Treppchen, auf der Fahrt durchs Nildelta von Alexandria nach Kairo genauso wie auf der Schmalspurbahn im Libanongebirge oder unterwegs von Konstantinopel nach Teheran. Immer sitzt sie auf dem Treppchen, schaut sich die Welt an und singt. Hin und wieder lässt sie es zu, dass eins ihrer Geschwister sich eine Weile zu ihr setzt. Aber dann will sie wieder allein sein.
In Kilchberg steigt ihr der Duft von Schokolade in die Nase, in ihrem Rücken zieht die prunkvolle Schlossfabrik von Lindt & Sprüngli vorbei. Auf dem See kreuzen ein paar Segelboote, an einer Anlegestelle liegt ein Raddampfer. Die Morgennebel haben sich verzogen. Der Himmel ist fahlblau. Die Wiesen am gegenüberliegenden Ufer sind, weil sich noch kein Frost übers Land gelegt hat, zu grün für die Jahreszeit. An der Spitze des Sees taucht aus dem Dunst die Stadt auf. Die Schiene beschreibt einen langen Bogen und vereinigt sich mit vier, acht, zwanzig anderen Schienen, die aus allen Himmelsrichtungen aufeinander zuführen, um schließlich parallel in den Hauptbahnhof zu münden.
Gut möglich, dass dem Mädchen bei der Einfahrt in die Stadt jener junge Mann auffiel, der im November 1924 oft zwischen den Gleisen auf der Laderampe eines grau verwitterten Güterschuppens saß, um die ein- und ausfahrenden Züge zu beobachten und sich Gedanken über sein weiteres Leben zu machen. Ich stelle mir vor, wie er seine Mütze knetete, während der Orient-Express an ihm vorüberfuhr, und dass ihm das Mädchen im hintersten Wagen ins Auge fiel, das ihn mit beiläufigem Interesse musterte.
Der Bursche passt nicht recht zur Laderampe und zum Güterschuppen. Rangierarbeiter oder Gleisbauer ist er jedenfalls nicht, und Kofferträger auch nicht. Er trägt Knickerbockers und eine Tweedjacke, und seine Schuhe glänzen in der Herbstsonne. Sein ebenmäßiges Gesicht zeugt von einer sorgenfreien Kindheit, oder zumindest einer katastrophenarmen. Die Haut ist klar, Augen, Nase, Mund und Kinn sind rechtwinklig angeordnet wie die Fenster und Türen an einem Haus. Sein braunes Haar ist akkurat gescheitelt. Ein bisschen zu akkurat vielleicht.
Sie sieht, dass sein Blick ihr folgt, und dass er sie anschaut, wie ein Mann eine Frau anschaut. Es ist noch nicht lange her, dass Männer sie so anschauen. Die meisten merken dann rasch, wie jung sie noch ist, und wenden sich verlegen ab. Der hier scheint es nicht zu merken. Der Bursche gefällt ihr. Stark und friedfertig sieht er aus. Und nicht dumm.
Er hebt grüßend die Hand, sie erwidert den Gruß. Dabei wedelt sie nicht mädchenhaft mit der Hand und winkt auch nicht mit allen fünf Fingern einzeln wie eine Kokotte, sondern hebt wie er lässig die Hand. Er lächelt, sie lächelt zurück.
Dann verlieren sie einander aus den Augen und werden sich nie wiedersehen, das ist dem Mädchen klar. Sie ist eine erfahrene Reisende und weiß, dass man einander normalerweise nur einmal begegnet, weil jede vernünftige Reise in möglichst gerader Linie vom Ausgangspunkt zum Ziel führt und zwei Geraden sich nach den Gesetzen der Geometrie nicht zweimal kreuzen. Ein Wiedersehen gibt es nur unter Dörflern, Talbewohnern und Insulanern, die lebenslang dieselben Trampelpfade begehen und einander deshalb ständig über den Weg laufen.
Der junge Mann auf der Laderampe ist zwar kein Dörfler und kein Insulaner, aber in Zürich geboren und aufgewachsen und mit den Trampelpfaden des Städtchens bestens vertraut. Dieses sonderbare Mädchen in der offenen Tür würde er gern wiedersehen. Wenn sie in Zürich aussteigt, wird er sie wiedersehen, dessen ist er sich gewiss. Wenn nicht, dann nicht.
Er ist neunzehn Jahre alt, vor vier Monaten hat er die Matura abgelegt. Jetzt muss er sich für ein Studium entscheiden. Die Zeit drängt, das Semester hat schon begonnen. Morgen um elf Uhr dreißig läuft die Immatrikulationsfrist ab.
Der Vater möchte, dass er Maschinenbau oder Ingenieurwissenschaften studiert. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH hat einen ausgezeichneten Ruf, und am Stadtrand stehen die besten Industriebetriebe der Welt. Brown und Boveri in Baden bauen die besten Turbinen der Welt, Sulzer in Winterthur baut die besten Webmaschinen und Dieselmotoren, die Maschinenfabrik Oerlikon die besten Lokomotiven. Mach Maschinenbau, sagt der Vater, als Techniker hast du ausgesorgt.
Der Vater selber ist nicht Techniker, sondern Getreidehändler. Getreidehandel mit Osteuropa ist vorbei, sagt der Vater, den kannst du vergessen. Die Grenzen sind dicht, die Zölle hoch und die Bolschewiken haben nicht alle Tassen im Schrank, mit denen kannst du keine Geschäfte machen. Getreide war gut für deinen Großvater, der ist damit reich geworden. Weizen aus der Ukraine, Kartoffeln aus Russland, fürs Gemüt ein bisschen ungarischer Rotwein und bosnische Trockenfeigen. Das waren die guten Zeiten damals, die Eisenbahn war schon gebaut und der Nationalismus hatte sich noch nicht so richtig durchgesetzt, und als Jude konnte man unter der Herrschaft der morschen Imperien so halbwegs auskommen. Schade, dass du unser Haus in Pilsen nie gesehen hast. Dein Großvater hat noch an den Getreidehandel geglaubt, deshalb hat er mich hierher nach Zürich geschickt. Ich habe gehorcht und bin hergekommen und Schweizer Bürger geworden, aber geglaubt habe ich damals schon nicht mehr daran. Jetzt bin ich hier und mache weiter, solange es eben geht. Für mich und deine Mutter wird’s schon noch reichen.
Dich aber, mein Sohn, wird das ukrainische Getreide nicht mehr ernähren, und deswegen rate ich dir: Mach Maschinenbau. Heute wird alles von Maschinen gemacht. Das Getreide wird von Maschinen ausgesät, von Maschinen geerntet und von Maschinen gemahlen, das Brot wird von Maschinen gebacken, unser Vieh wird von Maschinen geschlachtet, und die Häuser werden von Maschinen gebaut. Die Musik kommt aus Automaten, die ihrerseits von Automaten gebaut werden, und die Bilder macht nicht mehr der Maler, sondern der Fotoapparat. Bald werden wir auch für die Liebe Apparate benötigen und für das Sterben saubere, geräuschlose Maschinen haben, und auch die unauffällige Beseitigung der Kadaver werden diskrete Gerätschaften besorgen, und wir werden nicht mehr Gott anbeten, sondern eine Maschine oder den Namen ihres Herstellers, und der Messias, der den Weltfrieden bringt und in Jerusalem den Tempel wieder aufbaut, wird kein Sohn des Stammes Juda sein, sondern eine Maschine oder deren Erbauer. Die Welt ist eine einzige Maschine geworden, mein Sohn, deshalb rate ich dir: Geh an die ETH und mach Maschinenbau.
Der Sohn hört zu und nickt, denn er ist ein braver Sohn, der dem Vater den geschuldeten Respekt erweist. Bei sich selber aber denkt er: Nein, ich mache nicht Maschinenbau. Ich kenne diese Maschine. Lieber tu ich gar nichts im Leben, als dass ich ihr zudiene. Wenn ich überhaupt etwas mache, wird es etwas ganz und gar Nutzloses, Zweckfreies sein; etwas, das die Maschine sich keinesfalls dienstbar machen kann.
Der junge Mann hat das Wüten der Maschine eine halbe Kindheit und Jugend lang aus der Ferne studiert. Er war noch keine neun Jahre alt, als der Vater ihm die »Neue Zürcher Zeitung« mit der Schlagzeile aus Sarajevo über den Frühstückstisch reichte, und von da an las er täglich die Nachrichten von der Maas, der Marne und der Somme. Er schlug im Atlas nach, wo Ypern, Verdun und der Chemin des Dames lagen, hängte in seinem Bubenzimmer eine Europakarte übers Bett und spickte sie mit Stecknadeln, und er führte Statistiken in karierten Schulheften, in denen er die Toten erst zu Tausenden, dann zu Hunderttausenden und schließlich zu Millionen zusammenfasste. Aber nie gelang es ihm, in all dem Morden einen Sinn zu finden. Oder zumindest eine Logik. Oder eine plausible Ursache. Oder wenigstens einen ordentlichen Anlass.
Sich selbst zum Trost spielte er stundenlang Klavier im Wohnzimmer der Eltern. Er war kein besonders begabter Schüler. Aber als ihm die Finger zu gehorchen begannen, entwickelte er eine tiefe Zuneigung zu Bachs Goldberg-Variationen, deren ruhige, zuverlässige und berechenbare Mechanik ihn an das galaktische Ballett der Planeten, Sonnen und Monde erinnerte.
Er war, das berichtete er Jahrzehnte später in seinen handschriftlichen Lebenserinnerungen, ein einsames Kind. An der Grundschule quälten ihn die Mitschüler, weil er Schweizerdeutsch mit böhmischem Akzent sprach, und der Lehrer erinnerte die Klasse immer wieder gern daran, dass Felix einer bösen, fremdartigen Rasse angehöre.
Seine Beschützerin und engste Vertraute war die drei Jahre ältere Schwester Clara. Als sie im zweiten Kriegsjahr starb, weil sie mit dem rechten Fuß in einen Nagel getreten war, versank er für Jahre in hoffnungsloser Schwermut. Die Ärzte konnten mit ihrer Wissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts zwar recht genau erklären, was sich in Claras Körper abspielte – die bakterielle Verunreinigung, die Sepsis, schließlich der Kollaps –, ihre Heilkunst aber kannte noch keine Therapie, die Claras qualvollen, sinnlosen und banalen Tod hätte verhindern können. In den folgenden Monaten ließen seine Leistungen am Gymnasium stark nach. Warum sollte er sich in Biologie und Chemie anstrengen, wenn die Wissenschaft im entscheidenden Moment ohne Nutzen blieb? Wozu sollte er überhaupt etwas lernen, wenn Erkenntnis ohne Nutzen war?
Vergnügen bereitete ihm lediglich der Mathematikunterricht mit seinen verlässlichen, zweckfreien Gedankenspielen. Gleichungen mit mehreren Unbekannten, Trigonometrie, Kurvendiskussionen. Es war für den Jüngling eine Offenbarung, dass es in dieser aus den Fugen geratenen Welt etwas so Klares und Schönes wie das Verhältnis von Zahlen zueinander gab. Während der Herbstferien 1917 brachte er eine ganze Woche damit zu, mithilfe der Rotationsgeschwindigkeit der Erde, des Neigungswinkels ihrer Achse zur Sonne sowie Zürichs geographischer Breite die Dauer eines Oktobertags zu errechnen. Am nächsten Tag maß er mit seiner Taschenuhr die Zeitspanne von Sonnenaufgang bis -untergang und war unbeschreiblich glücklich, als die Messung mit seiner Berechnung übereinstimmte. Die Erfahrung, dass ein von ihm gedachter Gedanke – die trigonometrische Berechnung – tatsächlich etwas mit der realen Welt zu tun hatte und sogar mit ihr in Einklang stand, erfüllte ihn mit einer Ahnung von Harmonie zwischen Geist und Materie, die ihn zeitlebens nicht mehr verlassen sollte.
Am meisten verstörte den Jüngling während der Kriegsjahre, dass sein Zeitungswissen über die Welt in scharfem Kontrast zu seiner alltäglichen empirischen Beobachtung stand. Wenn er in seinem Bubenzimmer aus dem Fenster schaute, sah er unten auf der Seehofstraße keine Füsiliere durch Laufgräben rennen und keine aufgeblähten Pferdekadaver in Bombenkratern liegen, sondern wohlgenährte Dienstmädchen, die überquellende Einkaufstaschen heimwärts trugen, und rotwangige Kinder, die auf dem Pflaster mit Glasmurmeln spielten. Er sah Taxifahrer, die zigarettenrauchend beisammenstanden und auf Kundschaft aus dem Opernhaus warteten, und er sah dösende Kutscher hinter dösenden Pferden und den Scherenschleifer, der von Tür zu Tür ging. Derart groß war der Friede in der Seehofstraße, dass nicht einmal Polizei zu sehen war. Diese friedliche Straße lag im Herzen einer unfassbar friedlichen Stadt, die im Herzen eines unfassbar friedlichen Landes lag, dessen Bauern auf ihren von den Ahnen ererbten Äckern bedächtigen Schrittes ihre Furchen zu einem Horizont hin zogen, hinter dem das große europäische Menschenschlachten geschah. Nur in besonders stillen Nächten war über den Rhein und den Schwarzwald hinweg das Donnergrollen der deutsch-französischen Front zu hören.
Dieses Grollen verfolgte ihn in den Schlaf und schwoll dort zu ohrenbetäubendem Gebrüll an. In seinen Träumen watete er in Strömen von Blut durch zerfetzte Landstriche, und nach dem Aufwachen las er beim Frühstück im »Morgenblatt« in hilflosem Entsetzen, wie die Kriegsmaschine den Kontinent umpflügte und sich alles unter der Sonne einverleibte, was ihr irgendwie dienlich sein konnte. Sie verschluckte Mönche und spuckte sie als Feldprediger wieder aus, sie machte Hirtenhunde zu Grabenkötern und Flugzeugpioniere zu Kampfpiloten, Wildhüter zu Scharfschützen und Pianisten zu Feldmusikern und Kinderärzte zu Lazarettschlächtern, Philosophen zu Kriegstreibern und Naturdichter zu Blutgurglern, Kirchenglocken wurden zu Kanonen umgegossen und Opernguckerlinsen in Zielfernrohre eingebaut, Kreuzfahrtschiffe wurden zu Truppentransportern und Psalmen zu Nationalhymnen, und die Webstühle aus Winterthur woben keine Seide mehr, sondern Uniformdrillich, und die Turbinen aus Baden produzierten Strom nicht mehr für die Weihnachtsbeleuchtung, sondern für die Elektroloks aus Oerlikon, die keine Touristen mehr ins Engadin verfrachteten, sondern Kohle und Stahl zu den Hochöfen und Gießereien der Waffenschmiede schleppten.
Nach tausendfünfhundert Tagen war die Maschine kurz vor Felix Blochs dreizehntem Geburtstag mangels Treibstoff ins Stottern geraten und widerwillig zum Stillstand gekommen. Seither hat sie sich einigermaßen ruhig verhalten, das ist wahr, aber jetzt brummt sie schon wieder; bald wird sie wieder ruckeln und rattern, und über kurz oder lang werden ihre Schwungräder wieder zu drehen anfangen und ihre Schredderzähne sich aufs Neue durch die Landschaften und das Fleisch und die Seelen der Menschen fressen.
Mag sein, dass die Maschine nicht aufzuhalten ist, sagt sich der junge Mann, aber mich wird sie nicht kriegen. Ich mache nicht mit, ich studiere nicht Maschinenbau. Ich werde etwas ganz und gar Zweckfreies machen. Etwas Schönes und Nutzloses, was sich die Maschine keinesfalls einverleiben kann. Etwas wie die Goldberg-Variationen. Es wird sich schon was finden. Jedenfalls gehe ich nicht an die ETH. Ich mache nicht Maschinenbau, da kann der Vater lange reden. Eher werde ich Fuhrmann für eine Brauerei.
Trotzig stößt er sich vom Schuppen ab, zur Rebellion entschlossen springt er von der Laderampe. Aber noch bevor er unten auf dem Schotter landet, sinkt ihm schon der Mut und verlässt ihn die Entschlossenheit, und als er die ersten Schritte über den klappernden Plattenweg geht, der zwischen den Gleisen zur Bahnhofshalle führt, steigt ihm leise, aber unaufhaltsam wie eine bittere Champagnerperle die Erkenntnis aus den Eingeweiden übers Herz in den Kopf, dass er sehr wohl an die ETH gehen und Maschinenbau studieren wird – denn erstens würde er ein Zerwürfnis mit dem Vater nicht ertragen, zweitens hat er lauter Bestnoten in Mathematik, Physik und Chemie, und drittens will ihm auf den Tod nichts einfallen, was er mit seiner einseitigen Begabung anderes anstellen könnte, als Maschinenbau an der ETH zu studieren.
Zwischen den Gleisen springt ein Signal auf Grün und gibt dem Schnellzug nach Genf freie Fahrt aus der Bahnhofshalle. In einem Abteil erster Klasse sitzt an einem jener ersten Novembertage des Jahres 1924 – ob’s wirklich am selben Tag und zur selben Stunde war, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen – der Kunstmaler Emile Gilliéron. Er ist geschäftlich aus Griechenland über Triest und Innsbruck nach Reislingen bei Ulm gereist, wo er einen Auftrag an die Württembergische Metallwarenfabrik zu vergeben hatte. Auf der Rückreise will er einen Abstecher an den Genfersee machen, um die Asche seines Vaters, der kurz vor seinem dreiundsiebzigsten Geburtstag in einem Athener Restaurant tot unter den Tisch gesunken war, in heimatlicher Erde zu bestatten.
Der Vater hatte ebenfalls Emile Gilliéron geheißen, war ebenfalls Kunstmaler in Griechenland und ein berühmter Mann gewesen. Er hatte Heinrich Schliemann bei den Ausgrabungen Trojas und Mykenes als Zeichner begleitet und eine Briefmarkenserie für die griechische Post gestaltet, und er war Zeichenlehrer der griechischen Königsfamilie gewesen und hatte ein stattliches Wohnhaus mit prächtiger Aussicht auf die Akropolis gebaut, und er hatte den Sohn zu seinem tüchtigen Geschäftspartner herangezogen. Groß war deshalb in der Familie die Überraschung gewesen, als bei der Testamentseröffnung nur Schulden zum Vorschein kamen und sich herausstellte, dass die Gilliérons zwar auf großem Fuß, aber ständig von der Hand in den Mund lebten.
Zusätzlich in Verlegenheit brachte die Hinterbliebenen der testamentarische Wunsch des Verstorbenen nach einer Bestattung in seiner alten Heimat am Genfersee; denn eine offizielle, legale Repatriierung des Leichnams über drei oder vier Landesgrenzen hinweg wäre mit einem finanziellen und administrativen Aufwand verbunden gewesen, den sich allenfalls der Papst, der König von England oder ein amerikanischer Eisenbahnmagnat hätte leisten können. Einigermaßen durchführbar war nur ein klandestiner Transport nach vorgängiger Einäscherung. Zwar waren Feuerbestattungen im orthodoxen Griechenland bei strenger Strafe verboten, aber im Botschaftsviertel von Athen gab es Bestattungsunternehmen, die auf ausländische Kundschaft spezialisiert waren. Gegen Aufpreis brachten sie am Tag der Beerdigung dem Popen einen mit Sandsäcken beschwerten, ansonsten aber leeren Sarg zum Friedhof und führten den Leichnam auf geheimen Wegen einer informellen Kremation zu.
Emile Gilliéron hatte mit Nachdruck darauf verzichtet, über den präzisen Ablauf dieser Dienstleistung ins Bild gesetzt zu werden; er wollte nicht wissen, welcher Bäcker, Töpfer oder Schlosser nachts seinen Ofen zur Verfügung stellte, bevor er am nächsten Morgen im selben Ofen wieder Brötchen buk oder Wasserkrüge brannte. Erst auf der Überfahrt von Piräus nach Triest mit dem Postschiff des Lloyd Triestino war ihm der Gedanke gekommen, dass er niemals mit Sicherheit wissen würde, ob sein Vater tatsächlich kremiert oder den Haien zum Fraß vorgeworfen worden war, und ob die Zigarrenkiste in seinem Koffer nicht die Asche eines Fremden enthielt oder die zerstampften Knochen eines Straßenköters.
Emile Gilliéron junior ist ein schöner Mann im besten Alter. Sein Gesicht ist noch immer jugendlich scharf geschnitten und goldbraun gebrannt von den Jahren, die er mit dem Vater auf den Ausgrabungsfeldern von Knossos verbracht hat, und seine Augen glühen wie die seiner italienischen Mutter Josephine, die ihn und den Vater zeitlebens mit ihrer Fürsorglichkeit und Eifersucht verfolgte. Sein Kopfhaar und der kühn geschwungene Schnurrbart sind ein wenig zu schwarz, um ganz naturbelassen zu sein, die Nase ist gerötet von der täglichen Flasche Armagnac, und in den Mundwinkeln liegt eine Spur Bitterkeit und enttäuschter Ehrgeiz. In Athen erwartet ihn seine italienische Ehefrau Ernesta, die in ihrer freien Zeit auf der Terrasse ihres Hauses liebliche Ölbilder mit der immer gleichen Ansicht der Akropolis malt, und sein erstgeborener Sohn, der auf den Namen Alfred hört und vier Jahre alt ist.
Zweites Kapitel
Es wäre ein Zufall, wenn Emile Gilliéron bei der Ausfahrt aus dem Zürcher Hauptbahnhof das Mädchen und den Burschen wahrgenommen hätte, aber ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass er zu lange im Bahnhofbuffet saß und zum Zug rennen musste, und dass er schwitzend und keuchend Hut und Mantel ablegte und seinen Koffer ins Gepäcknetz stemmte, während der Zug langsam beschleunigend aus dem Bahnhof fuhr.
Ich wünsche mir, dass Emile Gilliéron sich ins Polster fallen lässt und um Atem ringend aus dem rechten Fenster schaut, wo in einiger Entfernung ein nachtblauer Zug vorüberfährt. In den Fenstern sind Fahrgäste zu sehen, die sich zum Aussteigen bereitmachen und durch die Seitengänge drängeln. Die Türen sind noch geschlossen, nur im hintersten Wagen sitzt ein blonder Backfisch auf dem Treppchen und gähnt mit weit aufgesperrtem Mund. Ein seltsamer Anblick um diese Jahreszeit, denkt Emile Gilliéron, das dumme Ding holt sich dort draußen den Tod. Hat sich wohl mit den Eltern gestritten und weigert sich jetzt, zurückzukehren ins warme Abteil. Hält ihre Eltern für Paviane oder Lurche, sich selbst hingegen für die Krone der Schöpfung. Wenigstens mit einer Hand an der Haltestange festhalten sollte sich die Lichtgestalt, sonst könnte es rasch ein Ende haben mit dem jugendlichen Auserwähltsein. Und die andere Hand könnte sie beim Gähnen vor den Mund halten, das sähe schon mal netter aus.
Der blaue Zug verschwindet rechts aus dem Blickfeld, im linken Fenster wird die Sicht frei hinüber zu den Güterschuppen, wo ein junger Bursche zwischen den Gleisen dahinschlurft. Noch so eine Type, denkt Gilliéron. Der Kerl sieht aus wie einer, der sich vor den Zug werfen will, weil er zu gut ist für diese Welt. Oder zu schlecht. Sonderbare Sache, dass sich junge, schöne und gesunde Menschen vor Züge werfen müssen. Vor meinen Zug wird er es Gott sei Dank nicht schaffen, dafür ist er zu weit weg. Das dauert ja immer Stunden, bis alles wieder sauber ist und man endlich weiterfahren kann.
Der Schaffner kommt und kontrolliert die Fahrscheine. Emile Gilliéron steckt sich eine seiner ägyptischen Zigaretten mit golden aufgedrucktem Monogramm an, dann lehnt er sich zurück und betrachtet durchs Fenster das Land seiner Ahnen, dessen puppenstubenhafte Niedlichkeit ihn bei jedem Besuch aufs Neue fasziniert. Der Zug fährt vorbei an einer putzigen kleinen Bierbrauerei, einer hübschen kleinen Getreidemühle und den blitzblanken Stahlkugeln eines kleinen Gaswerks, dann folgt er dem Lauf eines lieblich mäandrierenden Flüsschens zu den Ausläufern eines sanften, bewaldeten Gebirges. Zwischendurch hält er in blitzblanken Puppenstubenbahnhöfen, die zu blitzblanken, wenn auch düsteren Kleinstädten mit mittelalterlichen Ringmauern gehören, hinter denen Menschen leben, die emsig und höflich, aber nicht sehr gut gelaunt sind. Und nicht sehr gut gekleidet.
Zwischen zwei Kleinstädten fährt der Zug an den Kalksteinsäulen eines mittelalterlichen Galgens vorbei, der blütenweiß und weithin sichtbar am Waldrand steht, als hätte dort gestern noch der letzte Unglückliche am Strick gehangen. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt, denkt Gilliéron, dass ein Volk zwar den Henker zum Teufel schickt, das Schafott aber stehen lässt; was müssen das für Menschen sein, welche die Richtstätten überwundener Feudalherrschaft jahrhundertelang nicht nur nicht schleifen, sondern sogar putzen und instand halten. Kleine Menschen in einem kleinen Land mit kleinen Ideen, die kleine Städte, kleine Bahnhöfe und unfassbar pünktliche Eisenbahnen bauen. Sogar der Galgen ist klein. Da würde ich mir ja die Knie wundscheuern, wenn man mich an dem aufknüpfen würde.
In der achten Kleinstadt muss Gilliéron umsteigen, dann geht die Fahrt weiter an einem kleinen See entlang zum nächsten kleinen See, dann über einen Hügelzug mit winterlich nackten Kartoffeläckern und durch lächerlich klein parzellierte Weinberge, die lange nach Sonnenuntergang noch golden leuchten. Im Süden thront mächtig weiß und unverrückbar der Mont Blanc, Europas höchster Berg. Endlich mal etwas Großes in diesem Land, denkt Gilliéron, wobei ihm bekannt ist, dass der Mont Blanc genaugenommen in Frankreich steht, während die Schweiz sich mit dessen Anblick begnügt. Volkswirtschaftlich ist das eine kluge Entscheidung. Aus der Ferne ist so ein Berg schön anzusehen, die touristische Vermarktung des Postkartenidylls bringt gutes Geld. Aus der Nähe betrachtet hingegen ist er nur eine gefährliche und kostspielige Geröllhalde.
In Lausanne steigt Gilliéron um in die Regionalbahn. Eine halbe Stunde später gelangt er ans östliche Ende des Genfersees, zum Geburtsort seines Vaters und ans Ziel seiner Reise.
Der Bahnhof von Villeneuve liegt im Dunkeln. Auf dem Bahnsteig ist kein Mensch zu sehen, im Stationsgebäude brennt kein Licht. Der Fahrkartenschalter ist geschlossen, in der Tür zum Wartesaal liegt dürres Laub. Taxis oder Droschken gibt es keine, Kofferträger schon gar nicht. Der Bahnhofplatz ist gesäumt von kahlen Platanen, auf dem nassen Kopfsteinpflaster picken Tauben in plattgefahrenem Pferdedung. Hinter dem Bahnhof sind die schwarzen Umrisse der Waadtländer Voralpen zu sehen, davor steht leicht erhöht das »Hotel Byron«, das seit hundert Jahren vergeblich auf wohlhabende Engländer wartet und noch jeden Eigentümer in den Ruin gerissen hat.
Emile Gilliéron stellt den Koffer ab und schnuppert. In der Luft liegt tatsächlich Modergeruch – der süße, würzige Moorgeruch des Rhonedeltas, über den der Vater so unermüdlich schimpfen konnte, als habe er ihn nach Jahrzehnten des griechischen Exils noch immer in der Nase gehabt. Ihm zufolge führt die schlechte Luft von Villeneuve bei längerer Inhalation zu Schwindsucht und Schwachsinn sowie Rachitis und Zahnfäulnis, ebenso zu Trunksucht, Gürtelrosen, Epilepsie und allerlei Formen weiblicher Hysterie. Diese multiple Toxizität erklärte er damit, dass Moorgeruch nichts anderes sei als der Verwesungsgestank verendeter Organismen, die ein Lebensalter lang Zeit gehabt hätten, alle möglichen Krankheitserreger einzusammeln, wobei interessanterweise der Mensch, wenn er in den Sumpf gerate, der Gnade dieser Zersetzung nicht teilhaftig werde, weil er eben nicht an der sauerstoffreichen Oberfläche bleibe, sondern ziemlich rasch in jene Tiefe von drei bis vier Metern absinke, in der das spezifische Gewicht seines Körpers jenem des Umgebungssumpfs entspricht, um dort, falls er noch nicht tot ist, zu ersticken und in stabilem Schwebezustand luftdicht verpackt und von der Moorsäure sanft gegerbt jahrtausendelang eine körperliche Frische zu bewahren, von der die Pharaonen im trockenen Sand Ägyptens mit all ihrer Balsamierungskunst nur hätten träumen können. Deshalb sei mit großer Sicherheit anzunehmen, dass im Sumpf von Villeneuve Hunderte, wenn nicht Tausende lebensecht erhaltener Moorleichen friedlich beisammenlägen, die einander unter der Sonne niemals hätten begegnen können – keltische Fischer neben burgundischen Kreuzrittern, römische Legionäre neben deutschen Rom-Pilgern, maurische Entdecker neben venezianischen Gewürzhändlern und alemannischen Hirtenmädchen –, wobei die einen vielleicht aus Liebeskummer in den Sumpf gegangen waren und andere im Jagdfieber, wieder andere im Suff oder aus Dummheit oder aus Geiz, weil sie dem Grafen von Chillon den Wegzoll nicht hatten entrichten wollen; und irgendwo mussten, als würden sie nur schlafen, auch die hundertsiebenundzwanzig Juden von Villeneuve liegen, die 1348 während der Pestepidemie von der Bürgerschaft wegen Brunnenvergiftens massakriert und in den Sumpf geworfen worden waren.
Ach, die Bürger von Villeneuve.
Der Vater hatte eine ganze Kindheit und Jugend mit ihnen verbracht, und auch wenn er danach ein halbes Jahrhundert im Exil gelebt hatte, war er doch einer von ihnen geblieben. Vielleicht war er als junger Mann nur deshalb aus Villeneuve geflohen, um einer von ihnen bleiben zu können und nicht endgültig verstoßen zu werden.
Die Bürger von Villeneuve waren Fischer, Bauern und Fuhrleute, arbeitsame Protestanten und brave Untertanen, die ihren Platz kannten in einer festgefügten Welt. Jeder Fischersohn wusste, dass er zeitlebens auf den See hinausfahren würde, und jeder Bauernsohn wusste, dass er die von den Vätern ererbten Äcker bestellen würde bis ans Ende seiner Tage; das war so selbstverständlich, dass man nicht darüber nachdenken musste. Mitte zwanzig wurde geheiratet und mit fünfzig gestorben, und den Erstgeborenen taufte man auf den Vatersnamen, und um halb zehn war Lichterlöschen, und mittwochs wohnte man seiner Frau bei, und freitags gab es Fisch. Sonntags ging man zur Messe und trug eine schwarze Jacke. Und nicht etwa eine graue. Oder gar eine blaue.
Natürlich gab es auch in Villeneuve immer ein paar Milchbärte, die blaue Jacken trugen, um den Mädchen zu gefallen, und zu allen Zeiten hatte es ein Rudel Welpen gegeben, das durch die Gassen zog und davon träumte, Villeneuve hinter sich zu lassen und über den Großen Sankt Bernhard nach Italien abzuhauen. Dafür hatten die Bürger Verständnis, denn sie waren auch einmal jung gewesen. Genauso klar war aber, dass der Spaß irgendwann ein Ende haben musste, spätestens nach dem zwanzigsten Geburtstag hörte der Welpenschutz auf. Wer dann noch eine blaue Jacke trug, tat vielleicht tatsächlich besser daran, über den Großen Sankt Bernhard zu verschwinden.
Ach, die Bürger von Villeneuve. So ausschweifend der Vater über den Sumpf hatte schimpfen können, so milde hatte er immer seinen weißen Spitzbart gestreichelt, wenn die Rede auf die Bürger von Villeneuve gekommen war. Der Sohn hatte früh verstanden, dass der Vater den Sumpf von Villeneuve nur deshalb so leidenschaftlich hassen musste, weil er die Bürger weiterhin lieben wollte.
Emile Gilliéron nimmt den Koffer wieder auf, überquert den Bahnhofplatz und biegt ein in die nachtschwarze Grande Rue, die gesäumt ist von mittelalterlichen Fachwerkbauten. Alle Fenster sind dunkel, dabei ist es noch nicht einmal zehn. Rechts eine Apotheke, links eine Bäckerei, rechts eine Metzgerei, links das »Hotel de l’Aigle«. Dort isst man angeblich recht gut, aber die Fenster sind schon dunkel. In einer Seitengasse hängt ein Fischernetz zum Trocknen, in der nächsten duftet ein Miststock nach Kleinvieh.
Vor der Kirche plätschert einsam ein großer Brunnen. Dort muss sich der Waschtrog befinden, von dem der Vater erzählt hat. Viele Jahrhunderte lang hatten die Frauen von Villeneuve an diesem Trog ihre Wäsche gewaschen und nicht beachtet, dass er an einer Ecke gestützt wurde durch eine auffällig runde Säule, welche die Aufschrift »XXVI« trug. Eines Tages war der Kantonsarchäologe aus Lausanne vorbeigekommen und hatte den Bürgern von Villeneuve erklärt, dass sie einen zweitausend Jahre alten Meilenstein der Altrömischen Heeresstraße unter ihrem Waschtrog hätten, und dass die Zahl Sechsundzwanzig die Entfernung zur Garnisonsstadt Martigny in römischen Meilen angebe. Da hatten die Bürger bedächtig genickt, die Köpfe schief gelegt und beifällig ihren römischen Stein betrachtet, und manche hatten »Tiens donc« gemurmelt und »Sacré Romains« oder »ça, par exemple«. Als aber der Kantonsarchäologe die Bürger bat, das Zeugnis der Vergangenheit vor Witterung und Seifenwasser in Sicherheit zu bringen und zuhanden der Nachwelt in der Kirche aufzustellen, hatten sie trotzig die Fäuste in den Taschen versenkt und die Unterlippen vorgeschoben, weil man für diese Arbeit den Steinmetz aus Vevey hätte herbeirufen und ihm mindestens fünfundzwanzig Batzen geben müssen, und sie hatten erst gehorcht, nachdem der Archäologe die fünfundzwanzig Batzen auf den Waschtrog gezählt und fünfzehn weitere dazugelegt hatte.
Dies hatte sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts ereignet, während Emile Gilliérons Vater in Villeneuve heranwuchs als einziger Sohn des Dorfschullehrers und ganz gewöhnlicher Dorfjunge ohne auffällige Merkmale. Er war durchschnittlich groß, durchschnittlich kräftig und durchschnittlich braunhaarig, und er hatte keine herausragenden Eigenschaften oder erkennbaren Talente außer dem einen: er konnte unglaublich gut zeichnen – unglaublich scharf, unglaublich ausdrucksstark, und mit unglaublicher, geradezu fotografischer Präzision und Vorstellungskraft. Er hatte keinen besonderen Unterricht genossen, war von niemandem ermuntert und von niemandem zum Üben angehalten worden, er tat es nicht mal sonderlich gern – er konnte es einfach. Und weil Villeneuve für junge Leute wenig Zerstreuung bot, zeichnete er ohne Unterlass. Schon als Siebenjähriger hatte er auf dem Pflaster des Pausenplatzes mit fliegender Hand verblüffende Kohleportraits seiner Schulkameraden angefertigt, und sonntags war er mit dem Aquarellkasten zum Hafen gelaufen und hatte die Schiffe und die Weiden am Ufer und die schneebedeckten Berge am Horizont mit einer Leichtigkeit aufs Papier geworfen, dass der Betrachter die Brise zu spüren glaubte, die am Nachmittag vom See her landeinwärts wehte.
Die Bürger von Villeneuve hatten seine Begabung zur Kenntnis genommen, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen. So etwas gibt’s, sagten sie schulterzuckend, manche können Sachen, die andere nicht können, man darf da nicht ins Grübeln geraten. Es gibt Leute, die spüren Wasseradern oder hören Geisterstimmen, andere sprechen in Zungen oder können Warzen wegmachen. Der kleine Gilliéron kann nun mal gut zeichnen, was soll’s. Macht nix und schadet keinem. Solange er mit seinen Farbstiften spielt, macht er keine größeren Dummheiten.
Gilliéron selber maß seiner Begabung ebenso wenig Bedeutung bei. Das Zeichnen war ihm ein bloßer Zeitvertreib, der ihm übrigens nicht sonderlich viel Vergnügen bereitete. Auch war er nicht etwa stolz auf seine Zeichnungen, ging nicht mit ihnen hausieren und bewahrte sie nicht auf, sondern legte sie, kaum dass sie fertig waren, neben den Ofen zum Anfeuern aufs Brennholz.
Das änderte sich erst 1866, als er fünfzehn Jahre alt wurde, sich eine blaue Jacke zulegte und davon zu träumen begann, für immer nach Italien abzuhauen, statt wie die anderen Welpen seines Jahrgangs Bauer, Fischer oder Dorfschullehrer in Villeneuve zu werden. Als ihn der Vater ans Lehrerseminar nach Lausanne schicken wollte, verkündete er verächtlich schnaubend, dass er sich eher vierteilen lassen würde, als den Rest seiner Tage zwischen Lehrerpult und Schiefertafel zu vergeuden.
Stattdessen richtete er in einer verlassenen Scheune am Rand des Sumpfs sein erstes Künstleratelier ein, ließ sich das Kopfhaar lang wachsen und rauchte Waldrebenstengel, die er im Sumpf von den Bäumen gerissen und auf dem Scheunenboden zum Trocknen ausgelegt hatte. An den Markttagen lungerte er vor den Gasthäusern herum und versorgte die Pferde der auswärtigen Bauern unter der Bedingung, dass sie ihm dafür ein Glas Féchy spendierten. Wenn er Geld brauchte, ging er den Winzern in den Weinbergen zur Hand oder putzte den Fischern die Netze. Wenn das Wetter gut war, verbrachte er die Abende mit seinen Freunden am See unter einer alten Trauerweide. Während der kalten Jahreszeit diente sein Atelier als Treffpunkt.
So verging ein Jahr, dann ein zweites und ein drittes. Als aber Emile Gilliéron und seine Freunde volljährig wurden und noch immer keine Anstalten machten, ihre blauen Jacken gegen schwarze oder wenigstens gegen graue einzutauschen, beschlossen die Bürger von Villeneuve, dass es genug sei. In einer lauen Frühlingsnacht brannte Emiles Atelier aus nie geklärten Gründen vollständig nieder, und zwei Wochen später brachte ihm der Postbote einen Brief, in dem ihm zu seiner Überraschung die Kunstgewerbeschule Basel mitteilte, dass er zum Lehrgang für angehende Zeichnungslehrer zugelassen sei und sich am folgenden Montag zwischen acht und zehn Uhr zur Immatrikulation in der Aula Magna einzufinden habe.
Emile begriff, dass die eigentliche Absenderin nicht die Kunstgewerbeschule Basel, sondern die Bürgerschaft von Villeneuve war, die einige seiner Zeichnungen entwendet und nach Basel geschickt haben musste, und dass er den Brief nicht als Einladung, sondern als Verbannung zu verstehen hatte. Also packte er verächtlich schnaubend sein Bündel, reiste nach Basel und stellte nach dem ersten Semester verächtlich schnaubend fest, dass er alles, was die Professoren ihm beibringen wollten, eigentlich schon konnte. Gewiss lernte er Techniken des Skizzierens, Schabens, Spachtelns, Stechens, Modellierens und Ätzens, von denen er in Villeneuve nie gehört hatte, und in der ständigen Ausstellung des Kunstmuseums taten sich ihm Welten auf, die er sich im Sumpf des Rhonedeltas nicht hätte träumen lassen; zurück im Klassenzimmer aber kopierte, variierte und karikierte er nach Belieben jeden Alten Meister, den er gesehen hatte, jeden Stil und jede Schule. Er malte runde Puttenengel wie Rubens und pfeildurchbohrte Märtyrer wie Caravaggio, und er brachte seine Mitschüler zum Lachen, indem er pfeildurchbohrte Puttenengel malte und tanzende Märtyrer, denen gebratene Hühnerschenkel aus dem Mund ragten; er töpferte Vasen und modellierte Götterstatuetten und zeichnete griechische Tempel und Statuen, als hätte er sein ganzes bisheriges Leben auf dem Peloponnes verbracht, und das alles mit einer Lässigkeit, Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegenüber der eigenen Begabung, die seine Professoren faszinierte und auch ein wenig beleidigte.
Nach dem Unterricht zog er durch die Kneipen Kleinbasels und erlangte Berühmtheit, weil er Weißwein saufen konnte wie kein zweiter. Wo immer er hinkam, machte er sich Freunde mit seiner ungekünstelten Herzlichkeit und bäuerlichen Schlagfertigkeit; seine Kommilitonen aber nahmen ihm übel, dass er, der im Unterricht immer alles gleich konnte, was sie erst mühsam erlernen mussten, jedes gelehrte Stammtischgespräch über Kunst und Musenkuss verweigerte, weil er sich mehr für die Beine und Dekolletés der Kellnerinnen interessierte.
Emile Gilliéron war bei aller Faulheit und Nonchalance unbestreitbar der beste Schüler seines Jahrgangs. Er gewann sämtliche Wettbewerbe, obwohl die Schulleitung ihn jedes Mal zur Teilnahme drängen musste und er seine Arbeiten immer erst in der Nacht vor dem Abgabetermin anfertigte, und als die Merian-Stiftung ein zweijähriges Stipendium für die École des Beaux-Arts in Paris ausschrieb, bewarb er sich nur, um die unausweichliche Rückkehr nach Villeneuve hinauszuschieben.