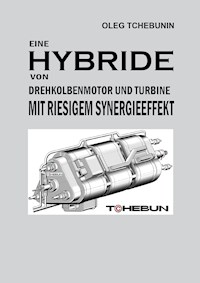
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In dem Buch ist Stand der Technik bei der Verbrennungsmotoren, darunter bei Drehkolbenmotoren, und die Mangeln bei seinen konstruktiven Schemen analysiert und die Wege zur Überwindung dieser Mangeln vorgeschlagen sind. Für der Leser gibt es Möglichkeit sich verdeutlichen, dass die wichtigste besteht darin, dass unbedingt notwendig ist von traditionellen konstruktiven Schemen mit diskontinuierlichem Arbeitsprozess mit Kurbetrieb (oder anderen Reglern bei neuprojektierten Drehkolbenmaschinen) und von seinen so genanten Takten (Ansaugen, Komprimierung, Arbeitsgang, Ausstoß) zu verzichten, denn diese Diskontinuierlichkeit ist die Hauptursache für abwesende Progress bei ihnen. In dem Buch ist gezeigt, dass Ausweg bietet nur das Schema mit kontinuierlichem Arbeitsprozess bei Brennen des Kraftstoffes so eine wie z. B. bei Turbomotor, der erlaubt es die Schelllauf und Wirkungsgrade bei Maschinen zu steigern und Gewichte beträchtlich zu reduzieren. Weiter Leser erkennt, dass schon eine von Autor patentierte Erfindung der Dreistufigen Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess vorhanden ist. Daraufhin bekommt der Leser zum Wissen, dass ist sie samt thermodynamischen Grundlagen und mit experimentellen Prototyp mit Leistung 100 KW mit allen Abmessungen, Charakteristiken und weiteren Beschaffenheiten bei Ausnutzung der von deutscher Industrie fertig gestellten und auf Bestellung gefertigten Bauteilen vorgeführt ist. Daneben bittet das Projekt die Hinweise zur Entwicklung der Drehkolbenkraftmaschine zum Marktreife sowie die weitere Perspektiven darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
EINFÜHRUNG
TEIL I
STAND DER TECHNIK BEI VERBRENNUNGSMOTOREN
1 Kurzübersicht über die aus der Patentliteratur und dem Internet bekannten Projekte von Drehkolbenkraftmaschinen
2 Mängel in den konstruktiven Schemata von Verbrennungsmotoren
3 Innovationen und Erfindungen
TEIL II
DREISTUFIGE DREHKOLBENKRAFTMASCHINE MIT KONTINUIERLICHEM BRENNPROZESS
Aufbau, Wirkungsweise und Betriebsverhalten
1 Konstruktion der dreistufigen Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess
2 Arbeitsprozess
3 Betriebsverhalten und Beschaffenheit
4 Kundennutzen
5 Marktpotenzial mit Zahlendarstellung
6 Experimenteller Prototyp
TEIL III
THERMODYNAMISCHE GRUNDLAGEN
1 Konstruktives Schema der Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess
2 Volumina
3 Thermodynamisches Modell des Arbeitsprozesses
4 Berechnung der Parameter und Charakteristika der Drehkolbenkraftmaschine
5 Analyse der thermodynamischen Berechnungen
ANHANG: TABELLEN UND DIAGRAMME
WEITERE FORSCHUNGEN
1 Berechnung der Druckschwankungen in der Brennkammer (/Umdrehung)
2 Typischer Drehmomentverlauf auf der Leistungswelle pro Umdrehung des Hauptrotors
3 Drehkolbenkraftmaschinen für die allgemeine Verwendung nach Leistung
4 Verbrauchernutzen
5 Weitere Perspektive
LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Dreistufige Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess – Längsschnitt
Abbildung 2: Querschnitt B-B durch die Verdichterstufe
Abbildung 3: Spezifische Profile des Kamms und der Vertiefung des Hauptläufers
Abbildung 4: Vorrichtung für die Herstellung der Schablonen
Abbildung 5: Querschnitt D-D durch die Expansionsvorstufe
Abbildung 6: Querschnitt F-F durch die Expansionsendstufe
Abbildung 7: Rückdeckel – Ansicht G-G 20
Abbildung 8: Einlassrohr, Verbindungsrohr und Brennrohr mit Brennkammer
Abbildung 9: Querschnitte U-U und V-V durch die Zwischenwand mit Labyrinthkanälen
Abbildung 10: Vorderdeckel – Schnitt K-K
Abbildung 11: Luftfilteranlage in den Projektionen mit Schnitten
Abbildung 12: Verlauf des Arbeitsprozesses in der Verdichterstufe der Drehkolbenkraftmaschine
Abbildung 13: p-V-Diagramm des Seiliger-Prozesses
Abbildung 14: Druckfluktuation in der Brennkammer (oben) und im Speicherraum (unten) pro Umdrehung des Hauptrotors
Abbildung 15: Typischer Drehmomentverlauf auf der Leistungswelle
Tabellenverzeichnis
Tabelle 4: Thermodynamische Berechnungen der Variante 0
Tabelle 5: Drehzahlender Rotoren nH/nN= 3334/10 000 min-1
Tabelle 6: Drehzahlen der Rotoren nH/nN= 5000/15 000 min-1
Tabelle 8: Technische Charakteristika der Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess im Vergleich mit Kolbenmotor, Wankelmotor und Turbine ähnlicher Leistungen
EINFÜHRUNG
Energie- und Ökologieprobleme sind einige der großen Themen der Zeit. Die Innovationen bei Energietechnologien, darunter bei den Verbrennungsmaschinen, stehen deshalb im Fokus. Zwei Gattungen der Verbrennungsmotoren haben bisher die größte Verbreitung gefunden: traditionelle Kolbenmotoren und Turbomotoren als eine Art Strömungsmaschine. Beide Gattungen haben sowohl Vorzüge als auch Nachteile, genügen aber nicht mehr den ökonomischen und ökologischen Anforderungen der Gegenwart.
Kolbenmotoren haben relativ hohe Wirkungsgrade (wahrscheinlich sind bis zu 50 % möglich) und dadurch einen geringen Kraftstoffverbrauch, ihr wesentlicher Nachteil – kleine Kennwerte bei Leistungsvolumen/Leistungsgewichten – begrenzt aber ihren bisherigen Erfolg. Zum Beispiel ist in der Luftfahrt, wo Triebwerke mit konzentrierter Leistung bei kleinen Gewichten und Ausmaßen gebraucht werden, weiterer Erfolg kaum denkbar. Besonders bei Flugzeugen mit SenkrechtstartZ-Landung ist ihre Verwendung gänzlich unmöglich.
Turbomotoren, die unter den Triebwerken bisher die größten Kennwerte von Leistungsvolumen/Leistungsgewicht aufweisen, haben zwei wesentliche Nachteile, die ihre ökonomische und besonders ökologische Anziehungskraft verderben: Sie haben relativ niedrige Wirkungsgrade und verbrauchen dadurch vergleichsweise mehr Kraftstoff als Kolbenmotoren. Daher erfüllen Triebwerke mit Turbomotoren als Kraftmaschinen die ökonomischen und ökologischen Erwartungen der modernen Zeit in der Luftfahrt meist nicht. Ein weiterer Nachteil besteht in ihren verglichen mit Kolbenmotoren höheren Herstellungs- und Wartungskosten.
Eine moderne, innovative Richtung im Bereich der Verbrennungsmotoren ist die Entwicklung der Rotationskolben-Verbrennungsmotoren, die verspricht, die bekannten Schranken bisheriger Verbrennungsmotoren zu überwinden. Rotationskolbenmotoren zu entwickeln, wird dadurch befeuert, dass sie theoretisch das Potenzial haben, die Leistungskennwerte von Turbomotoren zu erreichen und dabei die Wirkungsgrade und damit den Kraftstoffverbrauch von Kolbenmotoren einzuhalten.
Aber die Entwicklungsversuche stocken. Bisher konnte sich keine Art der Rotationskolbenmotoren auf dem Markt durchsetzen. Nur eine Art der Drehkolbenmotoren – der Wankelmotor – ist zurzeit marktpräsent, hat aber keine nennenswerten Vorteile gegenüber traditionellen Kolbenmotoren und kommt vor allem für spezifische Ziele, z. B. bei unbemannten Flugapparaten, zum Einsatz.
Mit dieser Publikation versuche ich, die Aufmerksamkeit der Spezialisten und der Öffentlichkeit auf die Ursachen der bisher erfolglosen Entwicklung bei Rotationskolbenmotoren zu lenken und Wege zur Überwindung der Entwicklungshürden vorzuschlagen.
Mein Wissen in diesem Bereich und meine darauf aufbauenden Forschungen mündeten in die Erfindung einer Dreistufigen Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess. Die Rechte sind beim DPMA mit drei Patenten und einem Gebrauchsmuster anerkannt und geschützt. Ein viertes Patent (mit einem Zusatz) ist angemeldet. Ein internationales und ein europäisches Patent sind ebenfalls erteilt worden. Angemeldet ist die Erfindung einer Schraubenkraftmaschine, die man als weitere Entwicklung der Familie der Rotationskraftmaschinen mit kontinuierlichem Brennprozess betrachten kann.
Die Darstellungen und Beschreibungen der Patente verdeutlichen die Entwicklungsetappen der Maschine, die mit Computersimulationen und thermodynamischen Berechnungen realisiert wurden.
Nach vier Entwicklungsphasen zeigt sich die „Dreistufige Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess“ als neuer Triebwerkstyp. Von seinem Wesen her ist er ein Hybride – eine Zusammensetzung der Teile eines Drehkolbenmotors und einer Turbine mit wertvollen Synergieeffekten.
Von Kolbenmotoren entlehnt die Drehkolbenkraftmaschine ein Verdrängungsarbeitsprinzip und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch. Von der Turbine übernimmt sie sowohl das Prinzip separater Arbeitsräume für die Verdichtung der Luft, die Verbrennung des Kraftstoffs und die Expansionsarbeit des Gases als auch die freie, aber abgestimmte Rotation der Rotoren in den Verdichtungs- und Expansionsräumen. Diese erfolgt ohne Rotationswandler, abgesehen vom Zahngetriebe für die Übertragung des gemeinsamen Drehmoments auf die Leistungswelle. Am wichtigsten ist, dass die Drehkolbenkraftmaschine von Turbinen das ununterbrochene Brennen des Kraftstoffs in der gesamten Brennkammer übernimmt. Dank dieser Eigenschaften hat die Kraftmaschine solche hohen Leistungskennwerte (Leistung pro Gewicht- oder Volumeneinheit), wie sie bisher nur für Turbinen charakteristisch sind.
Dank geregelten ununterbrochenen Brennprozesses, vollständiger Verbrennung des Kraftstoffs bei ständigem Luftüberfluss während des Brennens und vollständiger Ausdehnung des Gases in seinen Arbeitsräumen hat die Kraftmaschine einen sehr umweltfreundlichen und geräuscharmen Ausstoß. Jeder gasförmige oder flüssige Kraftstoff ist verwendbar, Kryostoffe inklusive.
Bei organischer Zusammensetzung der Teile beider Verbrennungsmaschinen-Gattungen entsteht eine neuartige Wärmemaschine, die sowohl die ökonomischen Verdichter- und Expansionsvorgänge von Kolbenmotoren als auch den kontinuierlichen Brennprozess mit Brennkammern von Turbomaschinen realisiert. Außerdem lässt sich die Brennkammer im Hauptrotor platzieren, umgeben von einem unbeweglichen Brennrohr, das mit von der Verdichterstufe gelieferter komprimierter Luft vor dem Eintritt in die Brennkammer allseitig gekühlt wird. Das Brennrohr isoliert also die Brennkammer im Inneren der Maschine und unterbindet einen Wärmeverlust nach außen, was den Wirkungsgrad positiv beeinflusst.
Versuche in diese Richtung werden schon seit Langem unternommen, z. B. in der RWTH Aachen: Dr.-Ing. Martin Nijs und Univ.-Prof Dr.-Ing. Stefan Pischinger vom Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen an der RWTH Aachen haben mir in ihrem Gutachten vom 18.03.2013 zu meinen Erfindungen freundlicherweise einige Information gewährt. Laut Auszug aus dem Vorlesungsdruck „Alternative und elektrifizierte Fahrzeugantriebe“ der RWTH Aachen wurde ein ähnliches IKV-Verfahren mit kontinuierlicher Verbrennung 1970 von U. Rohs am Institut für Kraftfahrwesen der RWTH Aachen entwickelt und in Experimenten untersucht. Für mich erwiesen sich die Ergebnisse dieser Experimente als große Argumentationshilfe bei meinen Ausarbeitungen. Meine Erwartungen und Vorstellungen der Drehkolbenkraftmaschine wurden durch Rohs’ Bewertung des IKV-Verfahrens bestätigt, denn das IKV-Verfahren bestand gerade in Versuchen mit kontinuierlichem Brennprozess. Die Bewertung ergab im Vergleich mit konventionellen Arbeitsverfahren folgende Vor- und Nachteile (vgl. RWTH Aachen).
Vorteile
Wegen fehlenden Druckanstiegs bei der Verbrennung können hohe Verdichtungsverhältnisse realisiert werden. Dies bewirkt hohe Wirkungsgrade.
Bedingt durch die kontinuierliche Verbrennung ist der Motor vielstofffähig.
Der Verbrennungsablauf innerhalb der Brennkammer kann optimal gesteuert werden, wodurch die Emissionen ohne Abgasnachbehandlung minimiert werden.
Der Motor ist extrem schwingungs- und vibrationsarm (Axialkolbenbauweise, Verbrennung ohne Druckanstieg).
Einfache Zündanlage, denn nur eine Erstzündung der kontinuierlichen Verbrennung ist notwendig.
Weitreichende Möglichkeiten zur Wirkungsgradsteigerung (Überexpansion, regenerative Abgaswärmenutzung, Aufladung).
Nachteile
– Es liegen hohe thermische Belastungen der Brennkammer und der Ladungswechselkanäle zum Expansionstriebwerk vor.
– Steuerung des Heißgases ist problematisch.
Wie auch weitere Materialien über Drehkolbenkraftmaschinen zeigen, können alle oben genannten Vorteile bei Drehkraftmaschinen realisiert werden, einschließlich Steuerung des Heißgases. Die „hohen thermischen Belastungen der Brennkammer und der Ladungswechselkanäle“ werden bei Drehkolbenkraftmaschinen durch das Luftüberflussverfahren beim Brennen reduziert. Die Kühlung dieser Elemente erfolgt hauptsächlich durch die Eintrittsluft aus der Verdichterstufe mit niedriger Temperatur, die vor dem Eintritt in die Brennkammer das Brennrohr mit der Brennkammer im Inneren allseitig umspült und kühlt sowie die Ladungswechselkanäle mit einer Grenzluftschicht schützt. Die Anwendung standardisierter hitzebeständiger Stähle o-der hochwarmfester Fe-Co- oder Ni-Legierungen wird womöglich nur an einzelnen Stellen nötig sein.
Zudem ist auch die Steuerung des Heißgases realisiert – ein Mittel oder Instrument für die nachhaltige Entwicklung des experimentellen Prototyps zur vollkommenen Kraftmaschine, indem mit der Optimierung der Kühlsysteme bei experimenteller Durcharbeitung des Prototyps die Temperatur des Arbeitsgases und die Wirkungsgrade nachhaltig erhöht werden können. Von Bedeutung ist auch, dass die Kühlung der Brennkammer durch die Eintrittsluft erfolgt. Damit wird Wärme in den Arbeitsprozess zurückgegeben und Verluste nach außen reduziert, was den Wirkungsgrad weiter steigert.
Diese Erläuterungen waren nicht Bestandteil meines bei der RWTH Aachen vorgelegten Konzepts, das dann wie folgt begutachtet wurde:
Vorteilhaft an dem Konzept ist die kontinuierliche Verbrennung, welche einen schadstoffarmen Betrieb der Maschine ermöglicht. Nachteilig ist der maximal mögliche Wirkungsgrad der Maschine zu nennen. Die Brennkammer und der Einlass des Expanders sind ständig der maximalen Prozesstemperatur ausgesetzt, was den Einsatz hochtemperaturfester, teurer Materialen erfordert und die maximale Prozesstemperatur limitiert und somit zu niedrigen Wirkungsgraden im Vergleich zum Verbrennungsmotor führt. Im Vergleich zu Gasturbinen lässt sich wahrscheinlich bei kleinen Maschinengrößen ein höherer Wirkungsgrad, speziell im Teillastbetrieb erreichen, jedoch wird die spezifische Leistung der Maschine aufgrund des höheren Leistungsgewichtes von Verdrängermaschinen im Vergleich zu Strömungsmaschinen niedriger ausfallen. Für größere Maschinen, Kraftwerksturbinen oder Luftstrahl-Triebwerke sind die Strömungsmaschinen im Wirkungsgrad besser als die Verdrängungsmaschinen und Ihre Erfindung somit nicht vorteilhaft. Für die Verdrängerverdichter und -expander setzen Sie einen Drehkolbenverdichter ein, welcher nur begrenzt bewertet werden kann, da aussagekräftige Zeichnungen und Systembeschreibungen nicht vorliegen. Jedoch stellt die Abdichtung auf der Stirnseite der Drehkolben eine Herausforderung dar.
insgesamt sehen wir auf Grund des eher ungünstigen Verhältnisses von Vorteilen und Nachteilen wenige Chancen für die Realisierung dieses Konzepts in der Serie.
Obwohl das Gutachten nicht positiv ausfiel – ich erwartete kein sofort positives Gutachten, da die ausführlichen Materialien zur Konstruktion und die thermodynamischen Auslegungen nicht beigelegen hatten –, fühle ich mich bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein.
In der Tat konnten die 1970 durchgeführten Experimente mit voneinander getrennten Einzelmaschinen nicht positiv ausfallen, denn mit schweren Einzelteilen und nicht geregeltem Temperaturregime sind kein Schutz der Konstruktion vor hohen Temperaturen sowie keine hohen Leistungsgewichte und Wirkungsgrade möglich. Dabei waren auch keine rationelle Wärmeabfuhr und keine Steuerung der Gastemperatur möglich. Zusammengefasst hat Rohs damals mit Maschinen experimentiert, die keine Ähnlichkeit mit der erfundenen Drehkolbenmaschine haben.
Bei der dreistufigen Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess sind alle von Rohs entdeckten Probleme gelöst und die Lösungen mit thermodynamischen Berechnungen belegt. Für die thermodynamischen Begründungen wurden von mir ein thermodynamisches Modell des Arbeitsprozesses sowie ein Berechnungsalgorithmus für ein Microsoft-Excel-Arbeitsblatt ausgearbeitet. Nach Angabe der gewünschten Leistung und Drehzahlen sowie etlicher anderer Begrenzungen und Konstanten berechnet der Algorithmus zahlreiche Bauvarianten der Maschine, aus denen dann die Variante ausgewählt werden kann, die der Bestimmung der Maschine und den Limitierungen bei Material, Herstellungstechnologie usw. entspricht.
Die Berechnungsdaten ergeben alle Parameter des Förderstroms in allen Teilen der Drehkolbenkraftmaschine sowie die Charakteristiken der Maschine wie Wirkungsgrade, Kraftstoffverbrauch, Abwärme, Dimensionen etc.
Durch die Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten und die umweltschonenden und Ressourcen sparenden Eigenschaften ergibt sich ein äußerst diversifiziertes Marktpotenzial für die Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess. Ein Einsatz der Drehkolbenkraftmaschine ist vor allem im Bereich der Automobilindustrie, Luft- und Schifffahrt, aber auch in Schienenfahrzeugen, Straßenbau und Bergbau denkbar.
Für die Anwendung in der Schwerindustrie hat die Maschine eine besondere Eigenschaft: „direkten Zug“. Nach entsprechenden Projektvorgaben konstruiert könnte sie also ein großes Anfangs-Drehmoment entwickeln, sodass bei etlichen Verwendungen kein Reduziergetriebe nötig ist.
Bedeutendes Marktpotenzial für die Drehkolbenkraftmaschine wird in der Automobilindustrie (Pkw, Lkw) gesehen, und hier nicht nur im Segment „Motoren für Neufahrzeuge“, sondern ebenfalls im Bereich der Nachrüstung.
Zurzeit gibt es einen bevorzugten Zielmarkt – sogenannte „Range Extender“ für die Versorgung eines leicht gebauten Elektrofahrzeugs. Daher würde eine Auslegung der Kraftmaschine bei 30–50 kW vermutlich Vorteil bringen.
Zweites aktuelles Einsatzgebiet wäre die Versorgung eines Mehrfamilienhauses mit einem Mini-Blockheizkraftwerk. Für diese Zwecke reicht vermutlich eine Auslegung der Kraftmaschine auf weniger als 30 kW aus.
Die vorliegende Publikation ist auch ein Versuch, Investoren und Unternehmen mit entsprechendem Equipment und Erfahrungen zum Bau des ersten experimentellen Prototyps zu finden. Die Baupläne (Generalplan und sog. Sprengzeichnungen) eines Prototyps mit einer Leistung von 100 kW habe ich bereits angefertigt.
Die Ausarbeitung der weiteren Dokumentation zum Bau und zur Herstellung wird durch die Verwendung ausschließlich frei zugänglicher, in Shops käuflicher oder auf Bestellung gefertigter Elemente und Waren (z. B. Hochleistungs-Gleitringdichtungen oder Brennkammer mit Brennkopf) für die innere Füllung erheblich erleichtert. Auswahl bzw. Nachbesserungen bei der Füllung sind zu optimieren und an die Beschaffenheit der Kraftmaschine anzupassen.
Für einen erfolgreichen Anfang der Experimente ist aus den Berechnungsdaten die Variante mit niedrigen Wärmebelastungen auserkoren. Dadurch wird die Maschine zunächst keine hohe Effizienz zeigen (hohe Leistungskennwerte und Wirkungsgrade), da sie mit hohem Luftüberschuss beim Brennen des Kraftstoffs1





























