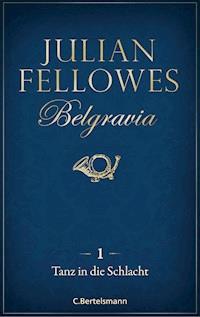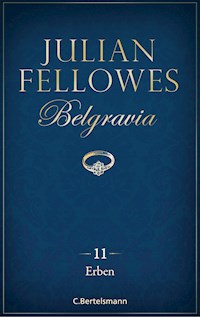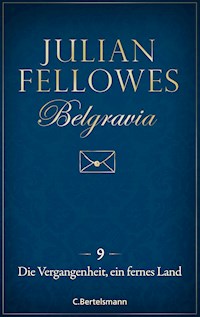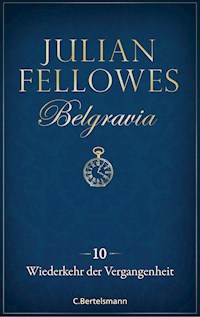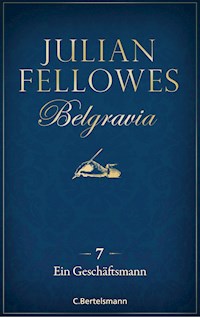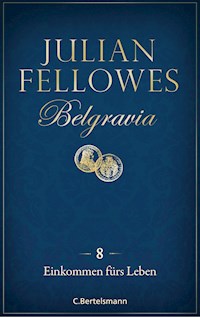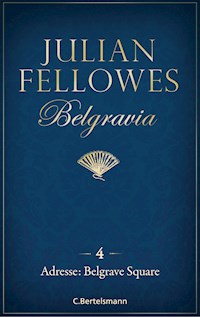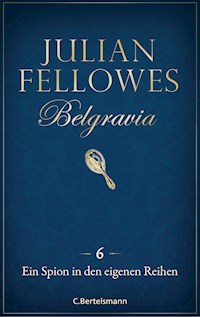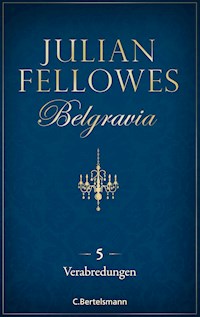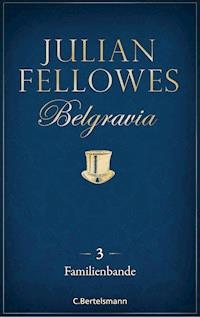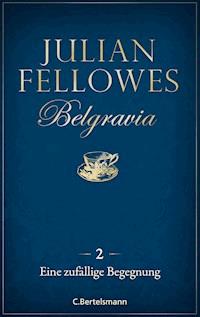5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman über die wirklich feinen Leute in London – very, very British
Julian Fellowes ist nicht nur Oscar-gekrönter Drehbuchautor, sondern auch ein Meister der englischen Gesellschaftskomödie, wie er es hier erneut unter Beweis stellt. Damian Baxter ist steinreich und weiß, dass er bald sterben wird. Er hat nie geheiratet und lebt alleine mit Chauffeur, Butler, Koch, Hausmädchen und allem was dazu gehört. Was ihn aber seit langem umtreibt ist ein anonymer Brief, den er vor zwanzig Jahren erhalten hat. Könnte es tatsächlich sein, dass er damals einen Sohn gezeugt hat? Der einzige, der ihm helfen kann, dies herauszufinden, ist der Mann, mit dem er seit Jahrzehnten tödlich verfeindet ist. Julian Fellowes nimmt die Leser mit in die untergehende Welt des englischen Adels. Und er tut es mit enormer Eleganz und feinstem englischen Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Für Emma und Peregrine,
ohne die ich überhaupt nie etwas zu Papier brächte
Damian
1
London ist für mich zur Geisterstadt geworden, ich selbst zum Gespenst, das darin umgeht. Bei meinen täglichen Besorgungen ist mir, als flüstere jede Straße, jeder Platz, jede Allee von einem vergangenen Lebensabschnitt. Jeder noch so kurze Weg durch Chelsea oder Kensington führt mich an einer Tür vorbei, wo ich einst willkommen war, heute aber ein Fremder bin. Ich sehe mich heraustreten, als junger Mann, herausstaffiert für einen längst vergessenen Anlass, nach einer flippigen Mode, die an die Nationaltrachten irgendwelcher Balkanländer erinnert. Diese wehenden Schlaghosen, diese kragenlosen Rüschenhemden – was haben wir uns bloß dabei gedacht? Und neben meinem jüngeren, schlankeren Selbst tauchen andere Schatten auf, Eltern, Großmütter, Großonkel und Cousins, Freunde und Freundinnen, fortgegangen aus dieser Welt oder zumindest aus dem Leben, das mir geblieben ist. Es gilt als Zeichen des Alterns, wenn die Vergangenheit uns näher ist als die Gegenwart, und schon jetzt spüre ich, wie die Bilder längst verflossener Jahrzehnte nach mir greifen, Bilder, neben denen sich alle Erinnerungen neueren Datums matt und grau ausnehmen.
Verständlich also, dass ich neugierig, um nicht zu sagen verblüfft war, als ich zwischen den Rechnungen, Dankeskärtchen und Spendenaufrufen, die sich täglich auf meinem Schreibtisch stapeln, einen Brief von Damian Baxter fand. Das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Seit fast vierzig Jahren hatten wir uns weder gesehen noch gehört, hatten, so merkwürdig es klingt, in verschiedenen Welten gelebt. England ist zwar in vielem ein kleines Land, aber groß genug, dass sich unsere Pfade in all den Jahren kein einziges Mal kreuzten. Allerdings gab es noch einen anderen, simpleren Grund für meine Überraschung.
Ich hasste ihn.
Ein Blick genügte, um ihn als Absender zu erkennen. Die Handschrift auf dem Umschlag war mir vertraut, freilich verändert wie das Gesicht eines Lieblingsneffen, dem die Jahre schonungslos zugesetzt haben. Selbst wenn sich meine Gedanken jemals zu Damian verirrt hätten, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er mir einmal schreiben könnte. Oder ich ihm. Ich möchte rasch klarstellen, dass mir seine unerwartete Nachricht keineswegs unangenehm war. Es ist stets erfreulich, von einem alten Freund zu hören, und von einem alten Feind in meinem Alter womöglich noch reizvoller. Denn anders als ein Freund hat er so manches über die eigene Vergangenheit zu erzählen, was man noch nicht weiß. Damian war kein Feind im Sinne eines aktiven Gegners, sondern schlimmer noch, ein ehemaliger Freund. Wir waren im Streit auseinandergegangen, in einem Moment rasender, ungebremster Wut, gezielt darauf aus, alle Brücken zu sprengen; dann hatten wir getrennte Wege eingeschlagen und nie versucht, die Trümmer aus dem Weg zu räumen.
Ich muss schon sagen, der Brief war sehr freimütig. Der typische Engländer wird eine Situation, die mit peinlichen Erinnerungen belastet ist, niemals direkt ansprechen. Er wird alles Unangenehme mit vagen Andeutungen herunterspielen: »Erinnerst du dich an dieses schreckliche Dinner, zu dem Jocelyn uns eingeladen hat? Wie haben wir das bloß überlebt?« Oder wenn der Stachel auf diese Weise nicht gezogen, der Vorfall nicht verharmlost werden kann, wird er einfach totgeschwiegen. Die Gesprächseröffnung »Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen« bedeutet in Wirklichkeit oft: »Von mir aus können wir diesen Streit gern begraben. Die Sache liegt doch schon ewig zurück. Schwamm drüber – einverstanden?« Ein williges Gegenüber wird die Antwort in ähnlich verdrängende Floskeln verpacken: »Ja, treffen wir uns doch mal. Was hast du denn so getrieben, seitdem du bei Lazard aufgehört hast?« Mehr braucht es nicht an Signalen, dass alter Groll ausgeräumt ist und der Weg wieder frei für normale Beziehungen.
Doch Damian wich vom Üblichen ab, mit einem geradezu mediterranen Mitteilungsdrang. »Ich schätze, nach allem, was passiert ist, hast Du nicht damit gerechnet, noch einmal von mir zu hören. Aber Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn Du mich besuchen kämst«, schrieb er in seiner immer noch ziemlich temperamentvollen, steilen Handschrift. »Nach unserer letzten Begegnung kann ich mir vorstellen, dass Du nicht viel Lust dazu hast. Ich will kein großes Trara machen, aber ich habe nicht mehr lange zu leben, und einem Sterbenden einen Gefallen zu tun, bedeutet Dir ja vielleicht doch etwas.« Langes Herumdrucksen konnte man ihm jedenfalls nicht vorwerfen. Eine Weile machte ich mir vor, ich müsse es mir überlegen, aber insgeheim war ich sofort entschlossen zu fahren, schon um meine Neugier zu stillen und das versunkene Atlantis meiner Jugend noch einmal aufzusuchen.
Auch wenn es gewisse Gefahren birgt, stemme ich mich nicht länger gegen die traurige Erkenntnis, dass das Leben in meinen jungen Jahren generell erfreulicher war als jetzt. Die heutige Jugend verteidigt verständlicherweise ihre eigene Zeit, was ihr auch zusteht, und wehrt sich gegen unseren nostalgischen Rückblick auf ein goldenes Zeitalter, als der Kunde noch König war, Pannenhelfer vor den Plaketten der Automobilclubs salutierten und Polizisten grüßend an den Helm tippten. Gott sei Dank ist Schluss mit diesen unterwürfigen Respektbezeugungen, heißt es jetzt. Aber solche Respektbezeugungen gehörten zu jener geordneten, sicheren Welt, die im Nachhinein Geborgenheit und sogar Freundlichkeit ausstrahlt. Diese Freundlichkeit, die England vor einem halben Jahrhundert zu eigen war, vermisse ich am meisten. Oder vermisse ich doch eher meine Jugend?
»Wer ist dieser Damian Baxter eigentlich? Warum ist er so wichtig ?«, fragte Bridget, als wir später am Abend zu Hause saßen und den überteuerten und zu knapp gegarten Fisch aßen, den wir von unserem italienischen Stammlokal um die Ecke geholt hatten. »Du hast ihn noch nie erwähnt.« Als Damians Brief eintraf, wohnte ich noch in einer geräumigen Erdgeschosswohnung in Wetherby Gardens, die neben Behaglichkeit alle möglichen weiteren Vorzüge bot, nicht zuletzt eine günstige Lage für die Take-away-Kultur, die uns in den letzten Jahren überrollt hat. Eine einigermaßen vornehme Adresse; ich hätte mir die Wohnung nie selbst kaufen können, sie wurde mir von meinen Eltern überlassen, als sie vor Jahren aus London wegzogen. Die Einwände meines Vaters wischte meine Mutter kühn mit dem Argument beiseite, ich bräuchte schließlich eine Starthilfe; dem hatte er sich dann gefügt. So profitierte ich von der Großzügigkeit meiner Eltern und betrachtete die Starthilfe bald als endgültige Bleibe. Die Einrichtung, an der ich nicht viel verändert hatte, stammte noch von meiner Mutter, an ihrem kleinen, runden Frühstückstisch im Erker fand meine Unterhaltung mit Bridget statt. Die bezaubernden Regency-Möbel und der als lockiger Knabe porträtierte Ahne über dem Kamin hätten wohl ein dezidiert weibliches Flair verbreitet, hätte sich meine Männlichkeit nicht in Form eines eklatanten Desinteresses behauptet, das Mobiliar gefällig zu arrangieren.
Bridget FitzGerald war meine momentane – beinahe hätte ich gesagt »feste Freundin«, aber ich bin nicht sicher, ob über Fünfzigjährige so etwas noch für sich reklamieren können. Der Begriff »Partnerschaft« ist nicht nur abgenutzt, sondern auch mit Gefahren behaftet. Kürzlich habe ich den Leiter einer mir gehörenden kleinen Firma als meinen »Partner« vorgestellt, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich die Blicke etlicher Leute, die mich zu kennen glaubten, richtig einordnen konnte. »Bessere Hälfte« wiederum klingt nach Seifenoper mit einer Golfklubsekretärin in der Hauptrolle, und die Stufe, bei der ich von »meiner Lebensgefährtin« sprechen würde, hatten wir noch nicht erreicht, obwohl wir nicht mehr weit davon entfernt waren. Jedenfalls waren Bridget und ich »zusammen«, ein etwas ungleiches Paar, ich ein mäßig berühmter Romanschriftsteller und sie eine geschäftstüchtige Immobilienmaklerin, eine gewitzte Irin, die den Zug der romantischen Liebe verpasst hatte und bei mir gelandet war.
Meine Mutter hätte die Beziehung nicht gutgeheißen, aber meine Mutter war tot und zählte daher nicht. Theoretisch. Ich glaube nicht, dass wir uns der Missbilligung unserer Eltern, tot oder lebendig, je entziehen können. Vielleicht hätte ich auf ihr posthumes Geflüster hören sollen, da ich nicht behaupten kann, Bridget und ich hätten viel gemeinsam. Doch war sie intelligent und sah gut aus, was mehr war, als mir zustand, und ich war wohl einsam und hatte die Anrufer satt, die mich am Sonntag zum Lunch einladen wollten. Wie auch immer, wir hatten uns gefunden, und obwohl wir nicht zusammenlebten, da Bridget ihre Wohnung behalten hatte, gingen wir seit ein paar Jahren friedlich gemeinsamer Wege. Von Liebe würde ich nicht direkt sprechen, aber uns verband doch etwas.
An Bridgets Frage amüsierte mich, wie besitzergreifend sie von meiner Vergangenheit sprach, von der sie naturgemäß wenig bis gar nichts wissen konnte. Der Satz »Du hast ihn noch nie erwähnt« konnte nur heißen: »Wäre dieser Typ von Bedeutung, hättest du doch von ihm erzählt.« Oder schlimmer noch: »Dann hättest du von ihm erzählen sollen.« Es ist ja ein weit verbreiteter Irrglaube, jeder habe das Recht, über seinen Partner alles bis ins kleinste Detail zu erfahren. »Wir haben keine Geheimnisse voreinander«, behaupten strahlende junge Gesichter von der Kinoleinwand herab. Blanker Unsinn. Wir wissen alle sehr wohl, dass unser Leben voller Geheimnisse ist, die wir oft sogar vor uns selbst verbergen. Bridget wurde offensichtlich von der Sorge umgetrieben, wie viel Wichtiges ich ihr neben Damian sonst noch vorenthielt. Dazu kann ich nur sagen, dass auch für mich ihre Vergangenheit, wie im Grunde die eines jeden Menschen, ein Buch mit sieben Siegeln war. Gelegentlich gestatten wir anderen einen kleinen Einblick, aber meist nur oberflächlich. Was sich in den dunklen Tiefen abspielt, machen wir lieber mit uns alleine ab.
»Ein Freund aus Cambridge-Zeiten«, sagte ich. »Wir haben uns im zweiten Studienjahr kennengelernt, Ende der Sechzigerjahre. Ich habe damals die Saison mitgemacht, viele Gesellschaften besucht und Damian einigen Mädchen vorgestellt. Sie nahmen ihn in ihre Kreise auf, und wir sind eine Weile zusammen durch London gezogen.«
»Zum Entzücken der Debütantinnen«, kommentierte Bridget halb spöttisch, halb amüsiert.
»Schön, dass dir meine Vergangenheit stets ein Lächeln auf die Lippen zaubert.«
»Und danach?«
»Wir haben uns nach dem Studium aus den Augen verloren, da gibt es nichts weiter zu berichten. Wir haben einfach verschiedene Richtungen eingeschlagen.« Das war natürlich eine glatte Lüge.
Bridget sah mich an; sie hatte mehr herausgehört, als mir lieb war. »Du willst vermutlich allein hinfahren.«
»Ja. Ich werde allein hinfahren.« Ich lieferte keine weiteren Erklärungen, muss aber fairerweise einräumen, dass sie auch keine verlangte.
Früher hatte ich Damian Baxter für mein Geschöpf gehalten, was nur zeigt, wie naiv ich war. Wie jeder weiß, kann der beste Zauberer der Welt kein Kaninchen aus dem Hut zaubern, wenn es nicht schon vorher drinsteckt. Damians Erfolg, den ich mir als Verdienst anrechnete, wäre nie eingetreten, hätte Damian nicht jenes außerordentliche Format besessen, dank dessen er triumphierte, ja triumphieren musste. Dennoch glaube ich nicht, dass er als junger Mann ganz ohne Hilfe in der besseren Gesellschaft Furore gemacht hätte, schon gar nicht zur damaligen Zeit. Und diese Hilfe bekam er von mir. Vielleicht der Grund, warum mir sein Verrat so bitter aufstieß. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel oder versuchte es zumindest, war aber doch verletzt. In meinen Augen hatte sich das Geschöpf gegen seinen Schöpfer gewandt.
»Dein Besuch wäre mir zu jeder Tageszeit recht«, hieß es weiter im Brief. »Ich gehe nicht mehr aus, noch empfange ich Gäste, stehe Dir also voll und ganz zur Verfügung. Ich wohne in der Nähe von Guildford. Die Fahrt von London dauert mit dem Auto bis zu eineinhalb Stunden, mit dem Zug bist Du schneller. Gib mir einfach Bescheid, dann schicke ich Dir entweder eine Anfahrtskizze oder lass Dich vom Bahnhof abholen – was Dir lieber ist.« Ich zögerte eine Weile, doch dann antwortete ich, schlug Damian vor, am Soundsovielten zum Dinner zu kommen, und nannte ihm meinen Zug. Er bestätigte den Termin mit einer Einladung, über Nacht zu bleiben. Ich nahm gern an, weil ich nach einem Abendessen auf dem Lande nicht mehr den Weg nach Hause antreten möchte, und so traf ich an einem milden Sommerabend im Juni am Bahnhof von Guildford ein und passierte die Sperre.
Ich ließ den Blick schweifen und suchte nach irgendeinem Osteuropäer mit einem Schild, auf dem mit Filzstift geschrieben mein falsch buchstabierter Name stünde. Stattdessen trat ein Chauffeur in Livree auf mich zu – jemand, der aussah, als spielte er in einem Agatha-Christie-Film den Chauffeur. Er stellte sich leise und zurückhaltend vor, setzte seine Schirmmütze wieder auf und führte mich hinaus zu einem neuen Bentley, der vorschriftswidrig auf dem Behindertenparkplatz stand. Ich sage »vorschriftswidrig«, obwohl in der Windschutzscheibe gut sichtbar ein Behindertenausweis lag, denn diese Ausweise werden vermutlich nicht ausgestellt, um Gäste vom Zug abholen zu können, damit sie nicht nass werden oder mit ihrem Gepäck allzu weit laufen müssen. Aber schließlich verdient jeder ab und zu einen kleinen Bonus.
Ich wusste, dass Damian zu Wohlstand gekommen war, konnte mich aber nicht entsinnen, woher diese Information stammte, denn wir hatten keine gemeinsamen Freunde und bewegten uns in völlig verschiedenen Kreisen. Wahrscheinlich hatte ich seinen Namen im Finanzteil der Sunday Times gelesen. Vom Ausmaß seines Wohlstands hatte ich jedoch nichts geahnt. Wir flitzten über die Landsträßchen von Surrey, und die akkurat gestutzten Hecken, die verfugten Bruchsteinmauern, Rasenflächen wie Billardtische und gleißende, unkrautfreie Kieswege sprachen für sich: Wir hatten das Reich des Großen Geldes betreten. Hier gab es keine bröckelnden Torpfeiler, keine leeren Stallungen und kein Pförtnerhäuschen mit leckem Dach, hier war nichts zu spüren von Tradition und einstiger Grandeur. Was ich hier sah, war nicht der ferne Nachklang, sondern die lebendige Präsenz von Geld. Viel Geld.
Das Milieu war mir nicht völlig fremd. Als einigermaßen erfolgreicher Schriftsteller kommt man, um mit Nanny zu sprechen, mit» allen möglichen Leuten« in Berührung. Aber so ganz meine Welt war das nicht. Das Vermögen der meisten sogenannten Reichen, mit denen ich persönlich bekannt bin, ist steinalt und im Vergleich zu früher erheblich geschrumpft. Aber die Häuser, an denen ich nun vorbeifuhr, gehörten Neureichen, ein spürbarer Unterschied. Für mich hat die unmittelbare Ausstrahlung von Macht etwas durchaus Erfrischendes. Eigenartig, aber neuem Geld begegnet man in Großbritannien auch heute noch mit einem gewissen Snobismus. Man würde erwarten, die Naserümpfer fänden sich unter den traditionell Konservativen, aber paradoxerweise ist es oft die intellektuelle Linke, die ihr Missfallen über die aus eigener Kraft Emporgekommenen hinausposaunt. Ich begreife nicht ganz, wie sich das mit dem Konzept der Chancengleichheit vereinbaren lässt. Vielleicht will man das auch gar nicht erklären, sondern gehorcht einfach widersprüchlichen Impulsen, wie wir alle bis zu einem gewissen Grad. Falls auch ich in meiner Jugend einem derart fantasielosen Denken verfallen war, dann habe ich es mittlerweile völlig abgelegt. Heute bewundere ich rückhaltlos alle Männer und Frauen, die ihr Glück gemacht haben, und jeden, der sich nicht scheut, den bei seiner Geburt vorskizzierten Zukunftsplan zu zerreißen und einen besseren zu entwerfen. Solche Menschen haben größere Chancen auf ein befriedigendes Dasein als die meisten anderen. Ich ziehe den Hut vor ihnen und ihrer gleißenden Welt. Doch von einem persönlichen Standpunkt aus fand ich es extrem ärgerlich, dass Damian Baxter zu ihnen gehörte.
Als Rahmen für seine Prachtentfaltung hatte er nicht etwa das Schloss eines verarmten Adeligen gewählt, sondern eines jener verschachtelten, verklemmten Landhäuser der Arts & Crafts-Bewegung, die in ihrer Weitläufigkeit an einen Kaninchenbau erinnern, schon zu ihrer Entstehungszeit um die letzte Jahrhundertwende nicht als Symbol Altenglands taugten und heute wie Disneyfilmkulissen anmuten. Umgeben war es von gepflegten, terrassierten Gärten mit säuberlich gejäteten Kieswegen; weitere Ländereien schienen nicht dazuzugehören. Offenbar folgte Damian nicht dem gängigen Modell, den Landadel zu imitieren. Sein Zuhause war kein Herrensitz im Schoße von Feldern und Weiden, sondern lediglich das Domizil eines großen Erfolgs.
Das ganze Anwesen strahlte das Flair der Dreißigerjahre aus, als wäre es von einem Kriegsgewinnler aus dem Ersten Weltkrieg erbaut worden. Erst der Agatha-Christie-Chauffeur, und jetzt auch noch ein Butler, der sich an der Tür verneigte … Auf dem Weg zur hellen Eichentreppe erblickte ich sogar ein Dienstmädchen, eine junge Frau in schwarzem Kleid und Rüschenschürze, die nicht ganz so steif wirkte; plötzlich fühlte ich mich in ein Gershwin-Musical versetzt. Der eigenartige Eindruck eines unwirklichen Abenteuers verstärkte sich noch, als ich zu meinem Zimmer gewiesen wurde, ohne vorher meinen Gastgeber begrüßt zu haben. So etwas riecht immer nach Krimi, nach Gefahr; mir lief ein leiser Schauer über den Rücken. Und ein dunkel gekleideter Diener, der einem an der Zimmertür zumurmelt: »Wenn Sie bitte nach unten in den Salon kommen möchten, Sir, sobald Sie bereit sind«, passte eher zu einer Testamentseröffnung als zu einem Freundschaftsbesuch. Doch das Zimmer selbst war sehr hübsch, ausgeschlagen mit dem gleichen blassblauen Damast, mit dem auch das hohe Himmelbett bespannt war. Das Mobiliar war solide englische Handwerksarbeit und die Chinoiserie-Bilder zwischen den Fenstern wirklich bezaubernd, auch wenn das Ganze einen Beigeschmack von Landhaushotel hatte. Ein Eindruck, den das spektakuläre Bad unterstrich, die ausladende Wanne, die begehbare Dusche, die glänzenden Armaturen auf hohen, direkt aus dem Fußboden aufsteigenden Rohren, die riesigen, flauschigen, brandneuen Handtücher. So etwas findet sich, wie wir wissen, in ländlichen Privathäusern selten. Ich machte mich frisch und ging nach unten.
Der Salon erweckte mit seiner gewölbten Decke den Eindruck einer geräumigen Höhle, einer Höhle voller übertrieben weicher, viel zu neuer Teppiche, die sich auffallend von den abgetretenen alten Persern in traditionsreichen Häusern unterschieden. Alles in diesem Raum war innerhalb eines Menschenlebens zusammengekauft, wahrscheinlich von einer einzigen Person. Das hatte nichts vom bunten Sammelsurium ländlicher Adelssitze, wo die Ausbeute aus einem Dutzend Häusern, über zwei, drei Jahrhunderte hinweg von vierzig Amateursammlern zusammengetragen, in einem einzigen Raum abgeladen wird. Aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Es war sogar ausgezeichnet; das Mobiliar stammte größtenteils aus den Anfangsjahren des achtzehnten Jahrhunderts, die Bilder eher aus späteren Epochen, alles von hervorragender Qualität, blitzblank und tipptopp. Wie mein Zimmer oben. Ob Damian wohl einen Innendekorateur beauftragt hatte, seinem Leben einen stilvollen Rahmen zu geben? Von Damians Persönlichkeit allerdings – überhaupt von Persönlichkeit – war nichts zu spüren. Ich schlenderte herum, sah mir die Bilder an, wusste nicht recht, ob ich stehen bleiben oder mich setzen sollte. Bei allem Glanz herrschte eine gewisse Tristesse; die glühenden Kohlen auf dem Kaminrost konnten die klamme Luft nicht vertreiben, als wäre der Raum sauber gehalten, aber längere Zeit nicht benutzt worden. Und es gab keine Blumen, nichts Lebendiges, für mich immer ein vielsagendes Indiz; die ganze Perfektion hatte etwas Schales, leblos Steriles. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass bei der Gestaltung der Räumlichkeiten eine Frau eine große Rolle gespielt hatte, geschweige denn ein Kind.
Ein Geräusch an der Tür. »Mein lieber Freund«, sagte eine Stimme. Dieses leichte Zögern, dieser Anflug eines Stotterns – wie gut ich mich daran erinnerte. »Ich hoffe, ich habe dich nicht warten lassen. «
Damian Baxter war immer noch der Alte. Anstelle des breitschultrigen, gut aussehenden jungen Mannes mit den üppigen Locken und dem ungezwungenen Lächeln stand da zwar eine gebeugte Gestalt, die unwillkürlich an entlassene Kriegsgefangene denken ließ, aber er hatte immer noch dieses unverwechselbare, unsichere Stottern, mit dem er sein tief wurzelndes, sorgsam kultiviertes Überlegenheitsgefühl kaschierte. Und in der überschwänglichen Geste, mit der er mir seine knochige Hand entgegenstreckte, spürte ich sofort seine alte herablassende Arroganz. Ich lächelte. »Was für ein Vergnügen, dich zu sehen«, sagte ich.
»Tatsächlich?« Wir starrten einander ins Gesicht und staunten, wie vieles darin verändert, wie vieles aber auch gleich geblieben war.
Und als ich ihn so scharf unter die Lupe nahm, erkannte ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte, als er sich in seinem Brief als Sterbenden bezeichnete. Er war nicht nur vorzeitig gealtert, sondern sehr krank. Allem Anschein nach unheilbar krank. »Na, zumindest interessant. Das kann man doch wohl sagen, oder?«
»Ja, das kann man sagen.« Er nickte dem Butler zu, der in Türnähe bereitstand. »Ob wir wohl etwas Champagner bekommen könnten? « Es überraschte mich nicht, dass Damian auch noch nach vierzig Jahren seine Befehle gern als schüchterne Frage ausgab. Das hatte ich oft genug miterlebt. Wie viele, die sich dieses Tricks bedienen, glaubte Damian wohl, damit einen charmanten Mangel an Selbstsicherheit zu suggerieren, ein ungeschicktes, aber ehrenwertes Bestreben, alles richtig zu machen. Dabei wusste ich genau, dass er nicht einmal 1967 so empfunden hatte. Der Angesprochene fühlte sich auch nicht zu einer Antwort bemüßigt, sicher zu Recht. Er ging einfach den Schampus holen.
Das Dinner, eine gedämpfte, förmliche Angelegenheit, fand in einem Esszimmer statt, in dem sich ein etwas unglücklicher Stilmix breitgemacht hatte. Hohe Sprossenfenster, ein wuchtiger Kamin aus gemeißeltem Stein und ein weiteres Flauschteppichexemplar waren die bestimmenden Elemente dieses seltsam öden Raums, der an ein kahles, aber teures Anwaltsbüro erinnerte, in das man aus unerfindlichen Gründen einen Esstisch und Stühle hineingestellt hatte. Das Essen war ausgezeichnet, wenn auch an Damian verschwendet, aber den Margaux, den er ausgewählt hatte, genossen wir beide. Der stumme Butler, Bassett, ließ uns kaum eine Minute allein, folglich blieb unser Gespräch sehr an der Oberfläche. Mir fiel eine Tante ein, die rückblickend staunte, welcherart Tischgespräche vor dem Krieg geführt worden waren: Anwesende Dienstboten wurden nicht als das geringste Hemmnis empfunden; politische Geheimnisse, Familienklatsch, persönliche Indiskretionen, alles wurde munter vor den Ohren der Dienerschaft ausgebreitet und hat sicher so manchen Abend im örtlichen Pub belebt, wenn auch keine Steilvorlagen für Memoiren geliefert, wie es in unseren geldgierigeren, sensationslüsternen Zeiten garantiert der Fall wäre. Wir Heutigen haben den unerschütterlichen Glauben jener Generation an den eigenen Lebensstil verloren. Ob es uns passt oder nicht – ich für meinen Teil bin sehr froh darüber –, die Zeit hat uns gelehrt, dass es ja Menschen sind, die uns bedienen. Für alle nach 1940 Geborenen haben die Wände Ohren.
So plätscherte das Gespräch dahin. Damian erkundigte sich nach meinen Eltern und ich mich nach den seinen. Mein Vater war von ihm sehr angetan gewesen, aber meine Mutter, auf deren Instinkt in der Regel mehr Verlass war, witterte von Anfang an Scherereien. Sie war jedoch inzwischen gestorben, wie Damians Eltern auch, daher gab das Thema nicht viel her. Und so gingen wir die anderen gemeinsamen Bekannten von früher durch und hatten bald eine beeindruckende Liste beruflicher Enttäuschungen, Scheidungen und unzeitiger Todesfälle beieinander.
Schließlich stand Damian auf und wandte sich an Bassett: »Könnten wir bitte unseren Kaffee in der Bibliothek serviert bekommen? « Wieder dieses leise Fragen, als bäte er um einen Gefallen auf die Gefahr hin, eine Absage zu kassieren. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn Bassett die zögerliche Frage einmal wortwörtlich nähme: »Nein, Sir. Ich fürchte, ich bin im Moment zu beschäftigt. Ich werde versuchen, den Kaffee später zu bringen.« Das hätte ich zu gern einmal erlebt. Aber dieser Butler kannte seine Pflicht und ging hinaus, um den verschleierten Befehl unverzüglich auszuführen. Damian führte mich unterdessen in den schönsten aller bisherigen Räume. Ein früherer Besitzer oder Damian selbst hatte die vollständige Bibliothek eines erheblich älteren Hauses erstanden, Regale aus dunklem, satt schimmerndem Holz, verblendet mit wunderschön geschnitzten Säulen. In einem fein verzierten Kamin aus rosa Marmor brannte auf einem polierten Stahlrost ein Feuer für uns. Flackernde Flammen, glänzende Ledereinbände, hochrangige Gemälde, darunter ein großes, sehr nach Turner aussehendes Seestück und das Porträt eines jungen Mädchens von Lawrence – das alles gab dem Raum eine Wärme, die anderswo im Haus spürbar fehlte. Ich war ungerecht gewesen. Nicht mangelnder Geschmack, sondern mangelndes Interesse war für die Lieblosigkeit der anderen Räumlichkeiten verantwortlich. Die Bibliothek war der Raum, den Damian wirklich bewohnte. Es dauerte nicht lange, bis wir mit Getränken und Kaffee versorgt waren, dann ließ uns der Butler allein.
»Du hast es ja weit gebracht«, eröffnete ich das Gespräch. »Gratuliere.«
»Überrascht dich das?«
»Nicht sonderlich.«
Das nahm Damian mit einem Nicken entgegen. »Wenn du damit meinst, dass ich schon immer ehrgeizig war, dann gebe ich das gerne zu.«
»Ich meinte eher, dass du nie ein Nein akzeptiert hast.«
Er schüttelte den Kopf. »So sehe ich das nicht«, entgegnete er. »Ich wusste stets, wann ich geschlagen war, schon damals. Wenn keine Aussicht mehr auf Erfolg bestand, habe ich mich damit abgefunden und mich anderen Dingen zugewandt. Das musst du mir doch zugutehalten.«
Das war nun wirklich eine haarsträubende Verdrehung der Tatsachen. »Nein, das tue ich nicht. Vielleicht hast du dir diese Tugend später angeeignet, davon weiß ich nichts. Aber zu meiner Zeit waren deine Augen viel größer als dein Magen. Und dass du ein ausgesprochen schlechter Verlierer warst, muss ich schließlich am besten wissen. «
Damian sah mich einen Augenblick überrascht an. Vielleicht hatte er einen so großen Teil seines Lebens mit bezahlten Claqueuren verbracht, dass er mit Widerspruch nicht mehr rechnete. Er nahm einen Schluck Cognac und nickte nach einer Pause. »Mag sein. Aber jetzt bin ich besiegt.« Auf meine unausgesprochene Frage hin erklärte er: »Ich habe inoperablen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da lässt sich nichts mehr machen. Der Arzt gibt mir noch drei Monate.«
»Die Ärzte irren sich oft.«
»Gelegentlich. Aber nicht in meinem Fall. Ein paar Wochen hin oder her, aber mehr ist nicht drin.«
»Oh.« Ich nickte. Man weiß nicht recht, was man auf eine solche Eröffnung erwidern soll, denn die Menschen sind so unterschiedlich. Ich bezweifelte, dass Damian von mir Heulen und Wehklagen erwartete, oder Vorschläge zu alternativen Heilmethoden einschließlich makrobiotischer Diät. Also schwieg ich einfach.
»Du sollst aber nicht glauben, dass ich mit dem Schicksal hadere. In gewisser Weise ist mein Leben zu einem natürlichen Schlusspunkt gekommen.«
»Wie das?«
»Ich war immer vom Glück verwöhnt. Ich habe gut gelebt, bin weit gereist. Und beruflich habe ich keine weiteren Pläne mehr. Ich habe eine Computersoftwarefirma aufgebaut. Wir waren unter den Ersten, die das Potenzial erkannt haben.«
»Sehr schlau.«
»Richtig. Klingt langweilig, aber die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich habe das Unternehmen verkauft und werde kein neues Projekt beginnen.«
»So etwas weiß man nie.« Keine Ahnung, warum ich das sagte, denn natürlich wusste er es ganz genau.
»Ich kann mich nicht beklagen. Meine Firma wurde von einem großen amerikanischen Konzern für eine Summe übernommen, die ausreichen würde, um Malawi zu sanieren.«
»Aber das hast du nicht vor.«
»Nein, eher nicht.«
Er zögerte. Ich war ziemlich sicher, dass wir uns dem Kern der Sache näherten, dem Grund, warum ich hier war, aber Damian schien auf der Stelle zu treten. Da wagte ich einen Vorstoß, um das Gespräch voranzutreiben. »Wie steht’s mit deinem Privatleben?«, fragte ich lächelnd.
Er dachte kurz nach. »Eigentlich habe ich keins. Nichts, was den Namen verdient. Ein gelegentliches zweckdienliches Arrangement, mehr nicht, schon seit vielen Jahren nicht. Ich bin kein geselliger Typ.«
»Warst du damals aber«, wandte ich ein. Ich schluckte schwer an dem »gelegentlichen zweckdienlichen Arrangement«. Allmächtiger! Ich beschloss, lieber keine nähere Klärung anzustreben.
Es bedurfte jedoch keines weiteren Anstoßes, Damian war in Fahrt gekommen. »Wie du weißt, hat mir die Welt, in die du mich eingeführt hast, nicht sonderlich gefallen.« Er sah mich herausfordernd an, doch ich hatte dem nichts entgegenzuhalten, und so fuhr er fort: »Aber als ich ihr den Rücken kehrte, musste ich kurioserweise feststellen, dass mir an den Vergnügungen meiner alten Welt auch nichts mehr lag. Nach einer Weile gab ich ›Partys‹ ganz auf.«
»Hast du geheiratet?«
»Einmal. Die Ehe hat nicht lange gehalten.«
»Das tut mir leid.«
»Nicht nötig. Ich habe nur geheiratet, weil ich das Alter erreichte, wo man sich als Single langsam komisch vorkommt. Mit sechs-, siebenunddreißig fiel mir auf, dass die Leute erstaunt die Augenbrauen hochzogen. Natürlich war meine Reaktion idiotisch. Fünf Jahre später haben meine Freunde begonnen, sich scheiden zu lassen, ich wäre nicht mehr allein im Abseits gestanden.«
»War es jemand, den ich kenne?«
»Sicher nicht. Ich war damals deinen Kreisen schon entronnen und hatte nicht den Wunsch, dorthin zurückzukehren, das kann ich dir versichern.«
»Und wir verspürten nicht das leiseste Bedürfnis, dich wiederzusehen«, konterte ich. Dieser Schlagabtausch hatte etwas Befreiendes. Endlich kam etwas von unserer gegenseitigen Abneigung hoch. Damit konnte ich besser umgehen als mit der Freundschaft, die wir den ganzen Abend geheuchelt hatten. »Meine Kreise kennst du außerdem gar nicht«, fuhr ich fort. »Du hast keine Ahnung von meinem Leben. Es hat sich an jenem Abend genauso verändert wie das deine. Und nach einer Londoner Saison vor vierzig Jahren gab es mehr als einen Weg, den man einschlagen konnte.«
Das nahm er anstandslos hin. »Ganz recht. Ich bitte um Verzeihung. Aber du kannst Suzanne wirklich nicht begegnet sein. Als ich sie kennenlernte, hatte sie ein Fitnessstudio in der Nähe von Leatherhead. « Im Stillen pflichtete ich ihm bei, meine Pfade hatten sich wohl kaum mit jenen seiner Ex gekreuzt, und hielt den Mund. Er seufzte müde. »Sie hat sich sehr bemüht. Ich möchte nicht schlecht von ihr reden. Aber im Grunde hatten wir nichts gemeinsam.« Er schwieg einen Moment. »Du hast nie geheiratet oder?«
»Nein. Habe ich nicht. Nie.« Meine Worte kamen schärfer heraus als beabsichtigt, aber er schien sich darüber nicht zu wundern. Das Thema war für mich schmerzhaft und für ihn unangenehm. Sollte es verdammt noch mal auch sein. Ich beschloss, mich aus dem verminten Gelände zurückzuziehen. »Und was macht deine Frau jetzt?«
»Ach, sie hat wieder geheiratet. Einen recht netten Kerl. Er hat ein Sportgeschäft, und so haben sie vermutlich mehr Gemeinsamkeiten als wir.«
»Sind Kinder da?«
»Zwei Jungs und ein Mädchen. Aber was aus denen geworden ist, weiß ich nicht.«
»Ich meine, gemeinsame Kinder.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, wir hatten keine.« Diesmal lastete sein Schweigen schwer. Nach einer Weile führte er den Gedanken zu Ende. »Ich kann keine Kinder bekommen«, sagte er. Trotz der Endgültigkeit dieser Feststellung schwang darin etwas seltsam Unabgeschlossenes mit, gleichsam ein Fragezeichen. Dann fuhr er fort: »Das heißt, als ich geheiratet habe, konnte ich keine Kinder mehr bekommen.«
Er verstummte, als wollte er mir Zeit geben, diese eigenartige Aussage zu verdauen. Was meinte er bloß? Er war ja wohl nicht kastriert worden, bevor er der Fitnessstudiomanagerin seinen Antrag machte. Da er das Thema selbst aufs Tapet gebracht hatte, hätte ich bedenkenlos nachgehakt, aber er kam meinen Fragen zuvor. »Wir sind zu mehreren Ärzten gegangen, die alle festgestellt haben, dass ich keine Spermien produziere.«
So etwas schockiert sogar in unserer modernen, aus den Fugen geratenen Gesellschaft, und eine sinnvolle Erwiderung fällt schwer. »Wie bitter«, sagte ich.
»Ja. Bitter. So kann man’s nennen.«
Offenbar war ich ins Fettnäpfchen getreten. »Ließ sich nichts dagegen unternehmen?«
»Im Grunde nicht. Die Ärzte hatten mehrere Erklärungen für den Zustand, aber niemand hielt ihn für reversibel. Das war’s dann also.«
»Ihr hättet es auf anderem Weg versuchen können. Die Wissenschaft ist heute ja so fortgeschritten.« Weiter ins Detail mochte ich nicht gehen.
Er schüttelte den Kopf. »Ich hätte nie das Kind eines anderen großziehen können. Suzanne wollte mich dazu überreden, aber das war für mich keine Lösung. Ich sah keinen Sinn darin. Wenn das Kind nicht von dir ist, spielst du doch nur mit einer Puppe. Einer lebendigen vielleicht, aber trotzdem mit einer Puppe.«
»Viele sehen das anders.«
Er nickte. »Suzanne gehörte dazu. Sie sah nicht ein, warum sie kinderlos bleiben sollte, wenn die Ursache nicht bei ihr lag. Nur zu begreiflich. Eigentlich war die Trennung schon beschlossene Sache, als wir die Arztpraxis verließen.« Er stand auf und goss sich noch einen Cognac ein. Den hatte er verdient.
»Ich verstehe«, sagte ich, um das Schweigen zu brechen. Mir graute vor dem, was nun kommen würde.
Tatsächlich war sein Ton, als er weitersprach, entschiedener denn je. »Zwei Spezialisten glaubten, die Ursache könnte eine Mumpsinfektion im Erwachsenenalter sein.«
»Ich dachte, das wäre ein Ammenmärchen, um aufgeregte junge Männer zu erschrecken.«
»Komplikationen sind sehr selten, kommen aber vor. Es kann eine Orchitis auftreten, eine Entzündung der Hoden. In der Regel heilt sie ohne bleibende Schäden ab, aber manchmal, in wenigen Fällen, eben nicht. Als Kind hatte ich keinen Mumps, und mir war auch nicht bewusst, dass ich später daran erkrankt wäre, aber nach längerem Überlegen fiel mir ein, dass ich im Juli 1970, ein paar Tage nach meiner Rückkehr aus Portugal, sehr starke Halsschmerzen bekam. Ich musste zwei Wochen das Bett hüten, und meine Lymphknoten waren geschwollen. Vielleicht war es das.«
Ich rutschte in meinem Sessel herum und trank noch einen Schluck. Der Grund, warum ich herzitiert worden war, begann sich auf unangenehme Weise abzuzeichnen. Ich hatte Damian damals nach Portugal eingeladen, zu Freunden. Meinen Freunden. Hinterher stellte sich weiß Gott alles als viel komplizierter heraus, aber vordergründig ging es darum, dass die Frauen in der Überzahl waren, deshalb bat mich unsere Gastgeberin, auch Damian einzuladen. Mit katastrophalen Folgen. Versuchte er nun, mir die Verantwortung für seine Sterilität anzuhängen? Hatte er mich herbestellt, damit ich meine Schuld eingestand? Und zugab, dass ich ihm in jenem Urlaub genauso großen Schaden zugefügt hatte wie er mir? »Ich erinnere mich nicht, dass jemand krank gewesen wäre«, sagte ich.
Er offenbar schon. »Die Freundin von dem Typ, der die Villa gemietet hatte. Diese neurotische Amerikanerin mit den gebleichten Haaren. Wie hieß die gleich wieder? Alice? Alix? Sie klagte dauernd über Halsweh, die ganze Zeit.«
»Du hast ein phänomenales Gedächtnis.«
»Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken.«
Plötzlich stieg ein Bild in mir auf, das ich vier Jahrzehnte lang aus meinem Bewusstsein verbannt hatte. Die Villa in Estoril, von der Sonne strahlend weiß gebleicht. Der heiße, goldgelbe Sandstrand unter der Terrasse, die Abendessen, bei denen wir alle betrunken waren und die Luft von Sex und Anzüglichkeiten flirrte, der Aufstieg zu dem verwunschenen Castelo in Sintra, das Schwimmen im unablässig flüsternden blauen Meer, das ewige Warten auf dem großen Platz vor der Kathedrale in Lissabon, um am toten Salazar vorbeizudefilieren … Das alles lebte in grellbuntem Technicolor wieder auf, einer jener Urlaube, die eine Brücke zwischen Jugend und Reife schlagen, die lauernden Gefahren einer solchen Reise, von der man als ein anderer zurückkehrt. Ein Urlaub, der mein ganzes Leben verändern sollte. Ich nickte. »Ja. Zeit zum Überlegen hattest du sicher.«
»Wenn das der Grund war, dann hätte ich natürlich vorher ein Kind zeugen können.«
Auf seinen ernsten Ton konnte ich nicht ganz einsteigen. »Nicht einmal du hättest viel Zeit dafür gehabt. Wir waren ja erst einundzwanzig. Heutzutage mögen manche Mädchen schon mit dreizehn schwanger sein, aber damals war es anders.« Ich lächelte beschwichtigend, aber er sah mich gar nicht an, sondern zog die Schublade eines eleganten Schreibtischs unter dem Lawrence-Porträt auf, nahm einen Umschlag heraus und reichte ihn mir. Kein neuer Brief. Den blassen Stempel entzifferte ich als »Chelsea. 23. Dezember. 1990.«
»Bitte lies.«
Ich faltete das Blatt behutsam auseinander. Der Brief war mit Schreibmaschine getippt, ohne handschriftliche Anrede oder Unterschrift. »Du Mistkerl«, begann er. Na, reizend. Ich sah mit hochgezogenen Augenbrauen auf.
»Nur weiter im Text.«
»Du Mistkerl, es ist bald Weihnachten. Und es ist spät, ich bin betrunken und deshalb mutig genug, Dir zu sagen, dass ich seit neunzehn Jahren mit einer Lüge leben muss. Deinetwegen. Diese Lüge habe ich jeden Tag vor Augen, und schuld daran bist Du. Niemand wird je die Wahrheit erfahren, und ich werde diesen Brief wahrscheinlich eher verbrennen als abschicken. Aber eigentlich solltest Du wissen, wohin deine Falschheit und meine Schwäche geführt haben. Ich verfluche Dich nicht, das nicht, aber ich verzeihe Dir auch nicht, dass mein Leben diese Richtung genommen hat. Das habe ich nicht verdient.«
Ich starrte den Brief an. »Abgeschickt wurde er jedenfalls«, sagte ich. »Fragt sich, ob mit Absicht.«
»Vielleicht lag er herum, und jemand hat ihn zur Post gebracht, ohne ihr Wissen.«
Das schien mir sehr wahrscheinlich. »Na, das war dann wohl ein Schock für sie.«
»Bist du sicher, dass es sich um eine Frau handelt?«
Ich nickte. »Du nicht? ›Ich muss mit einer Lüge leben.‹ ›Deine Falschheit und meine Schwäche.‹ Nach Macho klingt das für mich nicht. Und dem ganzen Tenor nach geht es um Liebesdinge. Hört sich nicht so an, als fühlte sich jemand wegen einer Fehlinvestition hereingelegt. Also wurde der Brief von einer Frau verfasst. Außer du hättest dich später neu orientiert.«
»Der Brief stammt von einer Frau.«
»Na also.« Ich lächelte. »Es gefällt mir, dass sie dich nicht verfluchen kann. Der Ton erinnert mich an Keats. Wie ein Vers aus Isabella oder der Basilikumtopf : ›Sie weint allein, um Freuden, die nie kommen. ‹«
»Was, glaubst du, hat das alles zu bedeuten?«
Mir war nicht klar, wie da überhaupt Zweifel bestehen konnten. »Kein großes Geheimnis«, sagte ich. Aber er sah mich abwartend an, also fasste ich es in Worte: »Offenbar hast du jemanden geschwängert. «
»Genau.«
»Mit Falschheit meint sie vermutlich, dass du ihr ewige Liebe geschworen hat, damit sie die Hüllen fallen lässt.«
»Das klingt sehr hart.«
»Findest du? Das war nicht meine Absicht. Wie alle Jungs damals hab ich’s oft genug selber damit versucht. Ihre ›Schwäche‹ lässt darauf schließen, dass du erfolgreich warst.« Mir fiel Damians ursprüngliche Frage nach der Bedeutung des Briefs ein. »Warum fragst du überhaupt? Gibt es noch eine andere Interpretation? Es könnte sein, dass diese Frau in dich verliebt war und ihr Leben seither eine Lüge ist, weil sie jemand anderen geheiratet hat, obwohl sie lieber mit dir zusammen gewesen wäre. Ist diese Variante für dich denkbar? «
»Nein. Eigentlich nicht. Wenn das alles wäre, hätte sie dann erst nach zwanzig Jahren geschrieben?«
»Manche brauchen womöglich länger, um über solche Dinge hinwegzukommen. «
»›Diese Lüge habe ich jeden Tag vor Augen.‹ ›Niemand wird je die Wahrheit erfahren.‹ Welche Wahrheit?« Er stellte die Frage, als könnte an der Antwort kein Zweifel bestehen.
Ich stimmte ihm durchaus zu und nickte. »Wie gesagt, du hast sie geschwängert.«
Er schien fast beruhigt, dass der Brief keine andere Deutung zuließ. Er hatte ihn an mir getestet. Er nickte ebenfalls. »Und sie hat das Baby bekommen.«
»Hört sich so an. Allerdings wirkt die ganze Geschichte ziemlich melodramatisch. Ich frage mich, warum sie es nicht hat wegmachen lassen.«
Damian bedachte mich mit seiner unnachahmlichen Kombination aus hochmütigem Blick und verächtlichem Schnauben. »Ich kann mir vorstellen, dass eine Abtreibung gegen ihre Prinzipien war. Manche Menschen haben nämlich so was.«
Jetzt war es an mir, höhnisch zu schnauben. »In diesem Punkt muss ich mich nicht von dir belehren lassen«, fauchte ich, was er widerspruchslos schluckte. Sein Glück. Langsam wurde mir das Thema lästig. Wozu ritten wir so lange darauf herum? »Na schön. Sie hat das Kind gekriegt, und niemand weiß, dass du der Vater bist. Schluss, aus.« Ich starrte auf den sorgsam gehüteten Umschlag. »Oder war doch nicht Schluss? Kam noch etwas nach?«
Er nickte. »Genau dasselbe dachte ich damals auch. Dass der Brief nur der Anfang einer … ich weiß nicht … einer Erpressung wäre.«
»Erpressung?«
»Ich habe meinen Anwalt konsultiert. Er riet mir, ihren nächsten Schritt abzuwarten. Seiner Meinung nach arbeitete sie eindeutig auf eine Geldforderung hin, ein Fall, für den wir gerüstet sein sollten. In jenen Tagen stand ich öfter in den Zeitungen, beruflich war mir schon einiges geglückt. Wahrscheinlich hatte sie erkannt, dass der Kindsvater inzwischen reich und der Zeitpunkt für einen Versuch gekommen war. Mein Sprössling wäre neunzehn gewesen …«
»Neunzehn«, verbesserte ich ihn. »Sie lebte seit neunzehn Jahren mit einer Lüge vor Augen.«
Er blickte mich verwirrt an und nickte dann. »Neunzehn und damit wohl gerade dabei, flügge zu werden. Da kommt Bares immer sehr gelegen.« Er sah mich an. Ich hatte dem nichts hinzuzufügen, denn es erschien mir recht plausibel, wie ja auch dem Anwalt. »Ich hätte ihr auch etwas gegeben«, sagte er vehement, wie um sich zu verteidigen. »Dazu war ich durchaus bereit.«
»Aber sie hat nicht mehr geschrieben.«
»Nein.«
»Vielleicht ist sie gestorben.«
»Vielleicht. Aber da wären wir wieder beim Melodram. Vielleicht ist der Brief, wie du sagst, wirklich nur aus Versehen aufgegeben worden. Jedenfalls haben wir nichts mehr gehört, und allmählich geriet die Sache in Vergessenheit.«
»Warum rollst du sie jetzt wieder auf?«
Er antwortete nicht sofort, sondern erhob sich und ging zum Kamin hinüber. Ein Holzscheit war nach vorne gerollt; er nahm den Schürhaken und rückte es äußerst konzentriert zurecht. »Es geht mir darum …«, sagte er schließlich in die Flammen, letztlich aber zu mir, »ich will das Kind finden.«
Für mich entbehrte das jeder Logik. Wenn er etwas wiedergutmachen wollte, warum hatte er es dann nicht vor achtzehn Jahren getan, als es wirklich sinnvoll gewesen wäre? »Ist es dafür nicht ein bisschen spät?«, fragte ich. »Es wäre schon zum Zeitpunkt, als sie den Brief geschrieben hat, nicht einfach gewesen, plötzlich den Papa zu spielen. Aber jetzt ist das ›Kind‹ ein Mann oder eine Frau Ende dreißig, eine voll entwickelte Persönlichkeit. Jetzt ist es viel zu spät, um den Werdegang deines Sprösslings zu unterstützen.«
Was ich sagte, schien ihm nicht von Gewicht. Ich war nicht einmal sicher, ob es zu ihm durchdrang. »Ich will die beiden finden«, wiederholte er. »Ich möchte, dass du sie findest.«
Jetzt so zu tun, als hätte ich noch nicht gemerkt, wohin der Hase lief, wäre nur albern gewesen. Aber eine solche Aufgabe war ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. »Warum ausgerechnet ich?«
»Bevor wir uns kennenlernten, hatte ich erst mit vier Mädchen geschlafen.« Er zögerte. Ich hob schwach die Augenbrauen. Jeder Mann meiner Generation wird begreifen, wie beeindruckend diese Leistung war. Mit neunzehn hatte ich nicht viel mehr vorzuweisen als einen Kuss beim Tanzen. Damian fuhr fort: »Ich hatte mit allen vieren bis Mitte der Siebzigerjahre Kontakt; von denen kann es keine gewesen sein. Dann haben du und ich viel unternommen, und ich war recht aktiv. Zwei Jahre später sind wir nach Portugal gefahren. Und danach war ich unfruchtbar. Schau dir doch den Stil des Briefs an, das Briefpapier, die ganze Ausdrucksweise. Diese Frau ist kultiviert …«
»Und theatralisch. Und betrunken.«
»Beides spricht nicht gegen einen vornehmen Hintergrund.«
»Das stimmt allerdings.« Ich ließ mir seine Theorie durch den Kopf gehen. »Was ist mit den beiden Jahren zwischen dem Ende der Saison und dem Urlaub in Portugal?«
Er schüttelte den Kopf. »Da waren nur ein paar Flittchen und zwei Mädchen aus unseren gemeinsamen Zeiten. Aber keine hat im fraglichen Zeitraum ein Kind bekommen.« Er seufzte müde. »Wie auch immer. Mit einer Lüge lebt nur, wer etwas zu verlieren hat. Etwas Wertvolles, woran er festhalten will. Was durch die Wahrheit gefährdet würde. Sie hat mir 1990 geschrieben, da waren die oberen Schichten die letzten, die an der ehelichen Geburt festhielten. Eine andere Frau hätte die Katze längst aus dem Sack gelassen.« Die Mühe des Sprechens, dazu das Herumschieben der Holzscheite hatten ihn seine restliche Energie gekostet, und er ließ sich ächzend in den Sessel sinken.
Ich hatte kein Mitleid mit ihm. Ganz im Gegenteil. Plötzlich stieß mir die Unzumutbarkeit seines Ansinnens heftig auf. »Ich habe keinen Anteil mehr an deinem Leben. Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Wir sind zwei völlig unterschiedliche Menschen.« Ich wollte ihn nicht beleidigen, sah aber nicht ein, was mich sein Anliegen anging. »Wir haben uns einmal ganz gut gekannt, aber das ist längst vorbei. Wir haben vor vierzig Jahren zusammen ein paar Bälle besucht. Und dann kam der große Knall. Es muss andere geben, die dir viel näherstehen. Ich kann nicht der Einzige sein, dem du das aufhalsen kannst!«
»Doch, das bist du. Diese Frauen stammen aus deinen Kreisen, nicht aus meinen. Ich habe keine anderen Freunde, die sie kennen würden oder überhaupt von ihnen gehört hätten. Und wenn wir schon dabei sind: Ich habe keine anderen Freunde.«
Für meinen Geschmack machte er es sich zu leicht. »Dann hast du eben überhaupt keine Freunde, denn mich kannst du nicht dazuzählen«, platzte ich heraus. Was ich natürlich sofort bedauerte. Ich glaubte ihm, dass er bald sterben würde, und es hatte keinen Sinn, ihn für Dinge zu bestrafen, die niemals rückgängig zu machen waren. Aber er lächelte. »Ganz recht. Ich habe keine Freunde. Wie du besser weißt als die meisten anderen, ist Freundschaft etwas, was ich nie begriffen oder zustande gebracht habe. Wenn du ablehnst, kann ich niemanden sonst darum bitten. Ich kann nicht einmal einen Detektiv einschalten. An die Informationen, die ich brauche, kommt nur ein Insider heran.« Fast hätte ich gefragt, warum er sich nicht selbst auf die Suche gemacht hatte, aber das verbot sich beim Anblick seiner klapprigen Gestalt von selbst. Nach einer kurzen Pause fragte er: »Machst du’s?«
Ich war mir nun sicher, dass ich nichts damit zu tun haben wollte. Nicht nur, weil eine solche Suche heikel, zeitaufwendig und peinlich wäre. Sondern auch, weil ich in meiner eigenen Vergangenheit genauso wenig herumstochern wollte wie in der seinen. Die Epoche, um die es ging, war vorbei. Für uns beide. Ich hatte kaum noch Kontakt zum damaligen Kreis, aus Gründen, die Damian zu verantworten hatte, wie er genau wusste. Und was konnte schon Gutes dabei herauskommen, wenn ich alles wieder aufwühlte? Als letzten Versuch appellierte ich an sein besseres Selbst; sogar jemand wie Damian Baxter musste so etwas besitzen. »Damian, denk doch mal nach. Willst du wirklich ein Leben auf den Kopf stellen? Dieser Mensch weiß, wer er ist, und hat sich damit eingerichtet. Wird es ihm guttun, wenn er mit einer neuen, unbekannten Identität konfrontiert wird? Wenn er seine Eltern anzweifeln muss, wenn es womöglich zum Bruch mit ihnen kommt? Willst du dein Gewissen damit belasten?«
Er sah mich ohne mit der Wimper zu zucken an. »Mein Vermögen beläuft sich, nach Erbschaftssteuer, auf weit über fünfhundert Millionen Pfund. Ich habe die Absicht, mein Kind als Alleinerben einzusetzen. Willst du die Verantwortung auf dich laden, ihm dieses Erbe vorzuenthalten? Willst du dein Gewissen damit belasten?«
Das änderte natürlich die Lage gewaltig, es zu leugnen wäre kindisch gewesen. »Wie stellst du dir das Ganze eigentlich vor?«, fragte ich.
Er entspannte sich. »Ich werde dir eine Liste der Frauen geben, mit denen ich in jenen Jahren geschlafen habe und die vor April 1971 ein Kind zur Welt gebracht haben.«
Wieder war ich sprachlos. Die Liste der Frauen mit oder ohne Nachwuchs, mit denen ich damals geschlafen hatte, hätte auf die Rückseite einer Visitenkarte gepasst. Und was für ein präzises, geschäftsmäßiges Vorgehen! Ich war nicht darauf gefasst gewesen, dass wir so schnell Nägel mit Köpfen machen würden.
Er spürte meine Verblüffung. »Meine Sekretärin hat schon etwas Vorarbeit geleistet. Ich glaube, die Liste ist vollständig.« Er lachte, wirkte nun viel gelöster bei der Aussicht, dass sein Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt würde. »Du kannst dich darauf verlassen, dass ich sehr gewissenhaft recherchiert habe. Bei jeder der Genannten besteht eine reelle Chance, dass sie die Mutter meines Kindes ist.«
»Und was soll ich konkret unternehmen?«
»Melde dich einfach bei ihnen. Mit einer Ausnahme habe ich die aktuellen Adressen.«
»Warum bittest du sie nicht um einen Gentest?«
»Dazu wären diese Frauen nie bereit.«
»Du idealisierst sie, obwohl du sie nicht magst. Ich glaube durchaus, dass sie dazu bereit wären. Und ihre Kinder erst recht, wenn sie wüssten, was auf dem Spiel steht.«
»Nein.« Er war plötzlich wieder sehr bestimmt, mein Einwand hatte ihn verärgert. »Ich will keine Sensation. Nur mein wirklicher Nachkomme darf wissen, dass ich nach ihm suche. Und wenn das Geld einmal in seinen Besitz übergegangen ist, kann er selbst entscheiden, ob er die Sache publik machen will. Bis dahin bleibt das meine Privatangelegenheit und hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattzufinden. Lass jemanden testen, der nicht mein Kind ist, und eine Woche später lesen wir’s in der Daily Mail.« Er schüttelte den Kopf. »Ein Test wäre gut, wenn du dir bei jemandem einigermaßen sicher bist.«
»Und was, wenn eine der Frauen das Kind heimlich bekommen und zur Adoption freigegeben hat?«
»Das hat sie nicht. Nicht die Mutter meines Kindes.«
»Woher weißt du das?«
»Weil sie sonst nicht eine Lüge jeden Tag vor Augen hätte.«
Das alles musste ich mir erst einmal durch den Kopf gehen lassen, was Damian zu begreifen schien. Er erhob sich mühsam. »Ich gehe jetzt schlafen, ich war seit Monaten nicht mehr so lange auf. In deinem Zimmer findest du einen Umschlag mit der Liste. Wenn du möchtest, sprechen wir sie morgen früh durch. Und auf die Gefahr hin, gegen den guten Ton zu verstoßen, wie du dich ausdrücken würdest, habe ich eine Kreditkarte beigelegt, die du im Zuge deiner Suche belasten kannst. Ich werde nicht nachfragen, wofür.«
Über diesen Hinweis ärgerte ich mich, war er doch so formuliert, dass ich Damian für großzügig halten sollte. Aber mit Großzügigkeit hatte dieser Auftrag nichts zu tun. Er war eine einzige Zumutung. »Ich habe noch nicht Ja gesagt«, warnte ich ihn.
»Ich hoffe, du wirst es tun.« An der Tür blieb er noch einmal stehen. »Siehst du sie noch?«, fragte er im Vertrauen, dass es keiner weiteren Erläuterungen bedurfte. Womit er völlig recht hatte.
»Nein. So kann man das nicht nennen.« Einen qualvollen Augenblick lang dachte ich nach. »Sehr selten, bei Partys, Hochzeiten oder Ähnlichem. Aber im Grunde nicht.«
»Ihr habt euch aber nicht überworfen?«
»Nein, das nicht. Wir lächeln uns zu. Wir plaudern sogar. Überworfen haben wir uns sicher nicht. Wir haben überhaupt keine Beziehung. «
Er zögerte, als überlegte er, ob er sich noch weiter vorwagen sollte. »Du weißt, dass ich nicht bei Sinnen war.«
»Ja.«
»Auch mir selbst ist das klar, und ich möchte, dass du das weißt. Ich bin einfach komplett ausgerastet.« Er schwieg wie in Erwartung einer besänftigenden Antwort. Aber die konnte ich ihm nicht geben. »Hilft es, wenn ich sage, dass es mir leidtut?«, fragte er.
»Nicht besonders.«
Er nickte und ließ diese Auskunft auf sich wirken. Wir wussten beide, dass dem nichts mehr hinzuzufügen war. »Bleib in der Bibliothek, solange du willst. Bedien dich am Whisky und schau dir die Bücher an. Manche werden dich interessieren.«
Aber ich war noch nicht ganz fertig. »Warum hast du bis jetzt gewartet? «, fragte ich. »Warum hast du nicht gleich deine Fühler ausgestreckt, als der Brief kam?«
Diese Frage hielt ihn eine Weile beschäftigt. Das Flurlicht fiel durch die offene Tür und vertiefte die Furchen in seinem von Krankheit gezeichneten Gesicht. Vermutlich stellte er sich diese Frage selbst tausendmal am Tag. »Ich weiß es nicht. Nicht bis zur letzten Gewissheit. Vielleicht konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass jemand glaubte, er könne Ansprüche an mich stellen. Ich wusste nicht, wie ich die Frau und das Kind suchen und identifizieren sollte, ohne ihnen Macht über mich einzuräumen. Und im Grunde wollte ich nie ein Kind. Wahrscheinlich bin ich deshalb auf die Bitten meiner Frau nicht eingegangen. Ein Kind gehörte nicht zu meiner Lebensplanung. Ich glaube, ich bin einfach kein Vatertyp.«
2
Ich war nie ein guter Menschenkenner. Mein erster Eindruck ist fast unweigerlich falsch. Aber wie es nun einmal in der Natur des Menschen liegt, brauchte ich viele Jahre, um mir das einzugestehen. In jungen Jahren bildete ich mir ein, ich könne selbstverständlich die Spreu vom Weizen trennen. Damian Baxters Urteile waren hingegen äußerst treffsicher. Er begriff sofort, dass ich ein Einfaltspinsel war.
Der Zufall wollte es, dass wir beide im September 1967 nach Cambridge gingen. Aber wir studierten an unterschiedlichen Colleges und bewegten uns in unterschiedlichen Kreisen. So kreuzten sich unsere Pfade erst Anfang Mai, zu Beginn des Sommertrimesters, auf einer Party im Innenhof meines Colleges. Zweifellos spielte ich mich dort ziemlich auf: Mit meinen neunzehn Jahren steckte ich mitten in jener berauschenden Lebensphase, in der man plötzlich entdeckt, dass die Welt viel komplexer ist als angenommen und eine enorme Bandbreite an Menschen und Möglichkeiten bereithält, viel mehr als die enge Welt von Internat und heimischer Grafschaft, die alles war, was ich bisher im Lauf meiner »privilegierten« Erziehung kennengelernt hatte. Obwohl durchaus kein Einzelgänger, war ich in dieser Gesellschaft nicht sonderlich beachtet worden. Ich stand im Schatten gut aussehender, geistreicher Cousins, und da ich dies weder mit einer blendenden Erscheinung noch mit Charisma wettmachen konnte, hinterließ ich einfach nicht viel Eindruck.
Meine Mutter erkannte mein Dilemma, das sie jahrelang stumm, aber mit großer Anteilnahme verfolgte, ohne mir viel beistehen zu können. Aber als sie sah, wie mit der Zulassung zur Universität mein Selbstvertrauen aufkeimte, beschloss sie, meinem Unternehmungsgeist weiter auf die Sprünge zu helfen, und verschaffte mir Einladungen bei Londoner Freunden mit Töchtern im passenden Alter. Manchen mag es verwundern, dass ich mich ihrer Initiative fügte, aber so begann ich mir einen eigenen Kreis aufzubauen, in dem ich keinen niederschmetternden Vergleichen mehr standhalten musste, sondern mich bis zu einem gewissen Maß neu erfinden konnte.
Der heutigen Jugend käme es merkwürdig vor, dass ich mich so stark von meinen Eltern lenken ließ, aber vor vierzig Jahren war alles anders. Man hatte schon einmal keine Angst vor dem Älterwerden. Fernsehmoderatoren mittleren Alters mussten niemandem vorheucheln, sie teilten Geschmack und Vorurteile ihrer jugendlichen Zuschauer, um sich bei diesen beliebt zu machen. Natürlich trennten uns politische Ansichten, Klassenzugehörigkeit und in geringerem Maß als heute auch die Religion, aber die entscheidende Kluft verläuft heute zwischen der Generation von 1968 – den Älteren – und der Generation vier Jahrzehnte später – den Jungen.
Damals jedoch wurde in meinen Kreisen das Leben der Jugendlichen noch ungewöhnlich stark von den Eltern bestimmt. Sie regelten untereinander, wann und in welchen Häusern während der Schulferien Feste veranstaltet wurden, welche Schulfächer die Kinder wählen, welchen Beruf sie nach dem Studium ergreifen sollten, und vor allem, mit welchen Freunden sie verkehrten. Das lief meist nicht autoritär ab, aber wenn unsere Eltern ein Veto einlegten, protestierten wir kaum. Ich erinnere mich an den Erben eines Baronet aus unserer Nachbarschaft, der häufig betrunken und stets ausfallend war, weshalb meine Schwester und ich ihn faszinierend, meine Eltern aber abstoßend fanden. Das ging so weit, dass mein Vater ihm den Zutritt zu unserem Haus verbot, »außer wenn seine Abwesenheit Anlass zu Gerede gäbe«. Kaum zu glauben, dass ein solcher Satz noch zu unseren Lebzeiten fallen konnte! Ich weiß, dass wir schon damals über diese Anweisung lachten. Aber wir widersetzten uns nicht. Kurz, wir waren auf eine heute kaum vorstellbare Weise das Produkt unserer Herkunft. Da erhebt sich die Frage nach der Ursache des elterlichen Autoritätsverlusts. War es ein von langer Hand geplanter Umsturz, wie uns die rechtskonservative Presse weismachen wollte? Oder war die Zeit einfach reif dafür, wie für den Verbrennungsmotor oder die Entdeckung des Penizillins? Jedenfalls ist die Autorität der Eltern in weiten Bereichen der Gesellschaft dahingeschmolzen wie Schnee in der Sonne.
Um jedoch auf jenes Frühjahr zurückzukommen: Ich wurde also zu einer College-Party eingeladen. Ich weiß nicht mehr, ob es sich bei besagter Party um eine offizielle Veranstaltung handelte oder um eine Privatfete, jedenfalls kamen wir uns alle enorm gescheit und auserwählt vor und sonnten uns im Ruf unseres Colleges, das noch immer als »hochnobel« galt. Wie erbärmlich heute, aus der müden Sicht der mittleren Jahre, solche kleinen Eitelkeiten doch anmuten, aber im Grunde waren wir harmlos. Wir hielten uns für erwachsen, was wir nicht waren, für vornehm, was wir auch nicht sonderlich waren, und für äußerst gefragt. Dabei steckte mir nach meiner traurigen Jugend das altbekannte, für die späte Pubertät so typische Gefühlsgemisch aus Stolz und Verzweiflung noch tief in den Knochen, wenn man sich hochnäsig für etwas Besseres hält, aber gleichzeitig an sozialer Paranoia leidet. Vermutlich machten mich diese inneren Widersprüche so angreifbar.
An den Moment, als Damian in mein Leben trat, kann ich mich noch genau erinnern. Bezeichnenderweise unterhielt ich mich gerade mit Serena, und so lernten wir ihn gleichzeitig kennen, was mir rückblickend weitaus bemerkenswerter vorkommt als damals. Warum Serena überhaupt da war, weiß ich nicht; sie gehörte nicht zu den College-Groupies. Womöglich hatte ein Bekannter sie mitgebracht. Ich kannte Serena damals erst flüchtig, nicht so gut wie später, aber immerhin waren wir uns schon vorgestellt worden. Heute unterscheidet man da nicht mehr so genau; Leute, die sich gerade einmal die Hand geschüttelt und einen Gruß zugenickt haben, erzählen herum, sie würden sich »kennen«. Manchmal versteigen sie sich sogar dazu, den anderen als »Freund« zu bezeichnen. Falls dem das gelegen kommt, werden beide diese Luftblase unterstützen, und fertig ist die Freundschaft. Auch ohne jede Grundlage. Vor vierzig Jahren waren wir uns der Abstufungen in einer Beziehung stärker bewusst. Was bei jemandem so weit außerhalb meiner Reichweite wie Serena auch anzuraten war.
Sie hatte das Licht der Welt als Lady Serena Gresham erblickt und schien nicht im Geringsten an den Selbstzweifeln zu leiden, von denen wir anderen alle befallen waren. Damit hob sie sich von vornherein von uns ab. Aber sie »ungewöhnlich selbstbewusst« zu nennen, würde zu Missverständnissen führen, denn jede aufdringliche, dreiste Selbstdarstellung lag ihr fern. Sie kam nie auf die Idee, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wer oder was sie war. Weder fragte sie sich, ob die Leute sie mochten, noch bildete sie sich etwas darauf ein, wenn sie es taten. Sie ruhte in sich selbst, wie man heute vielleicht sagen würde, und das schon im Teenageralter; damit war sie etwas Besonderes, damals wie heute. Ihre sanfte Distanziertheit, die etwas Schwebendes hatte, fast als triebe sie unter Wasser, nahm mich auf den ersten Blick gefangen, und es sollten viele Jahre vergehen, bis sie nicht mehr mindestens jede halbe Stunde durch mein wehrloses Gehirn geisterte. Ich weiß jetzt, dass sie vor allem deshalb so unnahbar wirkte, weil sie sich für mich nicht interessierte – für die meisten anderen übrigens auch nicht –, aber damals war ich schlichtweg verzaubert. Sie verdankte ihre Aura des Besonderen nicht so sehr ihrer Schönheit, ihrer Geburt oder ihren Privilegien, obwohl alles reichlich vorhanden; nein, gerade ihre Unerreichbarkeit war es, die sie zur Traumgestalt entrückte. Und ich bin nicht der Einzige, für den 1968 zum »Serena-Jahr« wurde. Schon im Frühling, ganz zu Anfang der Saison, schätzte ich mich glücklich, wenn ich mit ihr plaudern durfte.
Wie ich schon sagte, gehörte sie der alten, privilegierten Schicht an. Zu jener Zeit war selbst erworbener Reichtum viel bescheidener, als er es Jahre später werden würde. Die »wirklich Reichen« waren jene, die dreißig Jahre zuvor noch reicher gewesen waren.
Viele der alten Familien waren in den Nachkriegsjahren bankrott gegangen. Über kurz oder lang wurden die meisten von der oberen Mittelschicht geschluckt, ihren verlorenen Status sollten sie nie wiedererlangen. Selbst diejenigen, die die Fahne hochgehalten hatten, die immer noch in eigenen Häusern wohnten und eigene Fasanen jagten, huldigten oft genug einem düsteren Après moi le déluge. Aus den Schlosstoren tuckerten regelmäßig Lastwagen mit kostbaren, über Jahrhunderte hinweg angesammelten Schätzen, die in Londoner Auktionshäusern unter den Hammer kamen, damit die Familie einen weiteren Winter lang heizen und sich standesgemäß kleiden konnte.
Serena bekam von diesen Zwängen nichts zu spüren. Sie und die anderen Greshams gehörten zu den sehr wenigen Auserwählten, die so weiterleben konnten wie eh und je. Vielleicht gab es nur noch zwei Diener, wo es einmal sechs gegeben hatte. Vielleicht musste der Koch ohne Küchenhilfe zurechtkommen, und Serena und ihre Schwestern ließen sich vermutlich nicht von einer Zofe ankleiden. Doch sonst hatte sich für eine Gresham seit 1880 nicht viel geändert, abgesehen von der Länge der Rocksäume und der Erlaubnis, unbegleitet im Restaurant zu speisen.