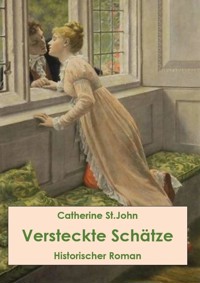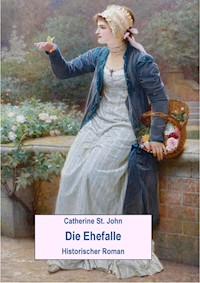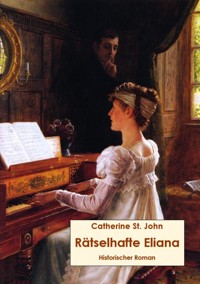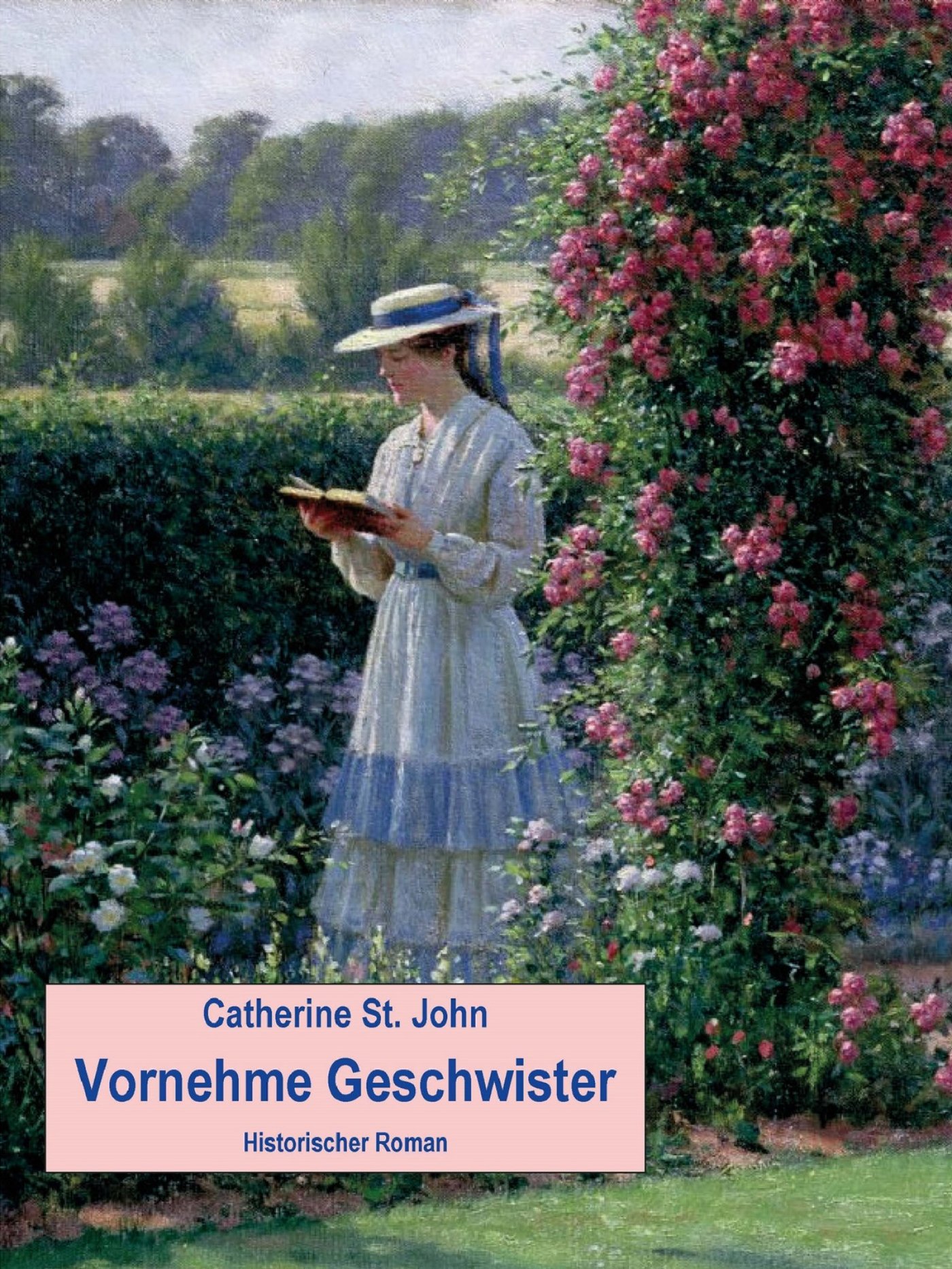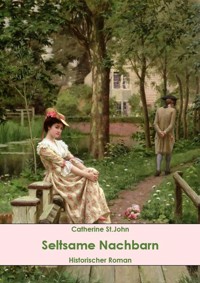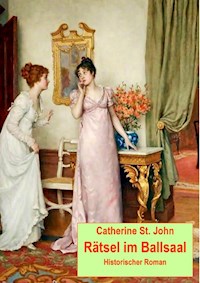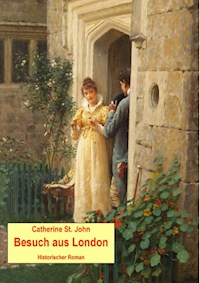Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sir Adam Prentice gewinnt gegen seinen Willen einen Landsitz. Northbury, der ehemalige Besitzer, verlässt das Land und seine nun heimatlose Tochter, Lady Helen. Da Sir Adam sich für sie verantwortlich fühlt, sucht er sie - zunächst vergeblich. Schließlich stolpert er durch Zufall in der besten Londoner Gesellschaft über sie, weil sie als Gesellschafterin bei Lady Brincknell untergekommen ist. Auf die ältere Lady, Adams Nenntante, werden immer wieder Anschläge verübt, und bald gerät ihr erbsüchtiger Neffe Neville unter Verdacht. Beim Bemühen, Lady Brincknell zu beschützen, kommen sich Adam und Helen nach anfänglichem Misstrauen und einigem Gezänk immer näher, bis nach dem "Showdown" schließlich alles klar ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint
Eine Lady ohne Vermögen.Historischer Roman
Catherine St.John
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de Copyright: © 2016 R. John 85540 Haar
ISBN 978-3-8442-8779-0
1
„Nein, Northbury, besser nicht.“
„Oh doch, los jetzt! Oder haben Sie Angst vor meinem Glück?“
„Vor welchem Glück?“, antwortete Sir Adam Prentice kalt. „Sie haben heute schon ein kleines Vermögen verloren.“
„Aber jetzt hat sich mein Glück gewendet“, insistierte Lord Northbury in leicht undeutlicher Aussprache.
Sir Adam seufzte ungeduldig. „Northbury, Sie sind betrunken. Der Wein und der Brandy lassen Sie Ihre Gewinnchancen in allzu optimistischem Licht sehen. Wenn Sie vernünftig sind, lassen Sie heute die Finger von den Würfeln.“
„W-was? Unsinn! Der nächste Wurf wird zu meinen Gunsten sein – was setzen Sie?“
Sir Adam sah sich gereizt um, aber die Umstehenden hatten den Wortwechsel nur mit Interesse verfolgt, zum Teil mit Sensationslust: Hatte denn niemand Einfluss auf diesen ältlichen Spieler? Northbury hatte schon den größten Teil seines Vermögens verspielt und konnte die Finger immer noch nicht von den Würfeln lassen. Wenn er wenigstens die Karten bevorzugt hätte, bei denen man mit Geschick und Rechenkunst sein Glück ein wenig steuern konnte – aber er hatte sich immer schon an die unberechenbaren Würfel gehalten.
„Sir Adam, es wird Ihnen nichts helfen. Würfeln Sie eben mit Northbury, vorher gibt er doch ohnehin keine Ruhe“, empfahl Lord Bernard Tamlin.
Sir Adam schüttelte den Kopf. „Tamlin, ich verstehe Sie nicht. Sind Sie nicht mit Northburys Tochter so gut wie verlobt? Warum wollen Sie, dass er seinen letzten Heller verspielt?“
Lord Bernard grinste. „Vielleicht möchte ich ja, dass er gewinnt und Helens Mitgift erhöhen kann? Kommen Sie, Sir Adam, Sie haben doch wirklich genug Geld!“
Nicht zum Verspielen, dachte Sir Adam, aber Lord Bernard hatte Recht, musste er zugeben – den angetrunkenen Northbury würde er ohne eine Runde Würfeln nicht mehr loswerden. Also seufzte er. „Northbury, Sie sind lästig. Nun gut, eine Runde Hazard. Nur eine!“
Lord Bernard und Viscount Motham lobten diesen Entschluss und bestellten eilfertig neue Würfel.
„Hundert Guineas?“, schlug Northbury als Einsatz vor. Achselzuckend stimmte Sir Adam zu, konnte es sich aber nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass dies doch eine beträchtliche Summe sei. Das Gemurmel der Umstehenden zeigte ihm, dass man diese Anmerkung für recht unvornehm hielt – aber das störte ihn nicht. Wenn Northbury sich das noch leisten konnte? Die Gerüchte über seine finanzielle Situation klangen nicht wirklich erfreulich.
Sir Adam und der Earl nahmen Aufstellung am Würfeltisch, viele andere scharten sich um sie und verfolgten das Geschehen atemlos. Sir Adam überließ es dem Earl, den Einsatz zu tätigen und den Main Point zu setzen, und verfolgte das Ergebnis mit eher trägem Interesse.
„Main Point ist acht“, verkündete Lord Bernard, der offenbar wirklich auf eine höhere Mitgift hoffte.
„Acht ist meine Glückszahl!“, freute sich Northbury und würfelte mit Schwung.
Elf – verloren.
Allgemeines Aufstöhnen, das Sir Adam zeigte, bei wem hier die Sympathien lagen. Northbury starrte auf das grüne Tuch und die sechs und die fünf, die ihn höhnisch angrinsten.
„Entweder setzen Sie neu oder Sie lassen Sir Adam würfeln“, mahnte Lord Motham.
„Stellen Sie sich vor, das weiß ich selbst“, schnauzte Northbury ihn an. Sir Adam streckte die Hand nach den Würfeln aus, denn bei einem neuen Einsatz geriete Northbury womöglich wieder in einen Spielrausch, wie man ihn schon öfter bei ihm beobachtet hatte. Zögernd gab Northbury die Würfel aus der Hand, und Sir Adam würfelte eher lässig.
Acht.
„Getroffen“, stellte Motham mit kaum gebremster Freude fest. Sir Adam stellte den Würfelbecher ab und verbeugte sich.
„Halt, halt!“, rief Motham, „Dein Gewinn!“
Northbury wollte ihm die hundert Guineas einzeln herzählen, aber Sir Adam hob die Hand. „Ich habe nicht vor, mir von diesem Gewicht die Taschen ausbeulen zu lassen. Lassen Sie mir das Geld morgen überbringen. Das genügt doch vollkommen.“
Northbury starrte ihn einen Moment lang unschlüssig an, dann stieß er hervor: „Dann geben Sie mir Revanche!“
Sir Adam seufzte ungeduldig – allmählich ging ihm dieser ältliche, spielbesessene Earl mächtig auf die Nerven. „Mylord, Sie konnten doch kaum diesen Verlust begleichen. Was wollten Sie bei einer erneuten Partie denn noch einsetzen? Vergessen Sie nicht, Ihre Finanzlage ist der ganzen Gesellschaft wohlbekannt.“
„Wie wäre es mit Northbury Abbey?“
Sir Adam taumelte regelrecht zurück.„N-northbury A-abbey?“, stotterte er.„Northbury, sind Sie jetzt vollkommen wahnsinnig geworden? Vom Spielteufel besessen? Ihr Grundbesitz ist alles, was Sie noch Ihr eigen nennen können, und das wollen Sie zwei Würfeln anvertrauen? Denken Sie gar nicht an Ihre Familie? Ihre Tochter?“
„Nun ja“, merkte Motham an, „nachdem er das meiste Land ohnehin schon verkauft hat und das Gemäuer bis über das morsche Dach hinaus mit Hypotheken belastet ist, dürfte der Wert der Abbey ohnehin gering sein.“
„Verdammt!“, explodierte Sir Adam, „es ist aber doch wenigstens ein Dach über dem Kopf! Hier in London wohnen Sie doch nur bei Bekannten, oder? Von Ihrem Stadthaus haben Sie sich schon lange verabschiedet – und haben Sie Ihre Tochter eigentlich überhaupt debütieren lassen?“
Northbury schnaubte. „Wovon denn, bitte? Ich weiß, dass die Würfel jetzt zu meinen Gunsten fallen werden – die Abbey gegen fünftausend Pfund? Damit kann ich dann auch Helen nach London kommen lassen – alt genug ist sie ja schon längst. Schlagen Sie ein!“
Er hielt Sir Adam auffordernd die Hand hin, aber der schlug nicht ein, sondern wich einen Schritt zurück und sagte brüsk: „Nein.“
Allgemeines Aufkeuchen – und der Earl of Northbury fragte perplex nach: „Wie bitte?“
„Ich sagte nein. Ich beteilige mich nicht an Ihrem Versuch, sich kopfüber in den Ruin zu stürzen.“
„Adam, überlege es dir noch einmal“, drängte Motham ihn. „Wenn du dich weigerst, sucht er sich jemand anderen, und wer weiß, wie sehr dieser andere ihn dann ausnimmt. Du weißt doch auch, wie wenige Skrupel manche Herren, auch aus der besten Gesellschaft, haben.“
Ein merkwürdiger Rat, Timothy Motham,dachte Sir Adam.
Laut sagte er: „Du denkst also, ich täte direkt ein gutes Werk, wenn ich Northbury seinen Stammsitz abgewinne? Timothy, es tut mir Leid, aber das erscheint mir nun recht als – sagen wir, Verdrehung der Wirklichkeit.“
Motham lachte kurz auf. „Vielleicht hoffe ich ja, dass Northbury gewinnt? Fünftausend Pfund würden ihm direkt wieder etwas auf die Beine helfen…“
Sir Adam sah etwas säuerlich drein. „Sehr freundlich, mein Bester. Ein solcher Verlust würde mich durchaus schmerzen. Wenn es wenigstens noch einem guten Zweck diente… aber Northbury hätte diese Summe doch sofort wieder verloren.“
„Ja, da magst du durchaus Recht haben… obwohl du es dir doch wirklich leisten könntest…“
Sir Adam zog es vor, darauf nicht näher einzugehen. Viele in der Londoner Gesellschaft wollten gerne wissen, womit er eigentlich sein Vermögen erworben hatte, auch Motham, der noch am ehesten das war, was man einen Freund nennen konnte - aber er würde ihnen den Gefallen nicht tun: Sollten sie ruhig spekulieren, dann waren sie wenigstens beschäftigt. Viel Sinnvolleres hatten die meisten von ihnen doch ohnehin nicht zu tun.
„Prentice, was ist jetzt?“, drängte Northbury. „Oder sind Sie zu feige?“
„Wollen Sie mich provozieren, Mylord? Das ist Ihrer doch nicht würdig!“
„Wenn Sie kneifen, Prentice, dann frage ich eben Sudworth. Der steht dahinten und tut mir bestimmt den Gefallen…“
Sir Adam erschrak etwas. Sudworth war eine eher zweifelhafte Erscheinung, trotz seines Titels – auch ein Baron konnte schließlich ein Gauner sein. Sudworth ging der Ruf voraus, nicht immer ganz ehrlich zu spielen, und wenn er gewinnen würde, würde er Northbury gnadenlos ausnehmen. Dann lieber noch eher selbst… er konnte den Verlust vielleicht etwas gnädiger gestalten. Vielleicht gewann ja Northbury auch, dann hatte er wieder etwas Geld – und er selbst würde diesen Club nicht mehr frequentieren, beschloss er.
Northbury wandte sich gerade in Richtung Sudworth ab, der allerdings noch nicht auf ihn aufmerksam geworden war. Sir Adam packte ihn an der Schulter.
„Gut“, sagte er dann, „ein allerletztes Spiel. Und danach ist es mir vollkommen gleichgültig, ob Sie mich für einen Feigling oder sonst etwas halten. Sie sind dem Spielteufel vollständig verfallen und werden sich über kurz oder lang restlos ruiniert haben. Also, fünftausend Pfund gegen die kläglichen Reste Ihres Grundbesitzes? Timothy, Lord Bernard, Sie sind Zeugen?“
Beide nickten; Motham scheuchte alle anderen, die gerne spielen wollten, von diesem Würfeltisch weg, damit die Partie ohne Störungen verlaufen konnte.
Sir Adam ließ wieder Northbury den Match Point bestimmen – je großzügiger er sich verhielt, desto eher konnte man ihm nachher nichts nachsagen. Andererseits kannte er die Gehässigkeit der feinen Gesellschaft, vor der einen gar nichts schützte außer guten Verbindungen. Und die hatte er nicht unbedingt.
Northbury rieb die Würfel zwischen den Händen, um sie zu erwärmen, spuckte einmal darauf, warf sie in den Becher zurück und würfelte mit großer Geste.
Fünf.
Sir Adam hoffte, er würde als nächstes eine acht oder neun würfeln und in Gottes Namen mit den fünftausend Pfund abziehen. Spätestens übermorgen hätte er die dann auch wieder verspielt.
Northbury vollführte das gleiche Spektakel wie eben; gerade, dass er nicht noch auf einem Bein um den Würfeltisch hüpfte (man hatte solche Dinge auch schon gesehen). Dann würfelte er, und alle verfolgten das Kullern der Würfel mit angehaltenem Atem. Der erste Würfel zeigte sechs Augen – noch nichts verloren. Der zweite Würfel überschlug sich noch einmal und zeigte dann auch die Sechs.
Totenstille.
Northbury wurde grau im Gesicht.
„Beim Jupiter, was für ein Pech!“, stieß Lord Bernard aus. Sir Adam überlegte einen Moment lang, ob er vorschlagen sollte, den Einsatz zu vergessen – aber Northbury würde entweder beleidigt reagieren oder ein weiteres Spiel verlangen. Und alle anderen glotzten ihn erwartungsvoll an, zum Teil das Weinglas noch in der Hand, als genössen sie das Schauspiel.
Wahrscheinlich taten sie das auch.
„Und, was soll ich jetzt tun, meine Herren?“, fragte er in die Runde, die sich daraufhin leise murmelnd zerstreute. Wahrscheinlich dachten sie jetzt, er wisse nicht einmal, wie ein Gentleman sich in einer solchen Situation zu verhalten habe.
Motham und Lord Bernard standen noch da und wirkten genauso ratlos wie Sir Adam selbst. Northbury starrte auf seine Füße, dann hob er den Kopf und sagte heiser: „Glückwunsch. Die Abbey steht zu Ihrer Verfügung. Sie haben ja zwei Zeugen.“
„Was werden Sie jetzt tun?“
Northbury zuckte die Achseln. „Das muss Sie wohl nicht mehr interessieren. Sie haben ja jetzt, was Sie wollten.“
„Northbury, wirklich, das ist aber ungerecht!“, protestierte Motham. „Sie haben Prentice praktisch gezwungen, mit Ihnen zu würfeln, was hätte der arme Kerl denn machen sollen? Sie Sudworth zum Fraß vorwerfen?“
Lord Bernard nickte schwächlich.
„Ihr Bevollmächtigter soll sich an meinen wenden“, fuhr Northbury fort, als habe er den Einwand gar nicht wahrgenommen, stellte sein Glas ab und verließ den Raum. Alle starrten ihm nach, dann löste sich Sir Adam aus seiner Erstarrung und eilte ihm nach, aber zu spät – Northbury hatte das Haus bereits verlassen.
Motham war ihm auch gefolgt. „Da kannst du nichts machen, Adam.“
„Und wenn er – nun, angesichts seiner Situation… - wenn er Schluss macht, wie man so schön sagt? Er hat doch nun alles verloren!“
Motham zuckte die Achseln. „Ich glaube nicht, dass er das tut. Northbury ist ein grenzenloser Optimist, er hofft bestimmt, dass sich irgendwo eine neue Chance auftut.“
„Aber wo will er hin? Und was wird jetzt aus seiner Tochter – wird Lord Bernard sie heiraten?“
„Nicht anzunehmen. Das war noch nicht spruchreif – und so reich sind die Tamlins auch nicht, dass Bernard gar nicht auf eine Mitgift achten müsste. Damit dürfte sich dieses Projekt wohl zerschlagen haben.“
„Verdammt! Das arme Mädchen…“ Sir Adam starrte vor sich hin.
„Kennst du sie?“, fragte Motham neugierig.
„Was? Nein, woher denn? Nach dem, was Northbury vorhin erzählt hat, lebt sie doch nur auf dem Land.“
„Aber ist dein Landsitz nicht dort in der Nähe?“
„Oakwood – ja, das ist freilich wahr. Allerdings hatte ich nie viel Kontakt zu den Nachbarn. Ich wüsste nicht, dass ich Northburys Tochter – wie heißt sie überhaupt? – schon einmal gesehen hätte.“
„Sie heißt Helen. Lady Helen Norwood.“
„Die einzige Tochter? Oder gibt es ältere Geschwister, die sich ihrer annehmen könnten? Bei denen sie möglicherweise leben könnte?“
Motham schüttelte den Kopf. „Sie hatte einen Bruder, der - ehrlich gesagt – nicht besser war als sein Vater. Ein Spieler. Er hat auf alles gewettet, worauf man überhaupt nur wetten konnte, und dabei ein Vermögen verloren. Einmal hat er in einer der übleren Spielhöllen Streit um ein Paar gezinkter – oder nicht gezinkter, wer weiß das schon – Würfel angefangen, es muss sich eine gewaltige Rauferei entwickelt haben und schließlich ein Duell, und am Ende war Lionel Norwood tot. Man hat nie herausgefunden, wer nun genau für seinen Tod verantwortlich war. Dass sein Erbe tot war, hat den Earl dann wohl endgültig auf die schiefe Bahn getrieben.“
„Wer würde denn nach seinem Tod den Titel und den Besitz erben?“
Motham starrte Sir Adam perplex an.„Aber er hat den Besitz ja an dich verspielt! Das hätte er doch nicht getan, wenn er darüber gar nicht verfügen dürfte – er ist doch immerhin ein Gentleman.“
Den strafenden Blick wusste Sir Adam schon richtig zu deuten: Er wusste wohl nicht so genau, was sich für einen Gentleman ziemte?
„Und den Titel?“
Motham zuckte die Achseln. „Ich glaube tatsächlich, er erlischt mit ihm. Man müsste da nachforschen…“ Sehr eifrig klang das nicht; Sir Adam beschloss, sich bei Lady Helen selbst zu erkundigen; schließlich wusste er ja, wo sie zu finden war.
2
Der Salon war kalt, kein Wunder, es gab kaum noch Feuerholz. Helen zog den warmen Schal enger um die Schultern und trat ans Fenster, vor dem sich eine freundliche Landschaft dehnte. Von hier aus gehörte das Land bis zum Horizont noch zu Norwood Abbey; schaute man hingegen aus dem kleinen Morgenzimmer nach draußen, besaßen sie nur noch einen schmalen Streifen Land.
Ach, Papa…!
Er hatte wirklich alles verspielt, was nicht niet- und nagelfest war. Deutlich wurde das an den Wänden des Salons, wo einst durchaus wertvolle Gemälde gehangen hatten, wie man noch an den unterschiedlich verblassten Tapeten sah. Die schönsten Möbelstücke waren verkauft worden, es gab nur noch Papas Reitpferd und ein Zugtier für das Gig im Stall. Nach London reiste ihr Vater mit einer Mietkutsche.
Was wollte er eigentlich als nächstes verkaufen? Mamas Schmuck war auch längst verschwunden; es gab zwar noch ihren eigenen, aber der war doch fast nichts wert – eine schmale Perlenkette, die Ohrgehänge von Großmama Ashton (leider nur Granate) und zwei Kameen.
Und sonst?
Sie fröstelte erneut und zuckte zusammen, als in der Ferne Lärm entstand. Aus dem Stimmengewirr hörte sie zunächst Montey, den Butler heraus, der immer noch treu hier ausharrte, obwohl er bestimmt schon lange kaum noch bezahlt worden war – sie wusste nicht mehr, woher sie es nehmen sollte. Beim letzten Vierteljahrslohn hatte sie ihm mit verlegenem Lächeln etwas vom Tafelsilber angeboten – und er hatte es genommen, was sollte er denn auch sonst tun?
Die andere, griesgrämige Stimme gehörte ihrem Vater.
Er hatte also wieder verloren…
Nein, sie würde ihm nicht entgegengehen, sie würde hier auf ihn warten. Also setzte sie sich auf eins der Sofas und starrte nach draußen.
Es dauerte auch nicht lange, und die Tür flog auf. „Helen?“
Sie stand auf. „Vater.“
Er sah sich im Zimmer um und seufzte. Sie glaubte aus langjähriger Erfahrung, diesen Seufzer deuten zu können: „Es tut mir leid, aber ich wüsste nicht, was Sie hier noch verkaufen könnten. Die restlichen Möbel sind alt und abgewohnt. Nun, das restliche Silber vielleicht?“
Er winkte ab, und in Helen keimte so etwas wie Hoffnung auf. „Sie haben gewonnen?“
„Nein, im Gegenteil. Ich bin am Ende. Die Abbey ist weg.“
Sie starrte ihn an. „A-aber, das kann doch nicht sein – Sie haben unser Zuhause verspielt? Was soll jetzt werden?“
„Ich weiß es nicht. Ich werde das Land verlassen, ich packe nur schnell einiges zusammen.“
„Ah ja. Es ist mir natürlich klar, dass es Ihnen vollkommen gleichgültig ist, was aus mir wird, aber was ist mit Montey und Mrs. King?“
„Mrs. King?“
„Die Köchin“, erläuterte Helen gereizt.
„Gib ihnen das Silber. Hast du noch Geld?“
„Nein. Keinen Penny“, log sie sofort. Schließlich musste sie ja auch noch hier wegkommen – nur wohin? Aber das interessierte ihren Vater natürlich nicht, er hatte ihr eben ja nicht einmal aus Höflichkeit widersprochen…
„Wirklich nicht. Was glauben Sie, womit ich bisher das Personal bezahlt habe? Und wenn Sie sich wundern, warum hier alles etwas staubig ist – wir haben schon länger kein Hausmädchen mehr, und ich schaffe auch nur das Nötigste.“
„Na, dann wirst du ja eine Stelle als Hausmädchen finden können. Vielleicht beim neuen Besitzer. Also, leb wohl.“
Er verließ die Reste des Salons und sie hörte ihn die große Treppe hinaufeilen, dann sank sie auf das Sofa zurück.
Und jetzt? Was konnte sie tun? Wohin gehen? Es gab keine Verwandten mehr, jedenfalls kannte sie keine – und ihr Vater würde ihr bestimmt keine Auskunft geben: Dann würden diese eventuellen Verwandten ja erfahren, dass er seinen gesamten Besitz verschwendet und verspielt hatte! So sehr achtete er wohl doch noch auf die Reste seines Ansehens…
Wen kannte sie denn überhaupt? Die Bauern in der Gegend hatten selbst nichts, und da ihr Vater nicht gerade ein fürsorglicher Gutsherr gewesen war…
Eine Schule hatte sie nie besucht, also fielen auch Schulfreundinnen weg - aber Linny? Miss Linhart, ihre Gouvernante?
Linny, genau! Linny würde sie aufnehmen, und dann müsste sie sich eben eine Arbeit suchen. Hoffentlich nicht wirklich als Stubenmädchen.
Sie horchte nach draußen – aha, ihr Vater eilte schwerfällig die Treppe herunter. Sie schaute aus dem Vorderfenster und sah, wie er in eine schäbige Mietkutsche stieg, die dann langsam die Auffahrt entlang rollte. Offenbar waren die beiden Pferde schon recht erschöpft.
Nun eilte sie selbst durch die Halle, an dem verdutzten Montey vorbei und nach oben. Dort packte sie ebenfalls eine Reisetasche mit ihren drei anderen Kleidern, etwas Wäsche und einem zweiten Paar Schuhe, versteckte ihre letzten paar Pfund (in Kleingeld) in ihrem Mieder und einige Münzen für den Notfall in der Tasche, die sich in ihrem Rock befand. In ihr Retikül steckte sie die Briefe von Miss Linhart. Zweifelnd betrachtete sie sich danach im Spiegel. Sehr schäbig, das alles – aber vielleicht war das ganz gut, so würde sie in der Postkutsche niemand für eine verlockende Beute halten. Besonders schön war sie eigentlich auch nicht, es fehlte ihr am modischen Blond und an großen, arglos-himmelblauen Augen, wie sie gerade de rigeur waren; dunkelblaue Augen und langweilig dunkelbraunes Haar reizten bestimmt niemanden.
Sie packte die Tasche und ihren Umhang mit der einen Hand und ihre kleine Schmuckschatulle mit der anderen. So stieg sie vorsichtig die Treppe wieder hinunter, wo Montey immer noch verwirrt dastand.
„Montey, ich denke, der Herr hat Ihm die Wahrheit gesagt?“
„Ja, Mylady… so ein Unglück! Was soll denn nun werden?“
„Ich weiß es auch nicht so genau. Bitte teilen Sie sich das Silber mit Mrs. King, als Ersatz für den fehlenden Lohn. Und hier, das ist mein Schmuck – viel ist es nicht, aber es gehört natürlich dem neuen Eigentümer.“
„Wissen Sie, wer das sein könnte, Mylady?“
„Mein Vater hat es mir nicht gesagt, tut mir Leid, Montey. Ich schreibe eine Quittung über den Schmuck aus, die lassen Sie bitte vom neuen Eigentümer unterschreiben und senden sie mir dann zu, ja? Ich werde erst einmal zu Miss Linhart gehen; ihre Adresse stand ja immer auf ihren Briefen und die habe ich dabei.“ Sie hielt ihr Retikül hoch.
Montey nickte traurig. „Soll ich Sie schnell zur Poststation bringen, Mylady?“
„Das wäre sehr nett, Montey. Am besten jetzt gleich.“
Sofort allerdings konnte sie doch noch nicht aufbrechen, denn Mrs. King kam aus den Küchenregionen gestürzt und schloss sie zum Abschied noch einmal fest in die Arme und versprach, gelegentlich zu schreiben. „Auch wenn es mir nicht leicht fallen wird… Ach Miss – Mylady, wollt´ ich sagen: Dass es so hat kommen müssen? Wie schrecklich! Behüte Sie der liebe Gott…“
„Sie auch“, antwortete Helen gerührt, schniefte wenig damenhaft und wandte sich zur Tür, wo sie wartete, bis Montey den Schecken eingespannt hatte und vorgefahren war.
3
Norwood Abbey sah im hellen Tageslicht arg heruntergekommen aus. Sir Adam zügelte seine Grauschimmel (ein perfekt zusammenpassendes Paar, das absolut nicht günstig gewesen war) und warf die Zügel seinem Groom zu.
„Ganz schöne Bruchbude, Sir“, wagte dieser zu bemerken. Sir Adam grinste ihm über die Schulter zu: „Ein wahres Wort, Tom. Pass auf die Pferde auf.“
„Müssen Sie mir nich sagen, Sir.“ Tom war gekränkt.
Sir Adam wanderte die ursprünglich einmal elegant geschwungene, aber nun fast zugewachsene Auffahrt entlang. Auf die Tochter war er durchaus neugierig – mit diesem verantwortungslosen Vater hatte sie nun nicht gerade Glück gehabt.
Auf sein Klopfen geschah zunächst gar nichts, dann öffnete sich die schwere Eichentür ganz langsam und ein ältlicher Butler schaute misstrauisch heraus, sagte aber nichts.
„Mein Name ist Prentice“, begann Sir Adam munter. „Es klingt vielleicht etwas phantastisch, aber – nun – also, ich habe dieses Anwesen gewonnen.“
Die Tür öffnete sich weiter. „Ich weiß, Sir. Lord Northbury hat mich informiert, bevor-“
„Bevor was?“, fragte Sir Adam hastig. Das Bild eines toten Earls im Arbeitszimmer, eine rauchende Pistole dort, wo sie ihm aus der schlaffen Hand gefallen war, war vor seinen Augen aufgetaucht und er fühlte sich schuldbewusst, obwohl man ihm dieses Spiel schließlich aufgenötigt hatte.
„Bevor er abgereist ist“, vollendete Montey, offenbar etwas verwundert.
„Er ist abgereist? Wohin?“
„Nach dem Kontinent, wie ich ihn verstanden habe.“
„Aha… mit seiner Tochter, nehme ich an.“
Die Tür öffnete sich noch etwas weiter. „Treten Sie doch bitte ein, Sir. Darf ich ihnen etwas anbieten?“
Sir Adam sah sich in der kahlen und nicht wirklich sauberen Halle um. „Können Sie mir denn überhaupt noch etwas anbieten?“
„Tee dürfte kein Problem sein, Sir. Aber Sie haben Recht, ansonsten ist es um unsere Vorräte eher traurig bestellt.“
„Wie viel Personal gibt es denn hier – außer Ihnen? Sie heißen - ?“
„Montey, Sir. Mrs. King, die Köchin ist noch da. Sonst niemand.“
„Und wer hat immerhin versucht, hier sauber zu machen?“
„D-das war Lady Helen selbst, Sir.“
„Und jetzt ist sie auf dem Weg zum Kontinent, verstehe. Ob sie da ein schönes Leben haben wird?“
„Sie ist nicht auf dem Weg zum Kontinent. Ihr Vater hat sie nicht mitgenommen.“
„Wie bitte? Dann ist sie also noch hier? Kann ich sie dann bitte sprechen?“
„Äh – nein, Sir. Sie ist ebenfalls abgereist. Allerdings mit der Post, ich habe sie selbst zum Crown and Lion gefahren. Ach ja, aber dies soll ich Ihnen übergeben und mir den Empfang quittieren lassen.“ Er überreichte Sir Adam ein kleines Holzkästchen.
Dieser klappte es auf und betrachtete sich die bescheidene Schmucksammlung darin. „Den Rest hat sie doch wohl mitgenommen?“
Montey reckte den Hals und spähte in das Kästchen. „Aber nein, Sir. Das ist – war – Lady Helens gesamter Schmuck. Die Preziosen ihrer Mutter hat der Earl – ich muss es sagen – längst verkauft und verspielt. Ich fürchte, Sie werden hier keinerlei Wertgegenstände mehr finden – außer diesem doch eher bescheidenen Schmuck.“
Sir Adam klappte das Kästchen zu. „Was sollten Sie denn mit der Quittung unternehmen?“
„Nun, Sir, Sie Lady Helen nachschicken, natürlich. Nicht, dass es nachher noch heißt, sie hätte ungesetzlicherweise etwas aus Ihrem Haus entfernt!“
„Sehr lobenswert – aber auch sehr albern“, kommentierte Sir Adam. „Es liegt doch auf der Hand, dass Lady Helen jetzt jeden Penny brauchen wird, der ihr zusteht?“
„Gewiss, Sir, aber sie dachte eben, ihr stehe hier nichts mehr zu. Ich muss zugeben, dass der Earl bestimmt alles, was noch irgendwie zu verkaufen sein könnte, mitgenommen hat, aber Lady Helen hat da eben sehr viel strengere Ansichten.“
„Das spricht für ihren Charakter. Sagen Sie, sind Sie und die Köchin denn überhaupt bezahlt worden? War dafür noch Geld da?“
Montey zuckte die Achseln. „Lady Helen hat uns das Silber angeboten. Es wird wohl nicht ganz leicht sein, das gut zu verkaufen, aber die Geste war doch sehr nett, fanden wir.“
Sir Adam zog sein Portefeuille, erkundigte sich nach dem Jahreslohn und händigte Motley eine entsprechende Summe aus – auch für Mrs. King. „Stellen Sie das Silber lieber wieder zurück, das wird nur kompliziert. Und können Sie zwei Hausmädchen auftreiben? Möglichst sofort?“
Montey strahlte. „Gewiss, Mylord!“
„Ich bin Sir Adam Prentice, kein Lord. Sir genügt also vollkommen. Meinen Sie, bis morgen haben Sie genügend Vorräte herbeigeschafft, dass ich bei Bedarf mit meinem Groom – ein recht verfressenes Subjekt – und meinem Diener hier wohnen kann? Ich denke, ich sollte den Wiederaufbau“ – er kräuselte dabei den Mundwinkel – „ab und zu persönlich überwachen.“
„Ja, Sir! Natürlich, Sir! Eine ausgezeichnete Idee, Sir!“
„Oh, herzlichen Dank, Montey!“, war die trockene Antwort. „Ich werde diese Nacht dann aber erst einmal im Crown and Lion verbringen. Ach – Moment noch: Sie wollten Lady Helen doch die Quittung nachschicken, nicht wahr?“
Montey murmelte etwas vage Zustimmendes.
„Schicken Sie ihr also den Schmuck nach – an welche Adresse übrigens?“
Montey sah seinen neuen Arbeitgeber unbehaglich an. „Das weiß ich noch nicht. Lady Helen wollte mir schreiben, sobald sie eine neue Adresse hat.“
„Wissen Sie, wohin sie mit der Post reisen wollte?“
Montey bestritt jegliche Kenntnis, und Adam seufzte. Wie sollte er das arme Mädchen – nein, die junge Lady – denn auftreiben, um ihr zu helfen? Selbstverständlich ganz diskret, denn offene Unterstützung würde sie wohl nicht annehmen – nach dem, was Montey ihm (eher unfreiwillig) verraten hatte, besaß sie eine gehörige Portion Stolz. Vielleicht verständlich, denn mehr war ihr ja auch nicht mehr geblieben.
4
Miss Linhart hatte sich sehr gefreut, als Helen mit ihrer Reisetasche vor ihrer Tür gestanden hatte, aber das hatte sie schnell unter heftigem Tadel verborgen: Wie konnte Lady Helen denn alleine, mit der Postkutsche obendrein, wie eine gewöhnliche – nun – reisen? Wenn sie nun jemand gesehen hätte? Ihr Ruf? Ihr Ansehen?
Immerhin zog sie gleichzeitig Helen in die kleine Wohnung und umarmte sie herzlich.
„Ach, Linny“, seufzte Helen, „was hätte ich denn sonst tun sollen? Die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, zu Fuß nach London zu pilgern, und das habe ich mir dann doch nicht zugetraut.“
„Du lieber Himmel, nein, natürlich nicht – aber hätte Sie nicht wenigstens die Zofe? ein Hausmädchen? - jemand begleiten können?“
„Linny, ich habe knapp den Fahrpreis für mich zusammenkratzen können und Zofen oder Hausmädchen gibt es auf Norwood Abbey schon lange nicht mehr. Vater hat doch alles verspielt! Und jetzt auch das Haus…“
Miss Linhart sank auf einen Stuhl, die Augen weit aufgerissen. „Was! Und wo bitte ist er jetzt? Oh, er hat sich doch nicht etwa -?“
„Erschossen? Aber nein, das entspricht wohl nicht seinem Charakter. Er hat sich nach dem Kontinent abgesetzt.“ Sie starrte vor sich hin, dann sah sie Miss Linhart kriegerisch an: „Und will ihn nie, nie wiedersehen!“
„Aber Kindchen – Verzeihung, Lady Helen! So kann man doch nicht über seinen Vater sprechen!“
„Als er gegangen ist, hat er mit keinem Wort gefragt, was ich zu tun gedächte. Es war ihm schlicht und einfach vollkommen gleichgültig! Es tut mir leid, wenn das deine Gefühle verletzt, Linny, aber das verzeihe ich ihm nicht.“
Linny erhob sich wieder und nahm Helen fest in den Arm. „Das kann ich dann wirklich verstehen. Und jetzt bleiben Sie bei mir. Ich sorge für Sie, und es wird genauso sein wie früher.“
„Das ist so lieb von dir, Linny. Sag doch bitte Kindchen zu mir, wie früher, und du – aber ich suche mir natürlich so schnell wie möglich eine Stelle. Schließlich kannst du mich doch nicht ewig durchfüttern!“
„Aber La – Kindchen, eine Stelle? Eine Lady Helen Norwood kann doch nicht für fremde Leute arbeiten! Für uns beide reicht meine kleine Rente allerdings wohl nicht… Und als was möchtest du denn überhaupt arbeiten?“
„Das weiß ich auch noch nicht“, gestand Helen. „Vater hatte ja gemeint, als Stubenmädchen, immerhin habe ich in der Abbey abgestaubt – aber ich dachte, vielleicht als Gouvernante?“
„Das kann ein hartes Brot sein, Kindchen – und du hast doch gar keine Erfahrung mit Kindern. Möchtest du zu einer guten Agentur gehen, die dich vermitteln soll? Oder möchtest du dich erst einmal mit einer lieben Freundin von mir unterhalten, die früher auch einmal Gouvernante war?“
„Das wäre wohl eine vernünftige Idee…“, überlegte Helen. „Ich bin so froh, dass ich zu dir gekommen bin!“
„Nun, in der Abbey hättest du unter diesen Umständen auch nicht bleiben können, das hätte sich gar nicht geschickt, mit diesem Mann unter einem Dach, ohne Chaperon… wer ist überhaupt dieser unmögliche Mensch, der deinem Vater den Familiensitz abgenommen hat?“
„Das weiß ich gar nicht“, musste Helen zugeben, „aber ich bin ihm nicht böse. Linny, du kanntest doch meinen Vater auch! Wenn er spielen wollte, dann spielte er auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er – wo auch immer – diesen Fremden so lange bedrängt hat, bis er zu einem Spiel bereit war. Und Lionel – du erinnerst dich an Lionel? – hat mir einmal erzählt, dass Vater immer nur Hazard spielt. Es gäbe ja auch Kartenspiele, bei denen man ein gewisses Geschick einsetzen kann, seinen Witz gegen den eines anderen ausspielen – aber Würfel? Das kann man ja gar nicht beeinflussen!“
Miss Linhart umarmte Helen fest. „Sicher, meine Liebe, du hast gewiss Recht – nur, Lionel hat zwar die Karten bevorzugt, aber was hat ihm das genützt?“
Helen seufzte. „Wohl wahr – Vater lebt wenigstens noch, und Lionel ist tot… aber haben ihn die Karten umgebracht oder sein loses Mundwerk? Soweit wir vor drei Jahren erfahren haben, hat er sich ganz sinnlos mit seinem Spielpartner auf einen Streit eingelassen und diesen so schandbar beleidigt, dass er gar nicht umhin konnte, als ihn zu fordern. Als Sir William vom Kontinent zurückgekommen war, hat er sich wirklich bei uns entschuldigt. Vater hat das natürlich nicht angenommen, aber ich schon."
Miss Linhart lächelte. „Und dieser Sir William, Kindchen? Ein netter Mann?“
„Ja, durchaus. Ich glaube, seine Frau und seine Kinder haben während seiner Verbannung auf den Kontinent sehr gelitten, aber er konnte wirklich nichts dafür, dass Lionel… anscheinend hat Lionel nicht einmal fair gekämpft, das konnten die Sekundanten bestätigen… aber so genau weiß ich in diesen Angelegenheiten nicht Bescheid.“
Miss Linhart tätschelte ihren Arm. „Das sind auch Dinge, die nur die Gentlemen betreffen, Kindchen. Sag einmal, die beste Lösung wäre doch, wenn du heiraten würdest. War denn da noch gar nichts geplant?“
Helen zuckte mutlos die Achseln. „Nichts Festes. Vater hatte da etwas mit dem Earl of Worley ins Auge gefasst, was seinen Enkel, Lord Bernard, betrifft. Aber die Familie Tamlin ist, soweit ich weiß, finanziell nicht besonders – naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lord Bernard noch interessiert ist, wenn ich jetzt doch mittellos bin.“
„Schade, das wäre doch eine recht annehmbare Verbindung gewesen?“
Helen schauderte. „Kaum. Ich schätze Lord Bernard nicht besonders. Ein Mann, der nur an seinen eigenen Vorteil und sein Vergnügen denkt. Ich habe ihn zwar nur vielleicht drei- oder viermal gesehen, aber er ist leicht zu durchschauen.“
Miss Linhart tätschelte sie wieder. „Wirklich traurig, meine Liebe – aber meinst du nicht, dass die meisten Ehemänner – nun – ihre Schattenseiten haben? Es geht doch mehr darum, angemessen versorgt zu sein – und du bist immerhin auch schon - ?“
„Dreiundzwanzig“, gab Helen zu. „Übriggeblieben, ich weiß. Wie denn auch nicht, ohne Saison? Vater hat für mich nie Geld ausgegeben. Nur für sein Spiel… Nun, jetzt ist es zu spät. Ich bin über das Heiratsalter hinaus und habe keine Mitgift mehr. Aber was nützt es, zu jammern? Ich würde gerne deine Freundin kennenlernen und etwas über die Aufgaben einer Gouvernante lernen. Und wenn ich mich hier auf irgendeine Weise nützlich machen kann, dann bitte, zögere nicht, es mir zu sagen. Ich möchte dir doch nicht lästig fallen!“
5
Sir Adam hatte auf seinem eigenen Landsitz Oakwood nach dem Rechten gesehen und beschloss nun, die zwanzig Meilen nach Norwood Abbey zu fahren und zu sehen, was sich dort bisher getan hatte.
Montey öffnete ihm und schien sich über sein Kommen zu freuen. Sir Adam trat ein und schnupperte vorsichtig: Es roch eindeutig besser als beim letzten Mal. Weniger staubig auf jeden Fall.
„Ah, man spürt schon Verbesserungen… Montey, was haben Sie bis jetzt unternommen?“
„Ich habe zwei Stubenmädchen engagiert, die, wie ich mir schmeichle, im Erdgeschoss schon recht hübsche Fortschritte erzielt haben, Sir, und wir haben vor allem das Schlafzimmer des Herrn einer gründlichen Renovierung unterzogen und die Vorräte aufgefüllt. Wenn Sie hier Wohnung nehmen möchten, Sir, können wir Sie, denke ich, schon recht erträglich beherbergen.“
Sir Adam dankte ihm und sah sich weiter um. Was er mit der Abbey anfangen sollte, wusste er eigentlich auch nicht. Oakwood hatte ihm, obwohl es eher klein und düster war, bis jetzt durchaus genügt – und für seine Interessen war ein einigermaßen komfortables Stadthaus in London viel wichtiger; Handel und Wandel fanden schließlich vor allem dort statt!
Andererseits war Norwood Abbey ein Besitz, der Pflege verdiente, ein Tudorbau, der auf den Resten eines mittelalterlichen Klosters erbaut und offenbar kurz nach der Erbauung bereits säkularisiert worden war. Das Ergebnis wirkte verblüffend harmonisch – der Orden, der hier nicht lange seine Heimat gehabt hatte, hatte sich sicher schwer damit getan, das Kloster zu verlassen. Andererseits hatten sie unter König Heinrich sicher froh sein können, das nackte Leben zu retten…
Er sollte sich vielleicht bei Gelegenheit einmal mit der Geschichte der Familie Norwood befassen, überlegte er. In der feinen Gesellschaft des Landes wusste natürlich jede Familie von der anderen, seit wann sie welche Titel trug und welche Besitzungen ihr eigen nannte, aber er selbst spürte jetzt wieder, dass er doch eine Art Außenseiter war, der für solche Feinheiten wenig Gespür besaß. Genau genommen war sein Interesse an solchen Fragen auch nicht übermäßig ausgeprägt, er fand das Kreisen um Adelsfragen eher etwas albern und unzeitgemäß: Was bedeutete es angesichts politischer Umwälzungen, technischer Erfindungen und wirtschaftlicher Fortschritte schon, dass dieser oder jener Edelmann seine Abstammung auf einen normannischen Halbwilden zurückführen konnte?
Aber die Abbey war schön. Schöner als Oakwood, musste er zugeben. Obwohl das nicht gerade schwer zu bewerkstelligen war, denn Oakwood war nichts, was man gesehen haben musste – eher klein, durch die winzigen Fenster eben ziemlich düster, schwer heizbar und auch landschaftlich nicht übermäßig schön gelegen. Eigentlich seltsam, denn es war kaum mehr als eine Stunde zu Pferd von der Abbey entfernt, und die Abbey lag sehr reizvoll in der leicht hügeligen Landschaft.
Vielleicht lag es an dem finster bewaldeten Bergrücken, der unmittelbar hinter den Oakwoodschen Salonfenstern aufzuragen schien. Deprimierend.
Nun, er würde die Abbey, ihre Geschichte und die Geschichte der Norwoods ebenso im Auge behalten wie das Schicksal von Helen Norwood, auch wenn er im Moment noch nicht so recht wusste, wie er sie finden sollte.
6
Helen hatte sich sehr schnell bei Linny eingelebt und durchaus erkannt, dass diese über nur sehr geringe Mittel verfügte und sich durch feine Stickereien etwas hinzuverdiente. Allerdings war Helen selbst wirklich nicht gerade verwöhnt, denn die Norwoodschen Finanzen waren auch schon lange am Ende gewesen und man hatte in der Abbey – vor allem, wenn der Hausherr in London weilte, also nahezu ständig – von der Hand in den Mund gelebt. Außerdem hatte Miss Linhart seinerzeit auch der kleinen Helen die Kunst feiner Stickereien beigebracht, so dass sie nun – nach anfänglichen Protesten der Gastgeberin - einträchtig beieinander saßen und die Borten stickten, für die Madame Angéliques begehrte Kreationen berühmt waren.
Die Sonne fiel schwach durch die dünnen Vorhänge, die bescheidenen Möbel dufteten nach dem Bienenwachs, mit dem Linny sie poliert hatte, und Helen fand es hier viel, viel schöner und angenehmer als jemals in der Abbey, was sie ihrer ehemaligen Gouvernante auch sofort mitteilte.
„Ach Kindchen!“, mahnte Linny, ganz Gouvernante, sofort. „In Norwood Abbey warst du aber doch Lady Helen, angesehen in der besten Gesellschaft – und jetzt?“