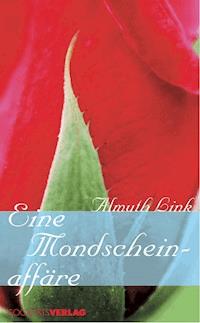Kapitel 1
Die Schaufensterpuppe, die Karla am meisten zu schaffen machte, war ein Mann; dunkle Kunsthaare, Bürstenschnitt, schmales Gesicht, Hornbrille, Lippenbärtchen, verhaltenes Lächeln mit einem Anflug von Spott. Er konnte nur sitzen, der Typ, und das mit übereinandergeschlagenen Beinen und lässig verschränkten Armen. Hätte sie ihm eine Badehose oder Boxershorts anziehen müssen, sie hätte sich nicht beklagt. Aber im Dezember, kurz vor Weihnachten, musste auch der zäheste Stubenhocker einen Skianzug tragen, er gehörte zum Wintergeschäft.
Nervös gab sie dem sperrigen Bein, das sich so salopp über das andere spreizte, einen Tritt. Doch da rührte sich gar nichts. Geduld war angesagt, Geduld und Sympathie, beides notfalls künstlich, aber unbedingte Voraussetzung für eine gute Schaufensterdekoration.
Er hieß Rhoderich, seinen beiden Kollegen hießen Roland und Rolf. So hatte es die Herstellerfirma bestimmt, offenbar gab es für jeden „Wurf“ die gleichen Anfangsbuchstaben – und so war es geblieben.
Rolf wurde von den Verkäufern gelegentlich auch „der Windschnittige“ genannt, weil er, flach vornüber gebeugt, auf einem Motorrad saß und meist enganliegende Kleidung trug. Auch er war – was das Anziehen betraf – für Karla ein schwieriger Fall.
Nun aber zu Roland, der einfach nur so dastand, aufrecht, einen Fuß etwas nach außen gedreht, ohne Allüren, ohne Angeberpose. Er lächelte freundlich, keine Spur von Anzüglichkeit, hatte dunkelblondes weiches Haar, halblang, in der Mitte gescheitelt, manchmal zu einem Schopf zusammengebunden. Mühelos ließ er sich ankleiden, herumrücken, abstellen, in Lücken einsetzen, kurz, er war ein willenloser Mann, was Karla zum Nachdenken veranlasste; mit ihm kam sie nicht nur am besten zurecht, sondern er flößte ihr sogar Vertrauen ein.
Die Kunststoffmänner im Nachbarfenster hießen Jochen, Jan und Jens. Zu ihnen wie auch zu den künstlichen Damen hatte sie kaum eine persönliche Beziehung. Sie zog sie an und aus, drapierte und steckte an ihnen herum, zauberte aus den Gewändern für schwergewichtige Personen gertenschlanke Kleider, indem sie die Fülle der Stoffe auf dem Rücken versteckte.
Es machte ihr Spaß, das Dekorieren, vor allem jetzt in der Adventszeit. Sie verlor sich fast in Tannenzweigen und Papierblumen, Glitzerbändern, bunten Glühbirnen und Engelshaar, durfte sich austoben, bis endlich die Schaufenster vor weihnachtlicher Atmosphäre fast barsten, natürlich zur vollen Zufriedenheit des Geschäftsführers.
Karla setzte sich hinter Rolfs Motorrad auf einen kleinen Schemel und angelte in ihrer Hosentasche nach den Zigaretten. Die Passanten draußen, die über die Louisenstraße durch den dunklen Spätnachmittag huschten, konnten sie nicht sehen. Sie tat drei tiefe Züge und drückte die Zigarette am Motorrad wieder aus, denn das Rauchen war hier streng verboten. Ein langer Tag ging für sie zu Ende, ein anstrengender Tag; aber es gefiel ihr, dieses neue Leben als Dekorateurin des Kaufhauses Hertie in Bad Homburg.
Zweiundvierzig Jahre war sie alt, Karla Stern, gelernte Buchhändlerin, rotblond, hilfsbereit, verträglich und zu dick. So sah sie sich selbst. Andere fanden sie wohlproportioniert, intelligent, sympathisch und obendrein gut aussehend. Daran jedoch konnte sie sich noch nicht gewöhnen. Denn bis vor kurzem hatte sie sich ausschließlich um ihre beiden großen Kinder gekümmert, Till und Anja, und diese fanden ihre Mutter einfach nur – ja nun, wie denn schon? Sie war halt ihre Mutter. Und eines Tages, als sie mittags vom Einkaufen nach Hause gekommen war, die Kinder nicht vorgefunden hatte, dafür aber deren unabgeräumten Frühstückstisch, da war in ihr binnen weniger Minuten der Entschluss gereift, auf Stellungssuche zu gehen.
Da die Unterhaltszahlungen ihres geschiedenen Mannes recht dürftig ausfielen, würde ihnen auch die zusätzliche Finanzspritze gut tun.
Und nun plötzlich in der „Taunuszeitung“ das Stellenangebot für die Bücherabteilung bei Hertie! Sie hatte es entdeckt, sofort angerufen und noch für denselben Nachmittag einen Termin beim Personalchef bekommen. Für das telefonische Protestgeschrei von Till und Anja blieb gar keine Zeit. Was sollte sie anziehen? Eine Nur-Hausfrau ist billig. Sie trägt Jeans und Pullover, im Sommer aus Baumwolle, im Winter aus Wolle. Dazu gibt es ein teures Kleid für die feinen Anlässe, die meist nur in der Fantasie stattfinden. Aus diesem Grunde halten sich solche teuren Kleider ewig, wirken immer neu, adrett und unmodern.
Auch die Handtasche hätte längst einer Auswechslung bedurft; ein schwarzer Ledersack, bananen- und unförmig, dem jeder ansah, dass er auch schon als Einkaufstasche für schwerere Lasten missbraucht worden war.
So ausgerüstet machte sich Karla auf den Weg – sie hatte es von ihrer Elisabethenstraße aus nicht weit – nachdem sie sich gegen die Aufregung zwei harte Schnäpse einverleibt hatte. Und nun saß sie in Herrn Schenks geschmackvoll eingerichtetem Büro vor einem Glastisch und hörte sich an, was der sympathische junge Mann ihr zu sagen hatte. Ihre Konzentration allerdings ließ zu wünschen übrig. Nervös registrierte sie die cremefarbene Raufasertapete, einen sehr schönen Stich vom Bad Homburger Schloss, die sandfarbenen Sessel, den Teppichboden … Erst als er sie nach ihrem Alter fragte, um es zu notieren, wurde ihr so richtig klar, wo sie sich befand und in welcher Angelegenheit. Im nächsten Augenblick hatte sie das Gefühl, vor Hitze platzen zu müssen, der Schweiß brach ihr aus, sie riss sich verzweifelt das Seidentuch vom Hals. Was, um alles in der Welt, hatte sie sich bei dieser Unternehmung nur gedacht? Herr Schenk würde innerlich den Kopf schütteln. Es gab Dreißigjährige, Zwanzigjährige, Kinderlose, Ungebundene, wieso also sollte er ausgerechnet sie nehmen?
Wichtig schien ihr jetzt nur noch, schnell hier herauszukommen, aufrecht zu gehen und einen weiteren Schweißausbruch zu vermeiden. „Ich weiß, ich bin zu alt für den Job“, nuschelte sie und angelte nach der Bananenförmigen.
Herr Schenk zog irritiert die Augenbrauen hoch. „Aber wer wird denn so schnell die Flinte ins Korn werfen, junge Frau – habe ich Sie vielleicht abgewiesen?“ Er beugte sich ein wenig über den Glastisch vor und lächelte sie freundlich an. Der Duft seines Rasierwassers wehte ihr um die Nase, ein angenehmer, herber Duft. „Jetzt trinken Sie mit mir eine Tasse Kaffee und wir sprechen über den Arbeitsvertrag, okay?“ Er ging zur Tür und bat seine Schreibkraft um zwei Tassen Kaffee, möglichst stark. „Ich selbst kann ihn auch gebrauchen“, lachte er, „heute ist wieder der Teufel los, die Vorweihnachtszeit, verstehen Sie?“
Sie glaubte, auf Wolken zu schweben. Deshalb ging sie auch endlich ganz unverkrampft auf ihn ein. „Weihnachten und der Teufel?“ „Ach, der hat doch überall seine Hand im Spiel – oder sagen wir, weil Weihnachten ist, sein Händchen …“
Als sie sich nach einer halben Stunde nun wirklich verabschiedete, durchwärmt von einem köstlichen Kirschlikör zum Abschluss, war sie Verkäuferin geworden von Büchern, aber auch von anderen Dingen, denn in einem so großen Betrieb müsse man flexibel sein, notfalls auch mal aushelfen können, wenn ein Dekorateur ausfiele zum Beispiel.
„Das würde mir sogar Spaß machen“, hatte sie rasch erklärt und es auch so gemeint. Fester Händedruck, „wer sagt’s denn!“ Noch ganz benommen tapste sie hinaus, vorbei an der jungen Frau, der sie glücklich mitteilte, sie gehöre jetzt auch hierher. „Einen schönen Tag noch!“ rief diese ihr nach, „hier kann man echt gut leben!“
Sie hatte Arbeit.
Ein Riesenschritt war getan. Alles andere würde sich jetzt auf irgendeine Weise fügen.
Weil der Nachmittag so gut angefangen hatte, wollte sie ihn auf keinen Fall verkommen lassen. Heute war sie noch Kundin in ihrem zukünftigen Revier und demnach Königin. Also überließ sie sich den Rolltreppen, zunächst hoch zur Spielwarenabteilung im dritten Stock. Weil sie sich darauf am meisten gefreut hatte, kam sie als erste dran und verbandelte sich sogleich mit den Erinnerungen an frühere Zeiten, als die Kinder ihr einen Wunschzettel für das Christkind diktiert hatten. Die Kinder klein und süß, die Mutter verliebt in ihrer jungen Ehe – Karla hatte mit zwanzig, mitten in ihrer Ausbildung, geheiratet – das Leben eine schier unermesslich große Strecke Zukunft, teils überblickbar, teils geheimnisvoll vernebelt, in jedem Fall aber eine von der Natur großzügig angelegte Absicherung gegen die Ängste vor dem Alter. Damals ließ man sich auch nicht durch chronischen Geldmangel bedrücken. Man kaufte eben keine elektrische Eisenbahn für Till, sondern nur eine kleine aus Holz, und für Anja den Puppenwagen aus Korbgeflecht, weil der es auch tat.
Heute war sie nur noch Betrachterin, nicht mehr unmittelbar beteiligt an dieser kleinen, verspielten Welt. Vielleicht würde es ja irgendwann einmal Enkelkinder geben …
Eine ältere Verkäuferin geht auf sie zu und schenkt ihr einen blauen Luftballon. „Nicht grübeln, gute Frau“, sagt sie freundlich „so ein Luftballon fliegt auch für Sie in den Himmel, wenn Sie es nur wollen, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ „Vielleicht will ich es gar nicht, vielleicht rückt einem der Himmel ohnehin schon zu nah auf den Pelz, wenn man älter ist!“ „Dachte ich’s mir doch – sie grübelt. Haben Sie Kinder?“ „Zwei erwachsene, ja, Bub und Mädchen.“
Die Frau macht einen zweiten Ballon los, rosafarben, und überreicht ihn ihr. „Für die beiden jungen Leute, ein Weihnachtsgruß des Hauses!“ Fast hätte Karla erwidert: Ich gehöre ja jetzt selber zu diesem Haus. Aber sie verschluckt es, um die nette Kollegin nicht zu irritieren.
Langsam wurde sie hungrig. In der zweiten Etage, im Restaurant Café hätte sie warmen Apfelstrudel essen können, mit Vanille-Eis. Es sollte aber ein richtiges Abendessen werden, heute, an ihrem Glückstag. Und da gab es das Restaurant in der Nähe, „Yuen’s China-Restaurant“. Langsam schwebte sie die Rolltreppen wieder hinunter. Der Anblick von oben in die glitzernde und kreiselnde Weihnachtsdekoration der nächstunteren Etage ließ sie beinahe schwindelig werden. Dazu die Chöre aus den Lautsprechern, schleifenreich gesungen und vom metallischen Vibrieren der Synthesizer untermalt, ach, es gefiel ihr das alles und sie wollte sich nicht durch Nörgelwörter wie „Konsumterror“ oder „Sentimentalität“ die gute Laune verderben lassen. Leise summte sie die Lieder mit, und als ihr unten, am Fuß der Treppe, der Nikolaus des Hauses ein Lebkuchenherz um den Hals hängte mit der Aufschrift „I love you“, gab sie ihm einen Kuss auf die weißwattierte Wange, „frohe Weihnachten!“ Ganz unheilig hielt er ihr sofort auch die andere hin und blickte sie mit blauen Augen schmachtend an. „Das sind ja feine Sitten hier“, lachte sie und gab ihm den verlangten Zweitkuss.
„Auch ein Nikolaus ist schließlich nur ein Mann“, hörte sie ihn in seinen Bart murmeln, ehe er sich galant zum Abschied verbeugte. Draußen schlug ihr nebligfeuchte Kälte entgegen. Doch in ihrem gesteppten Mantel fühlte sie sich unangreifbar.
Es war einer jener Tage im November, die ihr Dämmerlicht erst gar nicht aufgeben, um nachmittags schon wieder in tiefe Dunkelheit zu versinken. Ein Tag für Leute, die sich gern in gemütliche warme Ecken verkriechen und einen Grog trinken. Sie gehörte zu ihnen. Natürlich musste es nicht unbedingt Grog sein. Der heiße Jasmintee, den sie sich eine Viertelstunde später vom chinesischen Kellner servieren ließ, tat es mindestens ebenso.
Sie saß an einem der Fenstertische ganz für sich allein. Einige Tische waren noch leer zu dieser Zeit. In die gedämpften Gespräche hier und da mischte sich leise, unaufdringliche Musik, auch sie chinesisch. Mit ihren hastig dahinperlenden Tonketten, die keine erkennbaren Melodien ergaben, wirkte sie verwirrend wie eine fremde Sprache.
Ohne Begleitung in einem Lokal. Karla konnte sich nicht entsinnen, jemals allein ausgegangen zu sein. Aber es machte sie nicht traurig, nicht heute. Der neue Job, nach vielen Jahren Hausfrauendasein, gab Anlass genug, sich der blauen Stunde eines warmen Lokals anzuvertrauen, aus dem Fenster zu schauen und die Lichter der Autos, auf der Promenade vom Nebel eingetrübt und schnell wieder verschluckt, vorüberziehen zu lassen. Mehr und mehr gingen die Nebeltropfen in wässrige Schneeflocken über, die sich aus ihrer dunklen Umgebung lösten und wie hauchdünn gewebte Gardinen zu Boden sanken.
Langsam nistete sich der Abend ein, im Lokal wurde es lebendig. Die Gäste, die eintraten, klopften ihre nassen Schuhe ab, rieben sich die Hände. Sie hatten frostige Wangen, und ihre Haare glitzerten weiß.
Karla bestellte eine Frühlingsrolle und ein zweites Kännchen Jasmintee. Beides wurde ihr drei Minuten später gebracht; beim Yuen musste man nie lange warten. Der junge Mann am Nebentisch, der so eifrig auf seine Freundin einredete, erinnerte sie an Till. Hübsch und lebhaft, sehr groß, dunkelhaarig, von sich selbst und der Richtigkeit seiner Argumente überzeugt, dabei aber gutmütig und unbedingt zuverlässig. Till, Bundeswehrsoldat noch für ein paar Monate, ein lieber Kerl, der nach der Scheidung seiner Eltern die Rolle des Familienvaters angenommen und sich dabei eine leichte Überheblichkeit angewöhnt hatte. Seine augenblickliche Freundin? Karla war nie auf dem Laufenden, der stetige Wechsel vollzog sich zu schnell. Er kam selten nach Hause und sehr unregelmäßig. Aber wenn, dann sollte sie da sein, seine Wäsche in Empfang nehmen, seine Berichte anhören, Griesbrei kochen. Die ungewohnte Berufstätigkeit seiner Mutter würde ihm ganz sicher nicht gefallen.
Anja, neunzehn, zwei Jahre jünger als ihr Bruder, studierte Psychologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Auch sie würde es zu Hause nun nicht mehr so gemütlich finden und auch am Samstag lieber in ihrem kleinen Dachzimmer in der Eckenheimer Landstraße bleiben.
Zu Weihnachten aber wollten sie beide kommen, den Baum kaufen, den Ständer montieren und für schöne Musik sorgen. Karla freute sich darauf, auch auf den traditionellen Anruf von Wolfgang, ihrem geschiedenen Mann. Elf Jahre waren schon darüber hin gegangen. Nach einer angemessenen Zeit der Funkstille hatte es wieder eine leise Annäherung gegeben, und jetzt sprach man gelegentlich miteinander, vertraut nur, wenn es um die Kinder ging; sonst eher kameradschaftlich und mit der Spur von Ironie, die gern zum Zuge kommt, wenn zwei Menschen sich gegenseitig zu genau kennen. Säße Wolfgang jetzt hier bei ihr im Lokal, so würde er sich für süßsauren Fisch entscheiden – der ist gut fürs Gehirn, verstehst du – würde lustlos in ihm herumstochern, einen starken Kaffee dazu bestellen und sich dann ausschließlich Karlas Frühlingsrolle widmen. Er gehörte zu den Leuten, die einen flackernden Atem bekommen, wenn sie sich für etwas entscheiden müssen, in Schweiß ausbrechen, wenn sie sich endlich entschieden haben, das Ganze in Windeseile als Fehlentscheidung erklären und sich erleichtert dem zuwenden, wofür sich die anderen entschieden haben. Till und Anja wussten ein Lied von gemeinsamen Lokalbesuchen zu singen. Zuerst hielten sie ihre Teller fest, wenn der Vater wieder „diesen schweifenden Blick“ bekam und tauschen wollte. Später dann, mit wachsendem Selbstbewusstsein, machten sie ihn bereits während der Bestellung darauf aufmerksam, dass er doch bitte vorher bedenken möchte, worauf er Appetit habe.
Er lernte es nie. Also opferte sich Karla, was zur Folge hatte, dass sie nur selten in den Genuss eines selbst ausgewählten Menüs kam. Erst als sich seine Entscheidungsschwäche auf das Auswahlverfahren zwischen zwei Frauen auswirkte, machte Karla kurzen Prozess und trat zurück.
Sie lächelte und trank noch den Rest ihres duftenden, süßen Jasmintees. Dann blies sie die Kerze aus und winkte einer der netten Yuen-Töchter, um zu zahlen.
Der nächste Weg von hier zu ihrer Wohnung führte eigentlich über die Promenade, ein schöner Weg am Kurpark entlang. Da sie aber noch ein Mal an Hertie vorbeigehen wollte, einfach nur so, steuerte sie die Louisenstraße an.
Gleichmütig lächelten die Schaufensterpuppen vor sich hin, wunderschön eingekleidet, von unsichtbaren Lichtern angestrahlt. „Guten Abend, Kumpels“, flüsterte Karla, „wir dienen ein- und demselben Chef, jedenfalls ab morgen früh!“ Sie nickte ihnen zu, noch unbekannterweise, und zog sich den Schal fester um den Hals. Sie lief über den Kurhausplatz, bog rechts in den Schwedenpfad ein, links dann in ihre geliebte Elisabethenstraße, wo sich ihre Wohnung befand; im dritten Stock, immer noch da, wo sie nach der Scheidung mit den Kindern eingezogen war.
Sechs Parteien fasste das helle Mietshaus.
Dass Frau Kohlenberger von nebenan, seit zehn Jahren dem Klavierspiel und der C-Dur-Sonate von Mozart zugetan, im ersten Satz dieser Sonate stets eine Triole zu viel spielte, wahrscheinlich infolge des Umblätterns, konnte Karla mittlerweile mit Güte belächeln; freilich mit einer Art von Güte, die mehr dem Verstand als dem Herzen zuzuordnen war. Ebenso verhielt es sich mit dem Lächeln. Der freundliche Junggeselle unter ihr ließ sich jeden Morgen um punkt sechs Uhr ein heißes Bad einlaufen. Das Wasserplätschern war sozusagen ihr verlässlicher Wecker. Gegenüber wohnte eine schwerhörige alte Dame, die ihren Fernseher zum Lebensgefährten gemacht hatte, immer hörbar präsent. Dadurch liefen für Karla, wenn sie selbst fernsah, zwei Programme nebeneinander her, die sie jedoch allmählich zu sortieren verstand.
Tortur Nummer eins aber blieb die überflüssige Triole. Mit geschlossenen Augen und zusammengebissenen Zähnen wartete sie darauf wie auf das Zuschnappen einer Falle. Und sie schnappte zu, es war ein physikalisches Gesetz!
Trotzdem hing sie an ihrer Wohnung, an ihren Mitbewohnern, an dem gemütlichen alten Treppenhaus, den hohen Fenstern, an dem Ausblick auf die gegenüberliegende Häuserzeile, an den Glocken der Erlöserkirche, der Marienkirche, der Gedächtniskirche … Seit zehn Jahren lebte sie hier in ihrer hübsch eingerichteten Dreizimmerwohnung, bis vor kurzem zusammen mit ihren Kindern. Sie bedeutete das Auffangnetz nach ihrer missglückten Ehe, bedeutete Nestwärme, Harmonie, wenig Geld, manchmal auch Schulprobleme mit Till, die sich aber bis zum Abitur immer wieder hatten bewältigen lassen.
Ganz nah pulsierte die Stadt, Bad Homburg, lebendig und ausgerüstet mit allem, was man brauchte, um sich wohl zu fühlen. Darüber hinaus eine Stadt, die nichts Geringeres als Champagnerluft atmet, die großzügig davon abgibt, die den Charme einer hübschen Frau mit Silberblick hat: nicht so recht einzuordnen in so oder so, ein bisschen Großstadt, ein bisschen Kleinstadt, gepflastert und laut, waldig und leise, betongrau und blumig, verschachtelt und weitläufig, die Mutter von Bürgern und die Mutter von Monte Carlo.
Und nun ihre ersten Tage bei Hertie, nicht als Buchhändlerin zunächst, sondern als Dekorateurin, weil das ganze Haus geschmückt werden musste und überall die grippekranken Leute fehlten. Der Umgang mit Roland, Rolf und Rhoderich war zwar dem Umgang mit Büchern nicht gleichzustellen, aber er hatte seine eigenen Reize, die sie zunehmend entdeckte.
Drei Wochen später jedoch, frühmorgens, als sie sich anschickte, dem Windschnittigen eine kesse Schirmkappe über den Kopf zu stülpen, wurde sie durch den Lautsprecher zu Herrn Schenk gebeten. Vielleicht endlich die Bücher-Abteilung?
Doch so einfach fügen sich die Dinge nicht, sie wusste das. Wurst- oder Käsetheke im Untergeschoss? Während sie sich den Weg zu seinem Büro bahnte, sah sie sich im Geiste über die verschiedenen Wurstsorten gebeugt, als Vegetarierin jeweils die falsche einpackend oder das gewünschte Produkt erst gar nicht herausfindend … Oder Wischtücher und Besenstiele?
Herr Schenk lächelte beschwichtigend und schickte sie – vorübergehend für eine erkrankte Kollegin – zu den elektrischen Haushaltsgeräten. Sie trug nun, wie alle Angestellten hier, oben ein Ansteckschildchen mit ihrem Namen – und verkaufte mit dünner Stimme Staubsauger.
Als habe es unter den Staubsaugern eine geheime Absprache gegeben, um die neue Frau gezielt einzugewöhnen, ließen sie sich an diesem ersten Tag gleich acht Mal von ihr verkaufen. Immer mutiger stand sie Rede und Antwort: ob ihr Fabrikat mit Katzenkies, Erdklumpen und Hundeflöhen fertig würde? Wahrscheinlich, ja doch. Ein Hausmann wollte wissen, ob er während des Saugens seine zwei Sprösslinge auf den Schlitten setzen könne? Sie seien, einerseits, als Reiter hochmotiviert, andererseits wisse er nicht wohin mit ihnen.
Ihren Rat, der sicherlich etwas zögernd ausgefallen wäre, wartete er gar nicht ab. Er zahlte und zog verdrießlich mit seinem Staubsauger davon, seine Kleinkinder an zwei Gürteln hinter sich herziehend.
Zwei Tage Elektroabteilung, dann wurde eine Schuhverkäuferin krank. „Für den Anfang“, wandte sich Herr Schenk an Karla, „werden Sie noch etwas herumgereicht; wenn der Engpass dann überwunden ist, dürfen Sie sich endgültig der Welt des Geistes zuwenden!“
„Dafür bin ich eigentlich eingestellt worden.“
„Selbstverständlich. Aber Flexibilität gehört nun mal in die freie Wirtschaft, habe ich nicht Recht, Frau Schneider?“ Frau Schneider – sie hatte Karla damals die Luftballons geschenkt – wiegte den Kopf hin und her. Sie arbeitete schon lange hier, konnte es sich also leisten, mit ihrem Chef nicht immer einer Meinung zu sein. „Ehrlich gesagt, eine gelernte Buchhändlerin in der Schuhabteilung verheizen …“ „Niemand wird hier verheizt, unter Ihrer Regie schon gar nicht!“ Weg war er. Aber Frau Schneider blieb und schloss Karla in ihr großes Herz. Ende fünfzig mochte sie sein, ein runder, mütterlicher Typ mit kurzen grauen Löckchen, die sie „Rentnerkrause“ nannte. Sie kannte sich hier aus und besorgte auch die Kasse. Mit ihrer tiefen, warmen Stimme hieß sie Karla herzlich willkommen und bot ihr gleich einen starken Kaffee aus ihrer Thermoskanne an.
Seit zehn Jahren schon, seit dem Tod ihres Mannes, arbeite sie hier als Verkäuferin, und sie kenne sich aus wie in ihrer Westentasche. „In Sachen Schuhwerk“, erklärte sie, „kann man mir nichts mehr vormachen, auch nicht in Sachen Füße, wenn Sie wissen, was ich meine, da gibt’s ja die dollsten Dinger, Frau Stern, große Zehen so krumm wie gekochte Krabben …!“
Eine Kundin unterbrach ihre Schilderung, aber Karla war überzeugt, dass sie im Laufe der Zeit von ihren Erfahrungen profitieren würde.
Auch sie hatte übrigens schon recht bald einen Kunden. Er suchte nach „wärmenden Sportschuhen, Größe achtundvierzig“, und wühlte unwirsch in allen möglichen Fächern herum. Frau Schneider, die ihren ratlosen Blick bemerkte, kam ihr sofort zu Hilfe. „Das ist der Typ Opa, der auf jung macht“, flüsterte sie ihr ins Ohr, „und der nicht zugeben will, dass er weiträumige Pantoffeln braucht.“
Karla schaute ihn sich genauer an und verstand, was die Kollegin meinte. „Heutzutage regiert das Jugendliche“, kicherte diese, „da dürfen Sie sich über solche Gestalten nicht wundern – bei der grellen Clubjacke hat er sich um fünfzig Jahre vertan!“
Sie übernahm dann auch die Bedienung. „Wärmende Sportschuhe gibt es nicht, mein Herr, aber ich zeige Ihnen gern unsere Hausschuhe aus Wildleder, lammfellgefüttert.“
„Die wollte ich eigentlich nicht“, murmelte er, „aber zeigen Sie mal her.“
Als er mit seiner Schuhschachtel davon trottete, klopfte Frau Schneider der neuen Kollegin auf die Schulter. „Es lernt sich alles, und im Übrigen heiße ich Helma.“ Sie reichte ihr die Hand, „und du heißt Karla, so viel hab’ ich schon mitgekriegt.“ Sie tranken noch einen Kaffee miteinander, währenddessen Helma aus ihrem Leben erzählte. Sie hatte einen Sohn und eine Schwiegertochter, leider keine Enkelkinder, war in „Hombursch“ zu Hause seit Menschengedenken, früher in Kirdorf, seit zwanzig Jahren in der Waisenhausstraße, und wollte in absehbarer Zeit in Rente gehen. Dass sie für Karla eines Tages zu einer unverzichtbaren Stütze werden würde, konnten beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Die Dame, die zur Mittagszeit hereinrauschte und auf Karla zusteuerte, suchte Pelzstiefel für den Gatten. „Im Prinzip hat er Größe dreiundvierzig“, erklärte sie, „aber da gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einen Haken.“
Verwundert schaute Karla sie an. „Ja, wissen Sie“, fuhr sie fort, „der linke kleine Zeh hat die Form eines nach außen gedrehten Hakens, ein Martyrium, kann ich Ihnen versichern, und der Ruin für jeden Schuh, ganz zu schweigen vom Strumpf.“
„Also müssen die Pelzstiefel sehr breit sein?“
„Außerordentlich breit.“ Grübelnd ging sie die Reihe der dargebotenen Stiefel ab, während Karla, an die Haken denkend, in den verpackten Schachteln nach Sondergrößen suchte.
Tatsächlich wurde sie fündig und konnte ihr ein Paar graue Pelzstiefel einpacken, die die Form eines Quadrates hatten. Vor lauter Glück begann die Dame zu erzählen. „Mein Mann hasst Kaufhäuser, wissen Sie, deshalb bin ich gezwungen, ihn auf Verdacht anzuziehen. Nur leider ist es ja jetzt vorbei, dass man die Fehlkäufe in die DDR schickt. Na, diese Stiefel werden ihn aber sicher zufrieden stellen, auch wenn sie ästhetisch einiges zu wünschen übrig lassen.“
Ihren ersten freien Feiertag genoss Karla in vollen Zügen. Sie legte die Beine hoch, schon am Vormittag, zündete Kerzen an, stapelte Türme von Büchern um sich herum, blätterte, las, trank heißen Tee mit Kandiszucker. Zwischendurch schaute sie zum Fenster hinaus in den grauverhangenen Winterhimmel und dachte an die vergangenen Wochen. Anstrengend waren sie gewesen und im Hinblick auf die Art der Arbeit irritierend. Sie hatte sich an viel Neues gewöhnen und ihre Vorstellungen herunterschrauben müssen, sich dabei aber nicht schlecht gefühlt. Wohl etwas unsicher, aber nicht schlecht. Denn es gab einen Ausgleich: ihre angeborene Neugier, mit der sie sich auf Ungewohntes einließ, um es genau kennen zu lernen. Viel zu lange hatte sie diese Neugier zuwachsen lassen von allem möglichen Gestrüpp aus Prinzipien und Einredungen, schlechtem Gewissen und Sich-nicht-trauen, sogar weit über die Ehejahre hinaus. Es war höchste Zeit geworden, das Gestrüpp abzutragen und all das wieder zum Zuge kommen zu lassen, was eigentlich zu ihr gehörte wie das Wasser zur Pflanze. So gesehen fühlte sie sich jetzt zufrieden – und niemand sollte mehr daran rühren.
Gegen elf Uhr klingelte das Telefon. Anja meldete sich. „Wollte mal deine Stimme hören, hab’ Heimweh nach dir, nach Bad Homburg, wir könnten ja mal wieder in der Saalburg essen gehen oder über die Louisenstraße bummeln. Gefällt dir eigentlich dein Job noch?“
Noch ehe Karla antworten konnte, erzählte sie weiter, vom „Prof“, von einer wunderschönen Party im Studentenheim, von einem neuen Freund namens Jockel. Und an Weihnachten wolle sie heimkommen, eventuell mit Jockel, ob Karlchen für genügend Plätzchen gesorgt habe? Selbstgebackene?
„Noch nicht, Anja, ich habe ja nun nicht mehr so viel Zeit wie früher!“
„Dachte ich’s mir doch, gekaufte Plätzchen, das ist ja vielleicht ein Schock!“
„Wie wär’s, wenn du eher nach Hause kämst und selbst welche backen würdest?“
„Da sieht man“, lachte Anja gepresst, „wohin die Berufstätigkeit von Hausfrauen führt.“
„Zunächst mal zu etwas mehr Geld.“
„Aber die Gemütlichkeit zu Hause geht dabei hops.“
„Nicht die Gemütlichkeit, höchstens der Service an meinen erwachsenen Kindern!“
„Was hast du gegen Service?“
„Gar nichts, wenn ich selbst es bin, die in seinen Genuss kommt.“
„Wenn du einmal alt bist, werde ich dich versorgen.“
Jetzt musste Karla lachen. „Der liebe Gott behüte mich vor deiner Altenpflege, Anja!“
„Natürlich abwechselnd mit Till“, schränkte sie schon ein, „bei der Bundeswehr lernt er ja so was wie Erste Hilfe.“
„Ich werde keine Erste Hilfe brauchen, sondern …“
„… Meine Liebe und Güte, ich weiß; du kriegst sie noch obendrein, auch Geduld und was der alte Mensch sonst noch so braucht, wenn er marode und gefechtsunfähig wird. Aber vorläufig bist du ja noch gut drauf. Also wie ist das mit den Plätzchen?“
Karla ging später tatsächlich noch in die Küche und rührten einen Teig für Butterplätzchen an. Die Kinder, hoffentlich ohne Jockel, sollten doch merken, wie sehr sich ihre Mutter auf sie gefreut hatte.
Als am 24. Dezember um 14 Uhr der Gong durch das Kaufhaus dröhnte, tief und mächtig schwingend, atmete die ganze Belegschaft auf. Gott sei Dank, dieser wahnsinnige Vormittag war geschafft! Eine gute halbe Stunde dauerte es noch, bis auch die letzten Kunden das Haus verlassen hatten.
Noch ganz benommen trudelten die Verkäuferinnen und Verkäufer nach und nach im Personalraum ein, ließen sich auf die herumstehenden Stühle fallen, streckten die müden Beine aus.
Eigentlich hatten sie es eilig, nach Hause zu kommen, um mit den spärlichen Resten festlich erstickter Stimmung nun auch in der eigenen Wohnung weihnachtliche Atmosphäre zu verbreiten, wenigstens andeutungsweise. Doch zuerst, für ein paar Minuten nur, mussten sie hier sitzen, miteinander reden, sich entspannen, tief durchatmen.
Karla genoss es, neuerdings Menschen um sich zu haben, die mit ihr den Berufsalltag teilten und ihr damit das gute Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelten, in der Angenehmes und Unangenehmes gemeinsam erlebt und getragen wurde. Allein schon deshalb hatte sich ihr Entschluss gelohnt, das Hausfrauendasein endlich über Bord zu werfen und loszuziehen in die Welt, die zwar schon um die Ecke begann und um die nächsten Ecken wieder aufhörte, die aber doch neue Lebensdimensionen spendierte; zum Beispiel heute, am 24. Dezember. Helma Schneider hatte immer noch etwas Kaffee in ihrer Thermoskanne, den sie nun schwesterlich mit ihr teilte. „Auf unsere erste gemeinsame Weihnachtszeit und auf unsere Freundschaft!“ „Auf unsere Freundschaft, Helma, und danke, dass du mir in diesen ersten Wochen hier so geduldig geholfen hast, ohne dich …“ „… hätten dir andere in die Steigbügel geholfen, unsere Truppe ist in Ordnung, du musst sie nur erst alle kennen lernen.“ Der Kaffee tat gut, er weckte die erschlafften Lebensgeister. Allgemeine Verabschiedung jetzt, Begutachten von Geschenken, die noch schnell gekauft worden waren, Einpacken von Geschirr, das man zu Hause spülen wollte – und ganz allmählich leerte sich der Personalraum, es wurde stiller.
Helma hatte an der Kasse ihre Brille liegengelassen. Vertrauensvoll hakte sie sich bei Karla unter. „Komm mit, bitte, allein ist mir das zu triste.“
Wie ein stehen gebliebenes Karussell lag das Haus jetzt da, ein erschöpfter Koloss. Die Rolltreppen standen still, das Piepsen der Kassen hatte aufgehört, die bunten Glühbirnen in den Tannenbäumen und entlang der Decken und Wände waren erloschen. Nur noch in den Schaufenstern leuchtete hell und festlich weihnachtlicher Glanz. Überall sonst bemächtigte sich kaltes, gewöhnliches Licht rüde der großen und kleinen Gegenstände, entzauberte alle Räumlichkeiten und machte die Bahn frei für die Putzkolonne. Weihnachten war hier bereits ausgelöscht, ehe es draußen angefangen hatte.
Helma fand ihre Brille, steckte sie zufrieden in die große Einkaufstasche mit den soliden Henkeln, die sie immer mit sich trug, und verließ mit Karla durch eine noch geöffnete Seitentür das Haus. Einen kurzen Besuch noch statteten sie den „R-Boys“ ab, vor allem Roland, dem Normalen, Bescheidenen, der heute einen langen, dunkelblauen Wintermantel trug mit rot-grünkariertem Schal, auf dem Kopf eine flache, karierte Schirmmütze. Er lächelte gleichmütig, schaute durch die beiden hindurch in weite Fernen, um seinem Kunststoffgehirn Genüge zu tun. „Ein schönes Fest auch dir, auch euch!“ lachte Karla, „und macht mir keine Schande.“
Sie wandten sich ab und gingen nun endlich, Rolands Lächeln und seinen Fernblick im Rücken, die Louisenstraße hoch.
„Komm doch noch ein bisschen mit zu mir“, schlug Helma vor, „ich werde erst gegen Abend abgeholt, und wenn deine Kinder erst um fünf kommen, was willst du zu Hause herumsitzen?“ Einen Augenblick zögerte Karla. „Ich wollte vorbereiten …“ „Lass die beiden doch machen, sie haben vom Schmücken sowieso ihre eigenen Vorstellungen!“
Die gut gelaunte Helma, die Aussicht auf die Sofaecke ihres Wohnzimmers, ihren frischen Kaffee und ihren selbstgebackenen Stollen – das alles hatte nach diesem langen Vormittag etwas sehr Verlockendes, eigentlich Unwiderstehliches. Also steuerten sie gemeinsam die Waisenhausstraße an.
Erst gegen fünf, vergnügt und gestärkt und infolge des Kaffees aufgekratzt, machte sich Karla auf den Weg nach Hause. Draußen war es ruhig geworden. Aus der erleuchteten Kirche St. Marien tönte Orgelspiel und der Gesang der Gemeinde. „Stille Nacht, heilige Nacht …“, das unvergängliche, weltumspannende Lied der Christen. Karla blieb stehen. Warum bin ich mit Helma nicht in die Kirche gegangen? Nur weil meine Kinder nicht mehr dabei sind? Lässt man denn mit den Kindern auch die schönen Traditionen los? Sieht ja fast so aus, als wäre das Leben, das gute Leben, ohne die Anwesenheit der Kinder nichts mehr wert, als könnte man es ab jetzt schlecht behandeln, es hungern und schließlich verkümmern lassen. Morgen gehe ich in die wunderschöne Marienkirche, mit oder ohne die beiden!
Langsam schlenderte sie über den Waisenhausplatz, vorbei am Gefallenen-Denkmal. Nur noch ein paar Nachzügler beeilten sich, nach Hause zu kommen. Festlich erleuchtet die Auslagen der Geschäfte und darüber die Lichtergirlanden, aber kaum noch Passanten, um das alles zu bewundern. Der Kampftag war überstanden.
Hinter den erleuchteten Wohnungsfenstern hatte man sich längst zurückgezogen auf die unzähligen kleinen Inseln, die nur das Weihnachtsfest bereithält und die den Familien und Liebespaaren vermehrtes Glück, den Einsamen vermehrtes Unglück bescheren.
Ihre Kinder würden da sein und den Baum geschmückt haben. Den traditionellen Heringssalat hatte sie in der Lebensmittelabteilung besorgt, beim Bäcker im Haus einen Korb voller Plätzchen und einen wunderbaren Butterstollen. Das Mittagessen für die beiden Feiertage, Quiche Lorraine und Lasagne, lag sorgfältig verpackt in der Tiefkühltruhe, der Salat dazu im Gemüsefach. Till, beim Bund bis zum Überdruss mit Fleisch gefüttert, hatte um vegetarische Kost gebeten, was den beiden Frauen sehr entgegenkam. Niemand sollte ihr nachsagen, mit dem Beruf seien ihre hausfraulichen Fähigkeiten abhanden gekommen.
Alle Häuser waren hell erleuchtet, auch das ihre. Nur die Fenster ihrer Wohnung gähnten sie dunkel an. Auch konnte sie nirgends das kleine Auto von Till entdecken. Er wird mit einem Kameraden gefahren und hier abgesetzt worden sein, oder er kommt später, beruhigte sie sich und drückte die schwere, seit Jahr und Tag schleifende Haustür auf.
Langsam stieg sie die Treppe hoch. In jedem Stockwerk duftete es nach gutem Essen. Stimmengewirr hinter den Türen, sogar der Junggeselle unter ihr schien Besuch zu haben.
Die schwerhörige Dame nebenan, das wusste sie, war von Freunden abgeholt worden – also für ein paar Tage kein dröhnendes Fernsehen, kein doppeltes Programm! Und vielleicht hatte ja auch die Klavierspielerin ein Einsehen und verschonte sie mit Mozart und der überflüssigen Triole.
Auf ihr kurzes Klingeln oben, mit dem sie sich den Kindern ankündigen wollte, rührte sich drinnen nichts. Einen Augenblick wartete sie, dann stellte sie den Korb ab und angelte in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln. Ihr starkes Herzklopfen schob sie auf die Treppensteigerei. Sie versuchte, ruhig durchzuatmen und auch den kalten Schweiß zu ignorieren, der ihr plötzlich aus den Achselhöhlen zur Taille hinablief.