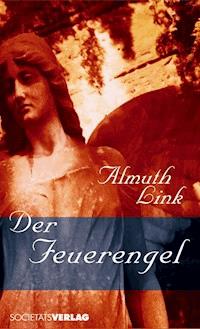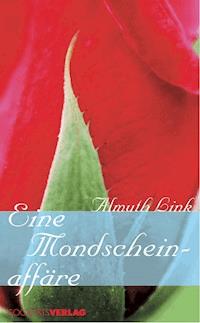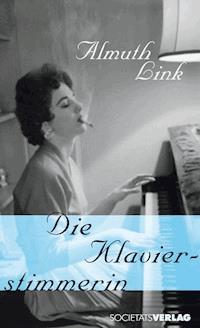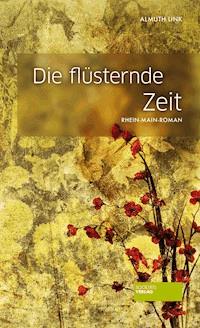Almuth Link
Der Feuerengel
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2005 Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH
Satz: Kerim Demir, Sandra Diepolder, Societäts-Verlag
Schutzumschlaggestaltung: Katja Holst
Schutzumschlagabbildung: Getty Images
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-140-3
Nach dieser Sintflutmöchte ich die Taubeund nichts als die Taubenoch einmal gerettet sehn.Ich ginge ja unter in diesem Meer!flög’ sie nicht aus,brächte sie nichtin letzter Stunde das Blatt.
(Ingeborg Bachmann)
Vorwort
Gestern habe ich nun endlich das Tagebuch hervorgeholt, das Tagebuch von Corinna und mir. Die letzte Eintragung stammt vom 26. September 1969. Damals war ich 31.
Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Turbulente Jahre mit viel Arbeit, mit angespannten Kliniktagen und unruhigen Nachtwachen, mit großen Reisen und interessanten Kongressen, mit ärztlichen Erfolgen und Misserfolgen. Und mit dem Mann, den ich liebe!
Jetzt erst hat sich unser heiß ersehntes Kind bei mir angemeldet. Hättest du dich eher dazu entschlossen, kleiner Wicht, dann wären mir viele enttäuschte Hoffnungen erspart geblieben und dir eine etwas angestaubte Mutter …
Aber wie auch immer, wir freuen uns, können den März, deinen Erscheinungsmonat, kaum erwarten. Freilich, du musst noch kräftig zulegen, bis du fit bist fürs Leben. Aber du hast ja viel Zeit, gerade erst hat der September angefangen.
Für einen Bubennamen konnten wir uns noch nicht entscheiden. Ein Mädchen wird auf jeden Fall Corinna heißen. Warum, das lässt sich in wenigen Sätzen nicht sagen. Auch die Notizen von damals reichen dafür nicht aus. Natürlich habe ich darin geblättert und dabei festgestellt, dass sie nur Farbtupfer hergeben, kleine, nicht ausreichende Leuchtkugeln für eine lange, rätselhafte Geschichte.
Ich habe in den nächsten Wochen des öfteren Bereitschaftsdienst auf meiner Kinderstation. Der September ist meist ein ruhiger Monat. Ich will in dieser Zeit versuchen, endlich meine Geschichte aufzuschreiben. Unser Kind kann sie lesen, wenn es erwachsen ist, wenn es anfängt, sich für die früheren Jahre seiner Eltern zu interessieren. Und dabei wird es ein Mal mehr begreifen, dass kaum ein entscheidendes Ereignis im Leben einfach so aus sich selbst heraus entsteht, zufällig oder gar auswechselbar, dass sich fast alles nur aus den Zusammenhängen erklären lässt, den gradlinigen, aber auch den kurvigen, unübersichtlichen, labyrinthischen, den hellen und denen, die an irgendeinem Punkt immer dunkel bleiben.
Das Tagebuch, aber auch die ordnende Distanz der zehn darüber hingegangenen Jahre werden mir helfen, noch einmal Corinna zu begegnen, meinem Feuerengel.
Kapitel 1
Unter der Alten Brücke in Frankfurt am Main bin ich zur Welt gekommen, 1938, an einem Juliabend um halb zehn. Eine tüchtige Hebamme sei dabei gewesen, erzählten mir meine Eltern später, und alles sei einigermaßen gut verlaufen. Unser Koppelverband-Schiff, ein Schleppkahn, aus einem Schubleichter und einem Gütermotorschiff bestehend, sei mit leisem Dröhnen mainaufwärts in Richtung Osthafen durch den warmen Abend getuckert. Nur zwei kleine Fackeln, die mein Vater und meine Schwester Corinna draußen auf dem Kajütendach im Kreise herumschwenkten, hätten die Besonderheit der Stunde angezeigt. Der Empfang kurz darauf im Hafen sei fantastisch gewesen, doch hätte ich ihn komplett verschlafen, ebenso wie meine geschundene Mutter. Weil ich also in Frankfurt geboren bin, gaben sie mir den Namen Franka, und ich war mit diesem Namen zufrieden. Schließlich hätte mir eine Schiffsgeburt auch in Hanau oder Würzburg passieren können, dann wären meine Eltern vielleicht auf die Idee gekommen, mich Hanni oder Burgl zu nennen. Nein, Franka gefiel mir besser, und auch meine Eltern, gebürtige Frankfurter, freuten sich über diese günstige Fügung.
Mit Nachnamen hießen wir Müller, Arthur und Annemarie, Corinna und Franka Müller. Unser Vater war Kapitän, angestellt bei einer Schifffahrtsgesellschaft, und wir transportierten in der Regel Sand und Kies aus Stollhofen. Unsere Kajüte auf dem Gütermotorschiff könnte man mit einem soliden unterirdischen Wohnwagen vergleichen, zu dem zwei Treppen hinabführten. Alles ein wenig beengt, aber sorgfältig durchdacht und praktisch eingerichtet. Jeder hatte eine kleine Schlafkoje, meine Eltern, wir beiden Mädchen, und unser Matrose. Es gab eine Küche und natürlich auch ein gemütliches kleines Wohnzimmer mit Essecke. Unter der Toilette hörte man das Wasser des Mains rauschen und gurgeln, was uns Kindern immer einen Schauer über den Rücken laufen ließ - so wie in den Toiletten der Eisenbahnzüge, unter denen man bedrohlich laut die Schienen scheppern hört.
Corinna war drei Jahre älter als ich. Sie soll mit rührender Zärtlichkeit um mich besorgt gewesen sein, mich gestreichelt und mir Lieder vorgesungen haben. Sobald mir der erste Brei verabreicht wurde, habe sie eifrig darüber gewacht, dass ich ja auch genug davon bekäme, um schnell groß werden zu können. Das Schiffskind brauchte eine Spielkameradin, herbeigesehnt wie nichts sonst auf der Welt, denn es gab ja keine Nachbarn oder Kindergartenfreunde.
Spätestens von meinem dritten Geburtstag an habe ich ihr diesen Wunsch erfüllen können. Im Sommer spielten wir auf dem Vordeck, dem Oberdeck, auf dem Dach, auf der Brücke, am Steuerhaus, in all den wunderbaren Nischen und Gängen des Schiffes Versteck, blinder Passagier, Polizist und Einbrecher und zum Leidwesen unseres Vaters auch Nachlauf vom hinteren zum vorderen Schiff, denn es gab einen wackeligen Übergang vom Gütermotorschiff zum Schubleichter.
Im Winter badeten und wickelten wir im Wohn-Esszimmer der Kajüte unsere Puppen oder wir bauten Bauernhöfe auf, deren holzgeschnitzte Bewohner sich überwiegend aus Männern zusammensetzten, Bauern, Holzfällern und Pferdekutschern. Nur zwei Frauen besaßen wir. Die von Corinna hieß, nach dem Geburtsnamen unserer Mutter, Frau Seidenader, die meine hieß Frau Müller. Natürlich waren sie eng miteinander befreundet und besuchten sich häufig in einem unserer kleinen Puppenhäuser zum Kaffeetrinken.
Alles, was um uns herum geschah, nahmen wir nur am Rande zur Kenntnis. Mama hielt sich immer in der Nähe auf, kochte das Mittagessen oder wusch in einer kleinen Blechwanne Wäsche, die sie dann im Freien, hinter dem Steuerhaus, auf die Leine hängte. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort, außer an Regentagen, jemals keine bunten Wäschestücke im Wind geflattert hätten. Sie gehörten dazu wie das Dröhnen und Tuckern des Schiffmotors, der Tanggeruch des Wassers, die lauten Zurufe zwischen unserem Vater und seinem Matrosen, das schäumende und spritzende Wasser rechts und links des Schiffes. Was noch dazugehörte: die Vögel mit ihren wilden, bedrohlichen Schreien, das dunkle Tuten des Nebelhorns, die langsam vorüberziehenden Landschaften, Dörfer und Städte, der Gruß, wenn uns ein Schiff begegnete: „Eine Handbreit Wasser unterm Kiel!“, der Stollhofener Hafen schließlich, in dem man den Kies oder den Sand in unser Schiff einlud, und zwei Tage später wieder Anlegen im Südbecken des Frankfurter Osthafens, in dem das Schiff gelöscht wurde.
Während der Aufenthalte in den Häfen liefen wir mit Mama in die jeweilige Stadt, kauften mit Hilfe eines riesigen Einkaufszettels ein, ließen die Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Mehl und Fett sogar anliefern, weil wir so viel nicht tragen konnten. Wenn wir Glück hatten, gab es an solchen Tagen auch neue Schuhe, ein Kleid, einen Pullover oder eine Trainingshose, zu Corinnas Leidwesen aber auch neue Schulbücher, Schwamm und Griffel für die Schiefertafel.
Freilich wurden solche Ausflüge zunehmend überschattet vom Krieg, in dem sich unser Land seit 1939 befand und der sich gegen Ende immer aggressiver mit seinen Bombengeschwadern über die Städte zog. Wir Kinder mussten jetzt auf dem Schiff bleiben, und die Fahrten nach Stollhofen wurden eingestellt, nicht nur wegen der gefürchteten Tiefflieger, sondern auch wegen einiger zerstörter Brücken. Nichts im Gemeindewesen funktionierte mehr geordnet und reibungslos, auch nicht die Schule mit ihren Sonderregelungen. Niemand wollte unsere Eltern zwingen, wenigstens alle zwei oder drei Tage in irgendeinen Hafen einzulaufen, um Corinna zur Schule zu schicken. Sie blieb zu Hause und lernte mit Mama, glücklich, wenn unser Schiff in einem kleinen Mainhafen außerhalb von Frankfurt angelegt hatte und uns die schweren Angriffe erspart blieben.
Nicht eine einzige Bombe hat unser Kies- und Sandschiff getroffen, nicht ein einziger Schuss. Unversehrt – wenn auch von Angst oftmals gepeinigt – sind wir durch den Krieg getuckert bis zu seinem bitteren Ende. Riesengroß müssen die Flügel des Schutzengels gewesen sein, den uns der liebe Gott vor die Kajüte und Papas Steuerhaus gesetzt hatte, uns zu behüten! Das wurde auch schon mir, der Siebenjährigen klar.
Es war im Sommer 1945, also kurz nach Kriegsende, als mich Mama eines Vormittags in die Frankfurter Innenstadt mitnahm. Ich saß auf dem Gepäckträger ihres rostigen Fahrrades und klammerte mich an ihr fest, denn sie musste slalomartig um die vielen Schlaglöcher herumfahren, die aus den ehemals asphaltierten Straßen lehmige Pfützenwege gemacht hatten. Rechts und links davon türmte sich der Schutt. Dahinter ragten Ruinen hoch oder auch nur vereinzelte Wände mit Fensterhöhlen wie trostlose Augen, abgebrochene Mauern, verbogene Gitter, abgeknickte Türme. Ein gespenstisches Niemandsland, als hätte jemand die Stadt abtransportiert und Unbrauchbares zurückgelassen.
Als wir endlich über all die unkenntlich gewordenen Straßen an der Domruine angekommen waren, die einsam zwischen vereinzelten Häuserresten und breiten Schutthalden emporragte, begann meine Mutter zu weinen. „Unsere schöne, schöne Altstadt“, sagte sie leise, „nichts mehr davon da!“ Wir liefen zum Garküchenplatz, dessen verkohlte Ruinen aussahen wie lieblos zusammengezimmerte, nach drei Seiten hin weitgehend offenstehende Puppenhäuser. Daneben kein Baum, kein Strauch, kein Bürgersteig, kein Asphalt. Nur kleine Hügel von Steinbrocken, vertrockneter Erde, Asche und staubigen Grashalmen.
Heute ist das alles nicht mehr vorstellbar. Damals stand ich entsetzt davor wie vor den Bildern grausamer Märchen, in denen sich unsichtbare böse Geister zusammenrotten, um auf hinterhältige Weise ihr Unwesen zu treiben.
Auch in dieser chaotischen Zeit wurde uns der tägliche Schulbesuch erlassen, mit unseren Eltern aber die Regelung getroffen, dass sie uns alle vier Wochen der Lehrperson einer jeweils zuständigen Volksschule vorzustellen hatten, die uns prüfen und den neuen Stoff mitteilen sollte. Da wir aber wegen der gesprengten und noch nicht wieder reparierten Brücken zunächst gar nicht auf Fahrt gehen konnten, hätten wir nach irgendeiner Schulbaracke in Frankfurt Ausschau halten müssen. „Ach was,“ meinte unsere Mutter, „ich bringe euch alles Nötige bei. Da habt ihr mehr davon als wenn ihr jeden Tag mit euren kaputten Schuhen durch die kaputte Stadt in eine kaputte Schule lauft!“
Natürlich hat ihr Unterricht geklappt.
Bei Arthur und Annemarie Müller klappte aber auch sonst alles. So jedenfalls wollte ich es sehen und habe dabei wahrscheinlich manches übersehen. Sie mussten in der Enge ihres Schiffes aufeinander eingeschworen sein wie ein gutes Team, genau wie wir beiden Schwestern. Wegen des eingeschränkten Platzes hatten wir alles miteinander zu teilen, die wenigen Spielsachen, die Schlafkoje mit dem Doppelstockbett, den kleinen Spieltisch, den Einbauschrank und schließlich unser ungewöhnliches Leben, das wir aber merkwürdigerweise nicht als ein heimatloses Leben empfanden. Unsere Heimat war halt beweglich. Sie bestand aus dem Koppelverband zweier Schiffe, einer Kajüte und einem Steuerhaus auf dem hinteren Schiff, dem Gütermotorschiff, einigen Treppen, Gängen, Ecken und Winkeln, Bullaugen, Oberlichtern, und das wars. Weder interessierten uns Kinder die Namen der Landschaften, Dörfer und Städte, noch die Häfen, in denen wir, zweieinhalb Jahre nach dem Kriegsende, nun wieder anlegten. Nur die Einkäufe mit Mama, wo auch immer, wurden zu interessanten Unternehmungen, ebenso wie die Schulprüfungen, denen wir jedes Mal in einer Mischung aus Angst und Vorfreude entgegenfieberten.
Alles hätte so bleiben dürfen, ein Leben lang. Wir waren unversehrt durch den Krieg getuckert, also standen wir offensichtlich unter einem guten Stern. Nichts konnte uns passieren.
Aber es passierte etwas, ausgerechnet im November, meinem Lieblingsmonat. Aus heiterem Himmel, ohne die leiseste Vorwarnung, brach es über uns herein und fügte dem Urvertrauen, das meinem Leben bis dahin Kraft verliehen hatte, einen tiefen Riss zu. Ich bekam Kinderlähmung. Gegen alles mögliche waren wir als Babys geimpft worden, nicht aber gegen diese tückische Krankheit, von der vermutlich jedermann dachte, sie tauche nur ganz selten auf, und wenn überhaupt, dann träfe sie die anderen.
Sie traf mich. Nicht in der schleichenden Form einer anfänglichen vermeintlichen Grippe, sondern wie ein hinterhältiger Überfall. Abends ging ich gesund ins Bett, wir spielten noch eine Runde „Schwarzer Peter“, Mama kam hinzu, betete mit uns, bevor sie das Licht ausmachte und den Vorhang zuzog, und wir hörten vor dem Einschlafen, wie immer, die leisen Stimmen unserer Eltern.
Als ich am nächsten Morgen aus dem Bett steigen wollte, konnte ich beide Beine nicht bewegen. Ich schrie auf vor Entsetzen, versuchte mich irgendwie an den Bettrand zu schieben, die Beine mit den Händen hochzuheben. Corinna sprang mit einem Satz von ihrem Oberstock herunter, kniete sich vor mich hin, rief abwechselnd nach Mama und Papa, begann vor Verzweiflung zu weinen. Mama war sofort da. Weiß bis in die Lippen schrie sie nach Arthur, stolperte die Treppe hoch zum Deck, schrie ihm entgegen: „Sie hat Kinderlähmung, das kann nur Kinderlähmung sein!“
Alles, was nun weiter mit mir geschah, hat sich in meiner Erinnerung zu einem Gewirr aus Aufregung, Funksprüchen, Zurufen, Ansteuerung eines Hafens, lauten Ratschlägen und tröstenden Worten zusammengeballt. Da ich immer wieder das Wort „Honsellbrücke“ hörte, nahm ich an, was mich ein wenig erleichterte, dass wir uns in der Nähe unseres Frankfurter Osthafens befanden.
Es ging mir schlecht. Ich fühlte mich plötzlich sehr schlapp, konnte kaum sprechen, hatte Kopfschmerzen, überall taten mir die Muskeln weh. Um mich herum Hektik, Aufregung, Unruhe, im Hafen dann ein Rot-Kreuz-Auto, über den Schiffsfunk schon herbeigerufen, in das ich wie auf einem Backblech hineingeschoben wurde, laut, aber flink und routiniert. Sie brachten mich in die Universitätskliniken.
Meine Familie saß um mich herum, sogar der Matrose, denn Mama meinte, alle sollten sich unbedingt, wenn es noch sinnvoll wäre, impfen lassen. In der Klinik dann, nach endlosen Wartereien in Fluren und Labors, bekam ich ein eigenes kleines Zimmer. Wäre mir nicht so elend gewesen, so hätte ich mich an der neuen Umgebung, für ein Schiffskind luxuriös und ganz ungewohnt, sicherlich gefreut. So aber konnte keine Freude aufkommen, denn der Rachenabstrich und die Blutuntersuchung hatten schon bald den gefährlichen Virus bei mir nachgewiesen.
Franka hatte Kinderlähmung.
Kapitel 2
Es wurde ein langer Winter im Krankenhaus. Langweilig wurde er nicht, denn Mama mietete in der Nähe der Kliniken für sich und Corinna eine kleine Mansardenwohnung und schickte ihren armen Arthur und seinen Matrosen allein auf Fahrt. Corinna, inzwischen zwölf Jahre alt, machte die Aufnahmeprüfung in die Quinta eines Mädchengymnasiums in Frankfurt-Sachsenhausen, und bestand sie. Annemarie Müller, geborene Seidenader, war eben eine gute Lehrerin für uns gewesen, die uns nicht nur in Mathematik, sondern auch in den anderen Fächern, vor allem in Deutsch und Englisch, eine Menge beigebracht hatte.
Meine Schwester strahlte vor Glück und Stolz, und jeden Nachmittag ließ sie mich an ihrem Glück teilhaben, indem sie mir von den einzelnen Schulstunden berichtete, jede Lehrerin, jeden Lehrer genau beschrieb, mir ihre Figuren aufmalte, ihre Profile, ihre Haarfrisuren, ihre Kleider. So lernte ich Frau Hof kennen, Frau Dr. Pepp und Herrn Sindel, den Hausmeister Kolb und die Verteilerin der Schulspeisung, Frau Rohr.
Meine Vormittage dagegen waren weitgehend ausgefüllt mit physikalischer Therapie und orthopädischen Maßnahmen, die ich mit zusammengebissenen Zähnen über mich ergehen ließ. Manches tat sehr weh, einiges aber machte mir auch Spaß, vor allem wenn ich gelegentlich einen winzigen Fortschritt spürte. Das geschah zwar äußerst selten und nur am rechten Bein, aber einen kleinen Lichtblick bescherte es mir schon. Wenn Zeit zwischen den Behandlungen übrig blieb, gab mir Mama, angespornt durch Corinnas Erfolge, Unterricht.
Im Handumdrehen war so der November vergangen, und auch der Dezember, in diesem Jahr schneereich und kalt, verging für uns, auch für mich in meinen weißen Wänden, wie im Flug.
Kurz vor den Weihnachtsferien sollte Corinnas Klasse ein Krippenspiel für die Eltern aufführen. Corinna war die Rolle des Verkündigungs-Engels zugesprochen worden. Damit ich teilhaben durfte, brachte sie ihr weißes Engelsgewand mit ins Krankenhaus und zog es sofort an. Es bestand aus einem ziemlich luftundurchlässigen, durch zahlreiche Gummizüge dehnbaren Nylonstoff und hatte, ebenfalls aus Nylon, aber mit Pappe verstärkt, gewaltige Flügel. Schwitzend, doch glücklich, sprach sie ihren Text: „Denn siehe, ich verkündige euch große Freude…“, und ich fand meine Schwester mal wieder hinreißend, schön, lieb, klug, und nun auch noch schauspielerisch großartig.
Mama freute sich mit uns. An dem großen Tag zog sie ihr „gutes Kleid“ an, ein blaues Baumwollkleid mit weißen Blümchen, und sie versprach mir, mit ihrer uralten Kamera Corinna während ihres Auftrittes zu fotografieren. So nur konnte ich den Abschied von den beiden verschmerzen, als der wichtige Nachmittag gekommen war.
Corinnas Berichte hinterher fielen wahrscheinlich länger und wohl auch lebhafter aus als das ganze Krippenspiel. Vor allem freute sie sich darüber, dass sie das Engelsgewand behalten durfte. Die Fotos waren leider nur klein, dunkel und vollkommen unkenntlich geworden.
Unser Vater richtete es ein, am 24. Dezember bei uns zu sein, so dass wir in meinem kleinen Krankenhauszimmer zu viert Weihnachten feiern konnten. Ich bekam eine mühsam ergatterte Babypuppe, die liebe Edeltraut, meine Schwester eine blaue Schultasche aus Stoff, von Mama selbst gebastelt und mit eingenähtem Filz einigermaßen stabil gemacht. Corinna spielte auf ihrer Mundharmonika Weihnachtslieder, wir sangen leise dazu und beobachteten das zarte Flackern der fünf Kerzen, die in einem winzigen Bäumchen steckten. Tränen ließ ich nicht zu, obwohl mir gerade an diesem Abend der Gedanke die Kehle zudrücken wollte, während meines ganzen weiteren Lebens im Rollstuhl sitzen zu müssen oder aber, was ich mir fast noch schlimmer vorstellte, eine hinkende Frau zu werden. Oft sprach ich mit Corinna darüber. Sie nahm mich dann jedes Mal stürmisch in die Arme und tröstete mich. Aber ihre Hilflosigkeit und manchmal auch ihre Tränen konnte sie nicht verbergen.
Da Papa nach den Feiertagen wieder zu seinem Schiff musste, nahmen wir uns für Silvester nichts vor. Wir wollten durchschlafen und erst am Morgen das neue Jahr begrüßen, das Jahr 1948.
Es brachte mir nicht die vollständige Heilung, aber es brachte mir im April, nach fast sechs Monaten, die Entlassung aus dem Krankenhaus mit einem einigermaßen stabilen rechten Bein und einem dünn und etwas kürzer gebliebenen linken, das ich nachzog. Ich hinkte; unschön und plump, in einer Art verschobenem Takt wie eine alte gichtgeplagte Frau. Und mir war klar, soviel hatte ich aus den Gesprächen zwischen den Erwachsenen heraushören können, dass ich kaum eine Chance hatte, jemals wieder richtig laufen zu können. So ergab sich für mich und damit auch für die übrige Familie die Planung der nächsten Jahre ganz von selbst: Um keinen Preis der Welt wollte ich mit diesem Gebrechen in eine öffentliche Schule gehen. Die Mitschülerinnen würden mich nachmachen, mich auslachen, hinter mir herflüstern, die Jungens pfeifen und einen Wettstreit um spöttische Bemerkungen austragen. „Die Kinder gewöhnen sich ganz schnell an deine Lähmung“, gab Mama vorsichtig zu bedenken, „wir könnten in der kleinen Wohnung bleiben, und nur Papa geht auf Fahrt.“ Hätte ich die Wahl nicht gehabt, hätte ich das abgeschirmte Leben zu fünft auf dem Schiff nicht gekannt, so wäre mir ja gar nichts anderes übrig geblieben als nachzugeben. So aber erschien mir in diesen Momenten unser grauer Kieskahn wie eine blühende Oase, eine Insel der Seligen, ein Ort der absoluten Sicherheit, der Geborgenheit, des Friedens. Auch glaubte ich, dass unsere Eltern unter langen Trennungszeiten leiden würden – und das machte ich mir zunutze. Was meine Schwester betraf, so kämpfte ich unentwegt gegen mein schlechtes Gewissen an, das sich heftig zu Wort meldete, wenn ich sie ansah, das Unglück in ihren Augen, weil sie ihre geliebte Schule schon wieder verlassen sollte.
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sich Corinna damals in dieser wichtigen Frage durchgesetzt hätte. Wir standen vor einem der berüchtigten Scheidewege, die sich im Leben plötzlich auftun und die, beide in eine unbekannte Zukunft führend, nichts als Angst und eine beklemmende Hilflosigkeit einflößen. In den Kirchen wird Gott gerühmt, weil er uns den freien Willen schenkt. Ich kann mir kein grausameres, zynischeres Geschenk vorstellen als dieses, und ich war immer meilenweit davon entfernt, Gott ausgerechnet hierfür zu rühmen! Ganz zu schweigen davon, dass ich es ihm nicht verzieh und nicht verzeihen wollte, mich zu einem Krüppel gemacht zu haben.
Unser zweites Leben auf dem Schiff, es war auf einmal ein anderes. Die Monate im Krankenhaus hatten mich verändert, mich älter gemacht, ernster, sicherlich auch melancholischer. Anders als früher, schaute ich mir jetzt öfter die vorüberziehenden Landschaften an, die Häuser und Gärten und arbeitenden Menschen, die spielenden Kinder, träumte von meiner Zukunft und blieb jedes Mal an der Vorstellung hängen, Corinna würde irgendwann heiraten, sich damit räumlich von mir trennen, ich würde ihr und ihrem Mann zum Abschied winken und allein auf meinen Kieskahn zurückhinken.
Corinna hielt sich tapfer, mir zuliebe, aber das Getümmel der Schule fehlte ihr sichtlich. Sie schrieb Briefe an ihre Klassenkameradinnen, gab ihr Taschengeld für Briefmarken aus und lief selber, wenn wir in irgendeinem Hafen eingelaufen waren, zum nächsten Briefkasten. Mit Rückantworten konnte sie nicht rechnen, da wir in dieser noch etwas chaotischen Nachkriegszeit nie genau wussten, wo und zu welchem Zeitpunkt wir postlagernde Briefe hätten in Empfang nehmen können.
Meine Mutter spürte unsere Kümmernisse, und sie litt darunter. Sie war eine wunderbare Mutter, eine, die sich die Zeit nahm, zu trösten, zu beruhigen, gute Auswege zu suchen. Auch unser Vater, so weit es ihm sein Dienst erlaubte, tat, was er konnte, uns das Leben schön zu machen. Neben Frankfurt war unsere Lieblingsstadt Würzburg, wo er freilich nur sehr selten zu tun hatte. Er wusste das, und jedes Mal, wenn wir dort eingelaufen waren, machte er es möglich, uns alle, auch seinen Matrosen, auf dem Weg zur Marienfeste in eine Milchbar zu führen, wo wir Milchshakes oder Eisbecher bestellen durften. Er selbst und Mama tranken Eiskaffee, und wenn sie dann vor ihren Bechern mit der aufgetürmten Schlagsahne saßen, atmete Papa tief durch. „Wie gut, dass dieser schreckliche Krieg vorbei ist!“ Und Mama, es war schon fast ein Ritual, antwortete: „Wer hätte gedacht, damals, dass es so was Gutes wie Eiskaffee noch mal geben würde!“
Was kümmerte uns in solchen Momenten die von Bomben immer noch zerstörte Stadt, die spärlich dekorierten Schaufenster, die ärmlich gekleideten Menschen, die rumpeligen Autos auf den beschädigten Straßen! Bis ich dann, wenn wir uns erhoben hatten und wieder weiter liefen, mein dünnes linkes Bein nachzog und hinkte, klick-klack, klick-klack. Mein Gott, war das schwer, sich an die Blicke der Leute, neugierig oder mitleidig, zu gewöhnen.
Wir mussten jetzt beide mehr lernen, denn wir hatten den Ehrgeiz, uns jederzeit in die für unser Alter geeignete Klasse eines Gymnasiums eingliedern zu können. Schulbücher waren 1948 noch immer schwer zu bekommen, und unser Geld, ein Jahr vor der Währungsreform, war wertlos.
Unermüdlich dachte sich Mama, die früher eine sehr gute Schülerin gewesen war und sich an vieles noch erinnern konnte, Aufgaben und Themen aus, um mit uns zu üben. Und die uns auferlegten Zwischenprüfungen, freilich in Volksschulen, nicht in Gymnasien, machten uns Spaß. Wir trugen jedes Mal viel Lob davon und wurden hin und wieder mit alten Schulbüchern beschenkt.
„Ich wäre rundherum glücklich“, seufzte Mama oft, „wenn ich nur dein Bein wieder in Ordnung bekäme!“ Dabei sah ich Tränen in ihren Augen, und damit ich sie nicht sehen sollte, nahm sie mich fest in die Arme. Ich spürte trotzdem, wie sie weinte und war überzeugt, sie hätte diese schäbige Krankheit ohne zu zögern auf sich genommen, wenn sie mir damit meine Gesundheit hätte zurückgeben können. Täglich massierte sie das Unglücksbein und machte mit mir ausgiebig die Übungen, die uns die Heilgymnastin im Krankenhaus gezeigt hatte. Doch es änderte sich nichts. „Ich bleibe einfach für immer auf Papas Schiff“, tröstete ich sie, „dann werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr angegafft.“ Mama schüttelte den Kopf. „Bis du groß bist, gibt es vielleicht schon neue Methoden, die uns weiterhelfen. Außerdem wollen wir doch auch mal wieder in einer richtigen Wohnung leben.“
„Lebst du nicht gern auf dem Schiff?“
„Doch, Arthur zuliebe und überhaupt. Aber eine Wohnung und die Stadt und ein bisschen Kultur, das hat ja schließlich auch was.“ Annemarie Seidenader hatte ihren Mann in Frankfurt in einem Ruderklub kennengelernt. Er hatte sich spontan in die hübsche junge Frau verliebt und trotz anfänglicher Widerstände nicht mehr locker gelassen. Ihre Eltern reagierten zurückhaltend, denn sie sollte studieren, einen Abschluss machen und Lehrerin werden. Ein Leben auf dem fahrenden Schiff, das stellte sich ihre Mutter „ziemlich windig“ vor, und der Vater, Finanzbeamter im mittleren Dienst, war so entsetzt, dass er sich gegen jede Gewohnheit eine ganze Nacht hindurch betrunken haben soll. Aber verboten haben sie ihr die Heirat nicht, obwohl sie noch nicht einundzwanzig, also noch nicht volljährig war. Erst im Laufe der Jahre hatten sie sich mit dem Gedanken an das Schiffsleben ihrer Tochter anfreunden können. Der Vater starb mit dreiundfünfzig Jahren an einer nicht rechtzeitig erkannten Embolie in Folge einer Gallenoperation. Und seine Frau, unsere Großmutter, zog wenig später von Frankfurt weg nach München, um ihren traurigen Erinnerungen auszukommen.
Arthurs Eltern lebten beide nicht mehr. Sie lagen in Würzburg begraben, Corinna und ich hatten sie nicht mehr kennengelernt. So gab es nur die Münchner Oma, mit der wir, wenn wir uns länger in einem unserer Häfen aufhielten, jedes Mal ausführlich telefonierten. Mama sah ihr sehr ähnlich, nur dass Omas Haare jetzt schneeweiß waren. Beide hatten ein hübsches, klares Gesicht, dunkelblaue Augen, einen schönen Mund, den sich Mama jeden Morgen mit einem rosafarbenen Lippenstift schminkte. Wir beiden Mädchen standen neuerdings dabei und bewunderten sie, auch ihre dunkelblonden langen Haare, die sich nach dem Waschen und Fönen ganz von selber lockten. Wir durften uns auch anmalen, wenn wir es wollten oder für unsere Spiele benötigten. Nur sollten wir sparsam mit ihrem Lippenstift umgehen, da er noch immer schwer zu bekommen war, schon gar in diesem hellen Rosa. Auch ihrer kostbaren Wimperntusche und ihres Nagellacks bemächtigten wir uns. Unsere teetrinkenden Holzdamen rückten immer mehr in den Hintergrund. Wir machten uns schön, und ich glaube, Corinna wollte, nebenbei oder hauptsächlich, unserem Matrosen Karlheinz gefallen. Dann setzten wir uns hinter unsere Zeichenblöcke und malten uns gegenseitig ab. Für Corinnas Haare, wie bei Mama dunkelblond, besaß ich einen braunen Stift, über meine hellblonden Haare aber jammerte sie, weil sie weder weiß noch gelb besaß. Sie half sich mit orange, was uns aber beiden nicht sehr gefiel. Von einer Vielzahl leuchtender Wasserfarben in großen Malkästen konnte man im Jahre 1948 nur träumen. Malten wir nicht nur das schwesterliche Gesicht, sondern auch die ganze Figur, so kam Corinna wesentlich besser weg. Ich hatte ja nun mal das dünne Bein. „Da malen wir einfach eine weite lange Hose drüber“, entschied sie, „dann bist du so schön wie du es verdienst.“
„Auf dem Bild sieht man ja nicht, wie ich hinke.“ Sie nickte. „Ganz genau. Und bald wird man es auch in Wirklichkeit nicht mehr sehen.“ Immer gab sie sich Mühe, mich zu trösten, und sie schaffte es auch. „Hier auf dem Schiff ist’s ja nicht schlimm“, spann ich den Faden weiter, „aber wenn wir mal in die Stadt ziehen und ich unter Menschen muss…“
„…dann wird man es erstens kaum noch sehen und zweitens machst du sowieso alles wett mit deinem schönen Gesicht und deinen hellblonden Locken.“
Wie ich Corinna liebte! Hoffentlich würde ich sie nicht so bald an einen Mann verlieren, hoffentlich blieb das Feuer, das sie für Karlheinz entfacht hatte, ein Strohfeuer!
Zwei Uhr, normalerweise die Zeit meiner ersten Müdigkeit. Doch ich bleibe hellwach, seit ich meine Geschichte aufschreibe. Der starke Kaffee der Nachtschwester wäre nicht nötig gewesen.
Aber sie hat ihn gebraucht, ebenso wie die Gymnastikübungen am offenen Fenster. „Man sackt so ab, wenn nichts los ist auf der Station“, sagt sie, „andererseits müssen wir ja froh sein, wenn die Kinder durchschlafen.“
Ich stimme ihr zu. „Wenn es so bleibt, könnte diese Woche fast erholsam sein.“
„Aber nicht, wenn man so viel schreibt wie Sie! Würde ich übrigens nie tun, schon gar nicht freiwillig.“ Sie lacht und holt kleine Schälchen für die Tabletten aus dem Schrank.
„Das müssen Sie auch nicht, Monika, so jung wie Sie sind. Und danke für den Kaffee – spätestens um vier Uhr treffen wir uns wieder.“
Ich gehe zurück in mein kleines Arztzimmer und überfliege noch einmal die ersten Seiten. Ein Gefühl von Ambivalenz, das ich schon beim Schreiben hatte, verstärkt sich. Von heute aus betrachtet hat nichts von dem, was ich da aufgeschrieben habe, wirklich Bestand. Die Erlebnisse und Eindrücke und Bilder verwischen sich in ihren Konturen, werden unscharf, auch verwackelt wie ein Foto, manchmal sogar von einem anderen Bild überblendet. Als hätte es einen störenden Lichteinfall gegeben, der alles „scheinbar“ werden ließ. Haben sich meine Eltern wirklich so geliebt, waren sie ein gutes, überzeugendes Team? Hatte ich die sehnsüchtigen – oder traurigen – Augen meiner Mutter vergessen, mit denen sie manchmal in die vorüberziehenden Landschaften schaute und sich dann beklagte, es gäbe optisch nirgendwo mal einen festen Punkt, an den man sich halten könne, und Freundschaften ließen sich bei dieser Art von Leben schon überhaupt nicht pflegen? Sagte sie Freundschaften und meinte Liebe? Liebe zu jemandem, der keineswegs Arthur hieß?
Und waren die abendlichen Unterhaltungen meiner Eltern im Flüsterton immer friedlich? Wohl kaum. Denn heute weiß ich vieles, was ich damals nicht wusste, oder nur ahnte, oder einfach nicht wahrhaben wollte.
Kapitel 3
Unsere Schifffahrts-Route war fast immer die gleiche, solange ich denken konnte. Von Stollhofen rheinabwärts über Speyer, Ludwigshafen, Worms, Gernsheim, Oppenheim, Nierstein, Nackenheim, Mainz, dann das scharfe Einbiegen steuerbords in die Mainmündung und weiter mainaufwärts über Gustavsburg, Bischofsheim, Rüsselsheim, Raunheim, Eddersheim, Kelsterbach, Höchst nach Frankfurt, manchmal noch weiter nach Würzburg. Wir konnten die vielen „heims“, aber auch die Namen aller Brücken herunterleiern wie einen Auszählvers. Obwohl wir die Landschaften, an denen wir vorüberzogen, eigentlich nur dann bewusst betrachteten, wenn wir uns in die Sonne setzten oder Wäsche aufhängten, waren sie uns vertraut wie die Seiten eines abgegriffenen Bildbandes, die man immer wieder aufschlägt.
Im Laufe der Nachkriegsjahre hatte es freilich Veränderungen gegeben. Schöne große Wiesen und Weiden waren bebaut worden, Wohnsiedlungen und Industrieanlagen waren entstanden, Deutschland atmete tief durch und erholte sich von den Zerstörungen des Krieges, baute auf, kam mit zunehmendem Pulsschlag wieder in Gang. Wir, auf unserer fahrenden Insel, blieben davon unberührt. Wie ein Kontrabass, der aus tiefster Tiefe Tonart und Rhythmus einer Musik bestimmt, so stampfte sich unsere Schiffsschraube durchs Wasser, gleichmäßig und verlässlich vom tiefen Brummen des Motors gestützt.
Am 25. Juni 1951 wurde Corinna sechszehn Jahre alt. Ihr Strohfeuer war natürlich mittlerweile zu einem helllodernden Feuer geworden. Karlheinz liebte sie ebenso, mit der ganzen Intensität und Ausschließlichkeit seiner dreiundzwanzig Jahre. Erst seit ich vollständig eingeweiht worden war, betrachtete ich ihn mir genauer, den großen kräftigen Kerl mit den dunklen Haaren und dem sehr schmalen gebräunten Gesicht, das meist recht ernst dreinblickte. Nur wenn er Corinna begegnete, und das geschah „zufällig“ sehr oft, ging ein Strahlen über seine Züge und, nach einem scheuen Blick in Richtung Steuerhaus, gab es einen schnellen Kuss. Corinna, auf den Wogen ihrer ersten Liebe, griff in jeder freien Minute nach ihrem Tagebuch, und dafür suchte sie sich den abgelegensten Winkel des vorderen Schiffes, des Schubleichters, um während des Schreibens möglichst nicht gestört zu werden, auch nicht von mir. Mit meiner Schwester war nun nicht mehr viel anzufangen, von heute auf morgen war ich zu einer Art Einzelkind geworden, das auf sich selbst zurückgreifen und über Solo-Spiele nachdenken musste. „Sei mir bitte, bitte nicht böse“, flüsterte sie mir abends aus ihrer oberen Bett-Etage zu, „weißt du, er ist meine große Liebe, wir wollen heiraten und Kinder kriegen und überhaupt.“ Ich nickte zustimmend, wenn auch unter Tränen, und behauptete, es wäre nicht so schlimm.
Aber heute, an ihrem Geburtstag, gehörte sie uns allen. Mama hatte draußen auf dem Kajütendach einen runden, mit bunten Bändern verzierten Kaffeetisch gedeckt und fünf große Torten gebacken. Es gab, damals noch ein Luxus, echten Bohnenkaffee, und für jeden der beiden Männer hatte sie in Stollhofen sogar eine Schachtel Zigaretten gekauft.
Natürlich wussten unsere Eltern von dem Verhältnis ihres Matrosen zu Corinna, und es machte ihnen auch die üblichen elterlichen Sorgen. Aber sie reagierten weder mit Vorhaltungen noch gar mit Verboten. Papa sprach nur „ein ernstes Wort unter Männern“ mit Karlheinz, das musste genügen. Und es genügte. Schon allein deshalb, weil so ein Schleppkahn kaum mit einem abgeschlossenen Schlupfwinkel dienen kann.