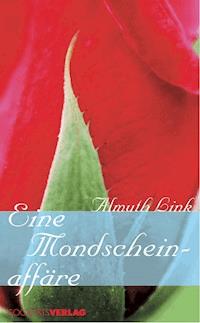Almuth Link
Die flüsternde Zeit
Roman
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2013 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Nicole Ehrlich, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Nicole Ehrlich, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: © INFINITY - Fotolia.com
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-065-9
Mater Rhabana zum Gedenken
1
Eine alte Frau trippelte auf mich zu und hielt mir ihre nackte Babypuppe entgegen. In ihrer Brust sei heute zu wenig Milch für den Säugling gewesen, schrie sie mit der schrillen Stimme eines Vogels, der sein Nest verteidigt. Dazu schüttelte sie den Kopf, so heftig, als müsste sie den spärlichen Rest ihrer weißen Haarsträhnen abwerfen.
Ich wich ihr in einem weiten Bogen aus, wollte ihre laute Verwirrtheit nicht ertragen, schon gar nicht hier. Sie stieß ihre Puppe wie einen Dolch in die Luft und trippelte weiter.
Der Alte Friedhof war vor mehr als einem halben Jahrhundert endgültig eingeebnet worden, man hatte eine Kirche und ein Pflegeheim darauf gebaut. Aber in dem jetzigen Park dahinter standen noch die hohen Buchen von damals, über die nun ein weiteres Menschenleben gegangen ist – auch mein Leben.
Sie werden die verwitterten Grabsteine und Platten zertrümmert und entsorgt haben. Mir wurde schwindelig, meine Beine wollten nicht gehorchen, fühlten sich wie schwere Gewichte an. Aber eine bestimmte Stelle in diesem Park musste ich unbedingt finden, oder wenigstens ahnen, wo sie gewesen sein könnte; die Stelle, wo ich so oft im Gras bei meiner steinernen Eva gesessen hatte. Ich fand die Stelle, ungefähr.
Eine Bank stand jetzt da, „gestiftet von den Stadtwerken“. Daneben ein grüner Papierkorb aus Plastik, bis zum Rand angefüllt mit Pappbechern, Zeitschriften und leeren Zigarettenschachteln.
Ich war allein, setzte mich nach kurzem Zögern hin. Vielleicht würde es mir gelingen, mich zu beruhigen. Über mir die hohen Baumkronen rauschten gleichmäßig und leise, wie damals, es waren ja dieselben geblieben. Und von irgendwoher wehte auch wieder der starke Duft von Jasmin. Ein Duft, nach dem ich mir bis heute meine Seifen und Parfums aussuche. Erinnerung an Weilburg, wie lange nun schon.
Ein Klassentreffen meines Jahrganges 1935 hat mich hierher geführt, zunächst zum gemeinsamen Mittagessen. Weil die meisten von uns nur während der ersten vier Volksschuljahre zu dieser Klasse gehört hatten, war es nur noch ein kleiner Kreis, der sich im gemütlichen „Café Pechan“ hoch über der Lahn zusammenfand. Und selbst für die wenigen hatte es den Initiator des Treffens viel Mühe gekostet, nach sechsundsechzig Jahren ihre Adressen ausfindig zu machen.
Natürlich hat keiner mehr den anderen erkannt, wir standen uns wie Fremde gegenüber, fremd und schon recht alt. Sollten uns aber duzen. „Ich hieß damals Ursula Berkum“, stellte ich mich vor, „vom Hauptlehrer bin ich Udrei genannt worden. Gesessen hab ich neben der Juliane Colpi.“
An Juliane erinnerten sich alle. Der Schock damals, als sie am 29. Juni 1942 mitten aus der Schulstunde von Gestapo-Leuten abgeholt wurde, hatte sich tief in die Gedächtnisse eingegraben. Und dann sprachen wir nicht über unsere einzelnen Schicksale, wie eigentlich bei Klassentreffen üblich, sondern ausschließlich über das, was damals mit Juliane, unserer jüdischen Mitschülerin, passiert war.
Abends wollten wir uns wieder zusammenfinden. Ich hatte also nachmittags genügend Zeit, nach der Stelle meiner kleinen Eva-Grabplatte zu suchen und auf der Bank der Stadtwerke meinen Gedanken nachzuhängen. Verwirrenden Gedanken, die sich in dauernder Wiederholung im Kreise drehten und schnell anfingen, mich zu peinigen. Ich packte sie energisch zur Seite und lief hinunter zur Lahn, an der Uferstraße entlang und wieder zurück, wohl auf der Flucht vor mir selbst.
Den Abend leitete unser Initiator, Karlheinz Böck, mit einer Rede ein. Wir „Neunzehnhundertfünfunddreißiger“ seien, so das Urteil der jüngeren Generationen, ohne eigenes Profil, eigentlich ohne erkennbares eigenes Gesicht. In der Nazizeit noch Kinder, hätten wir durch das Geflüstere der Erwachsenen vieles geahnt, manches auch bemerkt, nichts aber wirklich gewusst. In der Nachkriegszeit ja erst Heranwachsende, hätten wir ebenfalls nichts richtig gewusst, zum Beispiel nicht, dass einige – oder viele? – der ehemaligen Nazi-Bonzen sich inzwischen schon wieder in hohe Staatsstellen katapultiert hatten. Und was den Wiederaufbau beträfe, den hätten nicht wir, sondern unsere Eltern gestemmt. Als eine stets den eigentlichen Leistungen der Zeit hinterhergelaufene Generation würden wir eingestuft, irgendwie ein bisschen bedeutungslos und „dazwischen“, wie gesagt, ohne Profil!
Im Gespräch danach tauchten die immer gleichen Fragen auf, von denen wir wussten, dass Kinder und Enkel sie uns heute stellen. Für jeden von uns ähnlich erlebt und ähnlich beantwortet. „Habt ihr denn von dem Schicksal der Juden damals nichts gemerkt? Und wenn, warum sind denn eure Eltern nicht auf die Straße gegangen, so wie heute, als Protestbewegung zum Beispiel!“
„Protestbewegung? In einer Diktatur?“
Und: „Es konnte doch gar nicht ausbleiben, dass ihr etwas gemerkt haben müsst, auch schon als Kinder! Wenn Erwachsene sich fast nur noch im Flüsterton unterhielten, wenn jüdischen Familien von ihren Freunden dringend angeraten wurde, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Wenn sie plötzlich den Judenstern an ihren Jacken trugen. Wer kann denn behaupten, nichts gemerkt zu haben? Jeder musste doch gespürt haben, dass Gefahr im Verzug war, natürlich auch ihr Kinder, Gefahr für die jüdischen Menschen in eurer Mitte. Sonst hätte ja niemand zu flüstern brauchen! Warum habt ihr denn gar nichts unternommen?“
„Weil wir KINDER waren, erstens, und weil Widerstand unserer Eltern mit dem Leben bezahlt wurde, deshalb. Weil die Ideologie der Nazis einen Teil des Volkes durchsetzt hatte wie Schimmel, den man nicht überall sieht, der aber trotzdem da ist, der gefährlich dicht unter der Decke auf der Lauer liegt.“
„Und warum gab es eine so hirnverbrannte Ideologie?“
„Weil es zu allen Zeiten Dummheit, Fanatismus und Grausamkeit gibt, das Hirnverbrannte, auch heute noch.“
Wir redeten bis zwei Uhr nachts, die privat und in der Arbeit erlebten Dialoge mit denen durchspielend, die lange nach uns auf die Welt gekommen waren und alles nur aus den Geschichtsbüchern wissen.
Immer wieder wurde Juliane erwähnt und ihr älterer Bruder Simon, der als Einziger seiner Familie mit dem Leben davongekommen war. Der später meine große Liebe wurde. Das habe ich ihnen aber nicht erzählt.
Um halb drei lief ich dann durch die warme Juni-Nacht in mein Hotel, reichlich überdreht und schon wieder von einer Erinnerung eingeholt. Auf dieser Straße, der Frankfurter Straße, etwa hundert Meter vor dem Hotel (das es damals aber noch nicht gab), musste es gewesen sein, dass ich als Kind, abends von irgendeinem Kindergeburtstag kommend, eine laut hechelnde, offenbar angefahrene Katze neben dem Rinnstein entdeckte. Ich nahm sie hoch und schleppte sie nach Hause. Unsere Haushaltshilfe, sie hieß Miesi, die sich am liebsten ein Hakenkreuz auf die Brust genäht hätte, fing sofort zu lamentieren an. „Katzen haben in unserem Haus nichts zu suchen, Katzen nicht und eure Juden-Freunde auch nicht!“
„Das ist nicht I h r Haus, ich verbitte mir solche Redensarten ein für allemal“, schrie ihr meine Mutter von der Kellertreppe aus zu, „das ist unerträglich!“
„Mal sehen, wer hier am Schluss regiert!“, nuschelte Miesi und verschwand in der Küche.
Ich legte die hübsche, grauweiße Katze in mein Bett und beriet mit Mama und meinem Bruder, ob es irgendwo noch einen Tierarzt gab, der nicht als Soldat eingezogen war. Während wir noch überlegten, lief ein kurzes Zittern durch ihren Körper, sie streckte sich und hörte zu atmen auf. „Wenigstens ist sie in einem warmen Bett gestorben“, tröstete mich Johannes, „wir legen sie jetzt in einen Korb und morgen früh buddel ich ihr ein tolles Grab, vielleicht hinten neben dem Schwimmbecken.“ Mein großer Bruder – ich liebte ihn sehr, und das gilt heute noch. Morgen werde ich ihn ganz bestimmt anrufen.
Mit dieser Erinnerung an die Katze hatte ich mein Hotelzimmer erreicht. An Schlaf war nicht zu denken. Die schöne, sehr reichhaltige Bar im Keller hatte längst geschlossen, sonst hätte ich sie gerne noch aufgesucht. Also nahm ich mir aus dem Zimmerkühlschrank ein Fläschchen Sekt und setzte mich draußen auf meinen kleinen Balkon. Der Alkoholkonsum heute war ohnehin schon über das normale Maß hinausgegangen, da kam es auf ein Glas Sekt schon nicht mehr an.
Vielleicht hätte ich das Klassentreffen absagen sollen. Nach so vielen Jahren zurückzukehren in die Kleinstadt der Kindheit – dieser Kindheit – hatte etwas von einer leichtsinnigen Mutprobe. Ob ich sie bestanden habe heute, ist eine Frage der Sicht. Weggelaufen bin ich nicht. Aber ich habe mir mit Alkohol geholfen.
Vom Balkon aus konnte ich die Baumkronen meines Alten Friedhofs sehen. Sommernächte sind ja hell.
Einige Hausdächer kamen mir noch bekannt vor. Das Stadtbild hatte sich hier gar nicht so sehr verändert, war nur durch neue, geschickt integrierte Häuser etwas dichter geworden. Mein Hotel gefiel mir gut, hatte gemütliche Zimmer, und man wurde freundlich und zuvorkommend behandelt.
Morgen wollte ich endlich mein Elternhaus ansteuern. Die Gedanken daran ließen sich zunächst noch einigermaßen in Ordnung halten. Erst allmählich, durch die einzelnen Etappen der Erinnerungen aufgebracht, gerieten sie in Bewegung und fielen schließlich so ungebremst übereinander her, dass ich die Waffen strecken musste und den chaotischen Wirbel hinnahm. Ich hatte ja auch gegen den Alkohol anzukämpfen!
Zum Glück wurde ich irgendwann dann doch müde. Ich ließ alles auf dem Balkon stehen und liegen, legte mich in Kleidern auf mein Bett und schlief sofort ein.
Dass ich sehr früh schon wieder aufwachte, lag wahrscheinlich an dem lauten Vogelgezwitscher und an der Helligkeit des Junimorgens. Ich hatte in der Nacht natürlich vergessen, die Jalousien herunterzulassen.
Duschen, anziehen und auf den Weg machen. Damit würde ich ohne lange Vorlaufzeit mich selbst überrumpeln und mein schwieriges Vorhaben hinter mich bringen.
Eine halbe Stunde später, ich hatte mich zur Eile angetrieben, lief ich schon durch das noch schlafende Städtchen die steile Frankfurter Straße hoch.
Der anfängliche Schwung ließ recht bald nach, meine Schritte wurden schwerfälliger. Warum tat ich mir das überhaupt an? Andererseits, es gab doch auch schöne Erinnerungen! Denk einfach nur an die schönen, würde mein Bruder Johannes sagen, die anderen entsorgst du auf der Müllkippe!
Ach, Johannes …
Auf einmal stehe ich davor, auf der rechten Straßenseite vor einem niedrigen, gepflegten Jägerzaun.
Und starre auf das Haus.
Zu meiner Verwunderung nehme ich meine Eindrücke nicht nacheinander, sondern gleichzeitig wahr, so, als hätte ich ein Bild geknipst. Aber das Bild hat Fehler, die Dinge darauf überblenden sich, widersprechen sich auch und lassen keine eindeutigen Schlüsse zu. Sie wirken vertraut und fremd, freundlich und bösartig, warm und eiskalt, weit entfernt und ganz nah. Das Haus ist ein Behälter, so vollgefüllt, dass er fast platzt, so leer, dass er fast in sich zusammenfällt. Und das ganze Bild ist ohne den leisesten Anflug von Versöhnlichkeit.
Ich versuche das verkorkste Bild zu reparieren. Es gelingt mir sogar. Indem ich mir selber nur das erzähle, hörbar erzähle, was ich sehe, nicht was ich fühle.
Also: „Das Haus ist jetzt weiß gestrichen. Die breite Eingangstreppe ist nicht mehr grau, sondern blau. Die unteren Fenster hat man schmiedeeisern vergittert. Die drei Fenster von Johannes’ und von meinem Zimmer sind zu Dachgauben umgebaut worden. Der Weg zum Haus ist gepflastert und breiter. Die Wiesen sind jetzt Blumenrabatten, dazwischen stehen hübsch bepflanzte Terracotta-Töpfe. Unsere vielen Jasminbüsche an den Rändern des großen Grundstückes gibt es nicht mehr, auch nicht den Flieder.“
Ich öffnete das Gartentor und lief über den schmaleren Nebenweg zur hinteren Seite des Hauses. Der Wintergarten – wo blieben die dünnen Geigentöne meiner Mutter? – hatte man genau wie vor dem Bombenangriff wiederaufgebaut. Die Fenster aller anderen Zimmer waren bodentief vergrößert worden.
Unser steinernes Gartenhäuschen stand noch da, freilich ohne die Schaukel in seinem Ausgang. Unser Schwimmbecken hatte man zugeschüttet. Noch immer begrenzten die hohen Zedern unmittelbar dahinter den Garten zum Nachbarhaus.
Die weite Wiesenlandschaft bis hinunter ins Lahntal gab es nicht mehr. Sie war völlig zugebaut. Hier oben also hatte sich das Stadtbild ganz und gar verändert. Mit dieser sachlichen Feststellung rettete ich mich im allerletzten Moment vor einer Panikattacke, die sich ankündigen wollte. Nur noch weg von hier, weg vom Anblick der Zedern vor allem! Mit ihnen war die Zeit plötzlich zusammengeschrumpft und ließ mich den Abstand zu früher kaum noch wahrnehmen.
Auf einmal ist mir klar, und es verdichtet sich in meiner Vorstellung zu einem fast schon fertigen Manuskript: Ich werde alles aufschreiben, alles, was ich noch weiß. Für wen? Zunächst für mich und meine Generation.
Meine Geschichte ist nicht alltäglich. Aber sie passt genau in die Zeit, in der wir „Neunzehnhundertfünfunddreißiger“ uns alle auskennen. Und die nach uns kamen, die sich NICHT auskennen, die das, was sie nur vom Hörensagen wissen, aber nicht erlebt haben, sollten sie zur Kenntnis nehmen. Um gerechter zu urteilen. Das doch zumindest.
Draußen, endlich wieder auf der Straße, holte ich mein Handy aus der Handtasche und rief Johannes an. Er wusste von dem Klassentreffen und hatte, wenn auch nicht so früh am Morgen, mit meinem Anruf gerechnet. „Weißt du“, antwortete er auf meinen aufgeregten Bericht ganz ruhig, „wir sind jetzt in einem Alter, in dem man belastende Erlebnisse von früher endgültig abhaken sollte.“
„Hab ich damals als junges Mädchen schon getan. Sonst wäre ich später doch nicht wieder so glücklich geworden! Nur mit dem Wörtchen ‚endgültig‘ klappt das offenbar nicht so richtig. Die Zedern da hinten, wo das Schwimmbecken …“
„… Lass das blöde Schwimmbecken liegen und geh jetzt nicht auf den Hauptfriedhof zum Familiengrab, lass unsere Toten einfach ruhen. Fahr nach Hause.“
„Ich werde meine Geschichte aufschreiben.“
„Eine gute Idee. Und im Schreiben lass auch endlich deine letzten Schuldgefühle los!“
„Ich hätte selbst nicht gedacht, dass sie sich heute wieder melden würden.“
„Blas sie in den Wind, kleine Schwester, sie sind ganz und gar unberechtigt! Und damit du zwischendurch ordentlich was zu lachen hast, denk an die Geigerei unserer Mutter!“
Ich lachte jetzt schon, schaute noch einmal zurück zu dem ehemaligen Wintergarten und meinte die kratzigen Geigentöne durch die Glaswand zu hören, als hätten sich die Saiten losgelöst, um sich als Einzeltäter noch zu steigern.
Im Hotel packte ich meine Sachen, setzte mich in meinen Golf und fuhr zurück nach Frankfurt, über meine geliebte Friedensbrücke nach Sachsenhausen und in die Paul-Ehrlich-Straße.
Unter der Birke am Gartentisch richtete ich mir ein kleines Büro ein mit meinem Laptop, Papier und Brille – und dachte darüber nach, wie ich anfangen könnte.
2
Mein Weilburger Schulweg der ersten Jahre führte über den Alten Friedhof. Er bedeutete eine Abkürzung der weiten Strecke, die ich täglich zu laufen hatte. Aber nicht deshalb wählte ich diesen Weg. Ich freute mich immer schon darauf, das verrostete Eisentor nach innen zu drücken – die Klinke war abgefallen – mich mitsamt meinem Schulranzen durch den schmalen Spalt zu zwängen, das Tor wieder heranzuschieben und nun ganz allein mit mir zu sein. Kein Mensch sonst wollte offenbar diesen Ort betreten, denn noch nie war mir hier jemand begegnet.
Ich liebte diesen Friedhof, den ich wie eine notwendige Schutzzone vor der Schule empfand, vor diesem hässlichen gelben Kasten unten an der Lahn, der aussah wie eine heruntergekommene Kaserne. In der ein „Herr Hauptlehrer“ sein Unwesen trieb, Ohrfeigen verteilte und mit dem Stock auf die Handrücken von uns Kindern schlug.
Für Augenblicke gerieten hier solche Szenen ganz in Vergessenheit oder nahmen so verschwommene Konturen an, dass ich sie – und meine Angst – beiseite schieben konnte. Auf dem Alten Friedhof gab es keine Gegenwart. Sie war ausgesperrt worden für immer. So klein ich noch war, ich konnte das spüren, ganz unmittelbar. Wahrscheinlich, w e i l ich noch so klein war.
Sprödes Gras überall, keine Wege. Und darüber hohe, alte Buchen. Die rauschten weit da oben vor sich hin, filterten das Licht, sodass ich mich geborgen und beschützt fühlte wie in einem dämmrigen Raum. Dämmrig, nicht dunkel!
Ich kannte bald jeden einzelnen der verwitterten, lose herumliegenden Grabsteine. Ihre Inschriften konnte man kaum noch erkennen. Und die Grabeingrenzungen, wenn es sie überhaupt gegeben hatte, waren längst vom Gras überwuchert.
Besonders angezogen fühlte ich mich von einer kleinen losen Grabplatte, in der als Relief der Kopf eines Kindes zu erkennen war, mit einem ganz zart eingemeißelten Gesicht. Es musste ein Mädchen gewesen sein, denn man sah die Andeutung langer Haare. „Lange Haare und so ein süßes Gesicht, aber schon tot“, flüsterte ich traurig, „dann geb ich dir wenigstens einen Namen.“ Ich nannte sie Eva. Oben rechts auf dem Stein waren fremde Schriftzeichen eingraviert, hier sogar noch etwas deutlicher zu sehen. Vielleicht ihr richtiger Name oder ihr Todestag?
Weil wir noch Sommer hatten, konnte ich mich zu ihr ins Gras setzen und ihr alles Mögliche erzählen. Von meinem Vater, der im Krieg war, meinen Brüdern, meiner Freundin Juliane. Nach wenigen Minuten stand ich auf und klopfte mir die Grashalme vom Rock. „Jetzt aber auf Wiedersehen, Eva, weißt du, ich muss zur Schule!“ Die zweite Hälfte meines Weges, wenn ich auf der Rückseite des Friedhofs über einen halb eingerissenen Drahtzaun wieder hinausgeklettert war, konnte ich nur noch rennend zurücklegen, um gerade noch rechtzeitig vor dem Hauptlehrer ins Klassenzimmer zu witschen.
Der Lehrer war klein und spirlig und trug eine kreisrunde, randlose Brille, deren dicke Gläser seine Augen unmäßig vergrößerten. Und er vertrat noch die unangefochtene Prügelpädagogik der 40er Jahre: „Wer Angst hat, pariert.“
Alphabetisch geordnet, saßen wir in unseren Holzbänken mit den Klappsitzen. Ich hieß mit Nachnamen Berkum, zu unserem großen Glück hieß Juliane Colpi, sodass wir nebeneinander sitzen konnten.
Juliane war eine Träumerin, ausgeprägter noch als ich. Öfter vergaß sie ihre Schiefertafel, ihre Griffel oder ihr Lesebuch. Dafür wurde sie geohrfeigt. Und wenn der Hauptlehrer zum Schlag ausholte, traf er dabei mit seinem Handrücken auch mich. Ich beschwerte mich nicht, denn ich liebte Juliane sehr und fand es irgendwie in Ordnung, mit ihr gemeinsam zu leiden.
Ihre Schiefertafel hatte einen tiefen Riss, das allein schon heizte den Ärger des Lehrers an. Nach jeder seiner Attacken saß sie da, schluchzend, die Hand auf die feuerrote Wange und das Ohr gepresst. Und taub gegen meine Tröstungsversuche. Vielleicht auch vorübergehend wirklich taub. Sie wäre damals nicht das erste Kind mit zerschlagenem Trommelfell gewesen.
Wir beiden Freundinnen teilten in der Schule alles, was uns möglich war. Mit einem Griffel, Schwamm und Bleistift konnte ich aushelfen, leider nicht mit der Schiefertafel, auf der ja in meiner Schrift die Hausaufgaben standen. Unser Peiniger hätte es sofort gemerkt. Juliane gab mir im Gegenzug die Hälfte ihres Schulbrotes ab, weil ich selten eines dabeihatte.
Der Lehrer nannte mich Udrei. Eigentlich hieß ich, wie viele Mädchen meines Jahrganges, Ursula. Der Modename ging damals wie eine Flut über das Land. Und bis sich junge Eltern bei der Namensentscheidung dessen so richtig bewusst wurden, stand Ursula, die kleine Bärin, schon im Buch der Standesbeamtin. Der Lehrer half sich durch Nummerierung. Vier kleine Bärinnen waren wir in der Klasse, für ihn war ich aus unerfindlichen Gründen, denn es passte nicht ins Alphabet der Nachnamen, die Nummer drei. Deshalb also Udrei.
Zu Hause und von Freunden wurde ich freilich, solange ich denken konnte, immer nur Uffa genannt, weil mein kleiner Bruder den Namen Ursula nur so hatte aussprechen können. Er war damit zu meinem lebenslangen Namensgeber geworden.
In der Schule nun aber Udrei.
An den Kreisspielen auf dem Pausenhof hätte sich Juliane beteiligen dürfen, für mich waren sie gesperrt. Mich plagte eine Neurodermitis, meine Hände sahen rau und rissig aus, man mochte sie nicht anfassen, schon gar nicht, wenn sie von alten Verbänden umwickelt waren.
Juliane und ich wussten aber etwas viel Besseres als Kreisspiele oder Hickelhäuschen. Denn hinter dem Schulhof floss die Lahn, ein schmaler, aber tiefer, lebhaft strömender Fluss.
Wir schafften es immer, unbemerkt zu entkommen und uns durch die Büsche zu schlagen, die dem Fluss vorgelagert waren. Für uns Kinder der 40er Jahre, da Kinder damals nicht zur Mangelware der Nation zählten, wurde ein Schulhof noch nicht nach allen Seiten abgesichert, auch nicht vor einem Fluss, der uns hätte gefährlich werden können.
Wir fanden es prickelnd, unten an der Böschung zu sitzen und dem raschen Dahinfließen des Wassers zuzuschauen. Die andere Seite des Ufers begrenzte ein dicht bewaldeter Steilhang, der das Flusstal in schattiges Halbdunkel tauchte. Die Farbe der Lahn entsprach nie der Farbe des Himmels. Immer war sie braun und glanzlos. Fische blieben darunter unsichtbar. Das Strömende, Verborgene, Undurchsichtige war es wohl, was uns so faszinierte, uns Schauer des Grauens über den Rücken jagte. Schlammige Wasserteufel konnten sich da unten tummeln. Würden wir ins Wasser fallen, sie zögen uns sofort hinunter …
Der Lärm vom Schulhof gab uns angesichts solcher Vorstellungen einen angenehmen Rückhalt; fürchten mussten wir uns nicht, solange wir Menschen im Hintergrund wussten. Mit Ausnahme des verhassten Lehrers, den unsere Phantasie jedes Mal wortreich und genussvoll in die Lahn versenkte. Immer wenn sein imaginärer Kopf auftauchte, gaben wir ihm mit einer imaginären Stelze einen Schlag, wieder und wieder, bis er endgültig im braunen Wasser absoff. Nur noch die Brille, der Stock und ein paar Luftblasen, dann hatte sich’s ausgehauen, ausgebrüllt und ausgefistelt …
Störenfried unserer schönen Pause war die schrille Klingel, die ihr Ende ankündigte.
Doch konnten wir später nach der Schule, damit trösteten wir uns, noch eine kleine Strecke miteinander gehen.
Auf diesem Stückchen gemeinsamen Heimweges redeten wir meistens über unsere Geschwister und wie wir uns meines kleinen Bruders Christian, auf den ich nachmittags immer aufpassen musste, entledigen könnten. Mein fünf Jahre älterer Bruder Johannes störte uns zwar nicht, aber der Schlaumeier fand Mittel und Wege, sich der undankbaren Aufgabe des Aufpassens zu entziehen. Bei Juliane gab es nur den älteren Bruder Simon. Beide besuchten uns nachmittags so oft wie möglich, denn auch unsere beiden Brüder waren Klassenkameraden und schon lange die besten Freunde.
Unsere Ideen, wohin mit Christian, bekamen täglich Nachschub. Loswerden oder gar umbringen wollten wir ihn natürlich nicht, aber dingfest machen schon! Ich hätte ihn zum Beispiel im Sandkasten eingebuddelt, bis nur noch sein Gesicht zu sehen war, Juliane dachte an einen fest verschlossenen Kleiderschrank mit Luftlöchern oder an ein magnetisches Dreirad, von dem er nicht absteigen konnte. Wir wussten noch vieles mehr, wodurch wir uns des Spielverderbers hätten entledigen können. Das Gelächter darüber half unserer ramponierten Aufpassergeduld schon ein wenig!
Die neue Freiheit wollten wir dann nutzen. Am besten in unserem Garten, der an allen Ecken und Enden zum Spielen und Träumen verführte. Mit der Schaukel am Gartenhäuschen konnte man fast in den Himmel fliegen.
Für den Winter würde dann das große Haus bereitstehen, zumindest mittags in der Schlafenszeit ohne Christian und ohne die Geigerei meiner Mutter. Wir redeten uns heiß auf unserem kleinen gemeinsamen Stückchen Schulweg.
Wenn Juliane dann zu ihrem Haus abbiegen musste, drehten wir uns nach wenigen Schritten immer wieder um und winkten uns zu. Beide trugen wir den üblichen Schulranzen aus Presspappe, und da nur eine Schiefertafel, der Griffelkasten und das Lesebuch darin herumflogen, hatten wir nicht schwer zu tragen.
Ich musste jetzt eine schmale, holprige Steintreppe hochsteigen, die mit 114 ungleichmäßig hohen Stufen in einen felsigen Steilhang eingehauen war. Sie führte wieder, von der Rückseite aus, über den halb eingerissenen Drahtzaun, zu den hohen Buchen, zu den verwitterten Grabsteinen, zur kleinen Eva. Zu meinem einzigen Geheimnis, sogar vor Juliane!
Sie hätte mich zwar nie verraten, aber wenn man über etwas spricht, etwas Geheimnisvolles ausspricht, so viel wusste ich aus den Märchen, würde man es zerstören. Wahrscheinlich.
Dass ich nach der Schule immer zu spät nach Hause kam, bemerkte niemand. Meine schöne blonde Mutter stand meistens im Wintergarten und geigte. An ihrem hölzernen Notenständer lehnte ein zerfleddertes weißes Heft mit Etüden. Sie geigte ehrgeizig, akademisch und fürchterlich, jeder einzelne Ton malträtierte unsere Ohren. Beim Geige Üben sah sie blass und verkrampft aus, jedenfalls nicht glücklich. Johannes und ich sprachen oft darüber, warum sie es so gerne tat und – vor allem – warum sie über die Kratz- und Schleifperiode der Anfängerin nie hinauskam. „Die ist einfach völlig unmusikalisch und für’s Geigen unbegabt“, konstatierte Johannes gnadenlos, „und der komische Musikprofessor hält ja nur an ihr fest, weil’s Geld bringt und weil er in sie verknallt ist.“
„In die Mama?“
„Ja, meinst du vielleicht, in dich?
„Quatsch.“
„Also, warum übernachtet der Kerl so oft hier bei uns? Vielleicht weil er mit Mama nachts das Doppelkonzert von Bach spielen will? Mädchen, bist du naiv!“
„Angeber!“
„Übrigens, Uffa, dein Gefauche auf der Querflöte klingt auch nicht gerade hinreißend, aber doch wesentlich besser als Mamas Geschrubbe!“
Tadel und Lob in einem einzigen Satz. Beides wollte ich ihm zurückgeben. „Dein Geklimpere auf dem Klavier, na ja – aber manchmal hört man schon eine Melodie heraus.“ Er lachte, zog kräftig an meinen langen Haaren und rannte davon.
Mama war jedenfalls zunächst nicht zu sprechen. Aber unser Dienstmädchen, die Miesi, meldete sich aus der Küche. „Hände waschen, zum Essen kommen!“ Die Frage „Was gibt es denn?“ erübrigte sich. Es gab immer Gemüse und Kartoffeln. Zu Trinken leider nichts, nicht einmal Leitungswasser. Das sei schädlich fürs Herz, erklärte Mama, die Medizin studiert hatte und es daher hätte besser wissen müssen. Aber auch die Miesi fand, dass Trinken ungesund sei. Und was Miesi fand, war sowieso Gesetz. Haushilfen, selbst von ihrem Kaliber, galten auch damals schon als Errungenschaften, die zu verärgern sich übel auszahlte.
Unser kleiner Bruder war mittags immer schon gefüttert und ins Bett gebracht worden. „Galgenfrist für uns“, sagte Johannes, „hoffentlich schläft er recht lang, am besten bis heute Abend oder noch die Nacht durch!“ Er durfte alles aussprechen, auch wenn es noch so frech war, und immer musste man darüber lachen. Ich bewunderte ihn.
Mein Vater war Direktor einer mittelgroßen Weilburger Bank. Bevor man ihm diese Stelle angeboten hatte, lebten wir in Frankfurt am Main. Sowohl unsere Eltern als auch wir beiden Kinder waren dort geboren. So was Alteingesessenes nannte man damals „Frankforter Schlippche“.
Mit Frankfurt verband mich in meinen frühen Erinnerungen einzig sein berühmter Zoo. Unser Vater wollte uns zwar immer ans Mainufer und zu seinem Eisernen Steg führen, uns den Fluss und die Schleppkähne zeigen, aber Johannes schrie nach dem Zoo, und ich schrie es ihm nach.
So stand unser geduldiger Vater oft stundenlang mit hochgeschlagenem Mantelkragen vor dem Affenhaus und bei den Eisbären herum und fror.
In Weilburg wohnten wir in einem sehr schönen gemieteten Haus ganz oben am Stadtrand und hatten einen endlosen Blick über freie Wiesenhänge bis hinunter ins Lahntal. Der große Garten mit einer Wiese, Jasmin- und Fliederbüschen, Blumen und allen möglichen Obstbäumen gehörte dazu, eine Garage und ein steinernes Gartenhaus und, damals noch eine Seltenheit, ein in der hintersten Ecke des Grundstücks in den Boden eingelassenes Schwimmbecken. Mit ihm und mit der Schaukel und Johannes’ Tretroller waren wir eine Attraktion für die Kinder der ganzen Umgebung.
Es kam noch hinzu, dass Johannes vom Gartenhaus bis zur Garage in anderthalb Metern Höhe ein festes Seil gespannt hatte, auf dem wir, ausgestattet mit einer Bohnenstange zum Balancieren, stundenlang Seiltanz übten. Unten in der Stadt hatten wir eine aufregende Darbietung der Hochseil-Artisten „Trabertruppe“ gesehen und waren seitdem in unserem akrobatischen Eifer nicht mehr zu bremsen.
Mit von der Partie waren meistens auch Juliane und Simon.
Um unseren zweijährigen Christian freilich kamen wir nicht herum. Auf seinen unsicheren, aber flinken Beinen, mit einem Teddy oder Ball in den Armen, lief er kreuz und quer durch den Garten, und wir mussten vor allem dafür sorgen, dass er nie in die Nähe des Schwimmbeckens geriet. Aber auch, dass er nicht auf allen Vieren unter dem Gartenzaun hindurch auf die Straße kroch. Wurde der kleine Quälgeist zu mühsam, verschwanden unsere beiden großen Brüder einfach auf Nimmerwiedersehen. An mir blieb er hängen, was ich aber mit Juliane zusammen nicht so schwer nahm. Ohne zu grollen, verzichtete sie mit mir gemeinsam auf den Seiltanz, die Schaukel, den Tretroller, und wir trotteten gelangweilt hinter dem kleinen Monster her. Kleines Monster, ja. Trotzdem, ich liebte ihn wirklich, den quicklebendigen Christian mit seinen dunkelblonden Locken und den strahlenden Augen. Immer war er gut aufgelegt, zufrieden und witzig, aber eben auch, leider, voller Tatendrang.
„Sei froh, dass du ihn hast“, entschied Juliane, „ich könnte trotz allem so einen kleinen Bruder noch gebrauchen.“
Es war genau der Trost, der mir guttat. Juliane traf immer den richtigen Punkt, feinfühlig und liebevoll wie sie war. Eine Freundin wie im Bilderbuch. Ich wollte sie hegen und pflegen ein Leben lang. Diesen Sonderwunsch packte ich abends meist noch schnell in mein Gebet, bevor mich der Schlaf überfiel.
Sie war ein auffallend schönes, zartes Mädchen, hatte lange, schwarze Locken, ein sehr schmales, meist blasses Gesicht und dunkle Augen. Sie trug eine Brille, die sie oft mit dem rechten Zeigefinger hochschob, weil sie zu rutschen drohte.
Ihr Vater, Dr. Martin Colpi, war Oberarzt in unserem Kreiskrankenhaus gewesen. Beide, die Mutter Rebecca hatte als Ärztin in einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet, durften ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil sie Juden waren.
Deshalb auch, so erfuhr ich später, hatten die Eltern gegen den Herrn Hauptlehrer nichts ausrichten können.
„Träum halt nicht so viel“, wurde Juliane oft von ihrer Mutter ermahnt, „das Leben besteht nun mal nicht aus Träumen!“ Zunächst aber schenkte Johannes ihr seine alte Schiefertafel ohne Riss, und wir flehten sie an, diese doch bitte nie mehr zu vergessen! „Nein, nein“, versprach sie und schob ihre Brille hoch. Und ihr großer Bruder kündigte an, später, wenn dieser Scheißkrieg zu Ende sei, dem Scheißlehrer derart auf die Schnauze zu hauen, dass er zu Boden fiele wie ein nasser Sack. Wie verlockend wir diese Aussicht fanden!
Juliane träumte weiter. Selbst bei unseren aufregendsten Versteckspielen lief sie gedankenverloren durch die Wiesen und stellte sich dann hinter irgendeinen Baum, wo man sie sofort fand.
Für mich war sie beste Freundin, Schwester, Schulkameradin, eigentlich war sie für mich alles. Ich hing an ihr, schwärmerisch mit meiner ganzen romantischen Kinderseele. Die kleine steinerne Eva auf dem Friedhof wusste Bescheid, ich hatte ihr viel von Juliane erzählt.
3
Fehlte mir mein Vater? Jedenfalls erinnerte ich mich nach seinem Abschied immer etwas wehmütig an die Zeit, in der ich, noch kein Schulkind, ihn jeden Morgen zur Bank begleiten durfte, ein kleines Stück des Weges, fest an seiner warmen Hand und glücklich über unser Zusammensein. Nach etwa hundert Metern, am alten Wasserhäuschen, schickte er mich zurück. „So, jetzt geht mein Schatz wieder heim“, sagte er und blieb stehen, bis ich an unserem weißen Gartentor angelangt war. Ein letztes Winken, und der Tag wurde schön.
Ich war vier Jahre alt, als er plötzlich, 1939, in einer Uniform vor uns stand, ein scheußliches Schiffchen auf dem Kopf, auf dem Rücken einen Tornister, und sich verabschiedete.
Mama weinte, Johannes bewunderte die Uniform, und ich weinte und bewunderte im Wechsel. Vor allem war ich erschrocken. Einen Abschied hatte ich noch nicht erlebt.
Einige Tage später rief er zum ersten Mal bei uns an, wir gehörten zu den wenigen, die privat schon ein Telefon besaßen. Es klingelte, Mama stürzte zum Apparat, der im Flur an der Wand hing, und dann überhäufte sie ihn mit Fragen. Abends summte sie glücklich das Lied der Zarah Leander vor sich hin, das mir noch heute in den Ohren klingt: „Nachts geht das Telefon, ich weiß es schon, das kannst nur duuuu sein!“
Da war Christian noch nicht auf der Welt. Vermutlich lebte er aber schon in Mamas Bauch.
Noch war die Abwesenheit des Vaters das Einzige, was wir vom Krieg bemerkten. Oder fast das Einzige. Denn Mama und Miesi hörten nun vermehrt Nachrichten. Und die klangen furchterregend, insbesondere wenn Hitler selbst oder der Schreihals Goebbels ihre Reden anstimmten. Miesi kroch fast in das Radio hinein, und sie sah dabei so aus, als würde ihr eine Gänsehaut, sensationsgetränkt, über den Rücken laufen. Ob vor Begeisterung oder vor Abscheu, war zunächst nicht zu erkennen. Erst als sie erklärte, sie wolle ihren goldenen Ring für Hitlers Krieg einschmelzen lassen, ahnte ich mit meinem noch sehr beschränkten Wissen, dass sie nicht in unserer Richtung dachte.
Ein Ehering war’s nicht, den sie trug und nun einschmelzen lassen wollte, denn Miesi lehnte Männer ab. Für ihre Bettgelüste hätte sie später gern auf mich zurückgegriffen. Ein Kind war alles in allem für sie billiger, und sie musste sich emotional nicht verausgaben oder gar verpflichten. Doch das ist vorgegriffen und hat auch nur ein einziges Mal stattgefunden.
Fliegerangriffe blieben in der ersten Zeit des Krieges noch aus, ich konnte ungehindert spielen, toben, balancieren, Roller fahren und in den Himmel schaukeln. In die Schule ging ich ja noch nicht, auch nicht, als 1940 Christian geboren wurde. Da ich mir eine Schwester gewünscht hatte, konnte ich zunächst meine Enttäuschung nicht verbergen. Also empfing ich den armen Wicht mit Zornestränen.
Bis er mir, ein kluger Schachzug der Erwachsenen, behutsam in die Arme gelegt wurde! Eine lebendige Puppe konnte nicht süßer sein, nicht wärmer und weicher. Und ich fand auch, dass nichts auf der Welt so gut roch wie die Haut eines neugeborenen Babys, und dass kein Stimmchen so rührend krähte. Und überhaupt fand ich, dass man sich wirklich auch an einen kleinen Bruder gewöhnen konnte.
Das sah auch mein Vater so, der für dieses Ereignis Urlaub bekommen hatte. Ein paar Tage nur, die aber zu richtigen Familienfesttagen wurden. Besonders rund auch, weil wir eine schnelle Taufe hineinpackten und weil Mama ihre akademische Geige ruhen und den Musikprofessor außen vor ließ!
Und ich bewährte mich für die nächste Zeit als verlässliches Kindermädchen. Fuhr ihn im Wagen spazieren, schleppte ihn herum, sang ihm Lieder vor. Und als er anfing zu lächeln, dieses zahnlose Babylächeln mir entgegenstrahlte, schmolz mein Herz endgültig dahin.
Christian war erst ein Jahr alt, als ich 1941 in die Schule kam. Zuckertüten gab es damals nicht, sondern salzige Brezeln mit roten Schleifen. Dazu den Pappranzen und die wichtigsten Schreibutensilien. Aufgeregt und in voller Schulmontur stand ich schon eine halbe Stunde, bevor wir aufbrechen mussten, in der Haustür. Ich wartete auf Mama, die mich begleiten sollte. Doch dann entwickelte sich hinter mir im Flur ein Disput, den ich ängstlich hatte kommen sehen. Mama wollte unbedingt auf ihrer Geige eine Etüde für den Professor „ausfeilen“, und deshalb könne doch Miesi mich zur Schule bringen. Papa und Johannes waren nicht da, um meine Interessen zu vertreten, ich musste es daher alleine tun. Zwei Möglichkeiten fielen mir ein: weinen oder darauf verweisen, dass ich es später „unseren Männern“ erzählen würde. Beide Strategien zusammen führten zum Erfolg.
An der Hand meiner Mutter lief ich mit der Brezel im Arm die lange Frankfurter Straße abwärts; und sie war es, die mir die kleine Abkürzung über den Alten Friedhof zeigte. Das verrostete Tor stand damals noch halb offen. In wenigen Tagen, erklärte Mama, sollte der Friedhof „für die Bevölkerung unzugänglich gemacht werden“. Doch für mich wurde das ja nicht zum Problem, wie sich später zeigte.
Etwas anderes beschäftigte mich. Sollte ich nicht doch meiner Mutter die kleine Eva zeigen und sie nach dem Text der Inschrift fragen? Sie war heute doch ganz guter Laune.
Ehe ich es mir anders überlegen würde, zog ich sie schnell zu der Buche, neben der die Grabplatte im Gras lag.
„Das Kind ist ja süß“, sagte sie leise, „noch so jung“.
„Und was ist das für eine Schrift?“
„Hebräisch. Also ein jüdisches Mädchen. Warum es aber hier auf einem christlichen Friedhof liegt, weiß ich nicht.“
„Warum dürfen denn die jüdischen Leute hier nicht liegen?“
„Weil sie nicht nach der gleichen Religion leben wie wir, deshalb mag man sie nicht. Und deshalb sind viele böse und grausam mit ihnen …“
Ich fasste nach ihrer Hand, „Wo Tote sich doch gar nicht wehren können.“
„Die Lebendigen auch nicht, wenn sie machtlos und zu wenige sind.“ Wir schlenderten weiter durch das spröde Gras.
Den eingrenzenden Drahtzaun auf der Rückseite gab es auch noch nicht. Nur die hohe, ungleichmäßige Steintreppe hinunter zur Straße an der Lahn.
Und so steuerten wir zum ersten Mal auf den gelben Kasten zu. Und wurden auf dem Hof mit Namen aufgerufen, Ursula, Ursula, Ursula … und ich sah meine zarte, hübsche, schwarzhaarige Juliane wieder, die ich, da wir früher Patienten ihrer Mutter gewesen waren, schon kannte. Wir liefen uns sofort entgegen, an so einem Tag besonders froh darüber, uns an der Hand nehmen zu können.
Der Herr Hauptlehrer, nachdem er uns mit einem zackigen „Heil Hitler“ begrüßt hatte, hielt eine kurze, aufgeblasene Ansprache. Je wortgewaltiger er mit „Unser Vaterland“ und „Die Zukunft unseres Volkes“ in Fahrt kam, desto wilder überschlug sich seine helle Fistelstimme. Zum Schluss noch einmal „Heil Hitler“. Aber das klang stimmlich schon recht abgewirtschaftet. Nervös gestikulierend führte er uns nun in das Klassenzimmer. Nach ein paar spannenden Minuten dann das große Glück: Ursula Berkum und Juliane Colpi durften ganz offiziell nebeneinander sitzen!
Und unsere beiden Mütter gingen die kleine gemeinsame Strecke nach Hause, so wie mittags dann auch wir.
Dr. Rebecca Colpi, nun nicht mehr im Beruf, wühlte sich schlecht und recht durch ihren Haushalt und kümmerte sich um die Kinder. Ihr Mann Max, für die Wehrmacht als „wehrunwürdig“ erachtet, werkelte lustlos in seinem Garten herum oder hörte verbotene Radiosender und hoffte inständig, „dass irgend jemand endlich dieses kulturlose Nazipack zum Teufel jagen würde!“
Er hoffte es nicht nur, sondern versuchte auch so fest daran zu glauben, dass er vor dem Entschluss, mit seiner Familie Deutschland zu verlassen, wie vor einem unüberwindlichen Berg immer wieder stehen blieb. Ein schrecklicher Fehler!
Rebecca hatte die gleichen dunklen Haare und Augen wie Juliane, war wie sie zart und schön. Aber eine Träumerin war sie nicht, zumindest wirkte sie nicht so. Eher eine klare, sachliche, dem Leben zugewandte Frau, die alle Zeichen der Zeit wahrnahm, sie aber genau wie ihr Mann als einen „vorübergehenden Spuk“ bezeichnete. Wenn sie uns besuchte, lachte sie den „Spuk“ einfach weg und erzählte im Flüsterton alle Witze über die Nazis, die ihr irgendwo unter vorgehaltener Hand zu Ohren gekommen waren.
„Ich bin zwar von den Vorfahren her Jüdin, aber doch schon längst eine evangelische Christin“, erklärte sie, „und mein Mann und die Kinder auch. Außerdem ist er ein phantastischer Chirurg. Also können diese Hitlers und ihre Oberspinner doch auf Dauer nichts gegen uns haben!“
„Um Gottes Willen, Rebecca“, meine Mutter flüsterte wieder, „du weißt doch, Feind hört mit! Denk an die Miesi, die würde am liebsten nur noch braune Uniformen tragen.“
„Warum entlässt du sie nicht?“
„Weil sie schon viel zu viel von uns weiß!“
„Was denn eigentlich?“
„Na, zum Beispiel von unserer Freundschaft und dass ich den Johannes partout nicht im Jungvolk haben wollte. Womit ich natürlich nicht durchgekommen bin!“