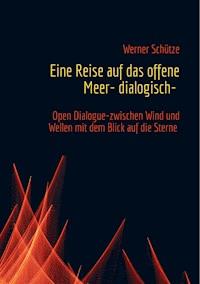
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In dem Buch wird eine Workshopreihe dargestellt, die als Grundkurs zum Erlernen der Methode und der Haltung im Open Dialogue-Ansatz dient. Dabei handelt es sich um eine Methode, Menschen in psychischen Krisen wirksam in ihrem Umfeld unter Einbeziehung des natürlichen Netzwerkes zu unterstützen. Dabei spielt die Art des gemeinsamen Lehrens und Lernens voneinander als kollaboratives Lernen eine große Rolle. Zusätzliche Artikel und Tagungsberichte tragen dazu bei, den Blick vom Feld der Helfer auf die Gemeinde hin auszurichten. Das Buch eignet sich für alle an diesem Thema interessierten Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist all den Patienten, Kollegen und Schülern gewidmet, die mich angeregt und ermutigt haben, mich intensiver mitdem zu befassen, was ich wissen, lehren und vermitteln möchte.
Ich bin auch dankbar für die vielen glücklichen Umstände, die ich in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten erleben durfte. Das Alles hat mich bereichert und dazu beigetragen, meine Jahre nach der Berentung mit zu den interessantesten meines Lebens zu machen.
Mein Dank gilt in besonderer Weise meiner Frau Sabine, die mich ermuntert, unterstützt und meine manchmal unbeholfenen Formulierungen geglättet hat. Ich bin ebenso dankbar dafür dass Dana Tech mich bei der ersten Fassung des Buches unterstützt hat.
Werner Schütze
Eine Reise auf das offene Meer
-dialogisch-
zwischen Wind und Wellen
mit dem Blick auf die Sterne
2. erweiterte Auflage 2018
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Liste der Workshops
Kapitel 1 Workshop I
Grundlagen zur Methodik des Open Dialogue – Teil I
Grundlagen zur Methodik - Teil II
Die Methodik des Reflektierenden Teams –Teil 1
Kapitel 2 Workshop I
I
Grundform der Entspannungsübung
Die Methodik des Reflektierenden Teams- Teil II
10 Regeln des Reflektierens
Netzwerkaktivierung
Netzwerkkarte
Kapitel 3 Workshop III
Eine Rede in Koszalin
Umgang mit Gefühlen- Teil I- Schweigepause
Zum Thema Krise....welche Krise?
Krisenplan
Kapitel 4 Workshop IV
Umgang mit Gefühlen-Teil II Akzeptanz
Einführung zum Netzwerkgespräch als Offenem Dialog
Leitfaden für einen gelingenden Dialog
Ein Vortrag in Wieliczka: OD- Möglichkeiten und Grenzen
Kapitel 5 Workshop V
Umgang mit Gefühlen III- Achtsamkeit
Das Genogramm
Kapitel 6 Workshop VI
Übung zum Umgang mit Gefühlen IV – Gefühlswellen
Überlegungen zu Traumatisierungen
Kapitel 7 Workshop VII
Conference on Peer- Supported Open Dialogue- London
Umgang mit Gefühlen- V Mitgefühl
Reframing- Eine Einführung
Überlegungen zur Technik des zirkulären Fragens
Kapitel 8 Workshop VIII
Kapitel 9
Anhang
:
Literaturempfehlungen
Weitere Berichte, Artikel:
Die Bedeutung des Dialoges für die Begegnung
Ein Besuch in Vermont
7. Netzwerktreffen Hometreatment in Stuttgart
8. Netzwerktreffen Hometreatment in Köln
21. Jahrestagung des Intern. Netzwerkes für die Behandlung von Psychosen(INTP)
Das Psychiatrische Krankenhaus im Übergang
Entdecken in Trieste
Der gegenwärtige Moment
John Shotter: Ontologische Risiken und Ängstlichkeit in der Kommunikation, wenn wir betrachten Was und Wer wir aus der Sicht Anderer sein dürfen. (Übersetzung durch den Autor) Jahrestagung 2016 der Deutsch- Polnischen Gesellschaft für Seelische Gesundheit in Berlin
Verschiedene Poster
Dialog- Reflektion- Netzwerktreffen
Open Dialogue- Haltung und Methode
Open Dialogue- Rad des Lebens
Eine Reise auf das offene Meer- dialogisch
Vorwort zur zweiten, erweiterten und veränderten Auflage
Es ist noch nicht ganz ein Jahr her, seit ich die erste Auflage dieses kleinen Büchleins in den Händen hielt, und als ich anlässlich des Besuches von-Freunden ein Exemplar verschenken wollte, fand ich keins mehr. Wenig hatte ich verkauft, die meisten habe ich verschenkt an Menschen, die an der Sache interessiert waren und mir nahe stehen. Das stellte mich nun vor die Frage: was nun? Es gut sein lassen? Eine zweite Druckserie desselben Buches bestellen? Oder eine zweite Auflage konzipieren, in die weitere Erfahrungen und Artikel oder Berichte aus der inzwischen vergangenen Zeit aufgenommen werden könnten? Es brauchte gar nicht viel Zeit, bis ich mir sicher war: ja, mach eine zweite Auflage. Die Resonanz auf meine im Buch enthaltenen Erfahrungen und Gedanken war so, dass ich mich ermutigt fühlte, auch in der von mir gewählten Weise weiter zu schreiben. Diese erlaubt es mir, meinen Weg durch die verschiedenen Erfahrungen, inzwischen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, zu verfolgen. Die gemachten Erfahrungen vertiefen bestimmte Bereiche und erweitern den Horizont der eigenen Eingebundenheit in die jeweils spezifische Lebenswelt, von der her wir die Welt betrachten und einschätzen. Es hat aus meiner Sicht einen enormen Entwicklungsschub in der Open Dialogue Bewegung gegeben. Vielerorts sind neue Kurse angeboten wurden oder werden geplant, der Bedarf an ausgebildeten Trainern ist gestiegen.
Der Trainingstourismus boomt. Insbesondere in England haben sich zwei - ein wenig konkurrierende Gruppen um Ausbildung innerhalb und au.erhalb des Nationalen Gesundheitswesen (NHS, NationalHealth Service) verdient gemacht. Sie firmieren als Open Dialogue Training (Nick Putnam) oder Peer Supported Open Dialogue (Russell Razzaque, Mark Hopfenbeck) und stützen sich hauptsächlich auf die Erfahrungen der finnischen Kollegen. Die ermöglichen es, auch bereits erfahrenen Kollegen im Rahmen der Ausbildungen eine spezielle „Train the Trainers“ Situation zu durchlaufen, um sie zu bef.higen, selber Kurse oder Workshops zu leiten. Sie waren inzwischen in Japan( Kari Valtanen, Mia Kurrti), Australien( Nick Putman, Jaana Castella, Richard Armitage, Kari Valtanen) und anderswo.
Auch hier also eine fortschreitende Globalisierung. In Italien gab es ein von der EU gefördertes Projekt für 8 verschiedene Arbeitsgruppen (Nord- Turin/ Süd- Rom) mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit solcher Schulungen zu evaluieren.
In Deutschland, England und der Schweiz bietet V. Aderhold in inzwischen 20 Regionen Kurse an. Auch ich bin an verschiedenen Stellen in Kursen oder Projekten tätig. Hier wächst der Bedarf an weiteren Trainern.
Dazu hat im Dezember 2016 ein Treffen der Interessierten stattgefunden, die gemeinsam Wege suchen wollen, wie das umzusetzen sei, damit es auch in der anspruchsvoller gewordenen internationalen Gemeinschaft Bestand haben kann.
In Polen haben inzwischen 10 Basiskurse stattgefunden, die ich zum grössten Teil mit Renata Wojtynska, heute Wallner, durchgeführt habe. In Warschau war Aldona Krawczyk an meiner Seite. Jaana Castella hat in Koszalin zusammen mit Ola Lisińska- Jarza einen Kurs geleitet.
Zusätzlich gab es einige Supervisionsangebote. Die Aktivisten für eine Gemeindepsychiatriereform in Polen um Regina Bisikiewicz haben im Rahmen des EU- Förderprogrammes zur Deinstitutionalisierung 70 Mio € „locker“ gemacht, um über 3,5 Jahre nachzuweisen, dass intensive Arbeit mit mobilen Teams und Hometreatment die Lage der Psychisch Kranken sichtlich verbessert. Da wartet mehr Arbeit und man darf sehr gespannt sein, wie sich diese Projekte entwickeln und möglicherweise zu einer Signalwirkung auch in anderen Ländern beitragen.
Das wirklich Ausserordentliche dieser Entwicklung liegt darin, dass sich in diesem “POW_ER- genannten Projekt 11 Regionen (Schlies lich wurden diese auf erwartungsgem.. 7 Regionen gekürzt) dazu bekannt haben, den Open- Dialogue- Ansatz verbindlich zur Grundlage der Arbeitsweise in der Gemeindepsychiatrie zu machen. Fast zu schön um wahr werden zu können! - wir werden sehen.
Aufgrund der geringen Ressourcen und Ausbildungskapazitäten, haben Renata und ich ehemaligen Absolventen unserer Kurse angeboten, als Assistenten an einem weiteren Kurs teilzunehmen, um sie in die Lage zu versetzen, selbst besser dort, wo sie leben, vor Ort, Kollegen unterstützen zu können, oder auch als Co- Trainer an weiteren Kursen teilzunehmen. Aldona Krawczyk, Ewa Rudska- Jarza, Alexandra, Jagoda, Kasha und zuletzt Wojtek Zak und Jolanta Cermak haben sich uns so angeschlossen.
Auch in der Tschechischen Republik gibt es den Wunsch, ein Basistraining zu etablieren. Hier sind Martin Nowak und Pavel Nepustil aus Brno aktiv. Der Kurs kann in Prag, im M.rz des Jahres 2018 beginnen. Ebenso sucht Ramune Mazaliauskiene in Litauen Wege, etwas Ähnliches zu verwirklichen.
In Dänemark gibt es seit einiger Zeit Kurse, in denen Open Dialogue geschult wird. Ein fortschrittliches Gemeindepsychiatriegesetz hat Open Dialogue als einen obligaten Teil des gemeindepsychiatrischen Behandlungssystems verankert. Auch hier muss man wissen, dass in Dänemark Gemeindepsychiatrie und Krankenhauspsychiatrie zwei sehr verschiedene Bereiche darstellen, die kaum miteinander verbunden sind.
Im US– Bundesstaat Vermont konnte eine Basisschulung mit 5 jeweils 3-tägigen Workshops in einem halben Jahr organisiert werden, an der verschiedenste Trainer und Erfahrene beteiligt waren. Nachdem neue Fördergelder zur Verfügung stehen, werden in 2017/ 18 neue Kurse angeboten, darunter auch einer für „Fortgeschrittene“.
Darüber wird es später mehr zu berichten geben. Neben den Angeboten, die Mary Olsson vorh.lt, gibt es Anfragen aus Santa F. in New Mexiko und Portland, Oregon. Inzwischen ist auch der Erfahrungsschatz der New Yor-ker Kollegen aus dem Parachute Project (Ed Altwies)(leider lief das Projekt in 2017 aus) und der Advocates in Framingham, Mass. (Amy Morgan, Chris Gordon) so gewachsen, dass sie bereitstehen, um nun wiederum ihrerseits Interessierte zu schulen. Dass die dortigen Unternehmen dann andere Namen tragen wie „Collaborative Pathways“ oder „Collaborative Network Approach“ und nicht schlicht „Open Dialogue“, liegt wohl daran dass vor einiger Zeit Mary Olsson in der Annahme, dadurch unqualifizierte Angebote verhindern zu können, diese Namensgebung für sich reklamierte. Ob das indes der Gesamtbewegung zuträglich ist, halte ich für fraglich, aber das lässt sich vielleicht doch noch lösen. Hier steht man sich meines Erachtens mit dem Aufstellen von Fidelity Criteria und Leitlinien- so sehr man damit aus der Sicht einer universitären Einrichtung auch im Trend liegt- möglicherweise selbst im Wege, denn noch immer sind wir am Beginn eines Weges und keinesfalls schon auf der Zielgraden. Die Spitze der Bewegung dürfte das Angebot der finnischen Gesellschaft für systemische Familientherapie sein, in der Psychiatrie und Psychotherapie ausreichend erfahrenen internationalen Kollegen erstmalig eine Trainerausbildung über 2 Jahre im Open Dialogue anzubieten. Dort hat Jaakko Seikkula persönlich Planung und Verantwortung übernommen. In diesem Rahmen würde wohl erstmalig eine fachliche Akkreditierung, die europaweit Gültigkeit besitzt, erfolgen. Erfreulich ist die immer enger werdende Zusammenarbeit mit Peers oder EXIN-Absolventen, die genauso an Schulungen oder auch in der Praxis beteiligt werden.
Soweit der gegenwärtige Stand der Entwicklung von Initiativen in den verschiedenenbLändern. Was ist darüber hinaus neu in dieser Auflage? Ich selbst habe mich durch das Engagement im englischsprachigen Raum aufgemacht, einige meiner Gedanken in englischer Sprache zu formulieren und entsprechende Artikel zu publizieren. Ich habe sie hier aufgelistet mit den Stellen, an denen sie veröffentlicht sind. Im Übrigen sind alle auf der Website www.dialogischepraxis.com einzusehen. Das soll eine fortlaufende Serie werden, in der ich versuche, die verschiedenen Ideen, die in die Beschäftigung mit dem Dialog eingehen, miteinander zu verknüpfen.
Werner Schütze (2015) Open Dialogue as a Contribution to a Healthy Society: possibilities andblimitations 1230-2813/˝2015Institute of Psychology and Neurology. Published by Elsevier Sp. z. o. o.
Schütze, W. (2016): Open Dialogue – a Contribution to a Healthier World: Threat or Chance? M J Psyc. 1(2):008
Werner Schütze, Kermit Cole (2017):Open Dialogue- a Contribution to a Healthier World: Threat or a New Chance? (not yet published)
Werner Schütze(2017): Open Dialogue- Working Together in Moments that Matter
Werner Schütze(2017):Open Dialogue- Implementing the Impossible
Bisher habe ich mir nicht die Arbeit gemacht, diese Artikel ins Deutsche zu übersetzen- das wird sicher noch Zeit brauchen. Ich kann aber feststellen, dass ich ein zunehmendes Interesse daran bekommen habe, auf welchem historischen und gesellschaftlichem Boden die im Open Dialogue aufgeworfenen Fragen und Ideen gewachsen sind. Dabei wurde mir immer deutlicher, dass es sich ja um keine genuin neue Ideen und Gedanken handelt, sondern es unsere Aufgabe ist, Wege zu finden, wie Menschheitswissen über Beziehungen und das in der Welt sein so in unsere heutige Sprache übersetzt werden kann, dass es anknüpft an Denk- und Sprachformen, mit denen wir heute vertraut sind. Das ist mir am Beispiel von „awareness“ oder „Achtsamkeit“ deutlich geworden. Heute geh.rt die Besch.ftigung mit Aufmerksamkeit schon fast zum „guten Ton“, man begegnet dem Phänomen in Kliniken, Praxen, eigenen Therapieformen und inzwischen auch in Betrieben und Organisationen, die sich entsprechende Trainer „einkaufen“.
Warum? Um die Leistungsbereitschaft der Belegschaft zu steigern?
Und ist das der „Sinn“ dieser Übung? Von der Achtsamkeit ist es nicht weit zur Meditation und von dort eröffnet sich ein weites Blickfeld auf den Buddhismus, der wohl am meisten Wissen um diese Dinge gesammelt, geordnet, und in verschiedensten Formen für uns Menschen nutzbar gemacht hat. Natürlich erinnert das an die Einführung von „Entspannungstechniken“ wie das Autogene Training, die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson oder die imaginativen Entspannungsübungen, die der damaligen Sprache und Denkgewohnheiten entsprachen. Diese gibt es noch, aber zunehmender Popularität geniessen Achtsamkeit und Meditation. Im Laufe der Beschäftigung mit diesen Fragen wurde ich wiederum angeregt, mich mehr mit dem Thema der Präsenz in der Begegnung und dem „gegenwärtigen Moment“ zu befassen, der in gewisser Weise seit Daniels Sterns Veröffentlichung unter genau diesem Titel in den entsprechenden Kreisen reüssiert. Daraus ist ein längerer Artikel geworden, der hier aufgenommen wurde.
Die Beschäftigung mit „Chancen und Risiken“ oder auch “Möglichkeiten und Grenzen“ bei der Einführung von Open Dialogue in ein Behandlungssystem haben mich gedrängt, mich mehr mit den gesellschaftlichen oder soziologischen Sichtweisen zu beschäftigen. Zygmunt Baumann, der gerade vor 2 Jahren verstarb, Richard Sennett, Ulrich Beck und Hartmut Rosa ermöglichten es mir(wieder) in weiteren Zusammenhängen denken zu lernen, um der Versuchung zu entgehen, eine neue, aufstrebende Therapierichtung hauptsächlich aus der fachlichen Perspektive zu betrachten.
Sie verdeutlichten mir, wie sehr jede Therapierichtung und jeder von uns sich in einem sehr viel weiteren Kontext bewegt und dort quasi „mitschwimmt“ und vom gesellschaftlichen Konsens, der sich oft nicht so offensichtlich zeigt, abhängig ist. Das wird auch unter dem Aspekt des „Common Sense“ oder Gemeinsinns diskutiert, in dem wir uns alle, mehr und weniger unreflektiert, weil scheinbar selbstverständlich, bewegen.
Welche Bedeutung das auch für psychische Erkrankungen haben kann, wenn wir mehr oder weniger aus dem Gemeinsinn oder „common sense“ herausfallen, stellt für mich eine hochinteressante Frage dar.
Das führt mich nun zu weiteren grundsätzlichen Fragen: Kann man psychische Krisen im Zusammenhang mit dem Verlust von Vertrauen, Sicherheit und einem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft in Beziehung setzen? Für mich ist es erhellend, so banal es erscheinen mag, und es führt zu einem, wie ich finde, besseren Verständnisses dessen, was wir für Andere in den unterschiedlichsten Krisen tun. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, noch einmal mehr auf das zu schauen, was wir Trauma nennen und welche Erfahrungen aus der Menschheitsgeschichte, die ja mehr als erwünscht vorhanden sind, wir uns mit heutigen Mitteln zu Nutze machen können. Aus diesen Überlegungen heraus sind dann die Artikel zu: „Open Dialogue- Working Together in Moments that Matter“ oder „Open Dialogue- Creating Change bzw. Community“ entstanden.
Die Erweiterung des Horizontes hat auch dazu beigetragen, dass ich inzwischen zum zweiten Mal in Triest gewesen bin, um etwas nachzuholen, was eigentlich längst überfällig war, nämlich mich mit der italienischen Psychiatrie-„Revolution“ und ihrem in Triest zu findenden, ungewöhnlich erfolgreichen und ansprechendem Ergebnis, zu befassen. Hier geht es um ein erweitertes Verst.ndnis des Menschen in seinen Lebensbezügen, bei dem nicht die Form der Therapie im Mittelpunkt steht, sondern die Unterstützung des Einzelnen, bei dem nicht die Form der Therapie im Mittelpunkt steht, sondern die Unterstützung des Einzelnen und seines Umfeldes bei einer Normalisierung der Lebensbezüge. Unter dem Stichwort der Deinstitutionalisierung, die hier in einmaliger Weise durchdacht und umgesetzt wurde, hat sich ein demokratisches, an Bürger- und Menschenrechten orientiertes Behandlungssystem entwickelt, was seinesgleichen sucht und jetzt seit fast 50 Jahren Bestand hat. Nicht umsonst ist die Organisation WHO- „Vorzeige“-Zentrum geworden oder WHO Collaborative Center, von dem sowohl durch viele Besucher aus aller Welt als auch durch eigene Aktivitäten zahlreiche Impulse ausgehen. Dazu habe ich einen Bericht geschrieben, der ebenfalls neu aufgenommen wurde.
Natürlich war ich auf dem XXI. International Network Meeting for the Treatment of Psychosis, diesmal in Kaunas in Litauen, auch davon gibt es einen Bericht, der bereits in der Facebook- Gruppe „Open Dialogue“ veröffentlicht wurde.
Spannend war im letzten Jahr auch das j.hrliche, diesmal Treffen der Deutsch- Polnischen Gesellschaft für Seelische Gesundheit, die sich nach einer internen Zerreissprobe konstruktiv mit den unterschiedlichen Bewältigungsstrategien der Flüchtlingskrise in beiden Ländern auseinandersetzte.
Auch dazu gibt es einen Bericht.
Und „last not least“, das 8. Hometreatment Treffen, im Jahr 2017 in Köln, wo wir uns in kleinem Kreise trafen, aber nicht weniger intensiv die Fragen diskutierten, die für die Teilnehmer im Vordergrund standen. Auch dazu gibt es einen kleinen Report.
Erschrocken bin ich, als ich hörte, dass John Shotter zum Ende des Jahres 2016 verstorben ist. Zu einem ersten Gedenktreffen konnte ich leider nicht reisen. Umso mehr freute mich die Ankündigung eines größeren Treffens im Oktober ltzten Jahres in Turin, an dem ich dann aber leider aus anderen Gründen nicht teilnehmen konnte.
Und manchmal kommt einem auch der Zufall zu Hilfe. Nach einigen Jahren traf ich Laura Millan- Ortiz wieder, die nach einer Zeit in der Nauener Klinik nun als Ober- und Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet. Sie und Ileana Steffens haben sich vorgenommen, das Buch ins Spanische zu übersetzen, um die Methode in ihrem Heimatland Mexiko bekannt zu machen. Wer hätte das gedacht!
Die Beiträge zu „Krisen“ und „Trauma“ im Buch habe ich mit Gedanken ergänzt, die mir wichtig scheinen, um in der gebotenen Kürze den gedanklichen Weg, den ich gewählt habe, nach zu vollziehen.
Damit ist weitgehend der Bogen vom letzten Jahr bis in dieses gespannt, bzw. der Horizont abgeschritten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dem Buch einen neuen Titel geben möchte, der zum Ausdruck bringt, dass ich mich auf der Reise, sozusagen mittendrin befinde. Dabei habe ich gedacht, ob es auch ein Untertitel machen könnte etwa derart: Zwischen Wind und Wellen mit dem Blick zu den Sternen.
So ist es dann auch geworden.
Alle diese Aktivitäten haben mit dazu beigetragen, dass ich mich entschlossen habe, meinen Vorstandsvorsitz im Lichtblick e.V. in Nauen aufzugeben. Es waren 14 Jahre, in denen ich zusammen mit Ulf Brandenburg und Anderen die Geschicke unseres Vereins mit bestimmte und vertrat.
Seit meinem Ausscheiden aus der Klinik fühlte ich mich in der Rolle nicht mehr wohl, da ich nicht mehr geeignet war, mit den lokalen Behörden zu verhandeln. Das hat dann Herr Brandenburg wie selbstverständlich übernommen. War während meiner Amtszeit als Klinikchef die Havelland Kliniken GmbH immer ein starker, unterstützender Partner gewesen, fehlte dieser in den letzten 3 Jahren. Dann ergab sich die Fügung, dass die Stephanus- Stiftung aus Berlin- Weissensee Interesse an unserer Arbeit zeigte.
Da war es konsequent, den Wechsel zu vollziehen, dass nun Ulf Brandenburg auch offiziell für das steht, was aus dem Verein wird. Ich selber werde weiter mitarbeiten und dort vor allem meine „Besucher“ treffen.
Ich möchte unbedingt meinen Dank zum Ausdruck bringen für die Unterstützung, die ich bei meinen Aktivitäten genieße, insbesondere bei der Abfassung dieses Buches. Ohne meine Frau Sabine, die neben ihrer (über-) Vollzeitstelle die Korrektur meiner fehlerhaften Schreibweisen und manchmal unbeholfenen Formulierungen fast klaglos erledigt, würde manches nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ihr gebührt der größte Blumenstrauss.
Und dann ist da noch mein tief empfundener Dank an alle die Ungenannten, die mich in meiner Arbeit unterstützen, beantworten und ermutigen, nicht zu viel zu rasten, um den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten.
Berlin, im Oktober 2017
Vorwort zur 1. Auflage:
Diese Schrift ist zu einem Werkstattbericht geworden. Dabei wird beschrieben,wie sich ein Basis- Kurs zur Vermittlung der Grundlagen des Vorgehens im Open Dialogue- Ansatz zur Behandlung psychischer Krisen über 8 Workshops mit jeweils unterschiedlichn thematischen Schwerpunkten in einer ganz eigenen Weise entwickelt. Diesen Kurs hat es tatsächlich von 2014 bis 2015 in Krakow gegeben, wo er von der Trägerorganisation Leonardo da Vinci mit Mariusz Panek als Geschäftsführer organisiert worden war.
Die Idee zu diesem „Buch“ entstand nach und nach beim Schreiben von vielen kleinen Aufsätzen zu theoretischen Themen, angefangen bei den Grundlagen des Open Dialogue über die Bedeutung von Krisen bis hin zu den Überlegungen rund um das zirkuläre Fragen. Das waren jeweils 2, höchstens 4 Seiten zu einzelnen Themen, auf denen ich meine Gedanken geordnet habe, um sie dann ohne Manuskript vortragen zu können. Das lebendige Erzählen im direkten Kontakt mit den Zuhörern gehört für mich zu den wirkungsintensivsten Unterrichtsmitteln, kann man doch in keiner anderen Weise so direkt in die fragenden Augen der Menschen blicken oder etwas von der Atmosphäre aufnehmen und nutzen, die beim Sprechen entstehen kann.
Und auch die Diskussion um Manuale, Prinzipien und Elemente des Open Dialogue auf der Tagung des „International Network for the Treatment of Psychosis“ (INTP) 2014 in Roskilde, hat mich dazu angeregt, darüber nachzudenken, inwieweit sich auch in der Lehre diese Prinzipien wiederfinden müssen, um über die gelebte Erfahrung die Wirksamkeit erleben zu können. Schliesslich gelang es mir, die Formulierung zu finden- und sie gut zu finden- dass es um „bedürfnisangepasstes Lernen“ ginge. Das unterscheidet sich vom üblichen Unterricht nach Lehrplan insofern, als die Bedürfnisse oder die aktuellen Fragen der Teilnehmer explizit erfragt werden und mit den Mitteln der Methodik versucht wird, Antworten zu diesen Fragen nachzugehen. Das scheint für einen Gruppenprozess und den erwünschten Lerneffekt von hoher Bedeutung zu sein, da so meist Bedeutungsvolles zur Sprache kommt.
Ich mag einer Kodifizierung dieser Methode nicht das Wort reden, sehe aber im Versuch der Darstellung eines gemeinsamen- um das von Harlene Anderson geprägte Wort des „kollaborativen Lernens“ („collaborative learning“) zu benutzen- Lernprozesses eine Alternative zur Abfassung einer Lehrfibel, geschweige denn eines Lehrbuches, um das tatsächlich Besondere der Art von Vermittlung und gemeinsamem Erarbeiten der methodischen Besonderheiten bei der Entwicklung dialogisch- reflektierenden Vorgehens anschaulich zu machen. Ich habe auch überlegt, inwieweit es gut wäre, mehr Sichtweisen auf einzelne Themen zur Geltung zu bringen, z.B. die Co-Trainerin und auch die Dolmetscherin neben den Teilnehmern, die darüber hinaus noch wissenschaftlich begleitet wurden, um mögliche Effekte der Ausbildung zu erfassen, zu animieren, ihrerseits spezielle Erfahrungen und Sichtweisen auf einzelne Abschnitte einzubringen. Auch das schien sich entwickeln zu können. Es war ja nicht zu übersehen, dass sich in gewisser Weise Kulturen begegnen, die z. B. unterschiedliche Traditionen bei der Wissensvermittlung pflegen. So sind in der mehr westlich orientierten Tradition das „Mitdenken“ und „Fragen“ von hohem Stellenwert, während in der, man kann wohl sagen, post- sozialistisch geprägten Kultur , sowohl das öffentliche Fragenstellen als auch persönliche Bekenntnisse (öffentliches Ich vs. privates Ich) keine Tradition haben und erst ermöglicht werden müssen.
In Polen ist der traditionelle Ansatz des monologischen Frontalunterrichtskultiviert worden, der nicht nur nicht zum Nachfragen animiert, sondern dies durch die zugeordnete implizite Annahme, dadurch eine Kritik am Lehrer und seinen Vermittlungsfähigkeiten zu üben, unmöglich gemacht wird.
So war es nicht verwunderlich, dass die Co-Trainerin als Polin anfangs regelmäßig darüber irritiert war, dass ich selbst einem vorgeschlagenen Tagesplan wenig Bedeutung zumass, da in meiner Vorstellung sich der
Workshop hochwahrscheinlich auf eigene Weise entwickeln würde, nämlich im Rhythmus der Gruppe und den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechend.
Diese Zusammenhänge klärten sich dann im Laufe der Zeit, hier half die junge Dolmetscherin, die eine Vermittlungsfunktion zwischen den Welten einzunehmen begonnen hatte. Aber an dieser Stelle hat der nötige Aufwand, dann polnisch sprachige Originale ins Deutsche zu übertragen, den Ausschlag gegeben, auf eine tiefergehende Auseinandersetzung zu verzichten und es bei meiner Sichtweise zu belassen, die sich nach und nach durchsetzen konnte.
Die Bedeutung der Funktion einer Dolmetscherin wurde mir im Laufe der Zeit in mehrfacher Funktion deutlich. Sie verbindet mich sprachlich mit den Teilnehmern, ihrer Wortwahl bin ich ausgeliefert und muss ich mich unterwerfen bzw. überlassen. Das ist ein Mangel, der in der Tat schwer wiegt. So ist es schon eine besondere Situation, wenn ich Englisch spreche und dies der Gruppe übersetzt wird, und das Gesagte mir auch wiederum ins Englische übersetzt angeboten wird, was ich dann für mich in der Folge ins Deutsche übersetze.
Die Co- Trainerin spricht mit mir dagegen fliessend Deutsch, was die Dolmetscherin ihrerseits aber nicht beherrscht. So bedarf es besonderer Sorgfalt in der Verständigung untereinander.
Da es wenig nutzt, diesen Zustand zu beklagen, lag es schnell nahe, das„Beste“ daraus zu machen. Der Vorteil der Entschleunigung von Sprechen viel zuerst auf. Ich begrenze den Umfang der gesprochen Sätze, um der Dolmetscherin die nötige Gelegenheit zu geben, zu übersetzen. Das gibt mir Zeit, zu überlegen, was ich als Nächstes sagen möchte, kurz und möglichst präzise. Die Teilnehmer lernen ebenso langsamer zu sprechen und Pausen zu machen, was Allen zugute kommt. Daneben merke ich, wie ich mehr und mehr darauf achte, wie etwas gesagt wird, die Sprecher aufmerksam anschaue und in mir bewege, was sie mit dem Gesagten auch noch zum Ausdruck bringen möchten. Die Begleitung bei der Arbeit in kleinen Gruppen habe ich nach und nach aufgegeben, denn die mitlaufende Übersetzung wird dort doch auch als störend erlebt, sodass diese Arbeit der Co- Trainerin vorbehalten bleibt.
Umso wichtiger wurde für mich das anschliessende Austauschen der Erfahrungen in der grossen Gruppe, um etwas von dem, was die Teilnehmer bewegt, zu erfahren.
Aber es hat sich auch erwiesen, das eben dies die Kohäsion der Gruppe fördert und die Bereitschaft stützt, Persönliches einzubringen und somit die Bewegung hin zur Gruppe als „sicherer Ort“ gefördert wird.
Den Ausschlag, diese anspruchsvolle und aufwändige Arbeit am Buch parallel zum Kurs zu machen, gab dann der Ablauf des ersten Workshops, in dem 13 der vorgesehenen Teilnehmer anwesend sein konnten und die Intensität der Begegnungen von Anbeginn mich so bewegt haben, dass der Entschluss feststand, diese Entwicklung ausführlicher beschreiben zu wollen.
Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass ich einen eigenen Schreib-und Sprachstil habe, der im Schriftlichen manchmal als ungewöhnlich wahrgenommen wird. Aber da ich ein möglichst nahes Bild von dem, was passiert ist, und wie ich es wahrgenommen habe, zeichnen wollte, bin ich diesem Stil treu geblieben.
Ich habe alles, was passiert ist, während der Workshops in meinen „freien Zeiten“ und zeitlich dicht darum herum aufgeschrieben. Dabei ist es mir dann auch nicht um Vollständigkeit gegangen, sondern um das, was mir wichtig erschien. Das mag für den einen oder anderen Leser dann immerwieder einmal sprung- oder lückenhaft wirken. Ich erkläre auch nicht jeden Schritt oder jede Übung ausführlich. Da mache sich jeder ein eigenes Bild.
Besonders ist auch, dass ich in Bemerkungen zum „Dazwischen“ Ideen und Aufsätze oder Vorträge einfüge, die ich andernorts entwickelt oder gehalten habe. Das soll auch meinen eigenen Weg und Einflüsse, die im Kurs zur Geltung kommen, deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass sich nur die Teilnehmer weiterentwickeln, sondern ich selbst bin es ja auch. Aber wo wird das jemals in einer Beschreibung eines Ausbildungskurses dargestellt?
Bevor wir angefangen haben, diese Art der Basisweiterbildung in Polen anzubieten, haben wir ein Curriculum erstellt, in dem für die 8 Workshops die Themen festgelegt wurden. Dabei durfte ich mich daran orientieren, was Volkmar Aderhold in seinen Kursen mit anfangs 15 und sp.ter 7 Workshops für essentiell hielt. Ihm bin ich zu ausserordentlichem Dank verpflichtet, da er mir nicht nur freundschaftlich mit Rat und Tat zur Seite stand, sondern auch ohne mit der Wimper zu zucken, mir alle seine Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, an denen ich mich reichlich bedient habe. Natürlich musste ich mir diese Dinge für meine Zwecke erarbeiten um sie entsprechend zu „besitzen“.
Ich möchte den weiteren Ausführungen eine kurze Beschreibung der einzelnen Workshops voranstellen, um den Überblick zu erleichtern: Diese Beschreibung dient lediglich der Orientierung:
Workshop I: Wer wir sind und wie wir arbeiten wollen
Der erste Workshop steht ganz im Zeichen des Kennenlernens, sowohl untereinander, als auch der Methode. Es gibt eine Einführung in die Geschichte, Methodik und Grundlagen des Open Dialogue, in der vor allem die Prinzipien der Umorganisation wie auch die Haltungsfragen erläutert werden. Das wird verbunden mit Übungen zum Zuhören, dessen Bedeutung frühzeitig herausgestellt wird. Ein wichtiges Ziel ist es, für die Gruppe einen sicheren Ort zu schaffen, an dem jeder gehört wird, jede Stimme zu Wort kommen kann und nach Möglichkeit beantwortet wird. So gibt es Übungen zu Zweit, in kleinen Gruppen und nach jeder Übung das Mitteilen der gemachten Erfahrungen in der Grossgruppe. Im zweiten Teil geht es um die Einführung des Reflektierenden Teams in die Arbeit durch eine Einführung mit anschliessender Übung.
Workshop II: Reflektierende Prozesse und das Netzwerk
Hier beginnt eine Serie von Übungen zum “Umgang mit Gefühlen”, die in Abwandlungen in den nächsten Workshops wiederholt wird. Danach erfolgt eine Erläuterung der 10 möglichen Grundregeln des Reflektierens mit weiteren Übungen. Im Anschluss daran wird die Bedeutung des sozialen Netzwerks für uns Menschen erläutert und die Netzwerkkarte als Werkzeug eingeführt. In einer Übung erstellt Jeder seine eigene Netzwerkkarte und bespricht sie mit einem Partner/ Partnerin mit anschliessendem Austausch in der Grossgruppe.
Workshop III : Krisen und Krisenpläne
Neben der Fortführung der Übung “Umgang mit Gefühlen- Einlegen einer Schweigepause” steht in diesem Workshop das Erarbeiten des Verständnisses dessen, was “Krise” bedeuten kann, im Vordergrund. Neben einer theoretischen Einführung gibt es Übungen zu eigenen Krisen und dem, was in Krisen hilfreich war. Der Krisenplan(KP) wird eingeführt, und jeder Teilnehmer füllt seinen KP aus, der dann in einer Kleingruppe besprochen wird (mit anschliessendem Erfahrungsaustauch in der Grossgruppe).
Workshop IV: Arbeit im Netzwerk
Fortführung der Übung zum “Umgang mit Gefühlen- Akzeptanz” sowie Fortführung des Themas “Netzwerkarbeit”. Dazu gibt es theoretische Erläuterungen, Übungen, Rollenspiele und eine spezielle Übung zur optimalen Nutzung des Dialogs.
Workshop V: Das Genogramm
Fortführung der “Übung zum Umgang mit Gefühlen- Achtsamkeit”. Danach steht das Genogramm im Mittelpunkt. Auf eine Einführung gibt es Zeit für jeden, sein eigenes Genogramm zu erstellen, in der Kleingruppe zu besprechen und sich anschliessend in der Grossgruppe miteinander auszutauschen. Die Erfahrungen aus der Beschäftigung mit dem eigenen Genogramm werden für weitere Übungen genutzt.
Workshop VI: Leben mit dem Trauma
Fortführung der Übung zum “Umgang mit Gefühlen- Gefühlswellen” Danach steht die Erarbeitung eines Verständnisses von Traumatisierung und deren Folgen im Mittelpunkt. Dazu erfolgt eine ausführliche Einführung in das Thema: “Trauma, Traumafolgen und spezifische Behandlung.
Anschliessend wird das Traumamapping erläutert. Jeder erstellt seinen eigenen Traumabogen, bespricht diesen mit einem Partner, und wir tauschen uns anschließend über Erfahrungen aus. Daraus ergeben sich zu vertiefende Aspekte.
Workshop VII: Reframing und zirkuläres Fragen
Fortführung der “Übung zum Umgang mit Gefühlen- Mitgefühl” Die Bedeutung des Reframing wird erläutert und in Kleingruppen geübt. Das zirkuläre Fragen in seinen unterschiedlichen Varianten wird dargestellt und geübt. Spezielle Fragen der Teilnehmer werden aufgegriffen und in Übungen vertieft.
Workshop VIII: ... und was ich unbedingt noch wissen wollte
Fortführung der Übung “Umgang mit Gefühlen- Einfühlen und bewusstes Spüren”
Dieser letzte Workshop ist völlig offen für die Gestaltung durch die Teilnehmer. Für das, was sie an Fragen mitbringen, was sie vertiefen oder wiederholen möchten. Breiten Raum nimmt – zunächst in Kleingruppen - die Frage ein: “Was habe ich für mich, für meinen Beruf gelernt?” Anschliessend erfolgt eine Auswertung/ Evaluation in der Gro.gruppe. Zum Abschluss findet eine achtsame und ausführliche Verabschiedung statt.
Kapitel 1
Workshop I - Wer wir sind und wie wir arbeiten wollen
2014
Nun zum praktischen Teil. Am Beginn jedes einzelnen Workshops steht das gegenseitige Kennenlernen in unterschiedlicher Form. Wir beginnen damit, dass sich jeder vorstellt mit seinem Namen, seinem beruflichen Tätigkeitsfeld und den damit verbundenen Erfahrungen sowie den Erwartungen an den ganzen Kurs oder auch an diesen speziellen Workshop. Sehr angenehm, dass es „nur“ 13 Teilnehmer sind, sodass viel Zeit für diese erste Begegnung bleibt. Die Gruppe ist von den Berufsgruppen her durchaus gemischt, sodass erfahrene PsychiaterInnen neben jungen Ergotherapeutinnen und Krankenschwestern sitzen. Auch Lehrerinnen und eine Angehörige eines psychisch kranken Familienmitglieds gehören zu uns, was es im Hinblick auf unterschiedliche Perspektiven interessant macht.
Nach einer Pause beginne ich mit einer Einführung , in der ich darüber spreche, was das Ziel des Kurses sein kann und erwähne dabei, dass es mir nicht nur darum ginge, Ihnen das Handwerkszeug zur Moderation von Netzwerktreffen beizubringen, sondern es mir genauso wichtig erscheint, sie darin zu unterstützen, über die zu machenden Erfahrungen eine Entscheidung für sich treffen zu können, ob sie mit dieser Methode und Haltung weiter arbeiten möchten. Ich ginge nicht davon aus, dass dies ein Weg für Alle sei, sondern zöge durchaus in Betracht, dass es auch andere Wege gäbe, die zu dem Ziel einer anderen Begegnungsform führen können.
Dann leite ich über zur Beantwortung der Frage: Was verstehen wir unter „Open Dialogue“? Ich spreche über
die Methode als solche und ihre organisatorischen Inhalte und
die damit verbundene Haltung
Jeder soll am Ende wissen, wie die Methode in der gemeindepsychiatrischen Arbeit genutzt werden kann und das n.tige Handwerkszeug erwerben, um ein Netzwerkgespräch durchführen zu können. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, sich persönlich mit der Methode auseinandersetzen zu können, um für sich eine Entscheidung zu treffen, ob ihm die Methode liegt und er sie sich zu eigen machen will.
Beide Ziele haben sich für mich bei der Gestaltung der ersten Kurse in Warszawa und Wroclaw, die Ende 2012 begannen und im Oktober 2014 endeten, entwickelt. Geprägt von meinen Vorerfahrungen aus der klinischen Arbeit, in der Verantwortung für vielerlei Mitarbeiter und beseelt von dem Wunsch, das psychiatrische Versorgungssystem einer Region zu verändern oder zu entwickeln, stand die Befähigung der Teilnehmer zu eigenständigem, therapeutischen Handeln ganz im Vordergrund. Die Situation der polnischen Teilnehmer an den Kursen hat mich diese Zielsetzung überdenken lassen. Es gibt zwar ein großes Interesse an einer Haltung in der psychotherapeutischen Arbeit oder Zusammenarbeit mit psychisch Kranken, die sich jenseits der sozialen, fachlichen(biologisierenden) und ökonomischen Zwänge wieder auf humanistische Werte und entsprechendes Handeln besinnen möchte. Es gibt so etwas wie eine Suche, vielleicht auch Sehnsucht, wenn das nicht zu romantisierend erscheint, nach einer anderen Form des Miteinander, in der Mitmenschlichkeit, Respekt und Toleranz ihren besonderen Platz haben. Es gibt viele Teilnehmer in diesen Kursen, die schon erstaunlich viel Erfahrung mit vielerlei verschiedenen Therapieformen, einschliesslich systemischer Arbeit haben, schliesslich hat das insbesondere in Krakow neben der fortschrittlichen Sozialpsychiatrie durch einen Lehrstuhl in Familientherapie eine eigene erfolgreiche Geschichte. Allerdings haben die wenigsten Teilnehmer die Möglichkeit, im Laufe der Kurse etwas von dem, was sie in Bezug auf Umorganisation, Netzwerktreffen und Reflektierendes Team lernen, umzusetzen.
Die Alltagszwänge verunmöglichen es nahezu für die meisten, diesen Teil der Weiterbildung zu nutzen. Und auch dort, wo es gehen könnte, da verschiedene Mitglieder einer Institution zusammen mit ihrer Leitung teilnehmen, ist es schwerer zu beginnen, als ich dachte. Auch in den Institutionen, (hier eine Klinik für Kinder und Jugendliche sowie eine Einrichtung mit Tagesklinik, Wohnheim und ambulanter Betreuung) gibt es noch ungeahnte Erschwernisse in Form baulich einschränkender Möglichkeiten, aber auch z.B. die Haltung zu den Berufsbildern macht es für die Krankenschwestern ausserordentlich schwer, sich als mögliche Moderatoren zu zeigen. Für mich sind das Beispiele für die Notwendigkeit, besondere Sorgfalt im Umgang bzw. mit dem Verständnis der besonderen gewachsenen Kultur in Organisationen innerhalb einer Gesellschaft walten zu lassen, die in den zurückliegenden Jahren erhebliche Veränderungen zu integrieren oder zu entwickeln hatte. Das wirkt sich auch im Bereich der ökonomischen Stellung der Angestellten im Gesundheitswesen aus, die von einem einzigen Gehalt kaum leben können. Das unter solchen Umständen Reformen äusserst schwer umzusetzen sind, sollte einleuchten. Man könnte auch sagen, dass der Weg zu Solchen wahrscheinlich sehr viel länger dauert, wenn nicht andere strukturelle Voraussetzungen von Verwaltung und Politik geschaffen werden.
Diese Zusammenhänge drängten sich mir dann durch vielerlei Gespräche am Rande nach und nach auf und halfen mir dabei mehr vom Kontext zu verstehen und gleichzeitig die eigenen Zielvorstellungen anzupassen. So rückte dann im Laufe der einzelnen Workshops mehr die persönliche Perspektive der Einzelnen ins Zentrum, verbunden mit der Frage, wie sie , jeder für sich, am besten von dem Gelernten profitieren könnten, sodass sie, selbst wenn keine Veränderungen im Arbeitszusammenhang möglich sind, trotzdem ganz für sich selbst und ihren Umgang mit Klienten/ oder Freunden und Familienmitgliedern profitieren können.
Wie wollen wir das erreichen?
Es wird im Laufe eines Jahres 8 Kurse mit jeweils 12 Arbeitseinheiten geben, die alle einen Schwerpunkt haben, um grundlegende Fertigkeiten zu vermitteln wie „Zuhören“, Reflektieren, Dialog fördern, Umgang mit und Bedeutung von Krisen, Frageformen, Bedeutung von und Eingehen auf Gefühle etc.. Dazu gibt es Materialien, kurze theoretische Einführungen und vor allem Übungen.
Wenn die ersten Erfahrungen gesammelt werden, wird es noch praktischer im Sinne von Supervision.
Dieser Kurs ist keine Schulung wie eine Unterweisung, sondern lebt von dem gemeinsamen Erarbeiten der Themen. Deshalb ist es wichtig, dass viel gefragt wird, um möglichst dicht an den Erfahrungen und Wünschen der Teilnehmer zu bleiben. So entsteht etwas wie eine Co- Kreation im Dialog des Unterrichts.
Das Team macht Vorschläge für die Struktur der Tage, aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es aufgrund der sich entwickelnden Bedürfnisse der Teilnehmer häufig zu Veränderungen kommt, was aber dem Entwicklungsprozess der Teilnehmer entgegenkommt.
Uns ist klar, dass der Beginn des Kurses am Freitagnachmittag und am Sonnabend für die Teilnehmer eine zusätzliche Belastung darstellt. Durch die Gestaltung des Freitages mit dem Einsatz von Entspannungstechniken versuchen wir dem zu entsprechen.
Häufig gibt es am Sonnabend alternative Verpflichtungen für Einzelne Teilnehmer. Wir bitten Alle zu prüfen, inwieweit diese Verpflichtungen unumgänglich sind, denn das Abbröckeln der TN am Samstagnachmittag stört den Verlauf nicht unerheblich. Das macht sich insbesondere dort bemerkbar, wo die Angehörigen einer ganzen Institution geschult werden sollen. Wenn es unaufschiebbare Verpflichtungen gibt, bitten wir darum, das in den jeweiligen Morgenrunden anzusagen. Wer zu einem der Workshops gar nicht kommen kann, schreibt das bitte rechtzeitig an Renata.
Weitere Fragen?
Und dann die erste Lektion:
Grundlagen zur Methodik des Open Dialogue – Grundprinzipien I
Nun zur Methode:
Die Methode wurde entwickelt, um neu aufgetretene psychotische Krisen („first episode") erfolgreicher zu behandeln, was zum jetzigen Zeitpunkt in Tornio in West Lappland, (Finnland) seit mehr als 25 Jahren praktiziert wird und dort dann auch auf alle anderen Formen von Krisen übertragen wurde. Lediglich im Bereich der Alkoholabhängigkeit gibt es noch wenig publizierte Erfahrungen, was am (auch in Finnland) geteilten Versorgungssystem liegt (Psychisch/Sucht).
Inzwischen lässt sich aber unschwer erkennen, dass auch Netzwerke mit einem abhängigen Mitglied von dem Ansatz profitieren können. Dabei setzt sich die Erkenntnis, wenn auch langsam, durch, dass auch Abhängigkeitserkrankungen aus Beziehungsstörungen resultieren. Und so könnte sich die therapeutische Arbeit in einer Krisensituation entwickeln:
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Krisenteam einer Einrichtung, die eine bestimmte Region in Ihrer Umgebung psychiatrisch versorgt. Sie haben heute Telefondienst und sind dafür verantwortlich, im Falle eines Anrufes zu klären, wie geholfen werden kann. Schliesslich klingelt das Telefon. Sie heben ab und melden sich und dann fragen Sie den oder die Anruferin nach dem Anliegen. Ihre Gesprächspartnerin am anderen Ende entschuldigt sich für die Störung, sie wisse gar nicht, ob sie an der richtigen Adresse sei, vielleicht sollte sie in der Notaufnahme der nahegelegenen Klinik anrufen. Sie lassen sich nicht beirren, denn Sie fühlen sich verantwortlich, bei der Klärung des Anliegens zu helfen, und kommen nicht in Versuchung die Anruferin weiter zu verweisen.
„Wobei brauchen Sie Unterstützung“ lautet ihre erste Frage? Die Frau berichtet, dass in einem Vorort der Grosstadt lebt, nicht weit von ihrer Einrichtung, zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter, um die sie sich grosse Sorgen mache. Die könne nicht mehr schlafen, stehe stundenlang am Fenster, führe Selbstgespräche, würde aber auf Nachfragen nicht antworten, manchmal zeige sie mit dem Finger auf Menschen, deute an, dass die nur ihretwegen dort vorbeigehen würden und sie könne hören, dass diese Menschen hässliche Dinge über sie sagten. Sie habe seit Tagen nicht mehr richtig gegessen, aus Angst, dass etwas im Essen sei, was sie zum Reden bringen solle und spreche immer öfter davon, dass sie das alles nicht mehr aushalte.
Die Eltern wüssten sich nun keinen Rat mehr und hätten Angst um die Tochter. Auch der jüngere Bruder habe es aufgegeben, sie zu überzeugen, dass da nichts sei und sie sich alles nur einbilde. Selbst die Nachbarin, mit der sich die Tochter immer gut verstanden habe, könnte nichts mehr ausrichten. Einen Haus- oder Facharzt hätten sie nicht aufsuchen können, da die Tochter das Haus nicht mehr verlasse.
Schliesslich habe der Hausarzt ihr die Telefonnummer des Krisenteams gegeben. Sie fragen, ob es den Eltern recht wäre, wenn sie als Team zu zweit oder zu Dritt zu Ihnen nach Hause kämen, oder ob eine andere Lösung besser sei? Nein, sagt ihre Gesprächspartnerin, das sei wohl im Moment das Beste. Sie fragen, wer noch an einem solchen Gespräch teilnehmen sollte und die Mutter schlägt vor einen Zeitpunkt zu wählen, an dem ihr Mann und der ebenfalls in der Stadt lebende Bruder ebenfalls können und will auch die Nachbarin fragen, ob sie Zeit habe. Sie einigen sich auf einen Termin am späten Nachmittag und fahren mit zwei ihrer Kollegen, die sie kurz instruiert haben, hinaus. Aufgrund der Schilderungen der Mutter halten sie es für denkbar, dass auch über eine medizinische Einschätzung geredet werden muss, weshalb sie den Arzt des Teams, einen Psychiater, gebeten haben, das Team zu verstärken.
In der Wohnung der Familie angekommen, sind alle eingeladenen Personen um den Küchentisch versammelt. Nur die Tochter hält sich in einem andren Zimmer auf und signalisiert kein Interesse an einem Gespräch. Sie schlagen vor, die Türen offen zu lassen und nachdem sie sich vorgestellt haben erläutern sie knapp die Art und Weise ihres Vorgehens, bedanken sich für den ungewöhnlichen Einsatz der Beteiligten und fragen, worüber im Moment gesprochen werden muss. So tauchen plötzlich alle möglichen Fragen auf, die um die Erlebnisse mit der Tochter kreisen: „Was das wohl sei, was sie da habe?“, „Ist das nicht schizophren, müsse sie nicht in eine Klinik?“, „Ob Medikamente dabei helfen könnten?“ „Ob sie sich an ihrer Arbeitsstelle im Supermarkt übernommen habe, sie hätte doch beklagt, dort von allen gemobbt zu werden?“, „Wie gefährlich es sei, dass sie nichts mehr esse?“, „Was man tun könne, um wieder an sie heranzukommen?“, „Ob sie nicht doch zwangseingewiesen werden kann?“, „Ob sie wohl schon daran gedacht habe, sich das Leben zu nehmen?“
Das Team versucht auf alle Fragen einzugehen und achtet darauf, dass möglichst jeder zu Wort kommt, sodass viele Perspektiven zur Geltung kommen. Es vermittelt zu den entsprechenden Fragen Informationen in einer dem Sprachgebrauch der Familie angemessenen Wortschatz, allgemeinverständlich und frei von Fachausdrücken und macht deutlich, dass es nicht ihre Absicht ist, für die Familie zu entscheiden, sondern vielmehr dazu beitragen möchte, dass die Familie die für sie passenden Lösung findet.
Nach etwa 2 Stunden scheinen alle erschöpft und nachdenklich, sodass sie vorschlagen, die Sitzung zu beenden. Sie bieten an, zu einem nächstmöglichen Termin, der für die Familie passt, wiederzukommen. Mutter und Vater greifen das auf, äußern ihre Dankbarkeit darüber, solche Unterstützung angeboten zu bekommen und sind froh, nicht irgendeiner Form von Zwang zustimmen zu müssen. Sie fühlten sich jetzt sicherer und möchten lieber am morgigen Tag weiter über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Das Team fragt die Teilnehmer, ob es passe, wenn sie jeder für sich noch einmal wichtige Gedanken aussprechen und reflektieren dann zu Überlegungen, die sie während der letzten 2 Stunden beschäftigt haben. Der Mutter stehen die Tränen in den Augen, als sie hört, wie sehr einzelne Teammitgliederihren Einsatz und das Engagement zu schätzen wissen, was sie in den letzten Tagen aufgebracht habe.
Dann vereinbaren sie einen nächsten Termin für den frühen Nachmittag des Folgetages und verabschieden sich.
Solche Geschichten zum Auftreten psychosenaher Symptome haben wir vielfach gehört, allerdings haben die Geschichten meist eine andere Wendung genommen, die in den meisten Fällen zu einer Einweisung in die
nächste Klinik führten, wo eine Medikation dringlich angeraten und durchgesetzt wurde.
Diese Geschichte liesse sich dadurch fortsetzen, indem das Team in der ersten Woche täglich kam, in der nächsten Woche nur noch jeden 2. Tag und danach immer seltener, allerdings gab es noch Gespräche, die sich insgesamt über 2 Jahre hinzogen. 2 Wochen dauerte es, bis sich die Tochter traute, an den Gesprächen teilzunehmen und begann das Haus wieder zu verlassen und schliesslich einen Psychologen aufsuchte, weil sie ein paar Dinge allein besprechen wollte, ohne die Eltern.
An den Netzwerkgesprächen nahmen später die Nachbarin nur gelegentlich, der Bruder gar nicht mehr teil. Dafür wurde der Arbeitgeber eingeladen und auch der Psychologe erschien zweimal. An Medikamenten kam ein Beruhigungsmittel für die Nacht zum Einsatz, der Gebrauch von Neuroleptika wurde heftig diskutiert, aber scheiterte an der Abneigung der Patientin. Die wurde nach einer Krankschreibung über ein halbes Jahr nach und nach an ihrer alten Arbeitsstelle wieder eingegliedert, wo sie heute die Abteilung Einkauf leitet.
An dieser Geschichte lassen sich die Prinzipien der Behandlung mit dem offenen Dialog gut veranschaulichen:
Hilfe muss sofort, am besten innerhalb von 24 bis 48 Stunden angeboten werden.
Sehr früh rückt bei allen Überlegungen der Blick auf das Netzwerk der Patientin in den Mittelpunkt.
Das Team fühlt sich von dem Moment an, in dem es kontaktiert wurde zuständig und verweist keinesfalls weiter.
Das Team ist flexibel in Bezug auf die zeitliche Beanspruchung in der Krise, in Bezug auf die eingeladenen Netzwerkteilnehmer sowie in Bezug auf die Wahl des Ortes, an dem sich das Netzwerk treffen möchte.
Es fühlt sich der psychologischen Kontinuität verpflichtet, ist also stabil über einen längeren Zeitpunkt verfügbar.
Und es arbeitet mit anderen Professionen oder Kollegen zusammen, unabhängig von der Frage, welcher theoretischen Ausrichtung die jeweils anhängen.
Pause
Und danach folgt die erste Übung:
Nun sollen die in der oben berichteten Geschichte erforderlichen Fähigkeiten nach und nach eingeübt werden Dabei ist die Fähigkeit des Zuhörens von besonders wichtiger Bedeutung und wird in verschiedenen Varianten geübt und vertieft. Wir beginnen mit dieser Übung:
Miteinander sprechen und beobachten, 1:
ein Interviewer, ein Interviewter, ein Beobachter (3 Personen) Jeder nimmt jede Rolle für ca 20 Minuten ein. Thema: Was bewegt mich, warum bin ich hier. Anschliessend in der Grossgruppe Austausch. Jeder berichtet: Was habe ich von meinem Gesprächspartner gehört? Wie habe ich mich in den verschiedenen Rollen erlebt? Da nicht genug Teilnehmer anwesend waren, um 5 gleich grosse Gruppen bilden zu können, sprang die Dolmetscherin, die bereits Erfahrungen aus den Kursen in Warszawa und Wroclaw mitbrachte, ein. Dazu habe ich bereits eingangs ein paar Worte gesagt: Hier geht es mir darum deutlich zu machen, wie wichtig es für die Dolmetscherin gewesen ist, selbst an Übungen teilzunehmen, um das eigene Verständnis für das, was sie übersetzt, zu vertiefen. Für mich ging es zunehmend darum, möglichst viel des Atmosphärischen über Mimik, Gesten und Bewegung aufzunehmen, was dazu führt, dass nun von meiner Seite viel mehr auf Körperlichkeit und entsprechende Zeichen Wert gelegt wird. Es scheint, als ob ich aus gegebenem Anlass nun diesen Ausdrucksformen gegenüber sensibler werde, was auch seinen Reiz hat, ich werde weiter berichten.
Damit geht der erste Tag zu Ende.
Am nächsten Morgen beginnen wir mit einer Übung, die auf dem Zuhören aufbaut:
Aber erst einmal die begrüßung :
Begrüssung in Bewegung, PartnerIn suchen, jeder erzählt 10 Minuten wie es ihm geht, was vom gestrigen Tag geblieben ist, was die Erwartungen für heute sind. Nach dem Austausch über die Ereignisse oder Erwartungen an den heutigen Tag, setze ich die Ausführungen über das, was den Open Dialogue ausmacht, fort, indem ich an die gestrigen Ausführungen anknüpfe:
Fortsetzung Grundlagen des Open Dialogue – Grundprinzipien II
Haltung:
Das bisher Ausgeführte stellt einen ersten Umriss des Vorgehens in der Methodik des Open Dialogue dar, etwas, das viel mit Organisation zu tun hat. Nicht beschrieben sind damit die nötigen Voraussetzungen, um ein solches Vorgehen zu ermöglichen. Es ist aber unbedingt erforderlich, sich über die nötigen Veränderungen der Strukturen, in denen man arbeitet, Gedanken zu machen. Sehr schnell stösst man auf Grenzen, die auch im Finanzierungssystem liegen, aber selbst die Widerstände in uns sind nicht leicht zu überwinden- wer gibt schon gerne lieb gewordene Gewohnheiten auf? Nun muss man sich davon nicht entmutigen lassen („Das würde bei uns nie gehen“). Hier könnte man zur Anwendung bringen, was sich in dem Satz „Der Weg ist das Ziel“ verbirgt. Natürlich sind wir auch abhängig von sozialen Bedingungen und Restriktionen, aber es hat durchaus etwas für sich, daran zu denken, dass Veränderung immer bei uns selbst ihren Anfang hat und sich von dort ihren Weg bahnt (jede Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt und es führen viele Wege nach Rom). Wie häufig haben wir persönliche Pläne gegen den Widerstand von Eltern, Partnern, Kindern, Vorgesetzten durchgesetzt, weil sie uns wichtig wurden. Hier vergleiche ich die Kraft und den Einfallsreichtum von Ideen gerne mit dem Einfallsreichtum und der Kraft des Wassers, das sich seinen Weg bahnt, wenn nur genug davon da ist. Und dieses „genug“ könnte sich aus der Kraft und dem Einfluss der folgenden Gedankengänge entwickeln: Dabei geht es um die Haltung, in der wir anderen Menschen in der Situation der Krise- und wohl auch sonst- begegnen wollen.
1. Die Toleranz von Ungewissheit
beinhaltet insbesondere, dass wir wieder lernen, dass es nicht immer schnelle Lösungen sind, die Bestand haben, sondern dass Lösungen sich im Zusammenhang des jeweiligen Lebensgefüges entwickeln. Wir haben in unseren Ausbildungen gelernt, Wissen als etwas Gegebenes hinzunehmen, als eine Sache, die ist. Das sollte unser Expertentum ausmachen, was dazu Geführt hat, dass wir als Ärzte und Psychologen anfingen, anderen Menschen vorzuschlagen, was für sie „richtig“ sein könnte, oder wie wir uns vorstellen, wie sie besser „funktionieren“könnten . Das hat sich besonders in allen Formen von Institutionen mit einer Hierarchisierung durchgesetzt. Nun gibt es ausreichende Hinweise, dass wir mit dieser Methodik für andere Menschen auf lange Sicht längst nicht so erfolgreich sind, dass wir stolz darauf sein könnten.
Lange Zeit haben wir es auf die von uns konstruierten Diagnosen und Krankheiten geschoben und nicht bemerkt, dass wir selbst Teil des Systems
sind und zur Chronifizierung psychischen Leidens beitragen. Und nun sollen wir umdenken und eine andere Haltung einnehmen. „Ich nehme Dich wie Du bist, und alles was Du sagst ist wichtig“, ist ein Ausdruck dieser Grundhaltung.
„Jeder Mensch ist Experte seiner Erfahrungen“. “Ich kann nicht wissen, was für einen anderen Menschen gut ist“. “Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sich Menschen/Patienten ändern“, selbst wenn das in Institutionen wie psychiatrischen Kliniken als alltägliche Notwendigkeit im Rahmen eines Anpassungsprozesses imponiert. Die Entlastung, die diese neue Haltung mit sich bringt, keine Lösungen mehr produzieren zu müssen, ist enorm und wahrscheinlich ein wesentlicher burn- out verhindernder Faktor.
B. Leben als Dialog
Über den Dialog haben sich seit Tausenden von Jahren die Denker Gedanken gemacht, während alle anderen ihn gelebt haben, jeder auf seine Art. Hier sollen, ohne auf Plato oder Vorsokratiker, geschweige denn taoistische





























