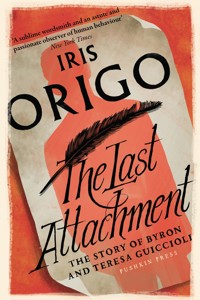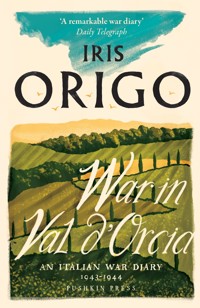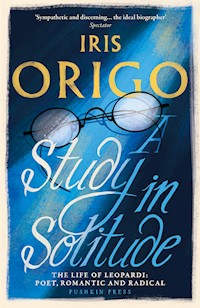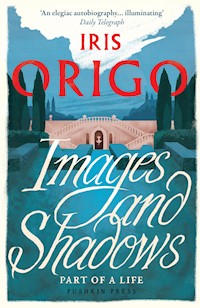Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Ein ruhiger herrlicher Sommerabend; die Trauben reifen, die Ochsen pflügen. Nur der Mensch ist völlig verrückt geworden." In der Rückschau ist es leicht, Anzeichen für drohendes Unheil auszumachen. Aber wer mittendrin in der Geschichte steckt, kann nur versuchen, sich aus Gehörtem, Gesehenem und Gelesenem ein Bild zusammenzusetzen. Im Sommer 1940 tritt Italien in den Zweiten Weltkrieg ein, ein gutes Jahr zuvor beginnt Iris Origo ihr Tagebuch. Die Britin lebt in der Toskana, ist aber auch in Rom bestens vernetzt. Und während die Nazis über halb Europa hinwegziehen, spricht sie mit Bauern und Politikern, hört Radio und liest Zeitungen – und hält alles fest. So bekommen wir nicht nur Einblick ins faschistische Italien, sondern auch ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn die Welt am Wendepunkt steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iris Origo
Eine seltsame Zeitdes Wartens
Italienisches Tagebuch 1939/40
Übersetzt vonAnne Emmert
Mit einem Vorwort vonLucy Hughes-Hallettund einem Nachwort von Katia Lysy
Inhalt
Vorwort
1939
1940
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort
Iris Origo war Ende sechzig, als sie ihre Memoiren schrieb. Im Rückblick auf ihr schriftstellerisches Werk widmete sie jeder ihrer Biografien mehrere Seiten (über Leopardi, Byrons Tochter Allegra, seine Geliebte Teresa Guiccioli, Bernardino von Siena), ihrem »kleinen Kriegstagebuch« dagegen nur einen Nebensatz. Dabei erhielt dieses »kleine« Tagebuch, das 1947 unter dem Titel War in Val d’Orcia (deutsch Toskanisches Tagebuch 1943/44: Kriegsjahre im Val d’Orcia) veröffentlicht wurde, von allen ihren Büchern die größte Anerkennung. Hier erscheint nun erstmals ein weiteres Tagebuch, aus dem eine völlig andere Origo spricht. Lebendig und anschaulich beschreibt sie die sonderbaren Monate vor dem Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg, in denen die Italiener in der Schwebe lebten, weil sie nicht wussten, ob sie in einem, wie Churchill es später formulierte, »unnötigen Krieg« an der Seite der verhassten Deutschen würden töten und sterben müssen.
War in Val d’Orcia war, als es 1947 erschien, auf Anhieb ein großer Erfolg. Origo wurde für ihre sparsame elegante Prosa und die Präzision ihrer Gedanken gelobt. Rezensenten wie Elizabeth Bowen und L. P. Hartley reihten sie in die oberste Schriftstellerriege ein. Das Buch wirkte sich sogar maßgeblich auf die anglo-italienischen Beziehungen aus. Während die Alliierten von Deutschen besetzte italienische Städte bombardiert hatten, hatten Origo, ihr italienischer Ehemann Antonio und die Bauern auf ihrem Gut Partisanen und flüchtigen britischen Soldaten Unterschlupf und Nahrung geboten und Letzteren auf ihrem Marsch nach Süden geholfen, wo sie sich den vorrückenden alliierten Streitkräften anschließen konnten. Damit riskierten sie eine standrechtliche Erschießung durch die deutschen Besatzer. Origos Biografin Caroline Moorehead schreibt: »Manchmal verwickelte Antonio vor dem Haus einen deutschen Spähtrupp in ein Gespräch, während Iris hinten im Garten Partisanen oder entflohene Kriegsgefangene mit Karten und Nahrung versorgte.«1 Immer wieder brachte sich das Paar aus Anstand, Güte und dem Bewusstsein der Verantwortung, die mit ihrer privilegierten Stellung verbunden war, in Gefahr. Die italienischen Bauern, die auf ihrem Gut arbeiteten, taten es ihnen gleich, teilten ihre knappen Vorräte und setzten ihr Leben aufs Spiel. In der Welt wurde das durchaus beachtet. Das Tagebuch, schrieb ein Rezensent der Zeitung La Stampa, »hat mehr Gutes für uns bewirkt als ein Schlachtensieg«.
Der englischsprachigen Welt führte das Buch vor, wie selbstlos und mutig Italiener sein konnten. Und aus Iris Origo machte es eine berühmte Autorin, ja, eine Heldin. Als die Deutschen sie samt ihrer Familie und ihren vielen wehrlosen Schützlingen vom Gut vertrieben, führte sie die Schar aus Kindern, Frauen mit Babys und gebrechlichen Alten auf einem abenteuerlichen Marsch übers Land, das von Alliierten aus der Luft bombardiert wurde. Nach mehreren Stunden gelangten sie zum Fuß des Hügels von Montepulciano und machten kurz Rast, um Kräfte zu sammeln vor dem steilen Anstieg zur Stadt, in der sie Zuflucht zu finden hofften.
Doch als wir so dasaßen, kam eine kleine Gruppe von Bürgern der Stadt, gleich darauf noch eine. Sie hatten uns von der Stadtmauer aus gesehen und [kamen], um uns mit offenen Armen zu empfangen. […] Viele von ihnen waren Partisanen, andere waren selbst Flüchtlinge aus dem Süden, denen wir vorher geholfen hatten, wieder andere waren alte Freunde und unsere Arbeiter, die in Montepulciano wohnten. Sie nahmen die Kinder auf die Schultern, dazu unsere Bündel. Von soviel Herzlichkeit angespornt, marschierten wir im Triumphzug die Dorfstraße hinauf, vorneweg Antonio mit Donata [ihrer jüngsten Tochter] auf den Schultern.2
»Man kann sich kein rührenderes Willkommen vorstellen«, kommentierte sie.
Diese Geschichte ist wahr, und doch beleuchtet sie nur einen Aspekt des schillernden Lebens und der komplexen Persönlichkeit Iris Origos. In Kriegszeiten glich sie einer Mutter Courage, aber sie war auch eine feinsinnige und weltoffene Frau mit scharfem Intellekt. Die Tagebuchschreiberin Frances Partridge lernte sie einundzwanzigjährig als Braut kennen, »zart wie eine Flamme, fast schon wie ein Botticelli, mit sehr flotter Stimme und ebenso flottem Verstand, von einer Sache zur nächsten eilend, beunruhigend in ihrer Klugheit«. Als Origo einige Jahre später im Jahr 1935 mit ihrem damaligen Verehrer, dem Romancier Leo Myers, wieder in London war, lernte sie Virginia Woolf kennen. Woolf beschreibt sie so: »Sie ist jung, vibrierend, nervös – sehr – stottert ein wenig – aber mit ehrlichen Augen; sehr blauen Augen. […] Jedenfalls, sie ist sauber & setzt ihre Füße entschieden.« Der erste Eindruck veranlasste die Woolfs dazu, Origo noch einmal zum Dinner einzuladen, und Virginia notierte, Iris sei eine »echte Frau«, »ehrlich« und »intelligent«. Sie strahlte Tüchtigkeit aus und funkelte entsprechend. Gut gekleidet sei sie, die über beste Beziehungen verfügte: »[Da] ich ja ein Snob bin, gefällt mir auch ihr Paradiesvogelflug durch die vergnügungssüchtige Welt«, schrieb Woolf. »Inspiriert ist das Bild von einer langen grünen Feder an ihrem Hut«.3 Eine andere Freundin schrieb: »Es war unmöglich, von Iris nicht begeistert zu sein … Sie war praktisch ständig Feuer und Flamme.«
Dieser lebhafte Paradiesvogel führte das privilegierte Leben einer Weltbürgerin. Ihre Mutter Sybil war die Tochter des anglo-irischen Earl of Desart. Ihr Vater kam aus einer reichen amerikanischen Familie, die mit Eisenbahnen, Schifffahrt und Zuckerrüben ein Vermögen gemacht hatte. Man spendete das Geld für philanthropische Projekte wie die Gründung der New York Public Library und erwarb Häuser an der Madison Avenue und auf Long Island sowie eine Loge in der Metropolitan Opera. Iris, die als Kind von einem herrschaftlichen Familiensitz zum nächsten zog, wuchs in dem Bewusstsein auf, in vielerlei Hinsicht ungemein begünstigt zu sein.
Geld und gesellschaftliches Ansehen bewahrten sie jedoch nicht vor Verlust. Wenige Wochen nach ihrer Geburt erlitt ihr Vater Bayard Cutting seinen ersten Blutsturz. Als Kind reiste Iris mit ihren Eltern durch die Welt, immer auf der Suche nach einer Therapie für die Tuberkulose oder, da das nicht gelang, zumindest einem Klima, das sie lindern konnte. Sie versuchten es mit Kalifornien, sie versuchten es mit der Schweiz, sie versuchten es mit verschiedenen italienischen Kurorten am Meer und in den Bergen. Sie hielten sich in Ägypten auf, als er mit einunddreißig Jahren starb. Iris, die er liebevoll als »Kanonenkugeldickkopf« oder »Dickerchen« geneckt hatte, war damals sieben. Der Tod ihres Vaters sei eines der beiden schlimmsten Ereignisse ihres Lebens gewesen, schrieb sie sechzig Jahre später, denn »es gibt keinen größeren Schmerz als den der Trennung«.4
Vor seinem Tod hatte Bayard Pläne für seine Tochter gemacht. In seinem letzten Brief an Sybil erwähnt er die Einwände seiner Familie gegen die Heirat mit einer Engländerin und fährt fort, er wolle, dass Iris »frei sein soll von jeglichem Chauvinismus, der die Menschen so unglücklich macht. Erziehe sie in einem Land, wo sie keine Wurzeln hat, denn nur so lässt sich das verwirklichen.« Er denke zum Beispiel an Italien. Dort könne sie »in ihrem Wesen wirklich kosmopolitisch« werden, damit sie die Freiheit habe, später »einmal ohne Schwierigkeiten den Mann heiraten und lieben zu können, den sie sich aussucht, gleich aus welchem Land er stammt«.5
Sybil folgte seinem Wunsch. Bayard hatte ihr viel Geld hinterlassen. Sie mietete die Villa Medici in den Hügeln oberhalb von Florenz (die sie später kaufte), und in diesem Haus, das Michelozzo für Cosimo di Medici erbaut und Giorgio Vasari als »prachtvollen und edlen Palast« gepriesen hatte, wuchs Iris auf.
Als einziges Kind einer exzentrischen und hypochondrischen Mutter verlebte Iris nicht gerade eine einfache Jugend, konnte aber ihren geistigen Horizont erweitern. Ihre Mutter las ihr, im Teekleid von Fortuny auf dem Sofa liegend, laut Gedichte vor, und wenn es ihr besser ging, schleppte sie ihre Tochter kreuz und quer durch Italien und platzte ungeladen bei Fremden herein, während sich die halbwüchsige Iris in Grund und Boden schämte. Zu Hause in Fiesole pflegte die damals große englische Kolonie ein umtriebiges Gesellschaftsleben: Bernard und Mary Berenson zählten zu den Nachbarn, mit denen Sybil conoshing spielte, ein Quiz, in dem die Mitspieler ihr kunsthistorisches Wissen unter Beweis stellten. Iris Origo schrieb später, dass der Krieg zu diesen Menschen »nur als fernes Donnergrollen drang, ein störender, lästiger Lärm hinter den Kulissen«. Auch Sybil nahm ihn nicht zur Kenntnis, sondern kümmerte sich um die Gestaltung des Gartens und zog unermüdlich durch die antiquari von Florenz. Für einen Hausball zu Iris’ Ehren war die »Gartenterrasse, wo das Abendessen an kleinen Tischen serviert wurde, […] von Lampions erleuchtet. Glühwürmchen huschten drunten im Weizenfeld des Guts umher. Der schwere Duft von Jasmin und Rosen erfüllte die Luft. Um Mitternacht stieg ein Feuerwerk wie Fontänen aus Edelsteinen von der Westterrasse über dem Arno-Tal hoch in die Lüfte.«6
Die junge Frau, die aus dieser exklusiven Atmosphäre, dieser merkwürdigen Mischung aus höchstem Anspruch und Frivolität hervorging, konnte es kaum erwarten, ihr zu entkommen. Sie wollte nach Oxford (denn sie hatte, ungewöhnlich für ein Mädchen, eine klassische Erziehung genossen), ließ sich aber dazu überreden, sich stattdessen dreimal in Folge als Debütantin in die Gesellschaft einführen zu lassen. Auf Florenz folgte England, wo sie sich am Ende eines Jagdballs beim »wilden Galopp« vergnügte, sich jedoch fühlte »wie ein Pekinese in einer Meute von Jagdhunden«.7 In New York war sie entsetzt von der stag-line, dem Spalier der ledigen Collegejungs, die (es waren die Jahre der Prohibition) »schieres Gift« aus dem Flachmann hinunterkippten und sich entsprechend ungehobelt aufführten. Da war es kein Wunder, dass sich Iris, als sie nach Florenz zurückkehrte, in Antonio Origo verliebte. Ihre Mutter fand ihn zu erwachsen (er war zehn Jahre älter als Iris) und zu attraktiv. Wiederholt schob Sybil die Hochzeit hinaus, indem sie sich mit mysteriösen Beschwerden ins Bett legte, bis der Hausarzt »frank und frei« riet, keine Rücksicht mehr auf sie zu nehmen: »Wenn wir jetzt nicht gleich heirateten, würden wir es nie mehr schaffen«.8 So ließen sie sich 1924 in der Kapelle der Villa Medici trauen.
Antonios Vater war Bildhauer und ein guter Freund des Dichters Gabriele D’Annunzio, doch Antonio war zum Geschäftsmann ausgebildet worden, ehe der Krieg seine Laufbahn jäh unterbrach. Gemeinsam mit Iris entschied er sich indes für einen anderen Weg. Beide besaßen Geld; Iris’ Vater hatte ihr so viel hinterlassen, dass sie finanziell unabhängig war. Die jungen Leute rebellierten gegen die Pläne ihrer Familien und kauften das Gut La Foce in der Südtoskana, das sie sich entgegen allen Warnungen genau deshalb aussuchten, weil der Boden erodiert und das Land schroff war, die Gebäude marode, Wasser Mangelware und befahrbare Wege nicht vorhanden. Sie wollten »etwas finden, das unsere ganze Arbeitskraft in Anspruch nehmen würde und unserem Leben einen Sinn geben«, schrieb sie. Iris hatte sich zwar auch eine »schöne Umgebung« erhofft, doch als sie das Anwesen besichtigten, lag »fahl und unwirklich […] diese Mondlandschaft« vor ihnen, die etwas von der »Trostlosigkeit, aber auch von der Faszination der Wüste an sich« hatte. Das Haupthaus war dunkel, hatte kein elektrisches Licht, keine Heizung, keinen Garten und kein Badezimmer (weil »der kleine Brunnen nur das Nötigste an Trinkwasser lieferte«). Unerschrocken kauften die beiden das Anwesen, denn sie wollten »den nackten Lehm in Weizenfelder verwandeln, die Höfe wieder aufbauen und neuen Wohlstand in ihnen einziehen lassen, die zerstörten Wälder wieder ergrünen sehen«. Was für ein Unterfangen. Fünfundzwanzig Höfe gehörten zum Landgut. Iris war erst zweiundzwanzig.9
Als sich Iris in Antonio Origo verliebte, entschied sie sich nicht nur für einen Mann, sondern auch für ein Land. Zwar besuchte sie weiterhin ihre Verwandten in England und Amerika. Sie reiste für ihr Leben gern und unternahm, auch nach der Geburt ihres angebeteten Sohnes Gianni, jedes Jahr Fahrten ins Ausland. Doch sie war an dieses Stück Italien gebunden. Anfang der dreißiger Jahre geriet sie ins Zweifeln, verbrachte viel Zeit in England und stürzte sich in mehrere Liebesaffären. Als aber der Zweite Weltkrieg vor der Tür stand, war sie wieder auf La Foce und widmete sich mit ganzem Herzen ihrem Zuhause, ihrer Ehe und ihrem Leben in Italien. Ihre Bestürzung darüber, dass ihre Wahlheimat gegen ihre beiden Herkunftsländer Krieg führte, war groß, doch sie stellte sich den Tatsachen mit der ihr eigenen Gelassenheit. Sie gelangte zu dem Schluss, dass »im Moment nichts weiter von mir erwartet wurde, als dass ich mich so zurückhaltend wie möglich verhalte«. Daher, überlegte sie, sei es vielleicht gut, »wenn ich mir dadurch über meine Gefühle klar werde, dass ich so wahrheitsgemäß und einfach wie möglich den winzigen Ausschnitt der Weltereignisse niederschreibe, den ich in den bevorstehenden Monaten selbst erfahren werde«.10 Das Tagebuch, das aus diesen Überlegungen hervorging, ist Eine seltsame Zeit des Wartens.
Heute ist das Wort »Faschist« ein Allerweltsschimpfwort. Es wirkt daher zunächst befremdlich, wenn eine liberale, weltoffene Frau wie Origo es als »unser Glück« bezeichnet, dass sie unter faschistischer Herrschaft im Rahmen von Mussolinis »Kampf für den Weizen« in der Urbarmachung von Land bestärkt und großzügig subventioniert werden. Ihrer Ansicht nach verkörperten die Beteiligten an den faschistischen consorzi – Landbesitzerverbänden wie dem, den Antonio leitete – »die besten Elemente des faschistischen Regimes«. Sie lobt Regierungsvertreter wie einen Professor »von überdurchschnittlichen Fähigkeiten und großem Charme« oder »etliche Sachverständige, die zwar […] kritiklos an die faschistischen Sprüche glaubten, sich aber auch mit Herz und Seele für ihre Aufgabe engagierten«.11 Wer Origos Memoiren und Tagebücher liest, muss sich vorschneller Urteile enthalten und darf nicht vergessen, dass sich eine ganze Generation lang Menschen verschiedensten Temperaments und unterschiedlichster politischer Couleur mit der faschistischen Herrschaft in Italien arrangierten – widerstrebend, bereitwillig oder in den meisten Fällen einfach nur pragmatisch.
Anfangs war Origo (wie viele britische Beobachter, auch Churchill) vom Duce beeindruckt. »Meine Liebste«, schrieb sie 1930 einer Freundin, »Mussolini ist ein großartiger Mann.« Sie erkannte in ihm »Standhaftigkeit, […] Unnahbarkeit und Einsamkeit. Hier war einer mit größerem Format als die meisten Menschen.« Später änderte sie ihre Meinung. Ende der dreißiger Jahre freundete sie sich mit der Familie Bracci und einer Gruppe mutiger Antifaschisten an. Viele Jahre lang verschloss sie jedoch – vordergründig jedenfalls – die Augen vor den Repressionen des totalitären Regimes. In ihren Memoiren räumte sie später ein, »dass ich keine Neigung verspüre, über die langen Jahre der faschistischen Diktatur zu schreiben, in denen ich gelernt habe, meinen Mund zu halten und meinen eigenen Überzeugungen treu zu bleiben«. Sie war eine Außenseiterin – eine Ausländerin –, die sich bemühte, nicht aufzufallen. »Auch glaube ich«, schrieb sie, »dass nichts dabei herausspringt, wenn man viel über Abschnitte des eigenen Lebens schreibt, die in der Erinnerung vornehmlich Missbehagen hinterlassen«.12 Diese Zurückhaltung betrifft indes die Rückschau und richtete sich an die Öffentlichkeit. In Eine seltsame Zeit des Wartens, das in der Eile unmittelbarer Beobachtung verfasst wurde und nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, offenbart sich eine tatkräftige, gereifte Frau (sie war siebenunddreißig), die unverblümt ihre Meinung sagt und ein lebhaftes Interesse an den umwälzenden Geschehnissen in ihrer Umgebung an den Tag legt.
Origo verfügte über beste Beziehungen. Ihr Patenonkel William Phillips, der in ihrem Tagebuch häufig vorkommt, ist US-Botschafter in Rom. Freunde und Bekannte, die ihr berichten, was Mussolini gesagt hat, sind hochrangige Vertreter des Staats. Die Reaktion Russlands auf die Maßnahmen der italienischen Regierung erfährt sie vom russischen chargé d’affaires. Sie liest einen Brief des US-Präsidenten. Die geplante Ausstellung zur Zwanzigjahrfeier des faschistischen Regimes bespricht sie mit der Frau, die für die Planung verantwortlich ist. Von einem Gespräch zwischen Volpi und Balbo, zwei Vertrauten und Beratern Mussolinis, erzählt ihr Volpis Tochter. Die Gerüchte, die Origo kolportiert, sind kein Stammtischgerede, kein piazza-Geschwätz, sondern kommen aus den innersten Zirkeln von Politik und Diplomatie.
Origos Privatleben spielt im Tagebuch keine Rolle. Sie hat sich vorgenommen, nicht ihre persönlichen Angelegenheiten, sondern die eines ganzen Landes zu schildern, wenn auch aus sehr persönlicher Perspektive. An ein privates Familienereignis reicht noch am ehesten das Eintreffen (oder Nicht-Eintreffen) des neuen Traktors für La Foce heran. Iris Origos erstes Kind Gianni war 1933 im Alter von sieben Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben. Sie hatte schweigend und in sich zurückgezogen getrauert. Erst im Alter begann sie über ihn zu sprechen, und da konnte sie, wie sich eine Freundin erinnert, gar nicht mehr damit aufhören und erzählte die Geschichte seines anrührend kurzen Lebens allen, die bereit waren zuzuhören. Nach seinem Tod folgten sieben kinderlose Jahre, und in dem Zeitraum, den das vorliegende Tagebuch abdeckt, wurde sie wieder schwanger. Die Leserschaft dürfte überrascht sein, wie beiläufig sie die nahende Geburt ihrer Tochter Benedetta im Jahr 1940 erwähnt, nachdem nichts darauf hingewiesen hatte, dass sie die hektischen Aktivitäten der vorangegangenen Monate im schwangeren Zustand entfaltet hat.
Über ihre Situation als Ausländerin schweigt sie sich ebenso aus wie über ihre Schwangerschaft. Kurz vor dem Krieg wurden in ganz Europa Menschen interniert, die plötzlich zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Origo veranlasste, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater – beide als Briten noch in Italien wohnhaft – mit Sondervisa rasch in die Schweiz ausreisen konnten. Über ihre eigene missliche Lage aber verliert sie kein Wort. Sie schreibt über einen kurzen Besuch in der Schweiz, den sie im August 1939 mit Antonio unternahm, ohne darauf einzugehen, dass die beiden in Luzern ein Konzert besuchten. Dirigieren sollte (der Jude) Bruno Walter, der jedoch absagte. Seine Tochter war am Tag zuvor von ihrem nationalsozialistischen Ehemann erschossen worden, der sich anschließend umbrachte. Walters Platz am Dirigentenpult nahm Toscanini ein. Origo lässt die beiden Todesfälle unerwähnt. Sie schreibt von »holzgetäfelten Häusern und Grüppchen, die an einem der Bäche ihr Sonntagspicknick machten«. Auf dem Rückweg über den Simplonpass sehen sie einen italienischen Fahrer, der an der Grenze abgewiesen wird, was der carabiniere mit den Worten kommentiert: »Für Italiener gibt’s keine Spritztouren mehr ins Ausland«. Diese Szene muss ihr einen kalten Schauer über den Rücken gejagt haben, sie erwähnt aber mit keinem Wort, dass sie sich mit der Rückkehr nach Italien darauf festlegt, den Krieg in einem Land zu verbringen, in dem sie Ausländerin ist. Eine weitere Gelegenheit, das Land zu verlassen, wird es nicht geben.
Das Tagebuch gibt eine eigentümliche Mischung aus Nachrichten – gefälschten wie authentischen –, Gerüchten, Kommentaren und Beobachtungen wieder. Später schrieb Origo, sie sei »zu einem der zahllosen unfreiwilligen Rundfunkhörer« geworden, »lauschte den undeutlichen, quäkenden Stimmen, die aus dem kleinen Kasten drangen«. Das Radio steht im Zentrum dieses Tagebuchs. Iris und Antonio Origo versammeln sich mit ihren Freunden um das Gerät, drehen an den Knöpfen, um ausländische Sender zu finden, und besprechen sorgenvoll, was sie gehört haben. Mussolini weiß das Medium für sich zu nutzen. Propaganda ergießt sich über den Äther. Kritische Zuhörer wie Iris Origo durchforsten die bombastischen Worte nach Wahrheit. »Weit mehr als später das Pfeifen und Krachen von Granateinschlägen oder das dumpfe Dröhnen von Bombergeschwadern über unseren Köpfen, ruft diese Kakophonie in mir persönlich den Nachtmahr der Jahre vor und während des Kriegs in mir wach«, schrieb sie später. Reden von Hitler und Dollfuß, Eden und Chamberlain, faschistische Hymnen, inbrünstig vorgetragen von Schulkindern oder Soldaten. »Es ist schwierig zu beschreiben, welche Wirkung diese gleichzeitig auf uns einstürmenden Stimmen hatten, wenn wir Tag für Tag allein in der Bibliothek in unserem einsamen Haus auf dem Land vor dem Radio saßen, und wie sie in uns das Gefühl immer stärker werden ließen, dass es von nun an kein Entrinnen mehr gab vor der bevorstehenden Katastrophe, dass der Moloch Krieg vor der Tür stand.«13 Es mag schwierig zu vermitteln gewesen sein, in diesem bemerkenswerten Tagebuch gelingt es ihr aber doch: Sie beschreibt die Beklommenheit und Verunsicherung, die Verwirrtheit und Verdrossenheit einer klugen, gut informierten Frau, die sich auf eine aberwitzige Situation einen Reim zu machen versucht.
Die Beschäftigten auf La Foce können schlicht nicht glauben, dass der Krieg wirklich kommen wird, nicht einmal, als nach der offiziellen Kriegserklärung ihre Söhne eingezogen werden. Fast schon teilt Iris Origo ihre Ungläubigkeit: Wie kann es sein, dass Italien seine jungen Männer für einen Verbündeten opfert, der dermaßen verhasst ist? (Italien kämpfte im Ersten Weltkrieg gegen Österreich und Deutschland, und im Vorfeld dieses Krieges hatte D’Annunzio die deutschsprachigen Völker, die als Vertreter des Habsburgerreichs Italiener so lange beherrscht und unterdrückt hatten, als »Erbfeinde« Italiens bezeichnet.) Wie kann es geschehen, dass plumpe Propaganda die feinen Nuancen, die facettenreiche Vieldeutigkeit des intellektuellen Diskurses verdrängt? Diese Fragen müssen ohne Antwort bleiben. Was Iris Origo hier eindringlich und mit großer Klarheit festhält, ist das Schweigen, das um sich greift, wenn die Debattenkultur der Friedenszeit von der banalen Brutalität des bewaffneten Kampfes abgelöst wird.
Ein besonders denkwürdiger Eintrag in diesem Tagebuch ist der des 10. Juni 1940. Vom örtlichen fascio