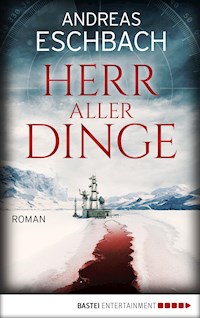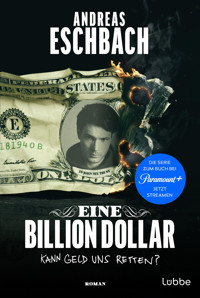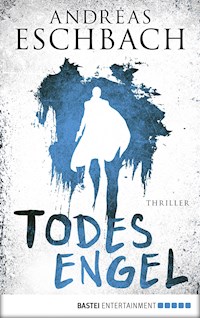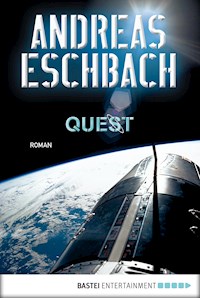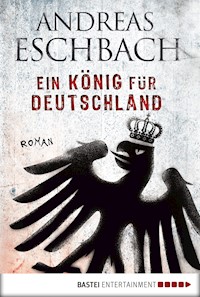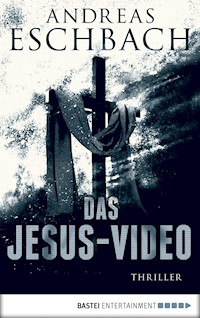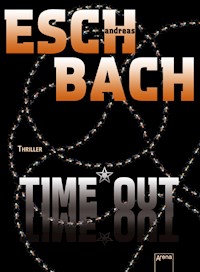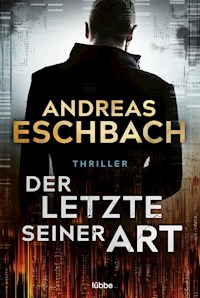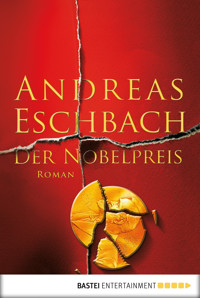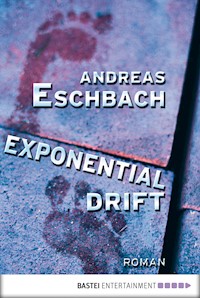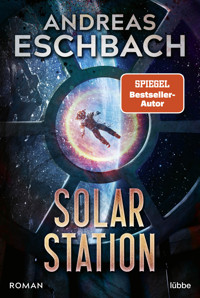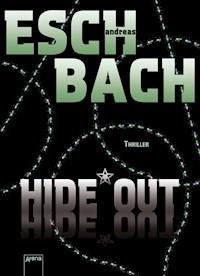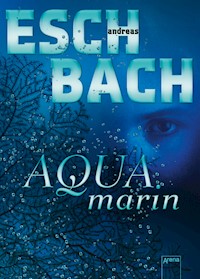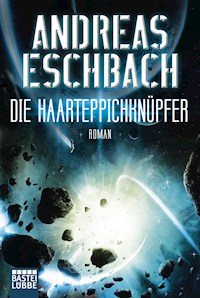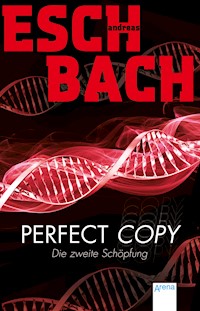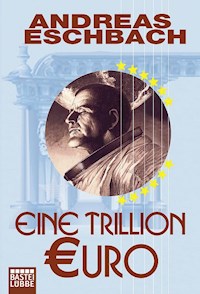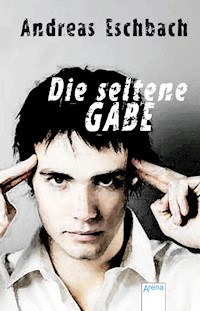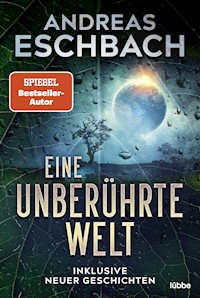
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit 13 neuen Geschichten! Erfahren Sie, wie - und vor allem warum - man UFOs anlockt. Wie die Zukunft des autonomen Fahrens aussieht. Ob es im Garten Eden nicht zu langweilig ist. Wie gefährlich gut gemeinte Liebesbeweise sind und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir im Müll ersticken. Außerdem in diesem Band: eine apokryphe Geschichte um die Haarteppichknüpfer. Diese Neuauflage beinhaltet alle ursprünglichen 27 Erzählungen des Sammelbandes und wird um neue Geschichten erweitert, die der Autor seit der Erstveröffentlichung geschrieben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumQuantenmüllHumanic ParkWell doneDie grässliche Geschichte vom Goethe-PfennigSprachschnittstelleDie Wunder des UniversumsDie WiederentdeckungAl-Qaida™HindukuschHalloweenDer Mann aus der ZukunftJenseits der BergeDer Supermarkt im NebelRain SongGarten EdenDer Amaryllis-VirusEin Fest der LiebeDie Liebe der JengDas fliegende AugeDie Fußballfans von Ross 780Zeit ist GeldUnerlaubte WerbungSurvival-TrainingDer AlbtraummannDas WortMutters BlumenEine unberührte WeltDas schönste FestLove HackingBlautagSchwarmeffekteAcapulco! Acapulco!Späte ReueDas UpgradeAbschied von der ErdeMARS ONE WAYAlles Geld der WeltWeiß in der GrauzoneDer BesuchDriving TomorrowÜber dieses Buch
Mit 13 neuen Geschichten! Erfahren Sie, wie – und vor allem warum – man UFOs anlockt. Wie die Zukunft des autonomen Fahrens aussieht. Ob es im Garten Eden nicht zu langweilig ist. Wie gefährlich gut gemeinte Liebesbeweise sind und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir im Müll ersticken. Außerdem in diesem Band: eine apokryphe Geschichte um die Haarteppichknüpfer. Diese Neuauflage beinhaltet alle ursprünglichen 27 Erzählungen des Sammelbandes und wird um neue Geschichten erweitert, die der Autor seit der Erstveröffentlichung geschrieben hat.
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf.
Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Ein Teil der Anthologie erschien bereits in der gleichnamigen Taschenbuchausgabevon 2008 und wurde um 13 neue Geschichten erweitert
Copyright © 2008 und 2022 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Lizard/adobestock.com; Sergey Nivens/adobestock.com; tikisada/shutterstock.com; michelle dudley/adobestock.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4336-5
luebbe.de
lesejury.de
Quantenmüll
Es gibt das Phänomen der »verschränkten Quanten« – zwei Teilchen, die über beliebige Entfernungen hinweg miteinander verbunden sind. Nimmt man Einfluss auf das eine, verändert sich zugleich auch das andere, ohne dass man bereits genau verstünde, wie das möglich ist.
Eine seltsame Ironie will es, dass es rund um die folgende Geschichte, die »Quanten« im Titel trägt, ebenfalls zu bizarren Gleichzeitigkeiten kam.
Die Grundidee kam mir schon vor vielen Jahren, und sie ruhte zunächst, wie üblich, in einem meiner Notizbücher. Bei deren Durchblättern blieb mein Blick immer wieder sinnend daran hängen, und im Dezember 2001 kritzelte ich dazu: Vielleicht als Hörspiel? Kurz darauf, im Januar 2002, meldete sich der DRS bei mir, der Schweizer Rundfunk, und fragte an, ob ich nicht zufällig auch ein Hörspiel in der Schublade liegen hätte. Womöglich eines, das zu einer Sendereihe passte, die damals geplant wurde.
Hatte ich nicht, aber, schlug ich vor, ich könnte ja eines schreiben. Ich hatte schon Hörspiele geschrieben, allerdings war ich damals 14 Jahre alt gewesen und frischgebackener Besitzer eines sogenannten »Radiorekorders«. Damals verfolgte ich die diversen Hörspielreihen der Radiosender, und eine Zeit lang vergnügte ich mich damit, eigene Hörspiele zu schreiben und mit verstellten Stimmen – und selbstproduzierten Geräuschen; es gibt da tolle Tricks! – auf Cassetten zu sprechen, die ich dann im Freundeskreis kursieren ließ.
Es war also eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, ein Hörspiel mit dem Titel »Quantenmüll« zu schreiben. Nach besonders gründlicher Überarbeitung schickte ich es an die Leute vom DRS.
Doch die wollten es nicht. Es gefiele ihnen im Grundsatz, passe aber nicht in die Reihe. Vielleicht ein andermal.
Gut, es kann nicht alles klappen. So ruhte dieses Hörspiel auf meiner Festplatte, bis mir im Frühjahr 2004 ein gewisser Helmuth Mommers schrieb, Urgestein der deutschen SF-Szene und in letzter Zeit umtriebiger Herausgeber diverser Kurzgeschichtenmagazine. Er fragte an, ob ich nicht etwas hätte für ein neues Storymagazin-Projekt, VISIONEN. Hatte ich eigentlich nicht – mein Storypool war seit Jahren leer bis auf den Grund –, aber mir fiel dieses Hörspiel wieder ein. Warum sollte das verschimmeln? Ich würde eine Story draus machen. Gedacht, getan, und diesmal gefiel sie und wurde angenommen.
Und wie das Leben so spielt: Am nächsten Tag meldete sich der DRS! Man wolle nun doch gern das Hörspiel »Quantenmüll« produzieren, ob es noch zu haben sei. (Und das ist jetzt nicht übertrieben, ich habe nachgeguckt: Die Story habe ich abgeschickt am 6.7.04 um 18:50, die Mail vom DRS kam am 7.7.04 um 14:48. Hier waltete das Schicksal. Oder eine Quantenverschränkung. Falls das nicht dasselbe ist, wer weiß.)
Natürlich war das Hörspiel noch zu haben, und so kam es im Herbst 2004 zum quantenmülltechnischen Dopplereffekt: Zunächst erlebte die Hörspielfassung im DRS1 am 17. September 2004 um 20 Uhr ihre Erstausstrahlung. (Die ich, meines fernen Wohnsitzes wegen, natürlich nicht miterlebte, aber ich erhielt einen Mitschnitt auf CD, der mir außerordentlich gut gefiel.) Und im November 2004 erschien die Storyfassung in dem Band »Der Atem Gottes und andere Visionen«, einer Anthologie, die in der Folge mit Nominierungen und Preisen geradezu überhäuft wurde. Dass meine Geschichte den Deutschen Fantastik Preis erhielt, ist da eher eine Randnotiz.
Ich habe mir den Luxus erlaubt, den Kamin anzufeuern. Ich werfe einen Scheit nach dem anderen in die Flammen, sehe zu, wie er verbrennt, stelle mir bildlich vor, wie oben der Rauch schwarz aus dem Schornstein quillt und sich in der Atmosphäre verteilt, und trinke meinen besten Rotwein dazu.
Die Flasche, mit der ich mich im Moment befasse, hat einmal viertausend Euro gekostet. Eines der edelsten Stücke meines Kellers, abgesehen von der ersten, die ich bereits verkostet habe und die, ich glaube, zehn- oder elftausend Euro kostete. Damals. Und sie war es wert, muss ich sagen.
Mal sehen, wie weit ich noch komme. Ansonsten habe ich nichts mehr vor. Ich habe Zeit, wie man so sagt.
Zeit, ja. Sie vergeht, und das ist wohl das Einzige, was man mit Bestimmtheit über sie sagen kann. Sekunde um Sekunde verrinnt sie, und mit ihr unser Leben.
Unaufhaltsam. Es macht Tick, es macht Tack, und wieder ist ein Augenblick dahin, unwiderruflich, unwiederbringlich.
Ist das nicht das größte Rätsel überhaupt – die Zeit? Was für eine Anmaßung von uns, etwas über sie aussagen zu wollen. Zeit: das Baumaterial unseres Lebens. Unser Leben ist aus Zeit gemacht, ist Zeit. Und wenn es zu Ende geht … und es geht zu Ende, ohne jeden Zweifel … dann schauen wir auf die Zeit zurück, die wir durchmessen haben, die wir gestaltet haben – oder die uns gestaltet hat –, betrachten die Entscheidungen, die wir getroffen haben, und erkennen, welche Auswirkungen sie gehabt haben. Wie sie uns von einem Punkt unseres Lebens zu einem anderen gebracht haben, zu dem, an dem wir jetzt stehen.
Ich war zum Beispiel nicht immer so reich. Es war auch nicht damit zu rechnen. Wenn man Physik studiert, wie ich es gemacht habe, und mit Mühe seinen Doktor zu Stande bringt, dann ist Reichtum das Letzte, was man erwarten sollte.
Dennoch sitze ich hier, in diesem riesigen Haus, das auf einem Anwesen steht, das mir gehört, so weit mein Auge reicht, und das heute Abend so still ist wie selten zuvor, weil ich dem Personal freigegeben und die Telefonanlage abgestellt habe. Dass ich den Abend damit verbringen kann, von den besten Weinen der Welt so viel zu trinken, wie ich will, geht letztlich auf eine Entscheidung zurück, die ich vor dreißig Jahren getroffen habe. Diese Entscheidung hat auch bewirkt, dass es Unsinn wäre, die Flaschen noch länger aufzubewahren.
Ich schätze, ich schreibe diesen Bericht nur, weil ich es nicht ertrage, überhaupt nichts zu tun.
Nach dem Studium war ich einige Zeit arbeitslos, wie üblich, und fand schließlich eine schlechtbezahlte Stelle an einem Kernforschungszentrum, für die ich überqualifiziert war. Im Grunde war ich Wartungstechniker für den Teilchenbeschleuniger. Dreizehn Kilometer muffiger Tunnel, hundertachtzigtausend Beschleunigerspulen, unendlich viele Kabel, und alles musste funktionieren. Mein Chef, der technische Leiter, war ein Idiot, der aus zwanzig Seiten Verlaufsprotokoll immer nur herauslesen konnte: »Irgendwo muss ein Fehler sein. Kümmern Sie sich drum, Steinbach.« Kein »Doktor Steinbach«, nicht einmal »Herr Steinbach«, und das Wort »bitte« kam in seinem Wortschatz überhaupt nicht vor.
Kurze Zeit nach mir wurde noch jemand zu meiner Verstärkung eingestellt, ebenfalls ein Doktor der Physik und ebenfalls unterfordert mit dem, was wir zu tun hatten. Er hieß Konrad Hellermann und nahm die Dinge im Gegensatz zu mir mit stoischer Gelassenheit hin. Meine Laune sank dagegen mit jedem Monat, der verstrich.
Der Vorfall, von dem zu berichten ist, ereignete sich an dem Tag, an dem ich Konrad von meinem Bruder erzählte. Ich halte das für eine nicht ganz unwesentliche Einzelheit, denn vielleicht wäre mir andernfalls die entscheidende Idee nie gekommen. Damals bemühte ich mich nämlich, so wenig an meinen Bruder zu denken wie möglich.
Dieter war zwei Jahre jünger als ich, und es war von Anfang an klar gewesen, dass ich studieren würde und er nicht. Während ich gute Noten heimbrachte und schließlich ein Abitur, das sich sehen lassen konnte, brachte er gerade mal die Hauptschule hinter sich, und auch das nur mit Ach und Krach. Während ich zielstrebig durchs Studium pflügte, ließ er sich ziellos treiben, jobbte hier und da und schwängerte schließlich die schöne, junge Tochter eines hässlichen, alten Schrottplatzbesitzers. Sie heirateten, sein Schwiegervater übergab ihm das Geschäft, und von da an scheffelte er das Geld nur so. Ich hatte am Ende eine Urkunde, die mir die Würde eines Doktors bescheinigte, war arbeitslos und fuhr nur die Strecken mit der Straßenbahn, die zu Fuß nicht zu bewältigen waren. Dieter dagegen fuhr einen dicken Mercedes, in dem es zwar aussah wie auf einer Müllhalde und stank wie in einem Klärwerk, aber einen Mercedes. Mein Bruder hatte weder Manieren noch Stil, noch Geschmack, jeder wusste, dass die eine Hälfte seiner Geschäfte krumme Dinger waren und die andere Hälfte illegal, trotzdem saß er im Gemeinderat. Da musste man sich doch fragen, was man falsch gemacht hatte im Leben, oder?
»Ach ja«, seufzte Konrad, während wir mit unserem kleinen Elektrowagen den Beschleunigertunnel entlangsummten. »Man gilt heutzutage einfach nichts mehr als Wissenschaftler. Oder? Hat schon mal jemand zu dir gesagt, ›Ach, Sie sind Quantenphysiker, wie beeindruckend‹? Eine Frau womöglich? Bestimmt nicht. – Halt mal da vorne, neben dem Schaltkasten.«
Wir suchten seit ein paar Tagen einen überaus rätselhaften Fehler. Alle Kontrollsysteme meldeten normalen Betriebszustand, doch wenn die Anlage feuerte, kam kein einziges Elektron in der Versuchskammer an. Da wir in einer Trilliardstelsekunde ungefähr so viel Energie verheizten, wie eine Kleinstadt in einem ganzen Jahr verbraucht, war das ein nicht unbeträchtliches Ärgernis. Und von uns erwartete man, dass wir es aus der Welt schafften.
»Schau mal«, meinte Konrad und klopfte gegen eine der Spulen. »Mit der stimmt doch was nicht, würde ich sagen.«
Ich war seiner Meinung, ohne dass ich sagen könnte, warum. Eine Beschleunigerspule war eine etwa anderthalb Meter durchmessende, knapp sieben Zentimeter dicke Metallscheibe, die komplizierte Spulenwicklungen enthielt, Anschlüsse, Dichtungen und so weiter. Hintereinander gestapelt wie Brotscheiben im Beutel bildeten sie den Schusskanal des eigentlichen Beschleunigers. Das war ein neues Patent, das die Baukosten eines Teilchenbeschleunigers durch Serienfertigung enorm reduzierte. Einziger Nachteil war, dass immer mal wieder Spulen ausfielen und ausgetauscht werden mussten, was jedes Mal eine Schweinearbeit war.
Die Spule, auf die Konrad gezeigt hatte, schimmerte seltsam. Natürlich erzeugten die müden Lampen an der Tunneldecke alle möglichen Reflexe auf dem Metall, aber im Lauf der Zeit lernte man, die Feinheiten zu unterscheiden. »Verzogen«, konstatierte ich grimmig. »Wahrscheinlich ist einer von der Putzkolonne mit dem Wagen dagegengerauscht und hat schön fein den Mund gehalten.« Ich griff nach dem Werkzeugkasten. »Also, raus damit.«
Wir gaben Bescheid, dass wir einen Austausch vornehmen würden, und machten uns an die Arbeit. Oben ließen sie nach unserem Anruf wahrscheinlich die Stifte fallen und verabredeten sich in die Biergärten, denn damit war der Tag gelaufen. Allein bis der Schusskanal, in dem natürlich normalerweise Vakuum herrschte, mit Luft geflutet war, vergingen anderthalb Stunden. Das wäre zwar auch schneller gegangen, aber dann hätte sich die einströmende Luft zu stark abgekühlt und eventuell andere Bauteile beschädigt. Das Vakuum wieder herzustellen schließlich dauerte gut und gerne die ganze Nacht.
Wir nutzten die Zeit, um eine Austauschspule aus dem nächsten Lager zu holen und durchzuchecken. Doch als wir endlich so weit waren, die verdächtige Spule herauszunehmen, ging es nicht. Sie schien regelrecht festzukleben, gab nicht einen Millimeter nach.
»Restmagnetismus«, diagnostizierte Konrad. Das war kein seltenes Problem. Spulen wurden im Betrieb manchmal magnetisch, und dann hingen sie so fest an ihren Nachbarn, dass man sie mechanisch nicht entfernen konnte, ohne die gesamte Konstruktion des Beschleunigers zu beschädigen. Vom nötigen Kraftaufwand ganz zu schweigen.
Das war einer der seltenen Fälle, in denen einen Köpfchen weiter brachte als schiere Kraft. Denn alles, was man zu tun hatte, war, elektrischen Strom so in die Spulenwicklungen zu leiten, dass eine eventuelle Restmagnetisierung durch ein entgegengesetzt gerichtetes Magnetfeld unwirksam gemacht wurde. Unser Elektromobil verfügte eigens für diesen Zweck über Anschlusskabel und eine fein regelbare Stromversorgung. Wir schlossen also die Spule an die Batterie an, trennten sie vom restlichen Stromkreis und regelten den Strom so weit hoch, dass wir sie mit dem Heber des Wagens problemlos heraushieven konnten.
Zu unserer grenzenlosen Überraschung fanden wir das Innere der Spule erfüllt von etwas, das aussah wie die Haut einer großen Seifenblase. Es schimmerte so eigenartig, dass wir respektvoll Abstand hielten.
»Was ist denn das?«, murmelte Konrad.
»Vielleicht ein Hochspannungsphänomen?«, war meine Hypothese. Extrem hohe Spannungen, wie sie in einem Teilchenbeschleuniger zum Alltag gehören, können überaus merkwürdige Effekte hervorrufen. Es ging damals das Gerücht um, in einer japanischen Anlage sei ein Kugelblitz entstanden und habe vier Wissenschaftler getötet.
Konrad konsultierte die Messgeräte. »Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Hochspannungsphänomen, das man mit Gleichstrom am Leben halten kann? Aus Batterien? Und der Stromverbrauch liegt nur bei drei Watt. Da verbraucht ja mein Radiowecker mehr.«
Ich griff nach einem der Schraubenzieher mit isoliertem Griff. »Dann wollen wir mal«, sagte ich, oder so etwas Ähnliches, und piekste damit auf das eigentümliche … Feld ein.
In dem Moment, in dem ich das blasenartige Etwas mit der Spitze berührte, gab es ein Geräusch, als atme jemand ein, eine unwiderstehliche Kraft riss mir den Schraubenzieher aus der Hand, und im nächsten Augenblick war er spurlos verschwunden.
Es muss ein eigentümliches Bild gewesen sein, wie wir da in dem dunklen Tunnel vor dem metallenen Spulenring standen. Wie Tiger vor dem Feuerreif, nur ohne Feuer. Innerhalb einer Viertelstunde waren wir sämtliche Schraubenzieher losgeworden, Konrads letzte Packung Zigaretten und alle Dichtringe, die wir dabeigehabt hatten. »Wir müssen allmählich damit aufhören, sonst kommen wir dem Materiallager gegenüber in Erklärungsnot«, meinte Konrad schließlich.
Ich grübelte noch immer über dem rätselhaften Effekt. Die Idee, es mit Dichtringen und Zigaretten zu versuchen, war von mir gekommen. »Man müsste etwas riechen, wenn die Gegenstände verdampfen würden, richtig? Tabakrauch oder verbrannten Gummi. Das würde man riechen.«
Konrad schüttelte den Kopf. Er hatte das Messgerät die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. »Es kann auch nicht sein. Der Stromverbrauch ist konstant 2,907 Watt. Konstant! Das ist nicht genug Energie, um auch nur einen Mückenflügel zu verdampfen. Von einem massiven 16-Millimeter-Chrom-Vanadium-Schraubenzieher ganz zu schweigen.« Er sah auf und schaute mich mit seinen großen Augen an, die durch seine starke Brille ins Unnatürliche vergrößert wurden. »Jens«, sagte er mit jener Art Klang in der Stimme, die man sich für weltbewegende Momente aufsparen sollte, »dafür gibt es nur eine Erklärung.«
»Genau«, sagte ich.
»Ein Quanteneffekt«, sagte Konrad.
»In makroskopischen Größenordnungen«, nickte ich. Offenbar war uns der gleiche Gedanke zur gleichen Zeit gekommen. »Das heißt, die Gegenstände verschwinden tatsächlich.«
»Ja. Sie verschwinden in einem … ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Elementarzustand vielleicht.«
Ich betrachtete den stillen, düsteren Stahlwurm des Beschleunigers und dann das matt schimmernde Feld in dem Spulenring am Greifarm der Hebevorrichtung. »Kein Wunder, dass kein Elektron in der Versuchskammer angekommen ist. Sie sind alle hier drin verschwunden.«
Konrad strich sich die Haare zurecht, als erwarte er jeden Moment Pressefotografen ums Eck biegen. »Das wird uns den Nobelpreis einbringen«, meinte er. »Ruhm und Ehre. Einen Platz in den Annalen der Wissenschaft.« Er sah mich an, unnatürlich bleich, selbst wenn man das schlechte Licht da unten in Rechnung stellte. »Man wird Universitäten nach uns benennen, wenn wir es jetzt nicht versauen, Jens.«
Ich erwiderte seinen Blick und überlegte, wie ich es ihm beibringen sollte. »Langsam«, sagte ich. »Vielleicht weiß ich noch etwas Besseres.«
Man muss das richtig verstehen. Es war ja keine wissenschaftliche Entdeckung, die wir da gemacht hatten – es war Zufall. Wir hatten keine Ahnung, auf was wir da gestoßen waren. Wir hätten uns lächerlich gemacht, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gegangen wären. Was hätten wir schreiben sollen? »Wir haben ein Feld gefunden, das Gegenstände verschwinden lässt – aber wir haben keine Ahnung, wohin sie verschwinden, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert, und wir haben keine Ahnung, wie das Feld entstanden ist?« Unmöglich. Also hielten wir unseren Mund und versteckten die Spule mit dem Feld, um erst einmal mehr darüber herauszufinden.
Natürlich haben wir uns gehütet, den Strom abzuschalten. Womöglich wäre das Feld kein zweites Mal aufgetaucht. Wir schafften den Spulenring mitsamt der Batterie unseres Elektromobils in einen unbenutzten Kellerraum, und ein paar Tage später schloss ich sicherheitshalber eine weitere Batterie an.
Das ist jetzt über dreißig Jahre her. Das Feld ist noch da, weil wir den Strom nie abgeschaltet haben, die ganze Zeit nicht.
Es ist uns nämlich nie gelungen, ein zweites Feld zu erzeugen.
Nach und nach wurde uns klar, dass wir mit den Messinstrumenten, die sich auftreiben ließen, ohne dass jemand Verdacht schöpfte, und den paar Stunden am Abend, die wir erübrigen konnten, nicht weit kommen würden. Wir mussten die Sache größer aufziehen.
Mit anderen Worten, wir brauchten Geld.
Der Einzige, den ich kannte, der Geld ohne Ende hatte, war mein Bruder. Wir schmuggelten ihn eines späten Abends an allen Sicherheitsleuten vorbei ins Institut und hinab in unseren Keller. Dort zeigten wir ihm den Ring, der wenig eindrucksvoll auf fünf alten Holzböcken lag und vor sich hin glomm. Wir konnten Dieter nur mit Mühe davon abhalten, mit der bloßen Hand in das Feld zu fassen.
»Jetzt übertreib mal nicht so maßlos«, meinte er, nachdem ich seinen Zeigefinger vor dem Schlimmsten bewahrt hatte.
»Ich übertreibe nicht.« Ich drückte ihm ein Abfallstück in die Hand, das ich aus der Werkstatt mitgenommen hatte.
»Aha«, meinte Dieter mit Kennerblick. »Stahl. St-50, würde ich sagen. Fünfhundert Gramm, geschätzter Altmetallwert –«
»Steck es in das Feld«, sagte ich.
»Was für ein Feld?«
»Na, das, was da in der Ringspule so lustig schimmert. Du wolltest es gerade anfassen.«
Dieter sah mich skeptisch an. »Und was passiert dann? Kriege ich einen elektrischen Schlag?«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Ehrlich nicht. Lass es einfach hineinfallen.«
Er tat wie geheißen, was angesichts des Standes unserer geschwisterlichen Beziehung schon allerhand war. Und wie viele andere Gegenstände vor ihm, verschwand auch der Stahlbolzen, anstatt auf dem Boden unterhalb des Feldes aufzuschlagen.
Dieter zeigte Anzeichen gelinder Verblüffung. »Cool«, räumte er ein. »Echt cool. Und? Sag schon. Was ist der Trick dabei?«
»Das ist kein Trick«, sagte ich.
»Aber die Stahlstange? Wo ist sie hin?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ins Innere der Sonne? Ins Zentrum der Milchstraße? Wir wissen es nicht.«
»Wir würden es allerdings gerne herausfinden«, fügte Konrad hinzu, dem mein Bruder deutlich mehr Respekt einflößte, als Dieter verdient hatte.
»Ja«, sagte ich. »Und dazu brauchen wir deine Hilfe.«
»Meine Hilfe?« Schlagartig hatte Dieter wieder seinen normalen geschäftsmäßigen Gesichtsausdruck täuschender Einfalt aufgesetzt. »Ich verstehe aber von solchen Sachen überhaupt nichts.«
»Wir stellen uns das so vor«, erklärte ich ihm den Deal, den wir anzubieten hatten. »Du finanzierst ein kleines, feines, privates Forschungsinstitut, in dem wir dieses Feld erforschen. Dafür bekommst du eine Option auf eventuelle geschäftliche Nutzungsmöglichkeiten.«
»Wofür hältst du mich? Für einen Geldscheißer?«, versetzte Dieter ärgerlich. Er betrachtete die Ringspule und das Feld mit äußerster Skepsis. »Wer sagt mir, dass das kein Trick ist? So ein David-Copperfield-Ding, mit dem ihr mich über’n Tisch ziehen wollt?«
Er begann, mich zu nerven. Ich streckte die Hand aus und sagte: »Gib mir mal dein Handy.«
Dieter zögerte, langte dann aber doch in die Tasche. »Hier.«
»Angeschaltet bitte.«
Er gab seinen PIN-Code ein und reichte es mir dann. »Und jetzt?«
»Deine Handynummer weißt du auswendig, oder?«
»Klar.«
»Fein«, sagte ich und ließ das Gerät in das Feld fallen. Choh! machte es, und weg war es.
»Hey?!«, schrie Dieter auf. »Bist du wahnsinnig? Weißt du, was das gekostet hat?«
»Null Komma nix, wie ich dich kenne«, erwiderte ich und reichte ihm mein eigenes Telefon. »Bitte schön. Ruf es doch mal an, dein Handy.«
»Wie bitte?« Er nahm das Gerät, das ich ihm hinstreckte, begriff aber überhaupt nichts.
»Tu es einfach«, sagte ich.
Er tat es. Wählte die Nummer, und das Nächste, was er hörte – was wir alle hörten –, waren die üblichen drei Töne und die Ansage, die immer kommt, wenn ein Mobiltelefon gerade nicht am Netz ist.
»Ich hätte gedacht«, fuhr ich fort, »dass eine Möglichkeit, Dinge spurlos verschwinden zu lassen, dich eigentlich brennend interessieren müsste. Oder?«
Natürlich interessierte es ihn brennend. Das Agreement sah so aus: Tagsüber gehörte das Feld uns, nachts gehörte es ihm. Unser erstes Labor richteten wir im Keller eines dem Firmengelände meines Bruders unmittelbar benachbarten Gebäudes ein. Zu diesem Gebäude existierte ein unterirdischer Verbindungsgang, der laut offiziellen Unterlagen nicht existierte, und ab Einbruch der Dunkelheit karrten seine Leute auf diesem Wege all das heran, was Geld brachte, wenn man es verschwinden ließ: Dichlormethan, Quecksilberverbindungen, Altröntgenfilme, Chromschwefelsäurereste und Ammoniumdichromat. Ich lernte, dass ein Standard-Behälter Amershan Typ P blau ist und sechzig Liter wässrige langlebige Radionukleide aufnehmen kann.
Und ich lernte, was man für seine fachgerechte Entsorgung in Rechnung stellen konnte.
Einen wirklich erstaunlichen Betrag.
Ein Jahr lang bissen wir uns die Zähne an dem Phänomen aus, ohne auch nur einen Schritt weiterzukommen. Wir erdachten alle möglichen Versuchsanordnungen, stellten Hunderte von Theorien auf, ließen Scharen von Computern rechnen und rechnen und verbuchten trotzdem nur Fehlschläge. Mehrmals waren Konrad und ich so weit, die Geheimhaltung aufgeben und andere Wissenschaftler um Rat fragen zu wollen, doch Dieter bewahrte uns mit seinem Veto vor diesem Schritt. Entweder lösten wir das Rätsel selber, oder es würde ungelöst bleiben.
Die einzige nennenswerte Beobachtung machte Konrad, und damals hielten wir das zweifellos beide für eine Bagatelle. Er stellte fest, dass der Stromverbrauch des Feldes zunahm.
»Der Stromverbrauch?«, wiederholte ich irritiert.
»Am Anfang«, erklärte Konrad, »lag der Stromverbrauch bei 2,907 Watt. Steht an mindestens zwanzig Stellen in unseren alten Aufschrieben vermerkt. Heute dagegen beträgt er 3,112 Watt.«
Das Gespräch fand in unserem Besprechungszimmer statt. Ich hatte den ganzen Vormittag, anstatt Bücher über Quantenphysik zu studieren, die Andrucke des neuen Leistungskatalogs von Dieters stetig expandierender Firma korrekturgelesen. Ich schob das ganze Zeug von mir weg und meinte: »Drei Watt? Ist ja wahrhaftig nicht die Welt.«
Konrad nickte. »Aber es ist eigenartig, oder? Als würde alles, was in dem Feld verschwindet, dazu beitragen, eine Art Druck aufzubauen. Und je höher der wird, desto mehr Strom verbraucht das Feld.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Gut, aber ich sehe das Problem nicht. Das Feld könnte tausend Kilowatt brauchen und würde uns immer noch reich machen.«
Das war eindeutig die falsche Antwort. Konrad sah mich an, seine Augen hinter der Brille wurden größer, und ein enttäuschter Ausdruck verfestigte sich in ihnen.
»Die wissenschaftlichen Zusammenhänge interessieren dich im Grunde nicht mehr, stimmt’s?«, fragte er leise.
Was hätte ich darauf sagen sollen? Er hatte recht. Die wissenschaftlichen Zusammenhänge interessierten mich tatsächlich nicht mehr. Seit ich angefangen hatte, in der Firma meines Bruders mitzuarbeiten, fand ich die wirtschaftlichen Perspektiven der ganzen Sache weitaus interessanter.
Vor allem, als Konrad kurz darauf entdeckte, dass man das Feld teilen konnte. Dazu brauchte nur eine simple Magnetspule, auf eine ganz bestimmte Art und Weise gewickelt und mit Strom versorgt, in die Nähe gebracht zu werden, und das Feld sprang über wie von einer Kerze auf ein Streichholz. Es war zum Schreien einfach.
Ich hatte sofort die Vision einer Welt vor Augen mit Millionen von Ablegern unseres Feldes, in denen aller Müll und aller Abfall verschwand.
Nur: Mein Bruder war dagegen. Und dummerweise hatte er laut Vertrag das letzte Wort hinsichtlich der Verwertungsmöglichkeiten des Feldes.
Und Verträge lesen, das konnte er.
»Nein, nein und nochmals nein«, fauchte er, als ich das Thema zum bestimmt fünfzigsten Mal aufs Tapet brachte. »Wie oft müssen wir noch darüber diskutieren? Mein Geschäft ist es, Müll verschwinden zu lassen. Nicht, Geräte zu bauen, mit denen die Leute ihren Müll selber verschwinden lassen können. Und jetzt Schluss; ich muss gleich fort.«
Während er in Ordnern und Ablagen wühlte, Papiere daraus hervorzog und in seinen abgeschabten Aktenkoffer warf, sagte ich, auf die segensreiche Wirkung der Kombination von Beharrlichkeit und Ruhe hoffend: »Es ist das größere Geschäft, Dieter. Damit werden wir zu einem Weltkonzern.«
»So? Werden wir das?« Dieter lachte trocken. »Ich will dir mal was sagen: Einen Scheißdreck werden wir. Erledigt sind wir, sobald wir das Feld aus der Hand geben. Weißt du, was die Firmen, die schon Weltkonzerne sind, nämlich tun werden? Ihre eigenen Ableger davon, genauso einfach, wie ihr das macht. Dann machen sie das Geschäft selber, und wir sind außen vor.«
Ich holte den Ordner hervor, den ich mitgebracht hatte, und legte ihn auf den Tisch. »Ich habe drei Rechtsgutachten erstellen lassen, unabhängig voneinander. Sie besagen übereinstimmend, dass das Patentrecht uns erlaubt, eventuelle Käufer von Geräten durch Lizenzverträge dahingehend zu binden, keine eigenen Ableger des Feldes herzustellen.«
Dieter hielt inne, beäugte mich, den Ordner, dann wieder mich. »Das Patentrecht? Dass ich nicht lache. Jens, du hast das Feld nicht erfunden – du hast es nur gefunden! Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, wie es funktioniert, das sagst du doch selber. Wie willst du auf der Grundlage eine Patentschrift formulieren?«
»Na und?«, versetzte ich. »Alle die Leute, die irgendwelche Gene patentieren, haben sie auch nicht erfunden, sondern nur gefunden. Und wie sie funktionieren, wissen sie auch nicht. Trotzdem verletzt du, wenn du diese Gene vervielfältigst, ihre Rechte daran und findest dich vor Gericht wieder mit einer Klage, bei der dir die Tränen kommen.«
Dieter schüttelte den Kopf und knallte den Aktenschrank zu. »Ich sage trotzdem nein, und damit basta.« Er schloss seinen Aktenkoffer.
Ich seufzte. »Also gut. Aber eine letzte Chance musst du mir noch geben. Lass uns kurz in mein Büro rübergehen. Ich habe etwas, das unsere Differenzen aus der Welt schaffen wird.«
»Wüsste nicht, was das sein könnte«, murrte Dieter, vergebens in allen Schubladen nach seinen Autoschlüsseln suchend. »Ich habe außerdem keine Zeit, ich sollte längst weg sein –«
»Es dauert nur einen Moment.«
»Wo sind diese verdammten Schlüssel, verflucht noch eins?«
»Bitte«, sagte ich. »Danach brauchen wir das Thema nie wieder zu diskutieren, großes Ehrenwort.«
Dieter seufzte abgrundtief. »Also gut, einen Blick. Wenn danach Ruhe ist …«
»Versprochen.« Ich öffnete die Tür, die von seinem in mein danebenliegendes, kleineres Büro führte. »Bitte, nach dir.«
Er stürmte vorwärts, wie es immer seine Art gewesen war, und als er begriff, was los war, war es zu spät, um zu bremsen. »He, das ist doch –!«, brachte er noch heraus. Ich gab ihm zur Sicherheit einen kräftigen Tritt in den Rücken, dann verschwand er in dem Feld, das ich im Türrahmen installiert hatte.
Alles, was ich danach zu tun hatte, war, die Batterie herauszunehmen, die das Feld versorgt hatte. Es erlosch, und die paar Spulendrähte ließen sich spurlos entfernen. Ein zweites Feld, in der Tiefgarage über seinem persönlichen Parkplatz installiert, entsorgte sein Auto. Seine Angestellten waren es gewohnt, keine Fragen zu stellen und sich keine Gedanken zu machen. Die Polizei ging später davon aus, dass Dieter in illegale Geschäfte verwickelt gewesen war – Hinweise darauf fanden sich zur Genüge – und untergetaucht war.
Es lief alles bestens. Nachdem sie die Scheidung durch hatte, heiratete ich Dieters Frau – und damit die Firma –, dann stiegen wir in die Produktion von Müllentsorgungsanlagen aller Art ein. Unsere Abgasfilter für Heizkraftwerke und Verbrennungsanlagen waren sensationell – reine Luft, die den Schornstein verließ. Aus unseren Klärendstufen kam Wasser, das man trinken konnte. Allerdings viel weniger, als hin-einfloss – das ließ die Techniker stutzig werden. Nun ja. Es war mir von Anfang an klar, dass die Sache mit dem Feld nicht für immer geheim bleiben würde.
Natürlich kam dann irgendwann ein hässlicher Verdacht auf, was das Verschwinden meines Bruders betraf. Aber da hatte ich schon genug Geld, um mir die schärfsten Rechtsanwälte der Welt leisten zu können, und so wurde nicht viel daraus.
Und wer hätte denn beweisen wollen, dass Dieter wirklich tot war?
Wie auch immer. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Das abgasfreie Auto ist heute eine Selbstverständlichkeit. Erinnern Sie sich überhaupt noch daran, dass es einmal so etwas wie eine Müllabfuhr gegeben hat? Müllverbrennungsanlagen? Wenn ja, dann sind Sie mindestens 25 Jahre alt. Und haben wahrscheinlich Kinder, für die der Entsorger unter dem Spülbecken eine Selbstverständlichkeit ist. Und was Müllhalden und Schuttplätze anbelangt, die hat man alle wieder ausgebaggert und ein für alle Mal verschwinden lassen. Radioaktiver Müll, einst ein unlösbares Problem – weg. Die abgebrannten Brennstäbe aus Kernkraftwerken, über die wir uns früher so viele Sorgen gemacht haben – aus der Welt geschafft. Die Erde ist so sauber wie noch nie.
Ich fürchte, mehr als die dritte Flasche werde ich nicht schaffen. Immerhin, ein Montrachet aus der Domaine de la Romanée-Conti. Samtig, duftig, feinwürzig; ein hervorragender Jahrgang. Aber der Gedanke an all die Schätze, die ich über die Jahre hinweg in meinem Keller versammelt habe und die nun ihre Bestimmung nicht mehr finden sollen, schmerzt.
Dreißig Jahre lang ist alles gut gegangen. Ich habe den Konzern geleitet, Konrad hat weiter geforscht, mit mehr Leuten, mehr Geld – viel mehr Geld –, aber so wenig Ergebnissen wie eh und je. Immerhin: Dass auch all die namhaften Kapazitäten, die Nobelpreisträger und so weiter vor unserem Feld kapitulieren mussten, war irgendwo beruhigend. Wir hatten uns zumindest nicht allzu blöd angestellt. Und wir verdienten schweinemäßig Geld. Wirklich. Die ganze Welt kaufte unsere Geräte wie süchtig, und unsere Profite waren geradezu obszön.
Bis neulich die Beschwerden anfingen, vor einem halben Jahr etwa. Den Anfang machten die batteriebetriebenen Entsorger für die Hosentasche – diese kleinen Metalletuis für Zigarettenasche und was eben unterwegs so anfällt. Sie gäben zu früh den Geist auf. Und zwar alle. Das war uns rätselhaft.
Vor einem Monat stellte sich heraus, dass die Felder in den Kfz-Abgasentsorgern erloschen waren und die Abgase ungefiltert entweichen ließen.
Reihenweise.
Das war uns äußerst rätselhaft.
Und dann kam Konrad mit der sensationellen Neuigkeit, sie hätten herausgefunden, wie das Feld funktioniert.
»Ich dachte immer, das ganze Zeug verschwindet in einem Quantenraum«, erklärte er mir mit einer ausholenden Bewegung, die alles einzuschließen schien, mein Büro und die atemberaubende Aussicht über die Stadt inbegriffen. »Du weißt schon, eines dieser hypothetischen Kontinua mit imaginärer Dimensionszahl. Aber wir wissen jetzt, dass das nicht stimmt.«
»Sondern?«, fragte ich, weil mir seine Kunstpause zu lange dauerte und ich das deutliche Gefühl hatte, dass mir nicht gefallen würde, was er zu sagen hatte.
»Alles, was man in das Feld wirft«, sagte Konrad, »verschwindet in der Zeit.«
»In der Zeit?«, echote ich. »Bist du sicher?« Was man eben so fragt in solchen Momenten.
»Du darfst gern die Protokolle unserer Experimente studieren, falls dich so etwas noch interessieren kann.« Konrad lehnte sich im Sessel zurück und faltete die Hände vor seinem Kinn. »Wir haben hochwertige Atomuhren hineingeschickt, funkkontrolliert und mit Ultrahochgeschwindigkeitsaufzeichnung. Hat Millionen gekostet. Aber wir sind uns jetzt sicher, dass das Feld alles, was hineingerät, in die Zukunft schleudert.«
»In die Zukunft?« Ich versuchte zu verstehen, was das für uns bedeuten konnte. »Das klingt nicht gut.«
Konrad schüttelte den Kopf. »Ist es auch nicht.«
»Kann man etwas darüber sagen, in welche Zukunft?«, hakte ich nach. »Ich meine, Zukunft – das heißt ja womöglich, irgendwann kommt alles wieder, oder?«
Er fuhr sich durch das schütter gewordene Haar. »Genau wissen wir es nicht, aber ich glaube, der Stromverbrauch des Feldes ist der Schlüssel. Er wächst, seit wir das Feld gefunden haben. Ich protokolliere das seit Jahrzehnten, und inzwischen steht fest, dass das Anwachsen des Stromverbrauchs einer hyperbolischen Kurve folgt.« Er nahm die Brille ab und begann, seine Nasenwurzel zu massieren. »Du erinnerst dich, was eine hyperbolische Kurve ist? Eine Hyperbel?«
Ich schnaubte. »Eine Kurve der Form eins durch x, natürlich. Hältst du mich für verblödet?«
»Und was ist das Merkmal einer Hyperbel?«
»Du wirst es mir gleich sagen.«
»Eins durch x. Oder irgendein Wert geteilt durch x. Was passiert, wenn x Null wird?«
Ich begriff. »Die Kurve geht gegen Unendlich!«
Konrad setzte seine Brille wieder auf. »Man nennt das eine Singularität«, erklärte er.
Und diese Singularität wird heute Nacht stattfinden, nach mitteleuropäischer Zeit um genau ein Uhr, zwölf Minuten, achtunddreißig Komma irgendwas Sekunden. Keine Ahnung, was an diesem Zeitpunkt so besonders ist. Ich schätze, nichts. Es ist eben einfach der Punkt auf dem Zeitstrahl, der mit unserem Feld von Anfang an verbunden war.
Inzwischen sind die meisten Felder erloschen, denn heute Abend betrug der Strombedarf fast ein halbes Megawatt je Quadratzentimeter. Bis Mitternacht wird kein einziges Feld mehr verfügbar sein. Man kann ausrechnen, wann der Bedarf je Quadratzentimeter größer werden wird als die gesamte im Universum verfügbare Energie – ein paar Millionstel Sekunden vor dem Moment der Singularität wird es so weit sein.
Und dann? Nun ja, wer kann das wissen? Die beste Schätzung dürfte die von Konrad sein: Im Augenblick der Singularität wird alles wiederkommen. Alles, was wir je hineingesteckt haben in das Feld und seine Abkömmlinge. Alle Kaffeefilter, Bananenschalen, Gemüsereste, alle vollgeschissenen Windeln der letzten dreißig Jahre. Aller Kehricht und alle Staubsaugerbeutel, alle zerbrochenen Spiegel, Durchschreibesätze und Medikamentenreste. Die Zigarettenkippen von drei Jahrzehnten. Die Inhalte aller Katzenklos. Berge von Eierschalen, ranzigem Frittierfett, vollgerotzten Taschentüchern, Binden, Tampons und Kondomen. Alles wird wieder auftauchen, aus dem Nichts, überall auf der Welt. Gebirge von Bauschutt, Fliesenscherben und ölverseuchtem Aushub werden uns unter sich begraben, zusammen mit Baggerreifen, Asbeststaub, Schrottautos, Holzschutzmitteln, radioaktiven Abfällen und Ozeanen von Urin, Klärschlamm und Säureresten.
Und dann die Abgase – die Abgase von dreißig Jahren, in denen man auf saubere Verbrennung und Abgasreinigung kaum noch Wert gelegt hat, weil man es nicht musste. Spätestens die Abgase werden uns ersticken.
Die Flasche ist so gut wie leer. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Was uns bleibt, ist die Hoffnung, dass Dr. Konrad Hellermann sich geirrt hat mit seiner Formel.
Wir werden sehen.
Humanic Park
Da wir nun schon mal mit dem Thema »Aussterben« angefangen haben: Die folgende Geschichte ist natürlich eine Hommage an Michael Crichtons »Jurassic Park«, seinen wohl besten Roman, wenn man mich fragt. Ich fand immer, dass es sich dabei um eine Geschichte handelt, die nach satirischer Weiterverwertung ruft: Was, wenn wir die Dinosaurier und ausgestorben wären – und geklont wiederauferstünden …?
Erschienen ist sie erstmals im Dezember 1999 im Magazin STARVISION.
Die meisten der Ankömmlinge waren Kinder. Noch benommen von dem langen Flug folgten sie den Erwachsenen von der Landeplattform hinab zu den etwas abseits gelegenen Empfangsgebäuden. Der Nebel, der die ganze Insel einhüllte, drückte kühl und feucht zwischen den Bergen herab und ließ die hohen Energieschirme rechts und links des Weges glänzen wie halb durchsichtige Seidenkokons.
Peria drehte sich gerade das zweite Mal nach den Kindern um, die sich verdächtig folgsam verhielten, und wollte sie ermahnen, sich in ihrer Nähe zu halten – überflüssigerweise, denn sie folgten ihr auf dem Fuß –, als ein Beben durch das Laufnetz ging, das alle Besucher veranlasste, abrupt stehenzubleiben. Einen Schlag des Bauchherzens lang war Stille, dann wiederholte sich das Beben, nur stärker, näher. Die Tautropfen auf den Knoten des Netzes zitterten.
»Schaut nur«, hauchte eines der Kinder.
Durch das perlmuttene Schimmern des Feldes hindurch war eine Bewegung zu sehen, eine unglaubliche Bewegung. Niemand rührte sich. Sie hatten die Prospekte gelesen und die Berichte in den Medien gesehen und geglaubt, vorbereitet zu sein. Aber die Wirklichkeit, insbesondere die schiere Größe, übertraf alle Erwartungen.
Der Boden unter ihnen dröhnte, als das Wesen hinter der Abschirmung sich auf die Knie niederließ. Ein riesiger Kopf senkte sich herab, und zwei große, überraschend bewegliche Augen musterten die Gruppe der Ankömmlinge. Dann, nach einer Weile, stand das Wesen wieder auf und entfernte sich mit enormen, donnernden Schritten.
»War das ein Mensch?«, piepste Ela-006133.
»Ja«, sagte Peria-230767. »Das war ein Mensch.«
Sie folgten den anderen den Netzpfad zu den Empfangsanlagen hinunter. Ein Schild überspannte den Weg. WILLKOMMENIMMENSCHEN-PARK stand in großen Leuchtbuchstaben darauf.
Die Halle, in der sie sich versammelten, war mit großen Fotografien der auf der Insel lebenden Menschen geschmückt. Peria-230767 betrachtete sie fasziniert. Als Kind war sie vor den riesigen Menschenskeletten in den Museen gestanden und hatte versucht, sich vorzustellen, wie die Welt damals ausgesehen haben mochte, als diese gewaltigen Wesen sie beherrscht hatten. Wie sie auf ihren zwei Beinen durch die urzeitlichen Wälder geschritten waren. Und nun hatten sie gerade am eigenen Leib erlebt, wie die Erde gebebt haben musste unter ihrem Schritt … Unglaublich faszinierend.
»Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen im MENSCHENPARK, der weltweit ersten und einmaligen Attraktion auf dem Gebiet der Menschenkunde …«
Die Kinder waren weit weniger fasziniert. Sie waren gekommen, um Menschen zu sehen. Der Vortrag, mit dem die Parkführerin begann, langweilte sie.
»Betragt euch!«, mahnte Peria-230767. »Sonst nehm ich euch ans Netz!«
Gemaule, aber sie rissen sich zusammen.
»Die Menschen in diesem Park«, fuhr die Parkführerin fort, »sind geklont. Das bedeutet, dass wir sie in unserem Laboratorium gentechnisch erzeugen.« Eine Reihe von Projektionen leuchteten hinter ihr auf und illustrierten den Vorgang. »Wir entfernen aus der befruchteten Eizelle eines Säugetiers die Erbinformation und ersetzen sie durch menschliche Erbsubstanz. Danach wächst aus der Eizelle ein Lebewesen, ein ganz normaler Vorgang – nur dass es sich dabei um ein Lebewesen handelt, das seit Jahrmillionen ausgestorben ist …«
Ein Zwischenrufer wollte wissen, aus welchem Säugetier die Eizellen stammten.
»Nun, die Auswahl ist nicht sehr groß, da nur wenige Säugetierarten den Untergang der Menschen überlebt haben«, sagte die Parkführerin. »Wir verwenden Eizellen von Ratten.«
Peria-230767 nickte. Das hatte auch in dem Prospekt gestanden. Und auch, dass man vermutete, bei den Ratten habe es sich um eine mit den Menschen konkurrierende Lebensform gehandelt.
»Sie werden wahrscheinlich wissen wollen, woher wir unsere menschliche Erbsubstanz bekommen.« Die Führerin deutete auf einen großen gelben, transparenten Stein, der, in Metallringe eingefasst, hinter ihr an der Wand hing. »Hieraus. Aus Bernstein – dem versteinerten Harz prähistorischer Bäume.«
Ein Raunen ging durch die Zuhörerschaft, obwohl diese Tatsache sicherlich keinem der Anwesenden mehr unbekannt sein konnte.
»Baumsaft«, erläuterte die Parkführerin, »tropft häufig auf Insekten und schließt diese ein. Dadurch bleiben sie in der Versteinerung vollständig erhalten. Wenn es sich bei dem eingeschlossenen Tier um ein stechendes Insekt gehandelt hat, besteht die Möglichkeit, dass es kurz vor seinem Tod einen Menschen gestochen hat und folglich noch dessen Blut in sich trägt.« Auf einem Monitor sah man, wie unter einem Mikroskop eine lange Nadel durch den Bernstein getrieben wurde und in den Brustkorb einer prähistorischen Mücke stach. »Doch man muss noch mehr Glück haben, denn da die roten Blutkörperchen eines Säugetiers, wie es die Menschen waren, keinen Zellkern und daher auch keine Erbsubstanz enthalten, mussten wir die viel selteneren weißen Blutkörperchen suchen, die einen Zellkern besitzen. Das ist uns geglückt. Es war eine lange, mühevolle Arbeit. Dass sie sich gelohnt hat, davon werden Sie sich auf Ihrer Rundfahrt durch den MENSCHEN-PARK nun gleich mit eigenen Augen überzeugen können.«
Die Panoramabahn fuhr vollautomatisch gesteuert, immer zwischen den Gehegen der einzelnen Menschengruppen hindurch. Die Kinder gerieten ganz aus dem Nestchen, als sie die ersten Menschen sahen.
»Schaut nur, sie haben sich Kleider gemacht!«, rief Ela-006133 begeistert. »Sie müssen intelligent sein.«
»Ja«, meinte Peria-230767 wohlwollend. »Nach allem, was die Wissenschaft weiß, müssen sie eine fast spinnenähnliche Intelligenz besessen haben.«
Sie fuhren an einem Menschen vorbei, der schlafend im Gras lag. Als die Wagen der Panoramabahn langsam an ihm vorüberzogen, öffnete er kurz die Augen, schaute eine Weile unschlüssig, aber nicht übermäßig interessiert herüber und wandte sich schließlich wieder ab.
»Können die Menschen auch bestimmt nicht ausbrechen?«, vergewisserte sich Ela-006133 ängstlich.
»Nein, Quatsch«, versetzte Loto-115341. »Die Schutzfelder sperren sie doch ein.«
»Selbst wenn einige Menschen tatsächlich ausbrechen sollten, könnten sie nicht lange außerhalb des Parks überleben«, beruhigte Peria-230767 sie. »Die Schutzfelder schützen nämlich nicht nur uns vor den Menschen, sie schützen auch die Menschen vor der Sonnenstrahlung und vor vielen Bestandteilen der Luft, die sie nicht vertragen.«
»Ehrlich?«, staunte Loto-115341. »Unsere Atemluft ist schlecht für sie?«
»Ja. Unter den Feldern wird künstlich eine Atmosphäre erzeugt, wie sie vor Jahrmillionen auf der Erde geherrscht hat.«
Die Panoramabahn erreichte ein anderes Gehege, in dem einige Menschen vor einem Baum standen, dessen Früchte sie pflückten und aßen. Auch sie schenkten den Besuchern nur beiläufig ihre Aufmerksamkeit.
»Wisst ihr eigentlich, dass man die Menschen auch die Wegbereiter nennt?«, fragte Peria-230767 ihre Kinder. »Ohne sie gäbe es uns heute nicht.«
»Ehrlich?«, staunten sie. »Warum?«
»Damals, vor Jahrmillionen, als die Menschen die Erde bevölkerten, war diese Welt noch kalt und dunkel. Ein dichter Panzer aus dreiwertigem Sauerstoff, dem sogenannten Ozon, umschloss den Planeten und hielt die wertvollsten Bestandteile des Sonnenlichts davon ab, die Erdoberfläche zu erreichen. Es gab kaum wärmende Radioaktivität, und die Atmosphäre wäre für uns unerträglich gewesen, so hoch war die Sauerstoffkonzentration. Unsere Art hätte sich überhaupt nicht entwickeln können – hätte es nicht die Menschen gegeben, die den Planeten umgestalteten.«
Die Menschengehege draußen waren vergessen. Die Kinder hingen wie gebannt an ihren Kieferfühlern. Peria-230767 nickte bedeutungsvoll und fuhr fort: »Wir wissen nicht sehr viel über die Zeit damals. Es muss eine sehr kurze Epoche gewesen sein, in der die Menschen mit gewaltigen technischen Anlagen die Verhältnisse auf der Erde grundlegend veränderten. Sie sprengten den Ozonpanzer, sodass das Licht der Sonne endlich frei auf die Erde fallen konnte; sie rotteten viele der Pflanzen aus, die den schädlichen Sauerstoff produzierten, und mit Hilfe anderer technischer Geräte, die sie in unglaublichen Mengen gebaut haben müssen – immer wieder findet man versteinerte Überreste davon –, reicherten sie die Atmosphäre mit frischem Kohlendioxid und Kohlenmonoxid an, mit aromatischen Stickoxiden und duftenden Schwefelwasserstoffen und tausend anderen wichtigen Bestandteilen. Sie gruben in der Erde nach allen radioaktiven Substanzen, die sie finden konnten, und setzten deren Strahlung frei; ja, sie erzeugten sogar künstlich weitere radioaktiv strahlende Elemente. So schufen sie eine Welt, die unseren Vorfahren optimale Entwicklungsmöglichkeiten bot – deshalb nennt man sie die Wegbereiter.«
»Und warum starben sie dann aus?«, wollte Loto-115341 wissen.
»Mit der Umgestaltung der Erde hatten sie Verhältnisse geschaffen, in denen sie selber nicht mehr überleben konnten«, erklärte Peria-230767, wohl wissend, dass sie damit wissenschaftliche Zweifelsfragen in höchst unzulässiger Weise vereinfachte. »Sie zogen sich in unterirdische Höhlensysteme zurück und starben schließlich alle aus.«
»Aber warum haben sie das denn alles gemacht?«, wunderte sich Ela-006133.
»Das weiß man eben nicht«, räumte Peria-230767 ein. »Das ist eines der ganz großen Geheimnisse der Wissenschaft, und vielleicht wird man es niemals mit Sicherheit wissen.«
Loto-115341 furchte abfällig die Kräuselhaut um seine Nebenaugen. »Ich glaube nicht, dass sie wirklich intelligent waren«, verkündete er mit der entschiedenen Sicherheit eines Kindes. »Sonst hätten sie das nicht gemacht.«
»So darfst du das nicht sehen«, meinte Peria-230767 mäßigend. »Ich denke eher, dass die Menschen einfach ein notwendiger Zwischenschritt der Evolution waren.« Sie schlug ihr vorderes Beinpaar mit einem aufmunternden Klacken zusammen. »Schluss jetzt, genießt die Fahrt! Schaut, dort vorne kommt ein Gehege mit ganz vielen Menschenjungen!«
Well done
Ach ja – fremde, nichtmenschliche Intelligenzen …
Die Erzählungen und Filme, in denen Außerirdische auf der Erde landen, um wehrlosen Erdenmenschen schlimme Dinge anzutun, sind Legion.
Wie das so meine Art ist, fragte ich mich eines Tages, ob es nicht auch ganz anders laufen könnte …
Ich habe auch immer an UFOs geglaubt. Ich weiß nicht, warum, aber ich war schon immer davon überzeugt, dass es sie gibt – die Scheiben am Himmel. Die fliegenden Untertassen. Die Aliens.
Ich habe keine Religion daraus gemacht, das nicht. Ich habe nicht erwartet, dass sie eines Tages kommen und uns von Krieg, Not und Hunger befreien; auch nicht, dass sie uns mitnehmen in eine bessere Welt.
Aber dass sie eines Tages kommen würden – ja, das habe ich schon geglaubt.
Und so war es dann ja auch.
Als Neunjähriger habe ich alles gesammelt, jeden winzigen Zeitungsartikel über Lichter am Himmel, fliegende Scheiben, Brandspuren auf Feldern … Die Fotos waren oft so erbärmlich. Die meisten sahen schon verdammt aus wie Fälschungen. Aber trotzdem …
Zum dreizehnten Geburtstag habe ich ein Fernglas bekommen, ein nachttaugliches. Von da an bin ich jeden Abend losgezogen, um nach UFOs Ausschau zu halten. In den Augen der anderen war ich damit natürlich erledigt. Sie haben mich nie gefragt, ob ich irgendwohin mitgehe, ins Kino, zum Tanzen, in die Kneipe. Ich wäre auch nicht mitgegangen. Ich hätte viel zu viel Angst gehabt, die Landung der Fremden zu verpassen.
Aber sie sind nie gelandet. Egal wo ich hingegangen bin, egal wie lange ich gewartet habe oder wie inbrünstig die Gedanken waren, die ich hinaus ins All geschickt habe – sie haben sich nicht blicken lassen.
An der Uni habe ich Linguistik belegt, zur Überraschung meiner Familie, denn was Fremdsprachen anbelangt, war ich nie eine Leuchte. Aber ich wollte, wenn es so weit war, im Stande sein, zur Verständigung mit ihnen beizutragen. Das habe ich natürlich nie jemandem verraten. Ich war vielleicht plemplem, aber nicht total bescheuert.
Wir Linguisten mussten auch ein paar Vorlesungen in Statistik besuchen, und zur ersten Stunde brachte der Professor diesen Zeitungsartikel mit, wonach sich in der Nähe einer bestimmten Stadt in New Mexico zweimal im Jahr die Meldungen über UFO-Sichtungen häufen.
Die simple Erklärung, dass sich dort tatsächlich zweimal pro Jahr UFOs blicken lassen, durfte natürlich nicht einmal in Erwägung gezogen werden. Also brauchte er die ganze Stunde, um mit irgendwelchen Lehrsätzen und Formeln, die ich mir nicht gemerkt habe, zu beweisen, dass es eine »statistische Anomalie« war. Gemerkt habe ich mir nur den Namen der Stadt.
Bei nächster Gelegenheit verkaufte ich mein Auto und flog hin. Ich war vorsichtig, blieb in Deckung. Die Leute, die von den UFOs wussten, bildeten eine kleine, verschworene Gemeinschaft, und anders als andere waren sie nicht darauf aus, den Rest der Welt zu bekehren. Im Gegenteil, sie blieben lieber unter sich. Einmal riskierte ich es, einen von ihnen anzurufen und ihn geradeheraus nach den Aliens zu fragen, aber er nannte mich nur einen Idioten und legte auf.
Aber da kamen mir die ganzen Statistik-Vorlesungen doch noch zugute. Mustererkennung. Data-Mining. Relevanz, Varianz, Stochastik. Ich besorgte mir die Daten der UFO-Sichtungen, verglich, rechnete und suchte und kam schließlich darauf, dass drei Wochen vor jedem Kontakt im Lokalblatt zwei Anzeigen örtlicher Unternehmen auftauchen. Der größte Arbeitgeber am Ort, ein Hersteller von Stahl-Halbfertigzeugen, schreibt zeitlich befristete Jobs in seinem Walzwerk aus, und »Joe’s Steak House« kündigt »Gourmet-Wochen« an. Sowohl Jobs als auch »Gourmet-Wochen« beginnen am gleichen Tag, und das seit fünfzehn Jahren. Und dieser Tag fällt statistisch signifikant stets zusammen mit dem Peak der UFO-Meldungen.
Also abonnierte ich die Lokalzeitung, und das nächste Mal war ich auch vor Ort.
Sie entdeckten mich, ehe es so weit war, und ich erinnere mich, dass sie nicht einmal besonders überrascht wirkten. Sie hatten Waffen in den Händen und sahen so aus, als könnten sie auch damit umgehen. Ich hob die Hände und erklärte hastig, dass ich nichts weiter wolle als dabei zu sein, wenn die Aliens landeten. Ich sprudelte meine ganze Lebensgeschichte heraus. Ich war so weit weg von zu Hause, es war mir egal, wenn ich mich blamierte. Hauptsache, ich würde die Aliens sehen …!
Sie lachten mich nicht aus. Stattdessen fesselten sie mich auf einen Stuhl, den sie an einem Pfosten festbanden, und machten damit weiter, ihre Wagen auszuladen. Sie stellten ein großes Zelt auf, Tische und Stühle und Riesengrills, die ganze typisch amerikanische Materialschlacht eben, mitsamt Kühlschränken und Spülbecken.
Es war offensichtlich, dass sie sich auf eine lange Nacht einrichteten.
Schließlich kam einer zu mir und fragte, wer alles wisse, dass ich hier sei, und ich war so leichtsinnig, zuzugeben: »Niemand.«
»Bist du ein Journalist oder so was?«
»Nein.«
Zu meiner Verblüffung lächelte der Mann. Dann stapfte er davon, zückte sein Telefon und beriet sich mit mindestens einem Dutzend Gesprächspartnern, immer am Rand des Lagerfeuers auf und ab gehend.
Schließlich kamen sie zu dritt zu mir und meinten: »Du kannst bleiben. Aber du wirst ein Geheimnis bewahren müssen.«
Ich schwor, dass ich das könne und werde, so wahr mir Gott helfe, aber sie banden mich nicht los. Sie sagten nur, es müsse sein, und später würde ich es verstehen.
Gegen Mitternacht schalteten sie die Signalscheinwerfer ein. Rote, blaue und gelbe Lichtbahnen stiegen in die Nacht auf, die von sommerlichem Zirpen erfüllt war. Die Männer am Grill schürten noch einmal die Glut, bis sie hellrosa leuchtete, dann legten sie die Schürhaken beiseite und gesellten sich zu den anderen.
Es wurde still.
»Woher wisst ihr eigentlich, dass sie kommen?«, fragte ich einen von ihnen leise.
Er deutete auf einen grauhaarigen, breitschultrigen Mann, der so etwas wie der Mittelpunkt der Gruppe war. »Das ist Jim. Er war mal bei der Air Force, hat so ein Ding abgeschossen. Später hat er in der Nähe der Stelle, wo es runter ist, eins von ihren Funkgeräten gefunden.« Er rieb sich den Hals. »Damit locken wir sie an.«
Ich erinnere mich, dass ich diese Formulierung merkwürdig fand, aber ich schob es auf meine begrenzten Englischkenntnisse und fragte: »Und dann kommen sie?«
»Ja.«
»Und was wollen sie?«
»Das wissen wir nicht.«
»Aber wieso nicht? Wenn sie landen … und Kontakt aufnehmen …?« Endlich konnte ich die Frage stellen, die mich beschäftigte, seit ich der Sache auf der Spur war: »Wieso hat die Welt nie etwas davon erfahren?«
Er erklärte es mir. Und als ich dann schrie, hatte er den Knebel schon griffbereit.
Sie hatten mich nämlich aus demselben Grund an den Stuhl gefesselt, aus dem Sie, mein lieber Freund, hier sitzen. Auch Sie werden warten müssen, bis das Raumschiff der Fremden gelandet ist und die Besucher aus dem All zum Vorschein kommen. Meistens sind es zwei, aber wenn wir Glück haben, auch drei oder vier. Sie sehen seltsam aus, aber sie sind … Wie soll ich sagen? Freundlich? Arglos? Gefesselt und geknebelt werden Sie mit ansehen müssen, wie wir ihnen entgegentreten. Wie wir sie lächelnd in unsere Mitte bitten.
Und wie einige von uns … na ja, wie sie tun, was eben getan werden muss. Eine schöne Sache ist es nicht. Erschrecken Sie übrigens nicht, das Blut der Fremden ist gelb; es sieht fast aus wie Eiter. Aber es ist keiner. Man kann es problemlos abwaschen.
Sobald dann die ersten Stücke gebraten sind, gegrillt über den Holzkohlefeuern dort drüben, werden wir Ihnen den ersten Bissen mit Gewalt in den Mund schieben. Ein paar von den Jungs haben, was das anbelangt, sehr wirkungsvolle Griffe drauf.
Und dann, mein lieber, glücklicher Freund, wird es Ihnen genauso ergehen, wie es jedem Einzelnen von uns hier ergangen ist: Sie werden kauen, Sie werden schlucken, und Sie werden verstehen.
Denn nichts, was Sie je im Leben gegessen haben, wird sich messen können mit diesem gegrillten Stück Fleisch. Nichts, was unser erbärmlicher Planet hervorbringt, kann es mit diesem unwiderstehlichen, diesem göttlichen Aroma aufnehmen, diesem wahrhaft überirdischen Geschmack, diesem … diesem … Ah! Ich versuche immer wieder, es in Worte zu fassen, aber es gibt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Sie werden sehen.
Nach ein, zwei Bissen werden wir Sie losbinden. Sie können später helfen, das Raumschiff in handliche Stücke zu schneiden. Die schmelzen wir im Stahlwerk vollends ein, damit keine Spur zurückbleibt und niemand herausfindet, wo die Fremden abgeblieben sind. Das nächste Mal zeigt Jim Ihnen dann, wie man sie richtig ausnimmt und zerlegt.
Die grässliche Geschichte vom Goethe-Pfennig
Im Juli 2005 fragte ein Redakteur einer der wichtigsten Wirtschaftszeitschriften Deutschlands bei mir an: Man feiere im Herbst das Jubiläum des Blattes, wolle dazu eine besondere Ausgabe machen, ob ich mir vorstellen könne, dafür eine Story zu schreiben? Er hatte auch gleich relativ konkrete Vorschläge, so konkret in der Tat, dass ich mich hätte fragen sollen, warum er die Story denn nicht selber schrieb.
Da ich dieses Blatt in meiner Zeit als aufstrebender Jungunternehmer selber gern und mit dem Gefühl, etwas davon zu haben, gelesen hatte, sagte ich nach Klärung der Randbedingungen (Honorar, Umfang, Ablieferungstermin) zu, trotz eines eigentlich schon ganz gut gefüllten Zeitplans.
Zur Inspiration bekam ich einige aktuelle Ausgaben des Magazins zugeschickt, die ich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden durchschmökerte und die mich, ja, tatsächlich inspirierten. Womit ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet hatte, denn normalerweise funktioniert so etwas wie »Inspiration auf Kommando« bei mir nicht. Aber tatsächlich kam mir beim Lesen all dieser Wirtschaftsberichte, Interviews mit Unternehmern, Kolumnen über neue Steuern und Vorschriften und so weiter eine Idee, die sich im Lauf der Lektüre immer weiter konkretisierte und schließlich so unwiderstehlich wurde, dass ich mich hinsetzen und in den darauffolgenden Tagen nichts anderes tun konnte als diese Story zu schreiben, die für mich so etwas wie die Quintessenz aus all dem Gelesenen war – und meinen eigenen Erfahrungen als Unternehmer. So viel hatte sich gar nicht geändert. Noch immer hakt und krankt die Wirtschaft daran, dass der Staat sich unverdrossen in immer mehr Bereiche einmischt, in denen er nur Unheil anrichten kann.
Nachdem ich die Story fertig hatte, gab ich sie meiner Frau zu lesen. Die war begeistert. Ich gab sie meinem Agenten zu lesen, der auch begeistert war. Ich schickte sie an den Redakteur besagter Zeitschrift …
… der sie ablehnte. Man habe sich doch etwas anderes vorgestellt. Mehr SF-mäßig. Eher so etwas wie ein Tag im Leben eines Menschen im Jahr 2050. Wie jemand morgens aufsteht und von allerhand intelligenter Haustechnik umsorgt und umhegt wird. Wie er mit Hilfe weltweiter Netze und Computern und so weiter seiner Arbeit nachgeht. Und so.
Ich war etwas gefrustet, musste aber zugeben, dass in den anfänglichen Gesprächen tatsächlich der Begriff Science Fiction gefallen war und dass meine Story damit nichts zu tun hatte. Also legte ich sie beiseite und schrieb eine andere. In der jemand morgens aufsteht und von allerhand intelligenter Haustechnik umsorgt und umhegt wird. In der er mit Hilfe weltweiter Netze und Computern und so weiter seiner Arbeit nachgeht. Und so.
Sie finden diese Story ebenfalls in diesem Band; sie trägt den Titel »Survivaltraining«.
Sie wurde ebenfalls abgelehnt.
An diesem Punkt hatte ich keine Lust mehr. Mein Agent handelte ein Ausfallhonorar aus, und was dann in besagter Jubiläumsausgabe erschien, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich in irgendeiner Marketingabteilung ein Texter gefunden, der eine Geschichte geschrieben hat über jemand, der morgens aufsteht und von allerhand intelligenter Haustechnik umsorgt und umhegt wird. Mit Hilfe weltweiter Netze und Computern und so weiter seiner Arbeit nachgeht. Und so. Und der diese Vision etwas toller fand, als ich sie finden kann.
»Die grässliche Geschichte vom Goethe-Pfennig« erschien, drastisch gekürzt allerdings, dann im Herbst 2007 in einem anderen, nicht minder bedeutenden Wirtschaftsmagazin, dem »Handelsblatt« nämlich. Und hier erscheint sie zum ersten Mal so, wie ich sie geschrieben habe.
Es war einer dieser Tage, an denen Peter Eisenhardt mit allem haderte, mit der Welt im Allgemeinen und mit seinem Schicksal im Besonderen.
Peter Eisenhardt war – neben seinem Brotberuf als Sachbearbeiter, der ihn leidlich ernährte – Schriftsteller. Unglücklicherweise galt seine Liebe der Science-Fiction, einem Genre also, dessen Liebhaber zwar treu waren wie Gold, aber leider auch ebenso rar, während es bei der Zivilbevölkerung einen eher anrüchigen Ruf genoss. Mit anderen Worten, selbst im Falle einer geglückten Veröffentlichung war nicht mit Verkaufszahlen zu rechnen, die das Schreiben eines Romans zu einem wirtschaftlich lohnenden Unterfangen gemacht hätten.
Überdies zählte Peter Eisenhardt nicht zu den großen Namen der Science-Fiction; zu seinem Leidwesen waren andere beliebter, und manche von denen, die beliebter waren, waren selbst seiner Meinung nach tatsächlich besser. Schrieben spannender. Zeichneten lebendigere, eindrücklichere Charaktere. Bekamen Dialoge hin, bei denen man die Stimmen der Figuren beinahe hörte.
Und er? Er stak gerade im ersten Drittel seines neuen Romans, kämpfte gegen rapide nachlassende Spannung, war unzufrieden mit seinen Charakteren, die ihm papieren und leblos vorkamen, und zu allem Überfluss rief auch noch sein Agent an und machte ihm den Vorschlag, es doch mal mit einem Krimi zu versuchen, Krimis gingen viel besser als Science-Fiction.
Genug Gründe also, um zu hadern. Eisenhardt schaltete den PC aus und ergab sich der Glotze. Wozu plagte er sich eigentlich ab? Letzten Endes interessierte es ja doch kein Schwein, was er trieb.
Genau in diesem Moment sagte ein ernst dreinblickender Politiker auf dem Bildschirm: »Man muss etwas für die Autoren tun!«
Eisenhardt verfolgte mit ungläubig geweiteten Augen, wie dieser Mann – laut Bildunterschrift Staatssekretär im Wirtschaftsministerium – fortfuhr, es könne nicht angehen, dass Autoren Monate, manchmal Jahre an Arbeit in ein Manuskript steckten und nachher dafür keine angemessene Entlohnung, ja mitunter nicht einmal eine Möglichkeit der Veröffentlichung fänden. Ausbeutungsähnliche Verhältnisse seien das, und seines Erachtens sei die Politik gefordert, hier endlich Abhilfe zu schaffen.
»Ein Autor, gerade der Neueinsteiger, hat keinerlei Planungssicherheit«, fuhr er fort. »Einen Roman zu schreiben ist im Grunde ein unzumutbares Wagnis. Ich frage Sie: Wissen wir, wie viele gute Autoren dadurch abgeschreckt werden? Wie viele gute Romane aufgrund dessen ungeschrieben bleiben? Wir haben es hier mit einer skandalösen Verschwendung kreativer Energie und schöpferischer Potenziale zu tun, die wir uns gerade als Kulturnation nicht länger leisten können. Alles klagt, dass es mit Deutschland abwärtsgehe. Ich sage: Hier ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen!«
Eisenhardt konnte es kaum fassen. Ein Traum wurde wahr! Autoren wurden auf einmal ernst genommen! Die Partei, der dieser Staatssekretär angehörte, war ihm auf einen Schlag sympathisch.
Abends war besagter Staatssekretär bei Sabine Christiansen, und nun erfuhr man die ganze Geschichte. »Sensibilisiert für die Problematik«, wie er sich ausdrückte, habe ihn das Schicksal seiner Tochter. Sieben Jahre lang habe diese an einem Roman geschrieben und sich danach weitere vier Jahre lang abmühen müssen, bis sie endlich einen Verlag dafür gefunden habe. Dort sei das Buch mit einer Startauflage von mageren 1500 Exemplaren erschienen. »Und wissen Sie, wie viel sich davon verkauft haben?«, erregte sich der Politiker. »Nach einem Jahr ganze 891 Stück! Ich frage Sie: Steht das im Verhältnis? Das reicht kaum, um die Portokosten zu amortisieren.«
Er hatte das Buch dabei und hielt es, den leisen Unmut seiner Gastgeberin erregend, in die Kamera. Peter Eisenhardt kannte es sogar. Es war eine Liebesgeschichte zwischen zwei Germanistikstudenten – die Autorin studierte im 26. Semester Germanistik –, die zahlreiche lobende Rezensionen bekommen hatte, darunter in angesehenen Tageszeitungen. In der Buchhandlung hatte er es einmal in die Hand genommen, allerdings nach den ersten zwei Absätzen wieder beiseitegelegt.
»Es geht nicht um ein einzelnes Buch«, beteuerte der Staatssekretär. »Es geht um eine grundlegende Neuorientierung der Kulturpolitik unseres Landes.« Die anwesenden Politiker der anderen Parteien pflichteten ihm im Grundsatz bei, und an einem der folgenden Tage kündigte ein hochrangiges Mitglied der Regierung eine entsprechende Gesetzesinitiative an.
Wenige Wochen später wurden erste Einzelheiten des geplanten »Autoren-Arbeitsplatz-Schutzgesetzes«, abgekürzt AuArSchG, bekannt. Wichtigste Neuregelung war, dass alle Bücher künftig mit einer Mindestauflage von 20.000 Stück erscheinen sollten.
Wie jedes kühne Reformvorhaben stieß auch dieses zuerst auf den Protest der ewigen Beharrer. Ein Kleinverleger mahnte in einem Tagesschau-Interview, man denke hoffentlich daran, dass viele kleinere Verlage nicht einmal insgesamt auf solche Stückzahlen kämen, und der Herausgeber einer großen Wochenzeitung nannte das Gesetzesvorhaben »blanken Unsinn«. Dessenungeachtet wurde der Gesetzentwurf einige Wochen später in den Bundestag eingebracht und passierte in erster Lesung und mit deutlicher Mehrheit, ein entschiedenes Bekenntnis der Volksvertreter also zum Kulturgut Buch.
Peter Eisenhardts Agent war begeistert. Eisenhardt selber nicht minder, als er den neuen, bereits nach AuArSchG abgeschlossenen Vertrag für sein nächstes Buch sah: eine bedeutend höhere Startauflage, das bedeutete natürlich auch einen bedeutend höheren Vorschuss!