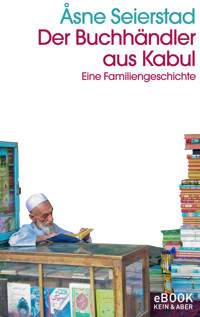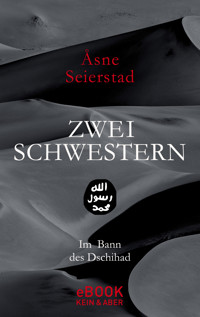19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie konnte sich Anders Breivik, der im wohlhabenden Westen aufwuchs, zu einem perfiden Terroristen entwickeln? Åsne Seierstads ausgezeichnetes Buch ist gleichzeitig psychologische Studie und literarisches True Crime, gleichzeitig Würdigung der Opfer und eine messerscharfe Analyse einer Tat, die sich jederzeit und überall wiederholen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Bibliografie
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Åsne Seierstad, geboren 1970 in Oslo, arbeitete als Korrespondentin und Kriegsberichterstatterin für verschiedene internationale Zeitungen und ist Autorin mehrerer Sachbücher. Sowohl als Journalistin als auch für ihren weltweiten Bestseller Der Buchhändler aus Kabul (2002) wurde sie vielfach ausgezeichnet. Sie lebt in Oslo.
ÜBER DAS BUCH
Wie konnte sich Anders Breivik, der im wohlhabenden Westen aufwuchs, zu einem perfiden Terroristen entwickeln? Åsne Seierstads ausgezeichnetes Buch ist gleichzeitig psychologische Studie und literarisches True Crime, gleichzeitig Würdigung der Opfer und eine messerscharfe Analyse einer Tat, die sich jederzeit und überall wiederholen könnte.
»Das ist Journalismus von seiner besten Seite.« The Sunday Times
»Eines der zehn besten Bücher des Jahres.« New York Times
»Åsne Seierstad schreibt treffend, präzise und aus der richtigen Distanz, um das Individuum wirklich zu sehen. Ihr Buch hat den Worten ›Utøya‹ und ›22. Juli‹ eine ganz neue Bedeutung gegeben.« Karl Ove Knausgård
Vorbemerkung der Autorin
Alles Geschriebene beruht auf Aussagen und Berichten von Augenzeugen und Betroffenen. Alle Szenen sind auf Grundlage ihrer Erzählungen rekonstruiert.
Für Anders Behring Breiviks Kindheit und Jugend gab es viele Quellen, unter anderem seine Mutter und seinen Vater, Freunde, Familienmitglieder sowie seine eigenen Aussagen im Verhör und vor Gericht. Ferner hatte ich Zugang zu allen Dokumenten der Osloer Sozialbehörden, die seine Kindheit betreffen.
Was die Planung des Terrorangriffs angeht, habe ich unter anderem Breiviks Tagebuch und Einträge aus seinem Manifest verwendet. Alle Angaben zu seinen Gedanken und Gefühlen in bestimmten Situationen beruhen auf seinen eigenen Aussagen. Dabei habe ich ihn sowohl wörtlich als auch sinngemäß zitiert.
Eine weitere, wichtige Quelle zu dem Massaker auf Utøya sind die überlebenden Opfer. Sie haben mir ihre Geschichten und Beobachtungen sowie ihre Gedanken und Gefühle erzählt. In Verbindung mit den Aussagen des Täters war es mir deshalb möglich, den Terrorangriff minutiös zu rekonstruieren.
Am Ende des Buches befindet sich ein längerer Bericht über meine Arbeitsmethode.
Åsne SeierstadOslo, 12. November 2014
Sie rannte.
Den Hügel hinauf, durch das Moos. Die Gummistiefel sanken im nassen Boden ein. Der Waldboden gluckste unter den Füßen.
Sie hatte es gesehen.
Sie hatte gesehen, wie er geschossen hatte und ein Junge niedergesunken war.
»Wir werden nicht sterben«, hatte sie zu ihren Freundinnen gesagt. »Nicht heute.«
Da hörte sie mehrere Schüsse. Eine Salve. Pause. Eine neue Salve.
Sie hatte den Pfad der Verliebten erreicht. Ringsumher liefen Jugendliche und suchten nach Verstecken.
Neben dem Pfad stand ein rostiger Drahtzaun, und auf der anderen Seite fielen steile Klippen in den Tyrifjord ab. Ein paar Maiglöckchen klammerten sich an den Abgrund. Sie waren verblüht, und aus den Blattkelchen tropfte Regenwasser auf den nackten Fels.Von oben betrachtet sah die Insel grün aus. Die Kronen der großen Kiefern gingen ineinander über, und die Laubbäume streckten ihre schmalen Äste in den Himmel. Doch hier unten am Boden war der Wald spärlich, nur an wenigen Stellen war das Gras hoch genug, um sich darin zu verstecken. An einem Abhang ragten flache Felsen aus der Erde, wie Schilde, unter die man kriechen konnte.
Die Schüsse wurden lauter.
Wer war das? Wie viele mochten es sein?
Sie duckte sich und kroch weiter. Alle suchten nach Verstecken. Es war zu spät zum Davonlaufen.
»Wir müssen uns tot stellen«, sagte ein Junge. »Legt euch in einer komischen Stellung hin, dann glauben sie, wir sind tot!«
Sie ließ sich auf den Bauch fallen und drehte das Gesicht zur Seite. Ein Junge legte sich neben sie, den Arm um ihre Hüfte.
Sie waren elf.
Alle taten, was der Junge gesagt hatte.
Hätte er »Lauft!« gerufen, wären sie vielleicht um ihr Leben gerannt. Aber er sagte »Legt euch hin.« So lagen sie dicht beisammen und drehten die Köpfe zum Wald und den dunklen Baumstämmen, die Füße am Zaun. Manche lagen sogar übereinander. Zwei beste Freundinnen hielten sich an den Händen.
»Alles wird gut«, sagte einer der elf.
Der schlimmste Regen hatte sich gelegt, aber das Wasser lief ihnen noch immer über die verschwitzten Wangen in die Krägen.
Sie atmeten so flach und lautlos wie möglich.
Auf den Klippen wuchs ein verirrter Himbeerbusch, Wildrosen mit blassrosa, fast weißen Blüten rankten um den Zaun.
Dann hörten sie seine Schritte.
Er streifte ruhig durchs Gestrüpp, über Glockenblumen und gelben Hornklee. Seine Stiefel stampften fest auf, trockene Zweige knackten. Er hatte bleiche, feuchte Haut und hellblaue Augen. Das dünne Haar war über der Halbglatze zurückgekämmt. Sein Kreislauf war voller Koffein, Ephedrin und Aspirin.
Bis jetzt hatte er zweiundzwanzig Menschen auf der Insel getötet.
Nach dem ersten Schuss war alles leichter. Der erste Schuss hatte Überwindung gekostet. Es war fast unmöglich gewesen, aber nun schritt er entspannt voran, die Pistole in der Hand.
Auf der Anhöhe, hinter der die elf Jugendlichen lagen, blieb er stehen. Er blickte auf sie herab und fragte: »Wo zum Teufel ist er?«
Seine Stimme war laut und klar.
Keiner antwortete, keiner rührte sich.
Der Arm des Jungen lag schwer auf ihr. Sie trug eine rote Regenjacke und Gummistiefel, er karierte Shorts und ein T-Shirt. Sie war sonnengebräunt, er bleich.
Der Mann auf der Anhöhe begann von rechts.
Der erste Schuss traf den Jungen, der außen lag, in den Kopf.
Dann zielte er auf ihren Hinterkopf. Ihr lockiges, kastanienbraunes Haar schimmerte im Regen. Die Kugel drang durch den Schädel ins Hirn. Er schoss noch einmal, diesmal in die Stirn. Wieder drang das Geschoss durchs Hirn und weiter durch Hals und Brusthöhle, bis es neben dem Herzen stecken blieb. Blut rann über den jungen Körper, lief auf den Pfad und sammelte sich in kleinen Pfützen.
Sekunden später wurde der Junge, der den Arm um sie gelegt hatte, getroffen. Der Schuss durchschlug seinen Hinterkopf, die Kugel splitterte beim Eindringen auf, traf das Kleinhirn und zerfetzte den Hirnstamm.
Sein Herz hörte auf zu schlagen.
Das Blut mischte sich mit Regenwasser und sickerte in den Boden.
In einer Tasche klingelte ein Handy. Ein anderes piepte, als eine SMS ankam.
Ein Mädchen flüsterte kaum hörbar »nein …«, als auch sie in den Kopf getroffen wurde. Sie zog das Wort in die Länge, bis sie verstummte.
Die Schüsse fielen innerhalb weniger Sekunden.Er hatte Waffen mit Laserschussprüfer. Die Pistole schickte einen grünen Strahl aus, das Gewehr einen roten, und die Kugeln trafen genau auf die Lichtpunkte.
Am Ende der Reihe sah ein Mädchen zu seinen schwarzen, schlammigen Stiefeln auf. An den Absätzen steckten spitze Sporen. Ein kariertes Reflektorband schimmerte am Hosenbein.
Sie hielt ihre beste Freundin an der Hand. Ihre Gesichter waren einander zugewendet.
Ein Schuss knallte und traf die Stirn ihrer Freundin. Sie zuckte, und ihre Hand wurde schlaff.
Siebzehn Jahre sind kein langes Leben, dachte das Mädchen, das noch am Leben war.
Dann knallte es wieder.
Die Kugel heulte und riss ihr die Kopfhaut auf. Blut rann ihr übers Gesicht und über die Hände, in denen sie es verbarg.
Der Junge neben ihr flüsterte: »Ich sterbe.«
»Hilfe, ich sterbe. Hilf mir«, bettelte er.
Sein Atem wurde immer schwächer, bis er still stand.
Aus der Mitte der Gruppe kam ein schwaches Jammern. Ein leises Stöhnen und Röcheln. Dann nur noch ein Fiepen. Am Ende war es totenstill.
Elf Herzen hatten auf dem Pfad geschlagen. Nun schlug nur noch eins.
Ein Stück weiter weg steckte ein Ast quer im Zaun. Er sollte das Loch verbergen, durch das einige gekrochen waren. Sie waren die Klippen herabgeklettert und versteckten sich auf einem Felsabsatz.
»Mädchen zuerst!«, sagte der Junge, der den anderen hinunterhalf. Als sie die Schüsse vom Pfad hörten, sprang er selbst über die nassen, glatten Steine.
Ganz außen saß ein Mädchen mit lockigen Haaren. Sie erkannte ihn und rief seinen Namen. »Setz dich zu mir«, rief sie.Alle rückten dicht zusammen, damit auch sie Platz hatte.
Sie hatten sich am Abend vorher kennengelernt. Er kam aus dem Norden, sie aus dem Westen.
Auf dem Konzert hatte er sie auf die Bühne gehoben, und hinterher waren sie auf dem Pfad der Verliebten zu den Klippen spaziert und hatten sich dort hingelegt. Die Julinacht war kalt, und er hatte ihr seinen Pullover geliehen. Auf dem Rückweg hatte sie ihn aus Spaß Huckepack getragen, um ihn näher zu spüren.
Der Mörder trat die elf Opfer, um zu kontrollieren, ob sie tot waren. Zwei Minuten hatte er gebraucht, um sie niederzuschießen.
Hier war er fertig.
Unter der Uniform trug er ein Medaillon an einer Silberkette. Es zeigte ein rotes Kreuz auf weißer Emaille, umrahmt von Silberdekor. In dem Dekor prangten ein Ritterhelm und ein Totenkopf. Das Wappen schlug gegen seine Kehle, als er festen Schrittes weiterging und Ausschau hielt.
Bei dem Ast im Zaun blieb er stehen. Er beugte sich über den Zaun und sah den Abhang hinab.
In einem Gebüsch erkannte er Farben. Ein Fuß ragte über den Absatz hinaus.
Der Junge und das Mädchen hielten einander fest an den Händen. Als die Schritte anhielten, schloss das Mädchen die Augen.
Der Uniformierte hob das Gewehr, zielte auf den Fuß und zog ab.
Der Junge schrie auf und ließ ihre Hand los. Sand und Steine spritzten ihr ins Gesicht.
Sie öffnete die Augen.
Er stürzte hinab. Ob er gesprungen oder gefallen war, konnte sie nicht sagen. Ein weiterer Schuss traf ihn in den Rücken und wirbelte ihn durch die Luft.
Er landete auf einem großen Stein am Ufer. Die Kugel war durch den Pullover, den er ihr gestern geliehen hatte, in Lunge und Brustkorb eingedrungen und hatte ihm von innen die Halsschlagader aufgerissen.
Der Mann auf dem Pfad jubelte.
»Ihr werdet alle sterben, ihr Marxisten!«
Er erhob die Waffe aufs Neue.
TEIL 1
Ein neues Leben (1979)
»Man will geliebt werden, mangels dessen bewundert, mangels dessen gefürchtet, mangels dessen gehasst und verachtet. Man will irgendein Gefühl in den Menschen wecken. Die Seele schreckt vor der Leere zurück und sucht um jeden Preis Kontakt.«1
Hjalmar Söderberg, Doktor Glas (1905)
Es war einer jener klaren, kalten Wintertage, an denen Oslo funkelt. Die Sonne, die die Menschen schon fast vergessen hatten, ließ den Schnee glitzern. Passionierte Skiläufer blickten sehnsüchtig durchs Bürofenster auf die weißen Berge, die Sprungschanze und den blauen Himmel.
Stubenhocker verfluchten die zwölf Minusgrade, denn wenn sie hinausmussten, zitterten sie in dicken Pelzjacken und gefütterten Stiefeln. Die Kinder trugen mehrere Schichten Wolle unter den Schneeanzügen, Schreie und Quietschen tönten von den Rodelhügeln der Kindergärten, die wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, seit immer mehr Frauen zur Arbeit gingen.
Vor der alten Klinik im Norden der Stadt hatten die Räumfahrzeuge Berge von Schnee aufgetürmt. Er knirschte unter den Füßen der Besucher.
Es war ein Dienstag, der 13. Februar.
Am Haupteingang fuhren Autos vor, aus denen werdende Mütter stiegen, gestützt von werdenden Vätern. Sie waren ganz in ihr persönliches Drama vertieft, gespannt auf das neue Leben, das zu ihnen kommen würde.
Seit den frühen Siebzigerjahren durften auch Väter der Geburt in norwegischen Kliniken beiwohnen. Anstatt auf dem Gang hin und her zu laufen und auf Schreie zu warten, durften sie nun zusehen, wie der Kopf ihres Babys herauskam. Sie rochen das Blut und hörten den ersten Schrei ihres Kindes. Die Mutigsten unter ihnen bekamen von der Hebamme eine Schere in die Hand gedrückt, um die Nabelschnur zu durchtrennen.
Die Gleichstellung der Geschlechter und eine neue Familienpolitik waren typische Slogans des Jahrzehnts. Haus und Kinder waren keine reine Frauensache mehr, die Väter waren von Anfang an in die Erziehung involviert, schoben Kinderwagen und kochten Babybrei.
Auf einem der Zimmer litt eine Frau große Schmerzen. Die Wehen waren heftig, aber das Baby wollte nicht kommen. Sie war schon neun Tage über dem Termin.
»Nimm meine Hand!«, stöhnte sie zu dem Mann, der am Kopfende stand. Er ging zu ihr, ergriff ihre Hand und hielt sie fest. Es war sein erstes Mal. Zwar hatte er drei Kinder aus einer früheren Ehe, aber damals war er folgsam draußen geblieben, bis er die Kinder sauber eingewickelt in Empfang nehmen durfte – zwei in Hellblau, eines in Rosa gehüllt.
Die Frau keuchte, der Mann hielt ihre Hand.
Sie hatten sich vor einem Jahr in der Waschküche eines Mietshauses in Frogner kennengelernt. Sie wohnte in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss zur Miete, er besaß eine größere Wohnung im ersten Stock. Er – ein frisch geschiedener Diplomat auf Heimatdienst nach zwei Stationierungen in London und Teheran. Sie – Krankenpflegehelferin und alleinerziehende Mutter einer vierjährigen Tochter. Er war dreiundvierzig Jahre alt, mager und hatte schütteres Haar, sie war elf Jahre jünger, schlank, hübsch und blond.
Kurz nach ihrer ersten Begegnung war sie schwanger. Sie heirateten in der norwegischen Botschaft in Bonn, wo er an einer Konferenz teilnahm. Er verbrachte eine Woche dort, sie nur zwei Tage, während eine Freundin auf ihre Tochter aufpasste.
Am Anfang freute sie sich über die Schwangerschaft, aber nach ein oder zwei Monaten überkamen sie Zweifel, und sie wollte das Kind nicht mehr haben. Immer, wenn seine drei Kinder zu Besuch kamen, wirkte er kühl und distanziert. Der Mann schien keine Freude an Kindern zu haben – sollte sie wirklich noch ein Kind mit ihm in die Welt setzen?
Im selben Monat, als sie schwanger wurde, hatte das norwegische Parlament mit einer Stimme Mehrheit für das Recht auf selbstbestimmte Abtreibung gestimmt. Das neue Gesetz sah die unbedingte Selbstbestimmung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche vor. Aber es sollte erst ein Jahr später in Kraft treten, und außerdem hatte sie schon zu lange gezweifelt. Es war zu spät.
Schon bald litt sie unter so heftiger Übelkeit, dass sie eine Abneigung gegen das kleine Leben entwickelte, das in ihr heranwuchs. Das kleine Herz schlug gleichmäßig und kraftvoll, der Fötus entwickelte sich völlig normal. Es gab keinerlei Anzeichen von Abnormalität, kein Klumpfuß, keine überflüssigen Chromosomen, kein Wasserkopf. Im Gegenteil, es war ein lebhaftes Baby, vollkommen gesund nach Ansicht der Ärzte, lästig nach Ansicht der Mutter. »Ich glaube, er tritt mich absichtlich, um mich zu quälen«, sagte sie.
Bei der Geburt war der Junge bläulich.
Abnormal, dachte die Mutter.
Gesund und munter, sagte der Vater.
Es war zehn vor zwei am Nachmittag. Der Junge begann sofort zu schreien. Eine normale Geburt, laut Klinikbericht.
In der Aftenposten stand folgende Geburtsanzeige:
Aker Hospital. Ein Junge.
13. Februar. Wenche und Jens Breivik.
Später würde jeder der beiden seine Version der Geschichte erzählen. Sie würde sagen, die Geburt sei grausam gewesen, er würde sagen, es sei gut gelaufen.
Bestimmt sei das Kind von den vielen Schmerzmitteln geschädigt, die sie bekommen hatte, meinte die Mutter. Mit dem Jungen sei alles in Ordnung, meinte der Vater.
Noch später würden ihre Meinungen über jede Kleinigkeit auseinandergehen.
Das norwegische Außenministerium hatte flexible Regeln für junge Eltern eingeführt und erlaubte frischgebackenen Vätern, in der Zeit nach der Geburt daheimzubleiben. Doch als Wenche aus der Klinik nach Hause kam, fehlte etwas Entscheidendes:
Ein Vater, der keinen Wickeltisch für sein Neugeborenes besorgt, kann es nicht lieben, fand Wenche. Es bedrückte sie, dass sie das Baby auf dem Boden im Badezimmer wickeln musste. Jens wechselte sowieso keine Windeln, er war von der alten Schule. Sie fütterte das Baby, wiegte es und sang es in den Schlaf. Sie gab ihm die Brust, bis sie wund war. Dunkelheit ergriff sie, der gesamte Frust ihres Lebens verdichtete sich zu einer tiefen Depression.
Schließlich schrie sie ihren Mann an, er solle endlich einen Wickeltisch kaufen. Jens tat es, aber von da an war ein Keil zwischen sie geschlagen.
Der Junge wurde auf den Namen Anders getauft.
Als Anders sechs Monate alt war, wurde Jens zum Botschaftsrat an der norwegischen Botschaft in London ernannt. Er zog nach England, Wenche und die Kinder kamen kurz vor Weihnachten nach.
Sie war viel allein in der großen Wohnung in Prince’s Gate, in der die Hälfte der Räume brachlagen. Ihre Tochter ging auf eine englische Schule, und Wenche blieb mit Anders und dem Au-pair zu Hause. Das Leben in der Großstadt machte sie nervös. Wenche kapselte sich immer mehr in ihrer eigenen Welt ein, wie sie es als kleines Kind oft getan hatte.
Noch vor kurzer Zeit waren sie verliebt gewesen, davon zeugte – daheim in Oslo – eine ganze Schachtel voller Liebesbriefe von ihm.
Und nun lief sie nervös in der riesigen Wohnung umher und bereute alles. Sie machte sich Vorwürfe, dass sie Jens geheiratet und sich durch das Baby an ihn gebunden hatte. Schon länger waren ihr Eigenschaften an ihrem Mann aufgefallen, die sie überhaupt nicht mochte. Er war manchmal sonderbar und unfähig, auf andere einzugehen. Immer wollte er seinen Willen durchsetzen. Ich darf mich nicht an ihn binden, hatte sie schon früh gedacht, aber genau das hatte sie getan.
Bei ihrer Hochzeit war sie schon mehrere Monate schwanger gewesen. Sie hatte die Augen geschlossen und gehofft, dass alles gut enden würde. Schließlich hatte er auch seine guten Seiten, er war freundlich, großzügig und ordentlich. Seine Arbeit schien er gut zu machen, er war viel außer Haus, auf Empfängen und zu anderen offiziellen Anlässen. Sie hoffte, dass ihr Zusammenleben besser werden würde, wenn sie eine echte Familie waren.
In London wurde sie immer unglücklicher. Sie hatte das Gefühl, dass er nur für den äußeren Anschein und ein sauberes Heim eine Ehefrau brauchte, denn das war ihm am wichtigsten. Nicht seine Frau und auch nicht sein Sohn.
Sie fand, er habe sich ihr aufgedrängt. Er hingegen fand sie zu distanziert und meinte, sie sei zu wenig für ihn da. Sie habe ihn ausgenutzt und aus egoistischen Motiven geheiratet.
Im Frühjahr fiel Wenche in eine tiefe Depression, doch sie wollte es nicht wahrhaben und schob es auf die fremde Umgebung. Sie konnte ihren Mann und ihr Dasein nicht mehr ertragen.
Schließlich packte sie die Koffer.
Jens war bestürzt, als sie ihm eröffnete, dass sie die Kinder mit nach Oslo nehmen wolle. Er bat sie zu bleiben, aber es schien leichter, einfach zu gehen.
Also ging sie. Weg von Jens, weg vom Hyde Park, der Themse, dem grauen Wetter, dem Au-pair, dem Hausmädchen, dem privilegierten Leben. Ein halbes Jahr hatte sie es als Frau des Botschaftsrats ausgehalten.
Zurück in Oslo reichte sie die Scheidung ein. Sie war wieder allein, diesmal mit zwei Kindern.
Wenche war ganz auf sich selbst gestellt. Zu ihrer eigenen Familie, die aus der Mutter und zwei Brüdern bestand, hatte sie keinen Kontakt, ebenso wenig zum Vater ihrer Tochter. Er war Schwede, hatte sie kurz nach der Geburt verlassen und seine Tochter nur einmal im Alter von wenigen Monaten gesehen.
»Wie konntest du nur das angenehme Leben in London aufgeben?«, fragte eine ihrer wenigen Freundinnen.
Es habe nicht an London gelegen, antwortete Wenche, sondern an ihrem Mann. Eigensinnig, aufbrausend und aufdringlich – so beschrieb sie ihn. Kalt und lieblos – so beschrieb er sie.
Die Ehe war nicht mehr zu retten. Mithilfe eines Anwalts einigten sie sich: Sie sollte Anders behalten, er würde für ihn Unterhalt zahlen. Zwei Jahre lang durfte sie in seiner Wohnung in der Fritzners gate in Oslo wohnen.
Es sollten drei Jahre vergehen, bis Anders seinen Vater wiedersah.
Wenches Leben war voller Verluste. Und Einsamkeit.
Kragerø, 1945. Der Frieden kam, und die Frau des Bauunternehmers Behring wurde schwanger. Kurz vor der Geburt bekam sie grippeähnliche Symptome. Mit Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen musste sie das Bett hüten. Die Ärzte diagnostizierten Polio, damals eine gefürchtete Krankheit, gegen die es keine Kur gab. 1946 kam Wenche per Kaiserschnitt zur Welt. Ihre Mutter war bereits von der Hüfte hinab und an einem Arm gelähmt. Wenche wurde sofort in ein Kinderheim gebracht, wo sie die ersten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte. Erst als das Heim schloss, schickte man sie zu ihrem Vater.
Dort blieb sie sich selbst überlassen. Baumeister Breivik war viel unterwegs, und die Mutter kapselte sich von der Umwelt ab. Niemand sollte über ihre Verkrüppelung lachen.
Als Wenche acht Jahre alt war, starb ihr Vater. Ihr Heim wurde noch finsterer und die Mutter immer anstrengender. Mit Wenche war »diese Krankheit« gekommen, deshalb war das Kind »böse«.
Das Mädchen hatte zwei ältere Brüder. Einer zog nach dem Tod des Vaters aus, der andere war aggressiv und jähzornig. Er plagte seine Schwester, wo er nur konnte, schlug sie und verprügelte sie mit Brennnesseln. Oft versteckte sie sich hinter dem Ofen, der einzige Ort, wo sie vor ihm sicher war.
Verschleiern und verschweigen. Alles in ihrem Zuhause war mit Scham belegt.
Wenn ihr Bruder schlechte Laune hatte, blieb sie den ganzen Abend draußen. Sie streifte durch das Küstenstädtchen, machte in die Hose und wusste, was ihr blühte, wenn sie heimkam.
Mit zwölf Jahren stand sie auf einer Klippe und überlegte, ob sie sich hinabstürzen sollte.
Aber sie sprang nicht und ging wie immer nach Hause. Das Haus war alt und vernachlässigt, sie hatten kein fließendes Wasser. Nur sie hielt es in Ordnung. Sie räumte auf, putzte und leerte den Nachttopf, der unter dem Bett stand, das sie mit ihrer Mutter teilte. Trotzdem schrie ihre Mutter sie an: »Du taugst zu nichts!«, oder: »Du bist an allem schuld!«
Die Mutter hätte lieber funktionstüchtige Beine gehabt als eine Tochter.
Wenche konnte es ihr nicht recht machten. Sie durfte nie andere Kinder einladen und fand keine Freunde. Die anderen Mädchen ärgerten sie und grenzten sie aus. Die Familie lebte so zurückgezogen, dass sie in der Kleinstadt verrufen war. Die Leute hielten sich von ihnen fern, obwohl manche das kleine Mädchen bemitleideten, das so hart arbeiten musste.
Nachts zog sie das Kissen über den Kopf, um die Geräusche des Hauses nicht zu hören. Am schlimmsten war das Klopfen, wenn die Mutter sich im Haus umherschleppte. Sie stützte den Oberkörper auf zwei Hocker und zog die Beine nach. Jedes Mal, wenn sie einen Hocker fortbewegte, knallten die Stuhlbeine auf die Dielen, gefolgt von einem unheimlichen Schleifen.
Wenche lag wach und hoffte, dass ihre Mutter sie eines Tages lieben würde.
Aber die Mutter wurde immer hilfloser und der Bruder immer brutaler. Als Teenager erfuhr sie zufällig, dass er nur ihr Halbbruder war. Niemand kannte seinen echten Vater. Ein außereheliches Kind war damals eine große Schande in der kleinen Stadt, weshalb auch dies verschwiegen wurde. Ebenso wenig wusste Wenche, dass ihr zweiter Bruder aus der ersten Ehe ihres Vaters stammte.
Die Mutter klagte über fremde Stimmen in ihrem Kopf. Als ein neuer Hausfreund auftauchte, beschuldigte sie Wenche, sie wolle ihn ihr wegnehmen. Trotzdem erwartete sie, dass ihre Tochter sie für den Rest ihres Lebens pflegen würde.
Mit siebzehn packte Wenche ihre Sachen und brannte nach Oslo durch. Das war 1963. Sie hatte keine Ausbildung und kannte niemanden in der Stadt, doch schließlich bekam sie einen Job als Putzhilfe. Später arbeitete sie als Au-pair in Kopenhagen und Straßburg. Nach fünf Jahren der »Flucht« machte sie eine Kurzausbildung zur Krankenpflegehelferin in Porsgrunn, das nur eine Stunde von Kragerø entfernt liegt, und bekam eine Stelle im benachbarten Skien. Dort fand sie zu ihrer großen Überraschung heraus, dass die Menschen sie mochten. An ihrem Arbeitsplatz war sie respektiert und geschätzt.
Ihre Kollegen beschrieben sie als klug, flink und fürsorglich, ja sogar fröhlich.
Mit sechsundzwanzig wurde sie schwanger. Der schwedische Vater forderte sie auf, das Kind abtreiben zu lassen, aber sie bestand darauf, es zu behalten. 1973 kam ihre Tochter Elisabeth zur Welt.
Erst viele Jahre später besuchte Wenche zum ersten Mal wieder ihre Heimatstadt. Ihre Mutter war inzwischen ernsthaft psychisch krank. Sie litt unter paranoiden Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn und Halluzinationen. Sie verließ ihr Bett nicht mehr und starb einsam in einem Pflegeheim in Kragerø. Wenche ging nicht zur Beerdigung.
Die Kunst, alles Schmerzhafte oder Hässliche zu verdrängen, war ihr ins Blut übergegangen. Sie versteckte ihren Schmerz unter einer polierten Oberfläche. Sie wohnte nur in den hübschen Wohnvierteln Oslos, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnte. Wenche war selbst hübsch, das war ihre schimmernde Fassade. Sie war stets wohlgepflegt und frisch frisiert, trug hochhackige Schuhe und enge Kleider aus den feinen Boutiquen der Hauptstadt.
Nach der Rückkehr aus London zerbröckelte ihre Welt Stück für Stück. Sie war Mitte dreißig, wohnte in Jens’ Wohnung in der Fritzners gate, kannte aber kaum Menschen, die ihr helfen konnten. Zuerst war sie nur müde, dann gebrochen. Sie fühlte sich machtlos und ausgestoßen.
Irgendetwas stimmte nicht mit Anders, stellte sie fest. Er war ein ruhiges Baby und ein eher stiller Einjähriger gewesen, aber in letzter Zeit klammerte er sehr und weinte viel. Er war launisch und neigte zu Wutausbrüchen. Am liebsten wäre sie ihn losgeworden, klagte sie.
Während der Nachtschichten ließ sie ihre Kinder allein. Als eine Nachbarin, die eine Tochter im selben Alter wie Elisabeth hatte, sie darauf ansprach, antwortete sie: »Sie schlafen, wenn ich gehe, und sie schlafen, wenn ich heimkomme.« Sie könne keine einzige Nachtschicht ablehnen, fügte sie hinzu.
»Bei Elisabeth gibt es nie Abendessen«, hatte die Nachbarstochter erzählt. In Wenches Familie wurde an allem gespart, was man von außen nicht sehen konnte.
Seit August 1980 bezog Wenche Sozialhilfe über das Sozialamt Vika. Ein Jahr später rief sie dort an und fragte, ob es möglich sei, eine Hilfskraft oder Tagesmutter für die Kinder zu bekommen. Im Juli 1981 beantragte sie einen Wochenend-Pflegeplatz für beide Kinder. Sie wünsche sich einen männlichen Ansprechpartner für ihre Tochter, schrieb sie, vielleicht einen jungen Studenten. Doch vor allem brauche sie unbedingt Hilfe bei Anders’ Erziehung, fügte sie hinzu. Sie komme nicht mehr mit ihm zurecht.
Anders war damals zwei Jahre alt, Elisabeth acht. Die große Schwester war längst zur Ersatzmutter für ihren Bruder geworden.
Im Oktober 1981 bewilligte das Jugendamt, Anders an zwei Wochenenden im Monat in eine Pflegefamilie zu schicken. Er landete bei einem jungen, frisch verheirateten Paar. Als Wenche ihn zum ersten Mal dorthin brachte, fanden sie die Mutter »etwas komisch«, beim zweiten Mal hielten sie sie sogar für verrückt. Sie hatte den Pflegevater gefragt, ob Anders seinen Penis anfassen dürfe, da dies wichtig für die Sexualität des Jungen sei. Er habe keine Vaterfigur im Leben, und diese Rolle solle der junge Mann übernehmen. Anders könne sich körperlich mit keinem in der Familie identifizieren, weil er »nur Muschis« sehe und nicht wisse, wie ein männlicher Körper funktioniere.
Das junge Paar war sprachlos. Der Vorfall war ihnen zu peinlich, um ihn der Behörde zu melden. Sie nahmen Anders auf Ausflüge in Wald und Natur mit, gingen mit ihm in die Parks und auf die Spielplätze der Stadt. Anders fühlte sich wohl bei ihnen, und sie fanden, er sei ein normaler, prächtiger Junge.
An einem Wochenende kam Wenche nicht. Es sei kein passendes Heim für Anders, hatte sie entschieden. »Mutter schwer zufriedenzustellen, verlangt immer mehr«, lautet ein Vermerk in der Akte von 1982. Und: »Die neunjährige Tochter macht seit Kurzem in die Hose.«
Einen Monat zuvor hatte Wenche sich beim Jugendamt erkundigt, ob sie beide Kinder zur Adoption freigeben könne. Sie wünsche die Kinder zum Teufel, hatte sie gesagt.
Der Herbst kam, und ihr Leben wurde noch dunkler. Im Oktober sprach Wenche beim Ärztezentrum in Frogner vor. »Mutter wirkt sehr deprimiert«, notierten die Ärzte. »Überlegt, ihre Kinder zu verlassen, um ihr eigenes Leben zu leben.«
Die zwei Jahre in der Fritzners gate waren inzwischen verstrichen, und Jens forderte seine Wohnung zurück. Aber Wenche zögerte den Auszug hinaus, denn ihr fehlte die Kraft.
Ein Nervenwrack, so beschrieb sie sich selbst. An Weihnachten hatte sie den Tiefpunkt erreicht, an Festtagsstimmung war nicht zu denken.
Den kleinen Anders konnte sie keinen Moment aus den Augen lassen, um kleine Katastrophen zu vermeiden, wie sie es ausdrückte. Manchmal schlug er nicht nur seine Schwester, sondern auch sie. Wenn sie ihn maßregelte, grinste er nur. Wenn sie ihn schüttelte, rief er nur: »Tut gar nicht weh, tut gar nicht weh!«
Er ließ sie nie in Frieden. Nachts lag er in ihrem Bett und drückte sich fest an sie. »Er war total aufdringlich«, sagte sie.
Lichtstreifen
Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
(1. Korinther 13.13)
Die Dunkelheit hatte sich über den Norden des Landes gelegt.
Es war pechschwarze Nacht, wenn die Menschen aufwachten, dunkel, wenn sie aus dem Haus gingen, dämmerig gegen Mittag und längst wieder schwarz, wenn sie zu Bett gingen. Die Kälte brannte auf den Wangen. Alle hatten einen großen Holzvorrat angelegt und schlossen die Türen schnell hinter sich, damit der Schneesturm draußen blieb.
Die Bären hatten sich in ihre Höhlen verzogen, sogar der Dorsch im Meer war träger als sonst. Wie die Tiere sparten auch die Menschen ihre Kräfte für den Frühling, das Licht. Auch sie machten Winterschlaf, ruhten viel und bewegten sich wenig. Die Glücklichen wärmten einander, doch die meisten waren trauriger als im Sommer.
Aber manchmal flammte der dunkle Himmel bunt auf.
»Sie will tanzen«, sagten die Leute und schauten aus dem Fenster.
Denn Aurora Borealis, das Nordlicht, steht nie still. In Bögen und Bändern flackert es am Himmel, entfernt sich und verschwindet ganz, nur um woanders wieder aufzuleuchten. Das Nordlicht ist unberechenbar.
Genauso unberechenbar wie die Menschen, die darunter leben. An einem Tag liegen sie melancholisch im Bett, am nächsten flammen sie plötzlich auf. Dann machen sie sich fein und gehen aus. Sie flackern wie das Naturphänomen am nördlichen Himmel.
Am 13. Dezember 1980, dem Tag der heiligen Lucia, gab es eine solche Nacht in der Fjordgemeinde Lavangen.
In engen Schlaghosen tummelten sich die Jugendlichen auf der Tanzfläche. Die Mädchen trugen anliegende Tops mit Puffärmeln, die Jungen Hemden mit langen Kragen. Auf der Bühne spielte eine Coverband Hits von Smokie, Elton John und Boney M. Aus allen Dörfern des verzweigten Fjords waren die Teenager zum jährlichen Vorweihnachtsfest gekommen, manche mit großen Hoffnungen, manche nur, um sich zu betrinken und Spaß zu haben.
Tone, eine fünfzehnjährige blonde Schönheit mit noch etwas Babyspeck, betrat den Saal. Sie hatte ihre Haare mit dem Lockenstab aus der Stirn gezwungen, genau wie die Blonde in Drei Engel für Charlie. Gleich darauf kam Gunnar, ein achtzehnjähriger Rabauke, schlank und sehnig, mit Vokuhila-Frisur.
Als sie einander im Halbdunkeln entdeckten, dachten beide: keine Chance.
Jeder der beiden wohnte an einem anderen Fjord, sie in Lavangen, er in Salangen. Tone hatte ihn schon einmal gesehen, denn sie musste immer nach Salangen zum Zahnarzt, weil es in Lavangen keinen gab. Hinterher ging sie meistens in die Bäckerei, denn auch die gab es nicht in ihrem Dorf. Als sie dort am Fenster gestanden und auf ihr Plundergebäck gewartet hatte, waren draußen drei Jungen vorbeigegangen. Der Mittlere war ihr sofort aufgefallen.
Das ist der hübscheste Junge, den ich je gesehen habe, hatte sie gedacht.
Und nun stand er vor ihr, während die Band die Bellamy Brothers spielte:
If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?
If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight?2
Natürlich sagte sie Ja, als er sie aufforderte.
Sie trafen sich so oft wie möglich, nahmen den Bus oder ließen sich von Freunden fahren. Ein Weg dauerte eine Stunde, aber als Gunnar den Führerschein machte, wurde es leichter: Er lieh sich das Auto seines Vaters und raste zu ihr. Ende Januar feierten sie den Tag, an dem die Sonne zum ersten Mal wieder über den Horizont stieg. Im April leistete Gunnar seinen Militärdienst weit weg im Süden, bei Lillehammer. Tone schickte ihm lange Liebesbriefe, Gunnar schrieb Gedichte für sie. Zumindest versuchte er es, denn die meisten seiner hellblauen Briefbögen landeten zusammengeknüllt im Papierkorb.
»Irgendwo zu Hause stand ein Liebespaar, er würde nie vergessen, wie verliebt er war.
Die Liebe ihres Lebens haben sie gefunden, niemals wird er von Dir gehn, selbst in harten Stunden.
Das Paar, von dem ich schreibe, das sind Du und ich, Du bist das Liebste, was ich hab, komm und tröste mich.«
Tone ging auf die Heimvolkshochschule in Harstad, wenige Stunden von Lavangen entfernt.
»Gestern habe ich den ganzen Tag geweint«, schrieb sie. »Eine Freundin kam auf mein Zimmer und fragte, was los sei. Ich konnte nichts sagen und zeigte ihr ein Bild von Dir. Da verstand sie sofort. Ich vermisse Dich wahnsinnig. Übrigens war ich ziemlich erleichtert, als ich am Sonntag meine Tage bekam.«
Jede Woche zur verabredeten Zeit bewachte sie die Telefonkabine, damit niemand anders sie benutzte, wenn Gunnar tausend Kilometer entfernt seine Kronen in das Münztelefon der Kaserne warf und sie anrief.
Als Gunnar den Militärdienst absolviert hatte, studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Tromsø. Er war nun fast zwanzig und spezialisierte sich auf das neue Unterrichtsfach Informatik, dazu noch Sport, falls das neue Fach sich doch nicht als zukunftsträchtig erweisen sollte.
Tone zog mit ihm in die Stadt. Sie war inzwischen siebzehn und im letzten Schuljahr der Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Endlich wohnten sie zusammen, wenn auch nur in einem winzigen Zimmer.
»Es war wie ein Sechser im Lotto«, würde Gunnar später einmal sagen. »Das pure Glück.«
Es gab keine Bessere als sie.
In der Dunkelzeit versteckten sie sich unter der Decke und kamen nur hervor, wenn die Nordlichter tanzten.
Schon als Teenager träumten sie von den Kindern, die sie einmal haben würden.
Ein Land in Veränderung
Der amtierende Ministerpräsident litt unter Migräne. Der Arzt hatte ihm eine Pause verordnet, um neue Kraft zu schöpfen, doch das lehnte der bescheidene Mann ab. In seiner Familie war Arbeit heilig, man trieb keinen Müßiggang. Dass die Krankheit ihn manchmal geradezu lähmte, verriet er nur wenigen.
Seit Mitte der Siebzigerjahre waren die Öleinnahmen Norwegens vehement gestiegen, und Odvar Nordli war der erste Ministerpräsident, der die Möglichkeit hatte, dieses Geld gezielt einzusetzen. In seiner langen politischen Karriere baute er den Wohlfahrtsstaat und das Gesundheitswesen großzügig aus. Während seiner Zeit als Regierungschef (1976–1981) konsolidierten die Gewerkschaften ihre Macht, die Löhne stiegen und die Bevölkerung bekam mehr Freizeit, um das Geld auszugeben. Ferner erhielten alle Arbeitnehmer das Recht auf volle Lohnfortzahlung vom ersten Krankheitstag an.
Gleichzeitig stagnierte die Weltwirtschaft, und Norwegen reagierte mit einer eigenen Konjunkturpolitik auf die Flaute: Löhne und Preise wurden eingefroren, um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Nordli war der letzte Ministerpräsident, der uneingeschränkt an die staatliche Kontrolle der Wirtschaft glaubte. Er wollte den Zins- und Wohnmarkt sowie das Finanzwesen weiterhin politisch regulieren. Doch aus Großbritannien und den USA wehte ein starker Wind von rechts, dem Nordli nicht standhalten konnte.
Seit 1935 hatte die sozialdemokratische Arbeiderpartiet (AP) das Land fast ununterbrochen regiert. Der politische Stimmungswechsel fiel mit Intrigen innerhalb der Parteiführung zusammen, und die Stimmen gegen Nordli wurden immer lauter. Im Januar 1981 gab das Pressebüro der Partei die Meldung heraus, Odvar Nordli wolle zurücktreten. Der alte Ministerpräsident war nicht daran beteiligt gewesen und wollte dementieren, doch der Stein war bereits ins Rollen gebracht worden, der Coup lief. Nordli war als freundlicher Mann bekannt und seiner Partei zu treu, um ihr öffentlich zu widersprechen. Zähneknirschend steckte er die Niederlage ein.
Das Land wartete gespannt. Wer würde auf Nordli folgen?
Diese Frage sollte das Koordinationskomitee der Partei lösen, das aus fünf mächtigen Männern und einer Frau bestand. Sie trafen sich im Haus von Nordlis Vorgänger Trygve Bratteli.
Odvar Nordli wollte wenigstens mitreden und schlug den Parteiveteranen Rolf Hansen vor. Der Sechzigjährige lehnte jedoch ab und zeigte auf die einzige Frau im Raum, Gro Harlem Brundtland, eine junge Ärztin und Vorkämpferin für selbstbestimmte Abtreibung. Damit traf er den Nerv der Zeit, denn an der Parteibasis gab es viele, die sie sich als neue Vorsitzende wünschten.
Drei Tage später, am 4. Februar 1981, stand sie vor dem königlichen Schloss und lächelte in die Kameras, nachdem sie dem König ihr neues Kabinett vorgestellt hatte. Es war männlich dominiert, weil sie die meisten Minister von ihrem Vorgänger übernommen hatte.
Dennoch bahnte sich an jenem Tag eine neue Zeit an. Gro, wie sie bald alle nannten, war der erste weibliche Regierungschef Norwegens und die erste Ministerpräsidentin der AP mit akademischem Hintergrund. Als Tochter des Staatsrats Gudmund Harlem war sie in die politische Elite quasi hineingeboren.
Bis dahin waren alle Ministerpräsidenten der AP aus der Arbeiterklasse gekommen. Einar Gerhardsen, der Vater des norwegischen Sozialstaates, hatte schon im Alter von zehn Jahren als Botenjunge gearbeitet. Ähnlich verhielt es sich mit Oscar Torp, der Gerhardsen vorübergehend im Amt ersetzte, und Bratteli, der Bauarbeiter und Walfänger gewesen war. Nordli, der Sohn eines Gleisbauers, war der Erste, der mehr als sieben Jahre Volksschule absolviert hatte. Er war Rechnungsprüfer.
Tief in der Arbeiterklasse verwurzelt, kämpfte die AP gegen Klassenbarrieren und für Chancengleichheit.
Doch auf einem Gebiet war das Ideal der Gleichheit weniger stark: An der Macht waren nach wie vor die Männer. Sie hatten die Chefposten in der Partei, den Gewerkschaften und der Regierung inne, und ihr Wort galt in den inneren Kreisen der Macht.
Die Frauenbewegung der Siebzigerjahre hatte den Weg für Gro Harlem Brundtland geebnet. Sie stammte aus einer Familie, in der Männer und Frauen sich die häuslichen Pflichten wie selbstverständlich teilten, und betrat die politische Bühne mit großem Selbstvertrauen.
Entsprechend heftig verlief die Kampagne, die im Wahlkampf gegen sie geführt wurde. Ihre Gegner beriefen sich gerne auf das, was »andere in der Partei« gesagt hatten. Spitznamen wie »Megäre« oder »Xanthippe« gingen um, auf Autoaufklebern stand »Schmeißt sie raus«. Eine Frau könne kein Land regieren, hieß es. Doch Brundtland blieb stoisch und ließ sich nicht zurück in die Küche schicken.
Die besagten Aufkleber fanden sich besonders häufig auf BMW- und Mercedes-Limousinen, die vor den Villen der westlichen Stadtteile standen. Die Menschen dort hatten es satt, dass die AP scheinbar für immer die Regierung bildete. In diesem Umfeld lebten auch Wenche und ihre Kinder.
Im September 1981 verlor Gro die Wahlen. Zum ersten Mal seit dem Krieg hatten die Konservativen eine Parlamentswahl gewonnen, und in den Villen von Frogner hob man die Gläser. Endlich würden die Steuern gesenkt werden und es würde mehr individuelle Freiheit geben.
Doch die Familie Behring Breivik brauchte die Hilfe des Wohlfahrtsstaates. Wenche hatte das Sozialamt schon mehrfach um Hilfe gebeten, und als alleinerziehende Mutter erhielt sie finanzielle Beihilfe.
Die neue konservative Regierung gab die Zinsen frei und den Banken mehr Handlungsfreiheit. Sie stoppte die Preisregulierungen auf dem Wohnungsmarkt und plante Privatisierungen auf dem öffentlichen Sektor.
Während Gro in die Opposition ging und begann, für ihre Rückkehr zu kämpfen, kämpften Wenche und die Kinder darum, einen Alltag zu überleben, der ihnen wie Treibsand vorkam. Die Mutter empfand ihr damaliges Leben als Hölle. Die Scheidung zog sich hin, sie war in der Schwebe, allein mit der Verantwortung für die Kinder, ohne eigene Wohnung. Der Streit um das Wohnrecht verschärfte sich. Anders wünschte sich einen Ort, an dem er sich sicher fühlen konnte.
Später würde er seinen Hass auf die mächtige Frau seiner Kindheit projizieren. Gro Harlem, die das neue, selbstsichere Norwegen symbolisierte. Das neue Norwegen, in dem junge Frauen bald die Bastionen männlicher Macht stürmen und Führungspositionen einnehmen würden, als wäre es das Natürlichste der Welt.
Silkestrå
»Alle glücklichen Familien sind gleich; jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.«3
Lew Tolstoi, Anna Karenina
Fünf Zimmer für eine dreiköpfige Familie. Viel Platz, hell, modern und brandneu. Ein Zimmer für jeden, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Balkon mit Blick auf den Spielplatz im »blauen Garten«. Die neuen Genossenschaftswohnungen am Frogner Park waren speziell für Familien gebaut. Wie Labyrinthe standen die dreistöckigen Blocks im Grünen, mit geschützten Innenhöfen, kleinen Gärten und bunten Spielplätzen.
Das Viertel trug den verlockenden Namen Silkestrå – »seidener Halm« –, und dank Jens’ Mitgliedschaft in der Baugenossenschaft war Wenche eine der ersten Käuferinnen. Jens bezahlte die Kaution für sie.
Der Auszug aus der Fritzners gate schien ewig zu dauern. Wenche packte ihre Habe in Kartons und warf ihr altes Leben fort. Als sie endlich die Wohnung im Obergeschoss bezogen hatte, atmete sie erleichtert auf. Sie rauchte eine Zigarette auf dem Balkon und genoss die Aussicht auf Bäume und den Himmel – ein echtes Mittelklasse-Idyll. Direkt hinter ihrem Block stand ein kleiner Wald mit seltenen Eichen, Bächen und schmalen Pfaden.
Hier hätte sie sich entspannen und glücklich sein können.
Doch der Umzug und die endlich erfolgte Güterteilung hatten ihr die Kraft geraubt. Von nun an war sie ganz auf sich gestellt. Viele der Wohnungen standen noch leer. Die Kinder stritten und prügelten sich unaufhörlich. Anders hatte nach wie vor Wutausbrüche, seine Schläge taten weh.
Anfang 1983 wandte Wenche sich erneut an das Jugendamt, um eine Pflegefamilie für Anders zu finden. Schon die kleinsten Alltagspflichten überforderten sie, zum Beispiel Anders in den Kindergarten am Vigelandpark zu bringen, der in Laufweite lag, und ihn nachmittags wieder abzuholen. Oft lief er ihr unterwegs einfach davon. Die Erzieherinnen machten sich Sorgen über den Jungen. Er hatte keine Freunde, konnte sich aber auch kaum selbst beschäftigen. Außerdem weinte er nie, wenn er sich wehtat.
»Er klebt an mir wie eine Klette und braucht ständig Aufmerksamkeit«, sagte sie dem Sachbearbeiter. »Auf infame Weise aggressiv«, lautet ein Aktenvermerk.
Sie bestand darauf, den Jungen untersuchen zu lassen. Vielleicht gab es eine Medizin, die ihm helfen würde? Weil er zu Hause ständig an einer Saftflasche nuckelte, befürchtete Wenche, er habe Diabetes. Im Kindergarten jedoch kam Anders ohne die Flasche aus, und auch bei der Pflegefamilie hatte er sie nie angerührt. Sein Blutzuckerspiegel war völlig in Ordnung.
Nach außen hatte Wenche zwei Gesichter. Meist zeigte sie ihr sorgloses Lächeln, aber manchmal war sie irgendwie fern und ging an den Leuten vorbei, ohne zu grüßen, oder schaute absichtlich weg. Wenn sie etwas sagte, klang es affektiert und undeutlich.
Die Nachbarn begannen zu tuscheln. Sie war nicht betrunken, doch nahm sie vielleicht irgendwelche Pillen? Schon bald hatten die Mitbewohner das Gefühl, dass bei Familie Breivik etwas nicht stimmte. Die Kinder waren kaum auf dem Spielplatz und so ängstlich und verschwiegen. Anders nannten sie den »Meccano-Jungen« – nicht, weil er gern mit dem damals beliebten Metallbaukasten spielte, sondern weil er steif und kantig wie eine Figur daraus war. Am meisten sorgten sie sich um seine große Schwester, denn die musste die Mutterrolle für Anders und Wenche übernehmen. Sie hielt das Heim in Ordnung und passte auf ihren Bruder auf.
»Wenche ist nicht ganz normal«, flüsterten die Nachbarn und begannen, sie zu meiden, wenn sie sie im Treppenhaus hörten. »Sie schwatzte einem immer das Ohr ab, und meistens redete sie Unsinn. Sie redete viel über Sex und lachte dabei.« Auch wenn die Kinder dabei waren, hatte Wenche keine Hemmungen, was die Nachbarn schockierte. Meist war es Elisabeth, die sie irgendwie zur Tür hineinzog. »Mama, komm, wir müssen die Tiefkühlkost in die Truhe legen!«
Die Gerüchteküche brodelte. Viele Männer kämen bei Wenche zu Besuch, hieß es. Und Wenche sei jede Nacht unterwegs, obwohl nie jemand eine Großmutter oder einen Babysitter gesehen habe. Einmal bat Wenche einen Nachbarn um Hilfe bei einer Reparatur, und der Nachbar sah keinerlei Anzeichen, dass Kinder in der Wohnung lebten.
Eines Tages bekam Jens Breivik einen Anruf von einem Nachbarn, der sich über den Lärm in Wenches Wohnung beschwerte und andeutete, dass die Kinder viel allein waren.
Jens reagierte nicht. Er hatte ein neues Leben mit einer neuen Frau in Paris.
Eines Morgens hörte eine Nachbarin wieder Lärm in der Wohnung und beschloss nachzusehen. Sie klingelte, worauf Elisabeth die Tür einen Spaltbreit öffnete. »Nein, hier ist alles in Ordnung. Mama schläft gerade«, sagte sie. Unter ihrem dünnen Arm starrte ein Junge mit unbeweglichem Gesicht durch den Türspalt.
Der Respekt der Nachbarin vor dem Privatleben war größer als ihre Sorge um die Kinder. Die Breiviks waren ohnehin auf dem Radar des Jugendamts, weil Wenche selbst schon zweimal dort um Hilfe gebeten hatte. Ihr letzter Besuch hatte den Sachbearbeiter zutiefst beunruhigt. Die Probleme der Familie waren eher ein Fall für den Psychiater als für das Jugendamt, so seine Überzeugung, und er verwies sie an einen Kinder- und Jugendpsychiater. Zwei Wochen vor Anders viertem Geburtstag, im Januar 1983, wurde die ganze Familie zur psychiatrischen Untersuchung bestellt.
Die Ärzte trafen auf eine verwirrte, gehetzte Frau. Sie hatte das psychiatrische Zentrum trotz einer genauen Wegbeschreibung kaum gefunden. Auch später fand sie nicht dorthin, weshalb man ihr den Transport mit dem Taxi bewilligte.
Wenche und die Kinder kamen auf die Familienabteilung der Tagesklinik, wo Psychiater und Spezialpädagogen ihr Zusammenspiel im Alltag, zum Beispiel beim Essen und Spielen, untersuchen und psychologische Tests durchführen sollten.
Anders ging in den Kindergarten der Einrichtung, wo er jede Menge Spielzeug zur Verfügung hatte: Autos, Häuser, Spielfiguren wie Cowboys und Indianer, Puppen, ein Kasperltheater, Stifte, Farben, Schere, Papier und vieles mehr.
Die Fachleute sahen einen Vierjährigen ohne Lebensfreude. Ganz anders als das anstrengende Kind, als das ihn die Mutter beschrieben hatte.
»Extrem unfähig, sich in Spiele einzuleben. Benutzt Spielsachen zögernd und ohne Freude, macht nicht bei den Spielen anderer Kinder mit. Rollenspiele sind ihm völlig fremd. Anders fehlt es an Spontaneität, Bewegungsdrang, Fantasie und Empathie. Auch zeigt er nicht die Stimmungsschwankungen, die bei Kindern seines Alters üblich sind. Er kann seine Gefühle nicht verbal ausdrücken«, lauteten die Notizen des Kinderpsychologen. Beim Kaufladenspielen interessierte ihn nur die Funktion des Kassenapparats.
»Anders braucht auffällig wenig Aufmerksamkeit. Er ist vorsichtig und beherrscht, quengelt wenig und ist extrem ordentlich und sauber. Ohne Letzteres ist er verunsichert. Von sich aus nimmt er keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. Er nimmt mechanisch an Aktivitäten teil, ohne besondere Freude oder Lust zu zeigen. Sieht oft traurig aus. Es fällt ihm schwer, Gefühle auszudrücken, aber wenn er einmal Regungen zeigt, fällt dies heftig aus.«
Wenn jemand etwas von ihm wollte, egal ob Erwachsener oder Kind, verfiel er in hektische Aktivität. Es war eine mechanische Abwehrreaktion, als wolle er sagen: »Nicht stören, ich bin beschäftigt!« Außerdem bemerkte der Kinderpsychologe ein aufgesetztes, abwehrendes Lächeln.
Anders passte sich jedoch schnell an die neue Umgebung an. Nach wenigen Tagen sagte er, es sei »schön«, dorthin zu gehen, und »dumm«, dass er wieder gehen müsse. Er zeigte Freude über Erfolgserlebnisse und nahm Lob an. Die Fachleute kamen zu dem Schluss, dass er nicht unter irreversiblen psychischen Schäden leide. Sein beträchtliches Potenzial könne durch bessere Fürsorge aktiviert werden, wobei sein Zustand allein an seiner häuslichen Situation liege. Er sei zum Sündenbock für die Frustration seiner Mutter gemacht worden, schloss der Report.
Auch Wenche wurde untersucht, und die Psychologen fanden eine Frau vor, die in ihrer eigenen Welt lebte und kaum Beziehungen zur Außenwelt hatte. Menschliche Nähe erfülle sie mit Angst. Ihr Gefühlsleben sei von einer Depression geprägt, die sie abstreite und verdränge, hieß es in der Diagnose: »Die Patientin ist von chaotischen Konflikten bedroht und kann in Stresssituationen nicht logisch denken. Ihr mentaler Zustand liegt nahe an einer Persönlichkeitsstörung. In gut strukturierten Lebenslagen kann sie funktionieren, in Krisensituationen ist sie extrem verletzlich.«
Wenche verhielt sich Anders gegenüber äußerst launisch. In einem Moment konnte sie sanft und nett zu ihm sein, im nächsten schrie sie ihn an. Ihre Abweisung fiel bisweilen brutal aus. Die Ärzte hatten sie schreien hören: »Ich wünschte, du wärst tot!«
Aber auch aus anderen Gründen wurde sie bald zum beliebten Gesprächsthema in der Klinik. Sie kokettierte mit dem Personal.
»Selbst in der Klinik redete sie ungeniert über sexuelle und aggressive Fantasien und Ängste und zeigte ein äußerst zwiespältiges Verhältnis zum männlichen Personal«, schrieb der Psychologe. Aber er notierte auch, dass sie im Lauf ihres Aufenthaltes gefasster wurde.
Nach vier Wochen Beobachtung wurde die Familie nach Hause geschickt, und eine Zusammenarbeit mit dem lokalen Jugendamt und ortsansässigen Psychiatern wurde eingeleitet. Die Schlussfolgerung nach dem Aufenthalt der Familie Behring Breivik lautete, die Familienverhältnisse seien insbesondere für Anders so schädlich, dass man dem Jugendamt die Unterbringung in einer Pflegefamilie empfehle.
»Das Familienleben, vor allem das Verhältnis der Mutter zu Anders, ist vom unstabilen psychischen Zustand der Patientin geprägt. Die Beziehung der beiden ist zwiespältig: Einerseits bindet sie ihn symbiotisch an sich, andererseits weist sie ihn aggressiv ab. Anders wird zum Opfer, weil sie ihre paranoid-aggressive und sexuelle Angst vor Männern auf ihn projiziert. Elisabeth ist als Mädchen weniger davon betroffen. Allerdings steigert die Schwester sich zu sehr in die frühreife Mutterrolle hinein, die sie Anders gegenüber einnimmt.
Anders sollte aus der Familie genommen und in bessere Obhut gegeben werden. Seine Mutter fühlt sich von seiner Anwesenheit provoziert und verweilt in einer ambivalenten Lage, die dem Jungen keinen Raum lässt, sich selbstständig zu entwickeln.«
Mutter und Tochter konnten besser unter einem Dach leben, meinten die Psychologen, doch sie empfahlen, auch ihre Entwicklung kontinuierlich zu beobachten, da sie ebenfalls kaum Freunde hatte und dazu neigte, sich in ihre Fantasie zu flüchten.
In einem Brief ans Jugendamt stand: »Die stark pathologische Beziehung zwischen Anders und seiner Mutter erfordert frühe Maßnahmen, um einer ernsthaften Entwicklungsstörung vorzubeugen. Die Ideallösung für ihn wäre eine stabile Pflegefamilie. Die Mutter wehrt sich jedoch gegen diese Lösung, und ein Entzug des Sorgerechts könnte unvorhersehbare Folgen haben.«
Als ersten Schritt empfahlen die Psychologen, was Anders’ Mutter selbst beantragt hatte, nämlich die Unterbringung in einer Pflegefamilie an Wochenenden. Man solle die Pflegeeltern darauf vorbereiten, dass dies auch zur permanenten Lösung werden könne.
Das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie betonte die Dringlichkeit der Sache und bot Hilfe bei der Suche nach Pflegeeltern an.
Dann geschah etwas, das den Plan durchkreuzte: Jens Breivik bekam den Report des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie, worauf er über seinen Anwalt per einstweiliger Verfügung die sofortige Übertragung des Sorgerechts auf ihn verlangte. Er wollte nicht bis zu einem möglichen Prozess warten. Als Konsequenz daraus weigerte Wenche sich fortan, jegliche Hilfe anzunehmen, obwohl sie diese selbst beantragt hatte. Sie wandte sich an ihren Scheidungsanwalt, der schrieb: »Entlastung in Form einer Pflegefamilie ist eine Lösung, die meine Klientin strikt ablehnt. Im Übrigen besteht seit längerer Zeit kein Bedarf mehr für die Entlastung meiner Klientin.«
Dem Jugendamt blieb nichts anderes übrig, als das Ergebnis des Prozesses abzuwarten. Im Oktober 1983 urteilte das Amtsgericht Oslo, dass Anders’ Situation keine sofortigen Maßnahmen erfordere und dass der Junge bis zur Hauptverhandlung bei seiner Mutter leben könne.
Jens Breivik verstand dies als Vorentscheidung. Er glaubte, das Gericht sehe keine Vernachlässigung des Jungen von Wenches Seite, und rechnete sich wenig Chancen aus, das Sorgerecht für Anders auf gerichtlichem Wege zu erlangen. Tatsächlich war es in den frühen Achtzigerjahren noch die Ausnahme, dass Väter Sorgerechtsprozesse gewannen.
Er hatte seinen Sohn seit drei Jahren nicht gesehen. Nun ließ er über seinen Anwalt mitteilen, dass er nicht klagen wolle. Seine neue Frau und er hätten Anders ein Heim bieten wollen, als er sich in der Krise befand. Es sei jedoch nie ihre Absicht gewesen, vor Gericht um den Jungen zu kämpfen.
Doch der junge Psychologe, der Anders untersucht hatte, wollte den Fall nicht einfach aufgeben. Einen Monat nach dem Beschluss des Gerichts forderte Arild Gjertsen das Jugendamt auf, Wenche das Sorgerecht zu entziehen und Anders in eine Pflegefamilie zu geben. Er schrieb: »Wir betrachten Anders’ familiäre Situation nach wie vor als so prekär, dass er eine ernsthafte Psychopathie entwickeln könnte, wenn sich nichts ändert, und wiederholen hiermit die Aufforderung, seine Pflegesituation zu verbessern. Dies sehen wir nach Paragraph 12, bzw. Paragraph 16a des Jugendhilferechts als unsere Pflicht an. Nachdem der Vater die Sorgerechtsklage zurückgezogen hat, steht das Jugendamt in der Pflicht.«
Im November desselben Jahres warf Wenches Anwalt dem behandelnden Psychologen »monomanische Verfolgungswut« vor.
»Ich gebe zu, dass ich kein Psychologe bin«, schrieb er, »aber im Lauf meiner dreißigjährigen Berufspraxis habe ich das erworben, was dem jungen Gjertsen offenbar fehlt, nämlich eingehende Menschenkenntnis. Aus diesem Grund kann ich getrost behaupten: Wenn Wenche Behring nicht in der Lage sein soll, sich ohne Einmischung des Jugendamts um den kleinen Anders zu kümmern, so gibt es in diesem Land wenige bis gar keine Mütter, die ihre Kinder selbstständig großziehen können.«
Da das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine ausschließlich beratende Funktion einnahm, war nur das Jugendamt zum Eingreifen bemächtigt.
Dort wurden die ernsthaften Bedenken der Psychiater gegen eine neue Einschätzung des Kindergartens am Vigelandspark abgewogen. Die Pädagogen bezeichneten Anders als »fröhlichen und glücklichen Jungen«, wobei Jens Breivik behauptete, dieses Urteil stamme von einer Freundin Wenches, die dort arbeitete.
Als der zuständige Ausschuss des Jugendamts Wenche Behring anhörte, erschien sie gut vorbereitet gemeinsam mit ihrem Anwalt. Dieser betonte, dass seine Klientin die kurze Krise nach der schwierigen Scheidung überwunden habe. Der Sachbearbeiter, der den Fall begonnen hatte, arbeitete inzwischen nicht mehr in Vika, und seine Nachfolgerin hatte keine Erfahrung in der Kinderfürsorge. Sie kannte den Fall nur aus den Akten und fühlte sich wie ins kalte Wasser geworfen. Das persönliche Treffen mit der Mutter war ihr sehr unangenehm.
Ein Entzug des Sorgerechts war gesetzlich nur bei schwerwiegenden Gründen wie Misshandlung, Missbrauch oder eindeutiger Vernachlässigung des Kindes möglich, weshalb das Jugendamt einen Kompromiss vorschlug: Anders sollte bei Wenche bleiben, aber die Verhältnisse in der Familie Breivik würden bis auf Weiteres regelmäßig überprüft werden.
Im Winter 1984 wurden drei Kontrollbesuche durchgeführt, zwei davon unangekündigt. Im Rapport des Jugendamts ist Folgendes zu lesen: »Die Mutter wirkt organisiert, ordentlich und kontrolliert. Sie ist ruhig und lässt mit sich über alles reden. Das Mädchen verhält sich ebenfalls ruhig, ist wohlerzogen und zurückhaltend. Anders ist ein sympathischer, entspannter Junge mit einem warmen, einnehmenden Lächeln. Während der Gespräche saß er am Esstisch und spielte mit Knete, Playmobil und anderen Spielzeugen.« Ferner wird vermerkt, dass nicht ein böses Wort zwischen den Familienmitgliedern fiel. Anders sei nie weinerlich oder störrisch gewesen. »Die Mutter bleibt immer gefasst und regt sich nicht auf, wenn es Probleme mit Anders gibt. Sie redet ruhig mit ihm, und Anders hört auf sie.« Die Sozialarbeiter hatten nur einen Einwand: Einmal habe Wenche ihre Kinder zum Pizzaholen geschickt. »Vielleicht sind sie noch zu klein für eine solche Aufgabe, außerdem kann man Pizza kaum als nahrhafte Mahlzeit bezeichnen.«
Der einzige Anlass zur Sorge sei, ob und wie die Mutter mögliche weitere Krisen bewältigen würde, schließt der Bericht, doch dies sei kein ausreichender Grund, ihr das Sorgerecht zu entziehen.
Im Mittsommer 1984, als Anders fünf Jahre alt war, fasste das Jugendamt Oslo einen einstimmigen Beschluss: »Die Bedingungen für einen Entzug des Sorgerechts sind nicht gegeben. Der Fall ist beendet.«
Pisse auf der Treppe
»Dieser kleine Rotzbengel«, dachte die Nachbarin, als sie wieder einmal versucht hatte, Anders einen Gruß zu entlocken. Er reagierte nie, drehte sich einfach um oder wich ihr aus.
»Na gut«, dachte sie und ging weiter.
Wer den Kindern beim Spielen zusah, musste den Jungen bemerkt haben, der fast immer allein blieb. Er stand meistens an der Seite und beobachtete die anderen. Doch die Eltern hatten genug mit ihren eigenen Kindern zu tun. Auf den autofreien Grünflächen zwischen den Blocks von Silkestrå wimmelte es von Kindern.
Eines Tages geschah etwas Neues. Die Stadt Oslo kaufte alle leer stehenden Wohnungen in Silkestrå, um dort Flüchtlingsfamilien Wohnraum zu gewähren, Asylbewerbern aus dem Iran, Eritrea, Chile und Somalia, und schon bald zog ein Duft von Knoblauch, Kurkuma, Piment und Safran aus den offenen Balkontüren durch das Wohnviertel.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!