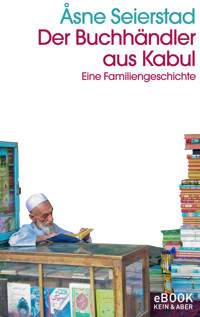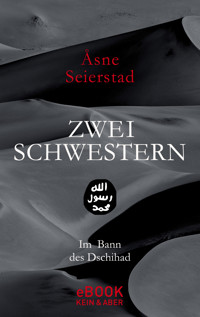18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Drei Menschen zwischen Hoffnung und Resignation, in einem Land des Krieges und der Widersprüche, in dem gleichzeitig normaler Alltag herrscht: Liebe, Schönheit, Dankbarkeit und Freude.
Zwanzig Jahre nach ihrem internationalen Bestseller Der Buchhändler aus Kabul kehrt Åsne Seierstad nach Afghanistan zurück. Sie erzählt die Geschichten derer, die vor den Taliban geflohen sind, und derer, die zurückblieben. Von Jamila, die sich Schul- und Universitätsbesuch erstreitet und als gläubige Muslima für die Rechte der Frauen einsetzt. Von Bashir, der von zu Hause wegläuft, um sich den Taliban anzuschließen und im Heiligen Krieg zu kämpfen. Und von Ariana, die geboren wurde, als westliche Truppen in das Land einmarschierten, nach der Machtübernahme der Taliban
zwangsverheiratet wurde und die Hoffnung nicht aufgibt, mit ihrem Jurastudium die Gesellschaft zu verändern.
Das Buch ist ein intimes Porträt dreier Menschen, die unterschiedliche Wege gehen, ihrerFamilien, Freunde und Bekannten– und die Geschichte eines Landes im Krieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Åsne Seierstad, geboren 1970 in Oslo, arbeitete als Korrespondentin und Kriegsberichterstatterin für verschiedene internationale Zeitungen und ist Autorin mehrerer Sachbücher. Sowohl als Journalistin als auch für ihre weltweiten Bestseller Der Buchhändler aus Kabul (2002) und Einer von uns (2016) wurde sie vielfach ausgezeichnet. Das 2017 ebenfalls bei Kein & Aber erschienene Werk Zwei Schwestern. Im Bann des Dschihad war Norwegens Sachbuch des Jahres. Åsne Seierstad lebt in Oslo.
ÜBER DAS BUCH
Zwanzig Jahre nach ihrem internationalen Bestseller Der Buchhändler aus Kabul kehrt Åsne Seierstad nach Afghanistan zurück. Sie erzählt die Geschichten derer, die vor den Taliban geflohen sind, und derer, die zurückblieben. Von Jamila, die sich Schul- und Universitätsbesuch erstreitet und als gläubige Muslima für die Rechte der Frauen einsetzt. Von Bashir, der von zu Hause wegläuft, um sich den Taliban anzuschließen und im Heiligen Krieg zu kämpfen. Und von Ariana, die geboren wurde, als westliche Truppen in das Land einmarschierten, nach der Machtübernahme der Taliban zwangsverheiratet wurde und die Hoffnung nicht aufgibt, mit ihrem Jurastudium die Gesellschaft zu verändern.
TEIL 1
WILLE
Das Fieber stieg.
Würde sie das Kind verlieren?
Das kleine Mädchen hatte knallrote Wangen. Seine Stirn war klamm, die Augen glänzten.
Der Schamane legte Amulette und Kräuter auf die Brust des Kindes. Er hatte Verse auf kleine Zettel geschrieben, die Bibi Sitara ins Trinkwasser legen sollte. Aber sie durfte sie nicht vorher deuten, sonst würde es nicht wirken. Die Mahnung war überflüssig, denn Bibi Sitara konnte nicht lesen.
Schon die Schwangerschaft war kompliziert gewesen, sie hatte gefühlt, wie ihre Lebenskraft schwand. Auch da war der Schamane bei ihr gewesen. Sie hatte ihn gefragt, ob das Kind gesund sei und leben würde. Er hatte zur Geduld gemahnt. Alles würde gut gehen, wenn sie nur das heilige Wasser trank.
Sie werde ein Mädchen gebären, hatte er gesagt, und es würde der große Stolz der Mutter werden. Jamila sollte es heißen – die Schöne.
Er hatte recht bekommen. Das Kind kam gesund zur Welt und war wirklich hübsch, mit großen, graubraunen Augen, heller Haut und einem herzförmigen Gesicht. Es war die Puppe der großen Schwestern. Sie trugen es überall herum, wiegten und verhätschelten es. Sie wickelten es in ein zerrissenes Laken und verschnürten es so fest mit bestickten Bändern, dass es sich kaum rühren konnte.
Bis das Fieber ihr Spiel beendete. Nun schauten die Schwestern zaghaft durch den Türspalt.
Bibi Sitara fühlte, dass ihr Kind im Sterben lag. In ihrer Not ließ sie einen weiteren heiligen Mann rufen, diesmal einen Mullah aus ihrem Dorf. Er setzte sich neben das kranke Kind und rezitierte bis spät in die Nacht Koranverse. Genau wie der Schamane wurde er großzügig bezahlt.
Nach dem Besuch des Mullahs blieb Bibi bei ihrer Tochter sitzen. Der Schamane hatte ihr damals noch mehr prophezeit, nämlich dass ihr Kind etwas Besonderes werden würde. Bibi Sitara hatte dies verdrängt, sie wollte kein außergewöhnliches Kind. Im Gegenteil, sie wünschte sich eine ganz normale Tochter.
Nach einer Woche ließ das Fieber nach. Die Mutter dankte Gott. Alles kam, wie Er es befahl. Alhamdulillah. Gott sei gepriesen.
Nach einer Weile hatten sie vergessen, dass das Kind je krank gewesen war.
Ihre Schwestern nahmen das Spiel wieder auf. Jamila bekam Kleider, Ketten und Ohrringe. Keiner fragte sich, warum sie nie aufstand, vielleicht lag es daran, dass sie so verwöhnt wurde und alles hatte. Sie kroch nur auf dem Teppich umher oder saß mit Kissen im Rücken da. Wenn sie etwas wollte, robbte sie mit den Armen über den Boden oder wand sich wie eine Schlange.
Eines Tages bemerkte die Mutter, dass das eine Bein Jamilas dünner war als das andere. Das wird sich schon angleichen, dachte sie, doch irgendwie schien das Bein auch kürzer.
Sie hob es an, und es fiel schlaff herab.
Erneut rief sie den Schamanen. Es gab mehr Beschwörungen, Amulette und Verse auf Zetteln, aber es half nichts. Das Bein blieb anders.
Noch immer glaubte die Mutter, Allah habe einen Plan.
Niemand wusste, dass ein Virus das Nervensystem des Mädchens angegriffen hatte. Es hatte den Hirnstamm befallen und Jamilas Rückenmark geschädigt. Die Infektion hatte das Bein zunächst geschwächt und dann gelähmt. Die Krankheit hatte einen Namen – Poliomyelitis.
Jamila wurde 1976 geboren. In Europa war Polio weitgehend ausgerottet, doch in Afghanistan wütete das Virus noch. Es gedieh unter den ärmlichen Verhältnissen und wurde durch schmutziges Wasser, Exkremente und Tröpfcheninfektion übertragen.
Gegen Polio gibt es kein Heilmittel, nur eine Impfung, doch diese Chance hatten Jamilas Eltern nie bekommen. Sie waren nie bei einem Arzt gewesen, bei einem »medizinischen Doktor«, wie Bibi es ausdrückte, im Gegensatz zu einem malang, der mit Zaubersprüchen und Handauflegen kurierte. Die seit vielen Generationen vererbte schamanistische Tradition galt nicht als Widerspruch zur Lehre des Korans. Im Gegenteil, ein malang hatte seine Heilkräfte von Allah.
Auch nach der Entdeckung der Mutter verwöhnten die Schwestern und Cousinen ihr fügsames, puppenhaftes Spielzeug. Das Haus war voller Kinder, denn die Brüder von Jamilas Vater wohnten mit ihren Familien rund um denselben Innenhof. Die Mutter reagierte auf den kleinsten Mucks ihrer Tochter und erfüllte ihr jeden Wunsch, sodass es Jamila an nichts fehlte. Sie wurde zwei, drei, vier und fünf Jahre alt, ohne aufzustehen. Den anderen Kindern krabbelte sie blitzschnell hinterher, doch wenn sie auf die Straße liefen, blieb Jamila daheim. Sie versuchte, das schiefe Bein zu verbergen. Die weiten Hosen, die sie unter dem Kleid trug, waren an den Knien zerschlissen. Die Knie waren ihre Sohlen geworden.
»Ihr solltet sie zu einem Arzt bringen«, sagte eine Tante zu Bibi. Vielleicht gab es ja eine Kur. »Sie wird euch zur Last fallen. Wenn das so weitergeht, wird keiner sie heiraten.« Dass Jamila das Gespräch hörte, kümmerte niemanden. Man ging einfach davon aus, dass eine körperliche Behinderung auch den Kopf und das Denken beeinträchtigte.
»Niemand will eine langak!«, seufzten die Tanten. Ja, Jamila war ein Krüppel und saß nur auf ihrem unbrauchbaren Bein. Bestimmt war dies Gottes Strafe für irgendeine Missetat, eine Buße für die Sünden ihrer Vorfahren. Es gab keinen Zufall, alles fiel auf einen zurück. Gott war gerecht, auch wenn die Strafe viel später kam und willkürlich erschien.
Außerdem gab es Dinge, auf die selbst Gott keinen Einfluss hatte, zum Beispiel die schwarze Magie. Vielleicht hatte jemand Jamila mit einem bösen Blick bedacht, um der Familie zu schaden. Solchen Flüchen konnte nur ein Schamane entgegenwirken.
Kein Arzt solle seine Tochter anrühren, beschloss der Vater. Bis auf Gebete und Beschwörungen sowie etwas Wasser aus der heiligen Quelle in Mekka erfuhr das Bein keine Behandlung.
Als Jamila fünf Jahre alt war, bekam die Frau ihres ältesten Bruders eine Tochter. Eines Tages beobachtete sie, wie ihre Nichte die Arme zur Tischkante hinaufstreckte, sich nach oben zog – und stand. Später versuchte Jamila heimlich, es ihr nachzumachen. Sie griff die Tischplatte, spannte die Armmuskeln an und zog sich langsam hoch.
Und bald geschah es: Sie stützte sich mit den Händen auf den Tisch und stand.
Jamila übte eifrig, die Muskeln ihres gesunden Beines wurden immer stärker, sie hielt die Balance. Schließlich nahm sie die Hände vom Tisch.
Beim nächsten Besuch beobachtete sie, wie die Nichte sich am Tisch festhielt und ein Stückchen vorwärtsbewegte.
Sobald sie allein war, machte sie es nach. Plötzlich stand ihre Mutter in der Tür. Jamila stolperte vor Schreck und fiel hin.
»Das musst du nicht tun!«, rief die Mutter erschrocken. »Ich kann dir alles holen.«
Jamila wuchs in einer Familie auf, in der Mädchen keine Wünsche äußerten. Je passiver sie waren, desto besser. Man solle mit offenen Händen leben, hatte ihr die Mutter eingeprägt. Nie etwas ergreifen oder verlangen. Dann würden die Töchter bekommen, was anderen durch die Finger rann.
Seit Jamila die Welt aufrecht stehend gesehen hatte, wollte sie nicht mehr krabbeln. Lieber hinkte sie auf dem starken Bein und zog das schwache nach. Als ihre Nichte ein Gestell zum Laufenlernen bekam, bettelte Jamila so lange, bis ihre Mutter einen Handwerker beauftragte, das Gleiche für ihre Tochter zu zimmern. Es sah aus wie ein kleiner Rollator aus Holz, war aber nur im Haus zu gebrauchen. Die Außenwelt war für Krüppel tabu.
Jeden Morgen, wenn ihre Brüder die Schuluniform anzogen, sich den Ranzen umhängten und nach draußen stürmten, blieben die Schwestern daheim. Lesen lernen würde sie nur von ihren Pflichten ablenken und auf dumme Gedanken bringen. Bildung war gefährlich. Sie würde nur ihren Wert auf dem Heiratsmarkt vermindern, und darum ging es schließlich bei Töchtern – um den Marktwert.
Die auf traditionelle Weise arrangierte Ehe war eine Transaktion. Bezahlt wurden die Qualitäten eines Mädchens: Alter, Aussehen, Fertigkeiten im Haushalt. Außerdem zählten ihr Clan, die Familie sowie deren Besitz, Ehre, Ansehen und Status. Zusammen machten diese Faktoren den Preis aus, den die Eltern mit der Familie des Freiers aushandelten.
Ibrahim stellte hohe Ansprüche an seine Kinder. Der Marktwert seiner Töchter sollte hoch genug sein, um durch Heiraten wichtige Verbündete zu gewinnen. So hatten es die Clans und Familien seit Jahrhunderten praktiziert.
Deshalb galt es, den Wert der Töchter bis zum heiratsfähigen Alter so weit wie möglich zu steigern. Faktoren wie die Clanzugehörigkeit und den Status der Familie konnte man nicht ändern. Umso wichtiger war es, andere Qualitäten zu optimieren. Unsichtbarkeit bekräftigte die Reinheit der Töchter. Kein Fremder sollte Jamilas Schwestern sehen, kein Mann sollte ihre Stimme hören, keiner ihren Namen kennen. Wenn der Name einer Frau verbreitet wurde, war sie bereits besudelt. Das prägte Jamilas Vater seinen Kindern ein. Wenn Gäste im Haus waren, saßen sie still in ihren Gemächern oder flüsterten miteinander.
Ibrahim war ein strenger und traditionsbewusster Mann. Er stammte aus Gasni, einer ganz von Clans beherrschten Stadt in der Hochebene im Südosten des Landes. In Armut und ohne Schulbildung aufgewachsen, hatte er schon als Kind auf dem gestampften Erdboden ihrer Lehmhütte Leder gegerbt. Als Jugendlicher baute und verkaufte er etwas, was die Menschen immer benötigten: Särge.
Er war ein echter Self-made-Afghane. Auch Kleider wurden immer benötigt, also erweiterte er sein Geschäft. Als Nächstes kamen landwirtschaftliche Werkzeuge und Fahrräder hinzu, dann Motorräder, Autos und schließlich Lastwagen. Sein einträgliches Geschäft nannte er schlicht »Import-Export«. Hinaus mit Wassermelonen, Granatäpfeln und Trauben, herein mit Klimaanlagen, Haartrocknern, Zement und Beton. Er kaufte ganze Geschäfte und große Grundstücke, auf denen er Einkaufszentren errichten wollte. Der arme Junge, der nie richtig Lesen und Schreiben lernte, nutzte die günstige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus, als Afghanistan seine erste Bank, sein erstes Kraftwerk, neue Brücken und bessere Straßen bekam.
Jamilas Eltern zogen von Gasni nach Kabul, wo Ibrahim die Zukunft sah. Er stellte zwei indische Sekretäre ein, die Verträge und Geldangelegenheiten für ihn regelten. König Mohammed Zahir Schah, der seit 1933 regierte, verstand es, die Position des Landes zwischen zwei Supermächten auszunutzen. Beide bauten das Land auf und bewaffneten es. Ein Straßenprojekt wurde an einem Ende der Sowjetunion begonnen und am anderen von den Amerikanern vollendet. Die Sowjets bauten einen modernen Flughafen in Bagram, während die USA Staudämme und Brücken errichteten. Im Hindukusch sprengten sowjetische Ingenieure den höchstgelegenen Tunnel der Welt, der den Süden und Norden Afghanistans verbinden sollte.
Der König hatte hochtrabende Pläne. Er heuerte amerikanische Ingenieure an, um die steinige Wüste der Provinz Helmand in eine Oase zu verwandeln. Dort wollte er eine Modellstadt mit grünen Alleen, Schwimmbädern, Kinos, Tennisplätzen und gemeinsamen Schulen für Jungen und Mädchen errichten, versorgt von den Generatoren der geplanten, riesigen Staudämme. Es begann verheißungsvoll. In »Klein-Amerika«, wie der Ort genannt wurde, bauten die Bauern Baumwolle und Weizen an und bewässerten die Felder mit Wasser aus den Stauseen. Aber die Erdschicht war dünn. Salz drang an die Oberfläche und zerstörte die Ernte. Der Boden verwitterte, und die Investitionen gingen verloren. Nach wenigen Jahren bauten die Bauern lieber Schlafmohn an, und die Wüste eroberte die Oase zurück.
Ibrahim war inzwischen ein einflussreicher Geschäftsmann in Kabul.
Jamila bewunderte ihn aus gebührendem Abstand. Sie wusste, dass sie eine Enttäuschung war. Er konnte sich weder mit ihr schmücken noch stolz auf sie sein. Sie sehnte sich nach seiner Anerkennung, sah ihn aber nur selten. Auf dem Hof standen oft Autos, in denen die Kinder spielen durften, wenn sie vorsichtig waren. Für Jamila gab es nichts Schöneres, als dort am Steuer eines Mercedes, Rolls-Royce oder Ford zu sitzen. Oft spielte und träumte sie den ganzen Tag – bis ihre Brüder aus der Schule kamen und sie vom Fahrersitz verscheuchten.
Manchmal öffnete sie heimlich die Schulranzen der Brüder, während diese draußen spielten. Sie zog die Bücher heraus und sah sich zuerst die Bilder und dann die schönen, fließenden Muster des persischen Alphabets an.
Erschrocken klappte sie die Bücher zu, bevor man sie erwischte. Sie wusste, wie es lief:
Für die Schwestern – verheiratet werden.
Für die Brüder – das Geschäft des Vaters erben.
Für sie – ihr Leben lang bei den Eltern wohnen.
Nach dem Tod ihrer Eltern würden die Brüder für sie verantwortlich sein. Sie war eine Bürde. Keiner konnte sie zu irgendetwas gebrauchen. Je reicher ihr Vater geworden war, desto mehr Personal hatte er eingestellt: Diener, Haushaltshilfen und Gärtner.
Aber wozu war sie gut?
Sie übte nun schon seit einer Weile, ohne Krücken zu gehen. Sie schob ein Bein nach vorn, zog das andere nach und wartete, bis sie stabil stand, ehe sie das erste Bein wieder bewegte. Schritt für Schritt. Man sollte möglichst nicht sehen, dass sie hinkte. Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte – zehn!
Ihre Beine schafften es gerade so, den Körper zu tragen.
Aber sie ging.
Sie konnte gehen!
Jetzt, wo sie auf eigenen Beinen stand, konnte sie nicht mehr warten. Sie wusste, was sie wollte: wie ihre Brüder die Schule besuchen. Hinter all den Mustern und Zeichen, die sie dort lernten, lag eine verborgene Welt, die sie erobern wollte.
Ibrahim schüttelte nur den Kopf.
»Das ist nichts für dich!«
»Lass es mich versuchen!«, bettelte sie.
»Kommt nicht infrage.«
»Bitte!«
Der Vater war keinen Widerspruch gewohnt. Ihre Brüder muckten nie, sie folgten dem Weg, den er für sie bestimmt hatte. Ihre Schwestern hatten nie um etwas gebeten.
Langak! Langak! Krüppel!
Der Vater hatte alle überrascht und schließlich nachgegeben. Jamila durfte mit ihren Brüdern zur Schule gehen.
Der Krüppel!
In Gesellschaft der anderen Kinder gewöhnte sie sich rasch an die Hänseleien.
Den Erwachsenen war es egal. Die Kinder lebten in ihrer eigenen Welt. Keiner hatte ihnen beigebracht, dass man Menschen, die anders waren, nicht verachten sollte. Sie sahen auf Schwächere herab und lachten über Gebrechen. Auf Jamila lastete der böse Blick oder Gottes Strafe, da war es besser, Abstand zu halten. Ihre Brüder verteidigten sie nicht. Im Gegenteil, es war ihnen peinlich, einen Krüppel als Schwester zu haben. Sie baten den Vater, sie von dieser Last zu befreien. Was wollte Jamila schon mit einer Schulbildung anfangen?
Aber der Vater hatte es ihr versprochen. Jamila durfte zur Schule gehen, bis sie Lesen gelernt hatte.
Jamila versuchte, Haltung zu bewahren. Die Bücher, die Stifte, die Lehrer – sie liebte alles an der Schule!
Bald war sie die beste Schülerin der Klasse. Am Ende des Schuljahres brachte sie ein Zeugnis nach Hause, von dem ihre Brüder nur träumen konnten.
»Gut«, sagte der Vater und lächelte. »Jetzt kannst du lesen und schreiben.«
Im nächsten Schuljahr sollte sie zu Hause bleiben und ihrer Mutter im Haushalt helfen. Pflaumen einmachen, Bohnen schälen, Mandeln knacken. Dazu hatte sie keine Lust. Sie wollte in die zweite Klasse.
»Geh mir nicht auf die Nerven«, sagte der Vater.
Jamila hob den Zeigefinger und sah ihn bettelnd an.
»Noch ein Jahr, bitte. Ein einziges Jahr …«
Keiner wusste recht, warum, aber Ibrahim gab nach. Das Resultat waren weitere gute Noten.
Das Spiel wiederholte sich jedes Jahr. Sie hob den Finger und sah ihn an.
Jedes Jahr bekam sie »noch ein einziges Jahr«.
UNRUHEN
Schon vor Jamilas Geburt hatten sich Unruhen im Land ausgebreitet. Mitte der Sechzigerjahre bekam Afghanistan eine neue, progressive Verfassung. Politische Parteien wurden gegründet, die Pressefreiheit verkündet, Behörden stellten Frauen ein, und in staatlichen Institutionen wurde das Tragen der Burka verboten. König Zahir Schah benutzte Wörter wie Demokratie und Gleichberechtigung in seinen Reden.
Die Reformen kamen von oben. Gymnasien wurden gegründet, in denen die Kinder der Oberschicht sich auf ein Studium im Westen oder an technischen Schulen in Moskau vorbereiteten. Die Universität von Kabul zog ein breites Spektrum von Intellektuellen an.
Das Nachtleben der afghanischen Hauptstadt wurde weithin berühmt. Pakistaner machten Wochenendtrips nach Kabul, um Whisky zu trinken, Scheichs kamen aus der Golfregion, um Diskotheken zu besuchen. Rucksackreisende aus dem Westen legten eine Rast auf dem Hippie Trail nach Indien ein, um Opium und Hasch zu rauchen.
Kabul schaute nach Westen. Das Straßenbild, die Mode, ja selbst die Jugendproteste waren von Paris inspiriert. Gleichzeitig konnte nur jeder zehnte Afghane lesen und schreiben. Die Stadt war wie eine Blase. Moderne Frisuren, Miniröcke und Tops gehörten dort zur Wirklichkeit, und doch waren sie eine Illusion.
Stadt und Land waren zwei voneinander getrennte Welten. Während in den Bars der Hauptstadt Jazz erklang, fehlte es in großen Teilen des Landes an sauberem Trinkwasser. Die Menschen hungerten, Kinder starben an einfachen Krankheiten. Das Land war nicht geeint, und bald wurden die Kontraste zum Konflikt.
Gegen Ende der Sechziger eskalierte die Lage. Viele Zeitungen forderten einen Regimewechsel. Afghanische Stalinisten und Trotzkisten bedienten sich der Demokratie, die sie eigentlich abschaffen wollten, und gingen auf die Straße. Die neue Kommunistische Partei spaltete sich unter großem internem Streit auf. Studenten warfen Steine auf Polizisten.
Auf dem Land verbreitete sich eine ganz andere Art der Unruhe. Sie war stiller, ging jedoch viel tiefer, unterstützt von jungen, intellektuellen Islamisten in den Städten. War das, was in Kabul geschah, im Einklang mit dem Islam?
Nein, sagten die Mullahs.
Während die Menschen in Kabul Beatles hörten, lebte die Landbevölkerung weiterhin, wie sie es seit Generationen tat. Sie bauten dieselben Nahrungsmittel wie ihre Vorfahren an – Nüsse, Aprikosen, Karotten – und lebten von der Hand in den Mund. An den Berghängen grasten Schafe und Ziegen.
Der Alltag der Frauen spielte sich hinter hohen Lehmmauern ab. Dort wurden sie geboren, dort starben sie. Nur zweimal im Leben sollte eine Frau ihr Heim verlassen, und zwar jeweils in Weiß: wenn sie frisch verheiratet ins Haus ihres Ehemanns gebracht wurde, und wenn sie im Leichenhemd aus dem Haus getragen wurde.
Der König orientierte sich eher nach Westen. Als die Unruhen ausbrachen, schickte er einen Notruf über den Atlantik, doch die USA hatten genug mit Vietnam zu tun. Deshalb knüpfte der Regent engere Bande zur Sowjetunion, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.
Als Anfang der Siebzigerjahre eine große Dürre dem Land zusetzte und der Monarch nichts tat, um die Not zu lindern, geriet der Thron ins Wanken.
An einem heißen Tag im Juli 1973, während der König bei seinem Augenarzt in Italien war, besetzte sein Cousin das königliche Schloss. Prinz Daoud hatte zehn Jahre zuvor seinen Posten als Ministerpräsident aufgeben müssen, weil die neue Verfassung bestimmte, dass kein Mitglied der Königsfamilie in der Regierung sitzen dürfe. Nun war er zurück.
Der Coup wurde von einer Handvoll Offiziere angeführt und verlief gänzlich ohne Blutvergießen. Daoud schaffte das Königtum ab und gründete eine Republik. Die Marxisten unterstützten seinen Staatsstreich und bekamen mehrere Ministerposten in der neuen Regierung, doch nach und nach wurden alle entlassen. Gleichzeitig unterdrückte der neue Herrscher die Islamisten, die er als Gefahr für sein Regime betrachtete. Die Anführer der muslimischen Bewegung wurden inhaftiert oder flohen nach Pakistan.
Die königliche Administration hatte eine schützende Hand über Jamilas Vater gehalten, aber als der König nach dem Coup nicht aus Italien zurückkehrte, wechselte auch Ibrahim die Seite. Daouds Politik war keineswegs schlecht fürs Geschäft. Ob Monarchie oder Republik, das Land brauchte weiterhin die Dinge, die Ibrahim verkaufte.
Die neue Verfassung von 1979 war in revolutionäre Rhetorik gekleidet, und der neue Präsident veranlasste sowohl Landreformen als auch Verstaatlichungen, aber im Großen und Ganzen fuhr das neue Regime wie früher fort: zentralisierend, autokratisch und unterdrückend. Die Macht lag beim Militär und in der Bürokratie.
Während Ibrahims Geschäft weiter wuchs, wurde die Pressefreiheit massiv eingeschränkt. Die freie Meinungsäußerung verschwand, Dissidenten wurden zum Schweigen gebracht.
Mit den Nachwirkungen des Krieges in Südostasien beschäftigt, kürzten die USA die finanzielle Unterstützung Afghanistans immer mehr. Trotzdem versuchte Daoud, sich dem Einfluss der Sowjets zu entziehen, indem er sich an blockfreie Länder wie Indien, den Iran oder Ägypten wandte. Bei einem Besuch in Moskau sprach Leonid Breschnew dies an. Daoud soll brüsk geantwortet haben, er arbeite zusammen, mit wem er wolle, und ließe sich von keinem etwas diktieren.
Vielleicht hat dieses mutige Statement sein Schicksal mit besiegelt. Auf jeden Fall war der Kreml Drahtzieher, als die afghanischen Marxisten unter der Führung des Dichters Taraki im April 1978 den Präsidentenpalast einnahmen. Nach wenigen Stunden heftiger Kämpfe wurden Daoud und seine gesamte Familie, insgesamt siebenundzwanzig Personen, hingerichtet – ähnlich wie die Bolschewiken sich 1917 der Zarenfamilie entledigt hatten.
Die Massaker hielten an und verbreiteten sich in ganz Afghanistan. Auf dem Land griffen die Kommunisten mit harter Hand durch. Mullahs und deren Anhänger wurden verhaftet, gefoltert und getötet.
Die neue Regierung hielt sich nicht lange. Nach einem Jahr, im September 1971, wurde Taraki in dem Palast erschossen, den er selbst besetzt hatte. Sein Ministerpräsident Amin, den Moskau eigentlich hatte loswerden wollen, übernahm die Macht.
Erst unter Amins Regierung begannen die Schwierigkeiten für Ibrahim. Privates Kapital unterlag fortan strengen Restriktionen, und radikale Landreformen bestimmten, wie viel Land eine Familie maximal besitzen durfte. Alles, was die Norm überstieg, wurde beschlagnahmt. Ibrahim verlor eine Menge Grundbesitz. Amin glaubte, das Volk würde ihn unterstützen, wenn er die Macht der Bürger einschränkte, doch seine Reformen waren weder beliebt noch produktiv. Die Ernte fiel karg aus, und der Mangel an Nahrungsmitteln führte zu Krawallen.
Leonid Breschnew wollte neue Marionetten in der Regierung einsetzen. Er ignorierte die Warnungen seiner Generäle und ließ das südliche Nachbarland besetzen.
Am 25. Dezember 1979 landeten sowjetische Truppen auf dem Flugplatz von Kabul.
Der ursprüngliche Plan des Kreml lautete, ein neues Regime einzusetzen und die Truppen nach einigen Wochen wieder zurückzuziehen. Zuerst sollten sie die Städte besetzen, in denen die Kommunisten am stärksten waren, dann das afghanische Militär mit Munition und Logistik versorgen, damit es den Widerstand auf dem Land brechen konnte. Sowjetische Soldaten sollten nicht direkt an den Kampfhandlungen teilnehmen.
Der Sturz der Regierung gelang schnell. Wie seine Vorgänger wurde Amin im Palast Arg erschossen, nachdem ihn seine russischen Köche bereits vergiftet hatten.
Die Großmacht hatte ein unabhängiges, blockfreies Land okkupiert, den Präsidenten beseitigt und eine Marionettenregierung eingesetzt. Von allen Fehlern, die der alternde Generalsekretär gemacht hatte, war die Invasion Afghanistans der fatalste. Breschnew hatte den Widerstandsgeist der Afghanen unterschätzt. In diesem Land sollte der kalte Krieg heiß werden.
Operation Zyklon lautete der Codename des CIA für die Bewaffnung der afghanischen Widerstandskämpfer. Es war die bis dahin teuerste Operation des amerikanischen Geheimdienstes. Sie wurde 1980 von US-Präsident Jimmy Carter gestartet und sollte bis in Ronald Reagans Regierungszeit fortdauern. Carters Sicherheitsberater hatte gelobt, der Sowjetunion »ihr eigenes Vietnam« zu bescheren.
Ronald Reagan erhöhte sogar das Budget. Als der Sicherheitsberater ihn nach einer Obergrenze fragte, antwortete er: »There are no budgets.«
Die sowjetische Invasion hatte begonnen, als Jamilas Leben sich noch auf einem Teppich im Haus abspielte. Als sie am Fenster zum Hinterhof saß, intensivierten sich die Kampfhandlungen, und als sie zur Schule ging, war Afghanistan zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges zwischen den beiden Supermächten geworden. Noch blieb die Welt der Kinder in Kabul verschont. Die Sowjets beschützten das Regime, in den Straßen der Hauptstadt herrschte Ruhe, und auf den Schulhöfen wurde gespielt. Auf dem Land und in den Bergregionen hingegen schlugen die Raketen ein. Dort wurden Kinder verkrüppelt, Väter getötet und Mütter ihren Familien entrissen.
Nicht, dass die Kinder in Kabul keine Veränderungen bemerkt hätten. Das islamische Glaubensbekenntnis und das Morgengebet in der Schule wurden vom Lehrplan gestrichen, Jungen und Mädchen gingen in gemischte Klassen. Die Mädchen durften kein Kopftuch mehr tragen. Wer sich den Aktivitäten der Kommunisten anschloss, gewann Vorteile und bekam das rote Halstuch der Pioniere. Jamila tat alles, um dies zu vermeiden, es war ihre Art des Protests.
In der Klasse wusste man nicht mehr, wer Freund oder Feind war. Manche Eltern arbeiteten für die sowjetischen Besatzer, andere waren gegen die Ausländer.
Für Jamila führte die Invasion dazu, dass sie zum ersten Mal fühlte, Teil einer größeren Sache zu sein. In einer Februarnacht im ersten Winter der Okkupation sammelte sich das Volk im Namen dessen, der den Widerstand prägen sollte: Allah.
Ein stiller Strom von Menschen trotzte der Sperrstunde und ergoss sich auf die Straßen. Auch auf den flachen Hausdächern standen Tausende Männer. Die Frauen gingen auf die Hinterhöfe und sahen in den Himmel. Für Jamila klang es, als würden sie ein Lied summen. Aber es war kein Lied, sondern ein Gebet. Sie rezitierten. Wie ein Kampfruf gegen die Flugzeuge hoch über ihren Köpfen.
Die ganze Nacht erklangen die Stimmen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gott ist groß, Gott ist größer, Gott ist am größten!
Das kleine, besondere Mädchen richtete sich auf, sah aus dem Fenster und hörte die Lobpreisungen, die zu einem Kanon wurden.
In diesem Moment fühlte sie, dass Gott ihnen zuhörte.
DIE TODESWÜSTE
Du stehst auf, legst Holz im Ofen nach, setzt den Kessel auf. Vielleicht wärmst du Brot von gestern auf – und plötzlich bist du tot. Einer, der nicht weiß, wer du bist, hat einen Angriff befohlen. Eine Bombe trifft dein Dorf vor dem Morgengrauen, glühend heiße Splitter fliegen umher, dringen in die Körper der Menschen ein, durchbohren Herzen, punktieren Lungen. Mehrere Hundert Grad heißes Metall zerschmettert Schädel, reißt Finger oder einen ganzen Arm ab. Alles bleibt stehen, ein Traum, ein Gähnen, ein Gedanke, ein halb ausgesprochenes Wort.
Der Tod kam meistens von oben. Wenn man das Flugzeug oder das Sausen in der Luft hörte, war es schon zu spät. Das Flugzeug warf seine tödliche Last ab. Eine Bombe durchschlug das Zelttuch oder das Dach und traf dich daheim. Ganze Familien, die drinnen Schutz gesucht hatten, verbrannten in ihren Hütten. Kinder, die vor Angst dicht beieinander hinter der Scheune kauerten, verbrannten zu Asche. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, damit die Rebellen sich nicht dort verstecken konnten.
Manche brauchten etwas länger zum Sterben. Wenn die Hauptschlagader deines Beins durchtrennt wird, dauert es zwei Minuten, bis dein Körper weniger Blut hat, als du zum Leben brauchst. Trifft es den Arm, verblutest du in zehn Minuten. Raketen, Bomben und Kugeln machten keinen Unterschied zwischen Leben, die gerade erst begonnen hatten oder in einem Leib heranwuchsen, und Leben, die länger überdauert hatten.
Millionenfach.
Und der Krieg war längst nicht vorbei.
Auch vom Boden kam der Tod. An den Berghängen sowie entlang der Straßen und Flüsse wurden Landminen ausgelegt. Bauern verloren Arme und Beine auf ihren Äckern, Kinder büßten das Augenlicht durch Sprengstoffe ein, die wie Spielzeug aussahen. Die Felder konnten nicht mehr bestellt werden, die Weideflächen lagen brach – nur eines von vielen Kriegsverbrechen.
Der Tod war überall, daran musste man sich gewöhnen.
*
Als Hala ihrem Mann zum ersten Mal in die Augen sah, lag er mit zwei Einschusslöchern in der Stirn auf dem Hof.
Seine Zähne waren zerschmettert, die Glieder steif. Die Brust war mit Kugeln durchlöchert, die Augen weit aufgerissen.
Es fühlte sich an, als würde der Boden unter ihr beben. Als sie ihn hereingetragen hatten, war sie auf den Hof gerannt, ohne sich um die fremden Männer zu kümmern, die um ihn herumstanden. Im Tod war Gott barmherzig, außerdem waren es bestimmt Nachbarn. Das Erdbeben unter Halas Füßen wurde immer stärker. Sie schwankte.
Hala sah ihrem Mann in die toten Augen. Sie vergoss keine einzige Träne. Endlich konnte sie ihn ansehen, ohne sich zu fürchten.
Sie berührte seinen Arm. Er war mit Blut, Dreck und Sand verschmiert, sein Gewand war braun von geronnenem Blut. In ihrer Ehe hatten sie einander nie wirklich in die Augen geschaut. Wenn er sie ansah, schlug sie den Blick nieder, wenn er mit ihr sprach, senkte sie den Kopf. Nur wenn sie ganz sicher war, dass er es nicht bemerkte, sah sie ihn an. Immer wachsam. Und niemals in die Augen.
Zehn Jahre jung war sie gewesen, als sie verheiratet wurde. Wasir war viel älter, dreißig oder sogar vierzig, sie wusste es nicht. Sie mussten mehrere Jahre warten, um Kinder zu bekommen. Sechs Stück waren es geworden. Vier Söhne – Hassan, Yaqub, Raouf und Baschir – und zwei Töchter, deren Namen kein Fremder kannte. Nun waren sie vaterlos. Von nun an hatten sie nur noch sie.
Sie dachte an seine Stimme. Ihr Ehemann hatte jeden Morgen und jeden Abend laut den Koran rezitiert, oft stundenlang. Es war so schön gewesen. Sie hätte so gern gefragt, ob er ihr die Verse lehren könne, aber sie hatte sich nie getraut. Jetzt war es zu spät.
Am Abend zuvor hatte sie das Essen gekocht und ihn daheim empfangen. Es gab Reis und gebratenes Gemüse von ihrem kleinen Ackerstück. Es war Ramadan, und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durfte kein Bissen und kein Schluck den Gaumen passieren. Das Fasten sollte sie reinigen, die Gedanken klären und sie näher zu Gott führen.
Sie hatte ein Tuch auf dem Boden ausgebreitet und die Reisschüssel in die Mitte gestellt. Er hatte das Essen gesegnet, bevor die Familie mit der Mahlzeit begann. Sie klumpten den Reis mit den Fingern zusammen oder stippten ihn mit Fladenbrot und etwas Soße auf. Nach dem Essen ging Wasir zum Abendgebet in die Moschee.
Die Gemeinde, vor der er predigte, war klein. Die meisten Männer aus Mussahi, das aus wenigen Häusern am Ufer eines kleinen Flusses bestand, hatten sich den Mudschahedin angeschlossen. Mudschahid kommt von Dschihad, was »Heiliger Krieg« bedeutet.
Das Dorf war für den Widerstand wichtig geworden, weil es strategisch günstig nur dreißig Kilometer südlich von Kabuls Stadtgrenze lag. Im Osten erhoben sich die Berge, im Westen lagen Felder und dazwischen die Hauptstraße nach Kabul. Ein Stück weiter im Osten lag die Provinz Lugar, die man die »Pforte des Dschihad« nannte. Durch die karge Provinz verliefen wichtige Versorgungslinien, große Mengen Waffen wurden aus Pakistan eingeschmuggelt.
Fast alle Einwohner Mussahis waren auf irgendeine Weise miteinander verwandt oder verschwägert. Der Widerstand beruhte auf dem Netzwerk der Stämme und Clans, sie waren das Dorf.
Mullahs und Schriftgelehrte waren ein wichtiges Rad im Getriebe des Widerstands. Nur wenige Männer im kampffähigen Alter befanden sich noch daheim, die meisten Besucher der Moschee waren Jünglinge oder alte Männer. Trotzdem spielten sie eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Sowjets. Mullah Wasir bekam von den Mudschahedin regelmäßig Listen, und dann schickte er Männer aus, um Proviant, Kleider und Ausrüstung zu besorgen. Hala kochte oft für die Krieger, wenn sie nachts zum Essen aus den Bergen kamen.
Die Dörfer waren die Lebensader des Widerstands, ohne ihre Unterstützung wären die Mudschahedin nicht zurechtgekommen.
Wenige Tage zuvor hatten die Krieger erfolgreich die nächste sowjetische Stellung angegriffen. Allah hatte ihnen beigestanden. Viele Ungläubige waren getötet worden, hatte Hala gehört.
Nachdem ihr Mann zur Moschee gegangen war, stillte Hala das Baby und brachte die anderen Kinder zu Bett. Wenn er nach Hause kam, wollte ihr Mann Tee trinken, deshalb stellte sie den Kessel aufs Feuer. Doch heute ließ er auf sich warten.
Es war Ramadan, ein heiliger Monat, vielleicht war er noch zum Beten in der Moschee geblieben. Das Gebet zur Fastenzeit gab einen besonderen Bonus zum Eintritt ins Paradies, vielleicht würde er die Nacht in der Moschee verbringen.
Sie konnte niemanden fragen, denn nachts durfte Hala das Haus nicht verlassen.
Plötzlich hörte sie Schüsse in der Nähe. Dann war es still. Sie kamen nicht aus der Richtung der Moschee, deshalb machte sie sich keine Sorgen und ging schlafen.
Am nächsten Morgen war er noch immer nicht daheim. Hala wollte draußen Schaftal pflücken, ein spinatähnliches Gemüse, das auf dem Feld vor der Hofmauer wuchs. Sie hatte Teig angesetzt und wollte für ihren Mann Bolani machen, wenn sie bei Sonnenuntergang das Fasten brachen. Dafür musste sie Zwiebeln und Schaftal hacken und kurz in Öl anbraten, dann den Teig in dünne Fladen ausrollen, die grüne Füllung darauf geben, sie mit einem zweiten Fladen bedecken und beide Seiten golden anbraten. Sie sollten frisch und warm serviert werden.
Im Morgengrauen ging Hala hinaus. Sie ließ die Burka hängen, weil es so früh war und sie auf dem Feld so unpraktisch war. Unterwegs erblickte sie eine Gruppe von Männern, verdeckte ihr Gesicht hastig mit dem Kopftuch und wendete es ab. Trotzdem bemerkte sie, dass die Männer sie anstarrten. Das war unerhört, so etwas taten sie nie. Männer sollten ihren Blick im Griff haben, und am allerwenigsten sollten sie ihn auf die Frau eines anderen richten.
Die Männer verstummten. War irgendetwas geschehen?
Sie pflückte rasch ein paar Büschel Schaftal und eilte zurück, ohne die Männer anzusehen.
Sie wussten, was Hala nicht wusste, doch keiner durfte es ihr sagen, denn sie gehörten nicht zur Familie.
Sie ging in die Küche, sah nach, ob genug Zwiebeln da waren, und spülte die Erde von den grünen Büscheln. Dabei lauschte sie, ob ihr Mann nach Hause kam.
Doch es kamen nur Wasirs Brüder.
Die Schergen des Ochsen hatten ihn aus der Moschee geholt.
Wasir war stets vorsichtig in seinen Predigten. Er packte seine Botschaft in Koranverse, denn es konnten immer Denunzianten anwesend sein. Auch die Verräter mussten aufpassen, denn die Dorfbewohner ahnten, wer sie waren. Man kannte die Familien und nahm an, dass sie mit Geld oder guten Stellungen bestochen wurden. Manchmal erschienen sie zum Freitagsgebet, einfach gekleidet wie die anderen, in zerschlissenen grauen, braunen oder dunkelblauen Gewändern mit weiten Hosen darunter. Man musste ihnen nur in die Augen sehen, meinte Wasir, um zu erkennen, dass sie eigentlich weg von Gottes Haus wollten, nach Kabul, in die Großstadt, wo die Straßen asphaltiert waren und es fließendes Wasser in den Häusern gab.
Ob ihn jemand denunziert hatte, wusste man nicht. Die Sicherheitskräfte hatten den Befehl, einige Männer herauszusuchen und Rache für den Angriff vor wenigen Tagen zu üben. Sie nahmen den Mullah und alle, die nach dem Gebet in der Moschee geblieben waren, mit. Ein paar andere wurden aus ihren Häusern geholt. Einer hatte sich geweigert mitzukommen und war auf der Stelle erschossen worden – das waren die Schüsse, die Hala am Abend gehört hatte.
Mullah Wasir und die anderen Männer wurden hinaus in die Wüste gefahren.
Dort wurden sie in einer Reihe aufgestellt, erschossen und liegen gelassen. Die Vergeltung war vollbracht.
Wer als Märtyrer fiel, sollte nicht gewaschen werden. Er sollte vor Gott treten, wie er gestorben war. Einen Sarg gab es nicht, nur ein Laken, in das der Tote gehüllt wurde.
Hala stand stumm da und sah allem zu. Die Erde bebte weiter unter ihren Füßen. Risse bildeten sich, während Wasir dort lag.
Der Mann, vor dem sie sich gefürchtet und geschämt hatte, vor dem sie immer demütig gewesen war. Den sie in sechzehn Jahren Ehe nie gefragt hatte, ob er ihr beibringen könne, den Koran zu lesen. Sie hatte seine Stimme geliebt, die dunkel, ruhig und warm gewesen war.
So wie jetzt hatte sie ihn noch nie gesehen. Ganz offen, ganz friedlich. Sie schämte sich fast. Selbst im Tod hatte er diese Wirkung auf sie.
Sie nannten ihn den »Ochsen«. Der Mann, der den Sicherheitskräften solche Racheaktionen befahl. Präsident Nadschibullah, seit 1986 an der Macht, war in der Tat ein bulliger Mann, trainiert durch Ringen und Gewichtheben. Während seines Medizinstudiums in Kabul in den Siebzigerjahren trat er in die kommunistisch geprägte Demokratische Volkspartei Afghanistans ein. Die Partei spaltete sich in verschiedene Fraktionen auf, die einander in regelmäßigen Abständen hinrichteten. Nach der sowjetischen Invasion 1979 meldete sich der frisch ausgebildete Arzt bei den neuen Machthabern zum Dienst. Der »Ochse« trat in den afghanischen Geheimdienst KHAD ein und stieg dort rasch auf. Sein Talent, Menschen zu foltern und zu ermorden, wurde offenbar höher geschätzt als die Fähigkeit, Menschen zu heilen.
Ein Jahr nach der Invasion wurde er Chef des KHAD, der nach dem Vorbild des sowjetischen KGB brutal gegen jede Art von Widerstand vorging. Zehntausende Islamisten, Gotteskrieger, Kommunisten der falschen Fraktion, Unschuldige und Zufallsopfer verließen das berüchtigte Gefängnis Pul-e-Charki am Stadtrand Kabuls nur noch als Leiche. Der Gewichtheber folterte seine Opfer gern selbst. Seine Spezialität war es, sie zu treten, bis sie als blutiges Bündel sterbend am Boden lagen. Oder er ließ die Rekruten die Gefangenen als Zielscheiben benutzen. Die Folterknechte zogen ihren Opfern langsam die Fingernägel, Haare und Bärte heraus oder schnitten ihnen Körperteile ab, während sie Aussagen über Versorgungswege oder Verstecke aus ihnen herausquetschten.
Wasirs Tod war geradezu barmherzig. Ein paar Schüsse, dann war es vorbei, und eine neue Reise begann.
Zu den Pforten des Himmels. Dorthin war er nun unterwegs.
Märtyrer hatten eine Eintrittskarte für die Dschanna, das Paradies. Dort bekamen sie die besten Plätze, in der Nähe von Gottes Thron.
Das Leben war hart gewesen, aber nun würde Wasir seinen Lohn im Jenseits bekommen. Auf Erden hatte er eine Frau gehabt, im Paradies waren ihm zweiundsiebzig Jungfrauen versprochen. Märtyrer wie er wurden im Himmel gefeiert, so hatte er es selbst gepredigt.
Sechs Kinder schliefen in Wasirs Haus, als die Schüsse fielen. Das jüngste war drei Monate alt.
Sie hatten ihn Baschir genannt, »Der freudige Botschaft bringt«.
Sein Vater wurde noch am selben Tag beerdigt. Bis auf die Kleider und den Koran hatte er nichts Persönliches hinterlassen. Keine Bilder, keine privaten Gegenstände. Hala hatte nur die Kinder. Das Baby wurde ihr großer Trost. Sie ließ sich von dem kleinen Wesen wärmen, das ohne sie nicht auskommen konnte und gierig an ihren Brüsten saugte. Sie wollte das Kind nicht loslassen, denn sie wusste, es würde ihr letztes sein. Sie würde nie wieder heiraten. Lieber würde sie sterben, als ihre Kinder voneinander zu trennen, was bei einer erneuten Heirat geschehen konnte. Ihre Kinder sollten nicht die gleiche entwurzelte und einsame Kindheit erleben wie sie, nachdem ihr Vater gestorben war, als sie zwei Jahre alt war. Halas Mutter war bald darauf mit dem Onkel ihres verstorbenen Mannes verheiratet worden und hatte ihre Kinder weggeben müssen. Sie waren ihrem Halbbruder zugefallen, und dieser Halbonkel verheiratete Hala später im Tausch gegen eine zweite Frau für sich selbst. Zwölftausend Afghani hatte er draufzahlen müssen, denn das junge Mädchen, das er sich als Zweitfrau wünschte, galt als schöner und geschickter und war deshalb mehr wert als die vaterlose Zehnjährige.
Eine Witwe hatte ein gewisses Selbstbestimmungsrecht. Davon wollte sie Gebrauch machen.
Das Haus füllte sich mit weinenden Frauen. Wasirs Mutter, Schwestern, Cousinen und Tanten. Hala selbst vergoss keine einzige Träne. Ihr Mann hätte es nicht gemocht, dass sie weinte, denn wie konnte sie traurig sein, wo er endlich das Martyrium und damit einen Platz an Gottes Seite erlangt hatte.
Der Teig, den sie angesetzt hatte, war aufgegangen, die Bündel Schaftal lagen noch immer in der Küche. Jemand hackte Zwiebeln, streute etwas Salz darauf und briet sie an. Eine Nachbarin half ihr, die Fladen auszurollen, eine andere strich die Füllung darauf und faltete den Teig. Ein angenehmer Duft zog durch die Küche, als die Bolani auf dem Steinofen gebacken wurden.
Die Kinder waren hungrig. Sie bekamen die Portion des Vaters.
Das Leben ging weiter.
EIN GRELLES, WEISSES LICHT
Jamilas Vater spürte es an seiner Geldbörse. Der Krieg zerstörte Straßen, Brücken, Lager für Landmaschinen, Düngemittel und Futter. Im ganzen Land sanken die Einkünfte beträchtlich. Der Transport wurde immer schwieriger, der Handel stagnierte. Ibrahims Geschäft wurde dezimiert. Die zwei indischen Sekretäre, die den Schriftverkehr und die Buchführung für ihn erledigt hatten, verschwanden mit einem ganzen Batzen seines Vermögens.
Das afghanische Heer war ineffektiv, obwohl es vom Kreml finanziert wurde. Säuberungen, Hinrichtungen und Desertionen hatten das Offizierskorps schon vor der Invasion um die Hälfte reduziert. Im ersten Jahr der Besetzung schrumpfte das gesamte Heer auf ein Viertel seiner ehemaligen Größe. Ganze Einheiten meuterten und liefen zu den Mudschahedin über.
Damit begann die Zwangsrekrutierung. Zuerst kam die Einberufung, dann standen die Rekrutierer an der Tür.
Ibrahim und Bibi Sitara machten sich Sorgen um ihre Söhne. Bisher hatten sie es geschafft, den Militärdienst auf Abstand zu halten, aber immer mehr junge Männer wurden einberufen. Die Wehrpflicht begann mit neunzehn Jahren. Nach der Einberufung wurde die Flucht als Desertion bewertet und mit dem Tode bestraft. Nach fünf Jahren Okkupation war der Wehrdienst auf vier Jahre verlängert worden. Nach den Pflichtjahren bekamen die Rekruten Ausbildungsstipendien angeboten, doch das war für Jamilas Brüder keine Option.
Ibrahim steckte in der Klemme. Er musste sich zwischen seinen Söhnen und dem Geld entscheiden. Wenn er die Söhne flüchten ließ, würde er schlecht dastehen. Ausnahmen gab es nur für hohe Parteifunktionäre, Studenten in Ländern des Ostblocks oder durch Bestechung.
Blutsbande wogen schwerer als Banknoten. Ibrahim ließ seinen ältesten Sohn unter dem Vorwand einer Geschäftsreise nach Pakistan fliehen. Er gab ihm genug Geld mit, um dort ein Haus zu kaufen, falls der Rest der Familie nachkommen musste.
Viele seiner Handelspartner hatten das Land verlassen, aber Ibrahim wollte lieber bei seinen Geschäften bleiben. Er hatte sich schon einmal angepasst, vielleicht konnte er sich auch an die Wirtschaft zu Kriegszeiten anpassen.
Doch bald traf es auch seine Familie. Als Erstes kam ein Cousin ins Gefängnis, dann ein Onkel, dann ein weiterer Onkel. Insgesamt sieben Verwandte waren von der Geheimpolizei abgeholt worden. Als er erfuhr, dass man sie hinrichten wollte, musste er etwas tun.
Ein paar ältere Frauen kamen zu Besuch, um Ibrahims Töchter für ihre Söhne, Neffen oder Enkel in Augenschein zu nehmen.
Wie Beutetiere, schnaubte Jamila. Gestriegelt und geschminkt. Die Tiere hatten keine Namen. Die älteste ihrer Schwestern wurde die rote Fee genannt, die zweitälteste die grüne Fee, weil sie einmal in entsprechenden Kleidern auf ein Hochzeitsfest gegangen waren.
Einer der Freier gehörte zur Elite der Kommunisten. Er war der Neffe des Chefs des Nachrichtendienstes. Eine bessere Partie gab es nicht.
Ibrahim benutzte die rote Fee als Einsatz, um seine Verwandten freizubekommen. Tatsächlich wurden sie nach der Verlobung freigelassen. Diese Ehe gab Ibrahim neuen Spielraum.
Jamila war von der Dekadenz der Hochzeitsfeier schockiert. Zwar feierten Frauen und Männer aus Respekt vor Ibrahims konservativer Einstellung getrennt, doch die Zehnjährige machte große Augen, als sie die glitzernden Kleider und tiefen Ausschnitte der weiblichen Gäste sah. Ohne Kopftuch, laut und ungeniert, tanzten die Frauen der Kommunisten auf der Feier. Ihre Sünden würden bestraft werden, da war Jamila sicher.
Die grüne Fee verheiratete der Vater mit einem Geschäftsmann, der gute Beziehungen zum Regime pflegte. Keiner der beiden Ehemänner kam aus Familien, die er respektierte, das wusste Jamila. Als tiefreligiöser Mann hasste Ibrahim die Kommunisten. Sie war enttäuscht. Die zwei Feen, die in ihrer Kindheit mit ihr wie mit einer Puppe gespielt hatten, wurden für höhere Zwecke geopfert.
Doch auch die neu geschlossenen Bündnisse konnten Ibrahim und seine Familie nicht auf ewig beschützen. Als sie neunzehn wurden, schickte er auch seine zweit- und drittältesten Söhne über die Grenze. Auch der vierte und schließlich der fünfte Sohn machten sich auf den Weg nach Pakistan. Ibrahim fürchtete, er würde bestraft werden. Er hatte Männer für weniger in Ungnade fallen sehen.
Der Boden wurde ihm zu heiß unter den Füßen. Nun mussten er, Bibi und Jamila ebenfalls flüchten.
Die Straße nach Pakistan war voller sowjetischer Sperren und deshalb ausgeschlossen. Die Söhne waren den Pfaden der Guerillas über den Chaiber-Pass gefolgt, doch das war für Jamila unmöglich.
Die Eltern beschlossen, sie in Begleitung eines Onkels unter dem Vorwand einer medizinischen Behandlung nach Pakistan zu schicken, und sobald alle Kinder in Sicherheit waren, wollten sie selbst nachkommen. Ibrahim bestellte einen Wagen mit Fahrer, setzte den Onkel auf den Vordersitz und drückte ihm ein ärztliches Attest in die Hand. Jamila kam auf den Rücksitz.
Das Auto verließ rasch Kabul. Sowjetische Ingenieure hatten eine solide Straße nach Dschalalabad gebaut. Eine niedrige Mauer begrenzte den an steilen Abgründen gelegenen Pass, der Chauffeur wich geschickt großen Steinen und Schlaglöchern in der Fahrbahn aus. Zum ersten Mal sah Jamila die Zerstörungen, von denen sie in Kabul verschont geblieben war.
Am Straßenrand standen ausgebrannte Panzerwagen. Militärfahrzeuge überholten sie. Ein entgegenkommender Kampfwagen gab ihnen Lichtsignale. Der Fahrer übersah dies, jedenfalls hielt er nicht an, sondern fuhr weiter auf den gepanzerten Wagen zu. Sie passierten einander. Jamila drehte sich um und sah, wie der schwere Wagen umdrehte. Aus seinem Turm ragte ein schweres Maschinengewehr. Es drehte sich langsam in ihre Richtung, bis der Lauf direkt auf sie zeigte. Jamila starrte in die Mündung.
Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war ein Lichtblitz. Ein grelles, weißes Licht.
Sie wachte auf, weil ihr kalt war. Sie spürte, dass sie nass war, aber sie konnte nichts sehen. Es war dunkel. Sie rieb sich die Augen, die von einer zähen Masse verklebt waren.
Das Auto jagte in wilder Fahrt weiter. Jamila öffnete mühsam ein Auge. Die Heckscheibe war zerborsten, ein paar Splitter hielten noch zusammen und wackelten im Fahrtwind. Überall war Blut. Auf dem Sitz, auf ihr, auf der Lehne des Vordersitzes. Sie versuchte, etwas zu sagen.
Der Fahrer drehte sich um.
»Alhamdulillah, du lebst!«, rief er.
Ein Schmerz durchfuhr ihren Kopf. Sie hob die Hand ans Ohr, wo das Blut bereits gerann.
Sie hörte ein leises Gluckern auf dem Beifahrersitz.
»Baba!«, rief sie.
Doch es kam keine Antwort.
Die Kugel hatte die Heckscheibe durchschlagen und Jamilas Kopf am rechten Ohr gestreift. Dann war sie durch den Beifahrersitz gedrungen und hatte ihren Onkel in den Hinterkopf getroffen. Baba war auf der Stelle tot, das Gluckern kam aus seinem Leichnam.
Der Fahrer war unverletzt. Er hatte sich kurz umgedreht, seine zusammengesunkenen Passagiere gesehen und geglaubt, er fahre zwei Leichen.
Im nächsten Dorf wurde Jamilas Kopf verbunden. Die Leiche ihres Onkels wurde von Verwandten abgeholt. Nach muslimischer Sitte sollte der Tote gewaschen und am selben Tag bestattet werden.
Ein weiteres Leben war durch sowjetische Kugeln ausgelöscht worden, aber sie dankten Gott, dass er das zweite Leben verschont hatte.
DIE BASIS
Als Jamilas Eltern ihre Tochter auf die Reise schickten, war ein Viertel der afghanischen Bevölkerung bereits geflohen. Mehrere Millionen hatten sich nach Westen in den Iran abgesetzt, noch mehr in den Osten oder Süden nach Pakistan. Der Krieg wütete seit acht Jahren. Fast eineinhalb Millionen Afghanen waren ums Leben gekommen, mehrere Millionen verkrüppelt.
Jamila und ihr Onkel wurden zu einem Teil der Statistik. Ein Toter, eine Verletzte.
Ibrahims Familie ließ sich in der schnell wachsenden Grenzstadt Peschawar nieder. Die Ebene rund um die Stadt war ein einziges großes Flüchtlingslager geworden. Dicht an dicht standen Hütten aus Lehm, Steinen, Plastik, Pappe und anderen Materialien. Immer mehr Menschen strömten in das sowieso schon überbevölkerte Land. Pakistan brauchte sie nicht, weder ihre Arbeitskraft noch ihre Gedanken. Sie waren überflüssig.
Das Sterben ging weiter. Die Menschen wurden auf offener Straße hingerichtet. Interne Konflikte wurden mit Bomben ausgetragen. Die Rivalität zwischen den verschiedenen Gruppierungen der Mudschahedin sowie zwischen den Islamisten und der kommunistischen Regierung kostete mehr afghanische Milizionäre das Leben als der eigentliche Krieg. Sie starben durch Meuchelmorde des KGB, des KHAD, des pakistanischen Geheimdiensts oder von der Hand des ewigen Feindes – der »Anderen«.
Gleichzeitig führte der illegale Strom von Geld und Waffen zu einem ökonomischen Aufschwung. Der Drogenhandel florierte. Edelsteine und gestohlene Schätze aus dem Nationalmuseum in Kabul wechselten die Besitzer.
Seit der Flucht nach Pakistan war Jamilas Vater gereizt und aufbrausend. Manchmal packten ihn plötzliche Wutausbrüche. Er hatte viel zurückgelassen in Kabul und fand sich in Peschawar nicht zurecht, dieser brodelnden Gerüchteküche, die zum Herz und Hirn des afghanischen Widerstands gegen die Sowjets geworden war.
Wenigstens blieben der Familie die tägliche Not und die kümmerlichen Verhältnisse der Lager erspart. Sie wohnten in einem Haus, das von Eukalyptusbäumen und Magnolien umgeben war, hinter hohen Mauern und direkt neben dem Hauptquartier von Professor Burhanuddin Rabbani, der nach einem missglückten islamistischen Staatsstreich schon vor der Invasion nach Pakistan geflohen war. Seine kampflustigen Männer dominierten das ganze Viertel, weshalb niemand seine Töchter dort herumlaufen ließ.
Ibrahim schüttelte den Kopf. Es kam gar nicht infrage, dass Jamila dort zur Schule ging.
Ihre Brüder unterstützten ihn. Dass Jamila auf einem Leben außerhalb des Hauses bestand, setzte den guten Namen der Familie aufs Spiel. Ihre Familie war vornehm, sie führte ein unauffälliges, würdevolles Leben und hielt sich aus der Politik und dem Krieg heraus. Keiner von Ibrahims Söhnen schloss sich dem Widerstand an, sie wollten lieber neue Geschäftsverbindungen knüpfen. Die älteren Brüder haderten mit ihrem Schicksal, verurteilten aber gleichzeitig das Familienmitglied, das sich weigerte, sein Schicksal zu akzeptieren: Jamila.
Die Flüchtlinge waren in mehreren Wellen gekommen. Zuerst kamen die Islamisten, die in den Siebzigerjahren in Kabul die Scharia studiert hatten. Nun waren sie die erste Zielgruppe der marxistischen Säuberungen. In den Flüchtlingslagern hatten sie die Deutungshoheit und bestimmten die Richtung des Widerstands. Dann folgten die Mullahs aus den Dörfern, nachdem die Kommunisten begonnen hatten, auch diese zu verhaften. Am Ende folgten Menschen, die einfach nur dem Krieg entkommen wollten.
Der Scharia-Professor von nebenan war der Kopf der größten Mudschahedin-Gruppe, der Dschamiat-i Islami. Die Partei war von Tadschiken dominiert, der zweitgrößten ethnischen Gruppe Afghanistans. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung waren Paschtunen, die Tadschiken machten ein knappes Drittel aus und lebten vor allem im Westen und Norden des Landes. Weitere Ethnien – jeweils rund ein Zehntel der Bevölkerung – waren die Usbeken und Hasara.
Mehrere von Rabbanis Studenten gründeten ihre eigenen Widerstandsgruppen. Mitte der Achtzigerjahre gab es fast zweihundert verschiedene Milizen in der Stadt. Viele betrieben Hilfsarbeit in den Flüchtlingslagern, um möglichst viel vom Strom der Spenden zu profitieren. Es herrschte Chaos. Die finanzielle Unterstützung der Rebellen kam größtenteils vom pakistanischen Geheimdienst, aus der Golfregion sowie von der CIA und ging an die sogenannten »Peschawar Seven«, die sieben größten Widerstandsgruppen. Saudi-Arabien trug mit einer halben Milliarde Dollar pro Jahr zum afghanischen Dschihad bei, womit es fast das Budget der USA übertraf. Die Zusammenarbeit mit dem pakistanischen Präsidenten, dem autoritären Islamisten Zia ul-Haq, führte dazu, dass streng sunnitische Dschihadisten mehr Geld als weniger dogmatische Widerstandsgruppen bekamen.
Nach Peschawar kam auch der ägyptische Arzt Aiman al-Sawahiri, nachdem er für die Mitwirkung an dem tödlichen Attentat auf Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat im Gefängnis gesessen hatte. Der Chirurg operierte verwundete Dschihadisten und war Anführer der Terrororganisation al-Dschihad. Er war pleite und suchte neue Geldquellen.
Ein reicher Saudi namens Osama bin Laden griff ihm unter die Arme. Über seinen Vater, der in Mekka und Medina Moscheen repariert hatte und bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, als er sich eine weitere Teenager-Braut holen wollte, hatte bin Laden direkten Kontakt zur saudischen Königsfamilie und den Ölmilliardären am Golf.
Er betrieb das sogenannte »Dienstleistungsbüro der arabischen Mudschahedin« (Maktab-al-Chadamat) in Peschawar, das Dschihadisten für Afghanistan rekrutierte und dafür jede Menge Öldollars von kuwaitischen Scheichs sowie Goldschmuck von wohlhabenden Frauen aus Dschidda bekam. Der saudische Kronprinz Abdullah stiftete Lastwagen, und Moscheen aus der Golfregion schickten kofferweise Bargeld.
Das »Dienstleistungsbüro« fungierte als Herberge für arabische Krieger und Redaktionssitz der Zeitschrift al-Dschihad. Bin Laden bewahrte das gesammelte Geld in dicken Safes auf. Keine andere Einzelperson brachte so viel Bargeld, so viele Waffen und so viele Kämpfer – die sogenannten »afghanischen Araber« – ins Land.
Osama bin Laden bezahlte den Freiwilligen Flug, Kost und Logis sowie dreihundert Dollar im Monat für jeden, der seine Familie mitbrachte. Obendrein gab es eine militärische Ausbildung, Indoktrination und freien Zugang zu bin Ladens theologischer Bibliothek.
Der CIA-Chef William Casey überzeugte den amerikanischen Kongress, dass die Rebellen die neuesten Ein-Mann-Boden-Luft-Raketen brauchten, um Flugzeuge und Helikopter abzuschießen. Die CIA rüstete die Mudschahedin mit Stinger-Raketen aus, und amerikanisches Personal schulte sie im Gebrauch der Waffen. Nun konnten sie es mit der überwältigenden Lufthoheit der Sowjets aufnehmen – ein entscheidender Faktor für den Wendepunkt des Krieges.
Casey befürwortete es, radikale Muslime aus der ganzen Welt anzuwerben, um die afghanischen Mudschahedin zu unterstützen. Präsident Ronald Reagan nannte sie »Freedom Fighters«. Ende 1987 lud er eine Gruppe Mudschahedin ins Weiße Haus ein und schwärmte von deren Klugheit. In seiner Rede an die Guerillas, die in traditionellen Gewändern im Roosevelt-Zimmer saßen, lobte Reagan die neuen Waffen und die kluge Taktik der Dschihadisten. »Ihr seid eine Nation von Helden. Gott segne euch«, schloss er ab.
Osama bin Laden hielt sich zunächst auf der pakistanischen Seite der Grenze. Er hatte seiner Mutter versprochen, nicht persönlich an Kämpfen teilzunehmen. Erst im Ramadan des fünften Kriegsjahres machte er sich selbst ein Bild von der Lage. Waffen, Infrastruktur, Schützengräben, alles ließ zu wünschen übrig. Bin Laden bat den Allmächtigen um Vergebung. »Es war eine Sünde, der Front fernzubleiben«, sagte er. »Ich hätte nicht auf die anderen hören sollen.« Gott würde ihm nur vergeben, wenn er zum Märtyrer wurde, dachte er, während die Flugzeuge dicht am Boden über ihm flogen und ihre tödliche Fracht abfeuerten. Er glaubte sich gesegnet, als die Raketen »wie schwarze Steine« um ihn herum liegen blieben, ohne zu detonieren. Er fühle sich Gott näher als je zuvor, sagte er zu seinen Gefolgsleuten.
Osama bin Laden und der Palästinenser Abdallah Azzam, Chefideologe des islamischen Dschihad in den Achtzigerjahren, hatten eine Idee zu verkaufen: das Märtyrertum. Sie verbreiteten es über Bücher, Pamphlete und Kassetten, die in Moscheen und Buchhandlungen verteilt wurden. Azzams Zeitschrift al-Dschihad war das i-Tüpfelchen auf dem Todeskult. Von ihm stammt die Forderung, es sei die Pflicht jedes gläubigen Muslims – fard al-ayn –, in den heiligen Krieg zu ziehen, wenn ein muslimisches Land angegriffen werde. Im Namen des Islam wurden junge Männer aus aller Welt rekrutiert, um den gerechten Kampf gegen die gottlose Besatzungsmacht anzutreten. Wenn die Gelehrten einen Krieg als fard definiert hatten, musste man nicht mehr seine Eltern oder den Imam fragen, sondern durfte einfach losziehen. Den Sündigen winkte ein ehrenhafter Tod, den Untätigen ein höherer Zweck. Ein armer Mann würde im Himmel eine juwelenbesetzte Krone tragen, Fleisch, Obst und Wein in Massen genießen, und nicht zuletzt würden ihm die sagenumwobenen Jungfrauen zur Verfügung stehen – keusch wie Perlen in einer Muschel.
Gemeinsam mit dem palästinensischen Ideologen gründete bin Laden die Terrororganisation al-Qaida, was »die Basis« bedeutet. Kurz darauf, im November 1989, wurden Azzam und seine beiden Söhne auf dem Weg zum Freitagsgebet in Peschawar von einer Autobombe getötet. Wer für das Attentat verantwortlich war, wurde nie geklärt – es gab zu viele Feinde.
Die Basis jedoch sollte weltweit bekannt werden.
KURZES SPIEL
Baschirs früheste Kindheitserinnerung war ein kleines Trauma, über das er später lachen sollte: Seine Mutter knöpfte ihr Kleid zu und sagte: »Jetzt bist du groß.«
Von da an gab es keine Milch mehr aus ihrer Brust.
An jenem Tag war Baschir drei Jahre alt. Im Jahr darauf wurde er verlobt.
Seine Cousine Yasamin war gerade ein Jahr alt geworden. Die Verlobung war Halas Werk. Sie wollte ihre Freiheiten als Witwe ausnutzen und ihre Söhne rechtzeitig auf eine gute Bahn leiten. Yasamins Vater, mit dem sie die Verlobung ausgehandelt hatte, war der Bruder ihres verstorbenen Mannes. Hala suchte Ehefrauen für alle ihre Söhne aus, als sie noch klein waren. So konnte sie die potenziellen Bräute aufwachsen sehen und nötigenfalls zurechtweisen. Es ging um Tugend und um Ehre. Darin war sie eine Meisterin.
Wenn man sie fragte, ob sie nicht wieder heiraten wolle, antwortete sie, dass sie lieber Erde essen würde, als einen neuen Mann zu suchen. Und sie meinte es ernst. Vieles hatte sich geändert, seit sie Witwe geworden war. Sie traf ihre eigenen Entscheidungen und erzog die Kinder allein, alles im Rahmen des paschtunwali, des traditionellen Rechts- und Ehrenkodex der Paschtunen, der grundlegende Normen wie Gastfreundschaft, Vergeltung, Ehre, Mut und Loyalität regelte.
Hala war streng zu ihren Kindern, was ebenfalls dem Kodex entsprach. Es gab mehr Prügel als Umarmungen. Sie hatte große Angst, dass ihre Söhne vom Weg abkommen und ihr Schande bringen könnten, zum Beispiel, indem sie Opium rauchten. Dann würden die Leute sagen: »Da gehen die vier vaterlosen Söhne.«
Allerdings konnten die Kinder viele in ihrem Umkreis baba nennen. Sie wuchsen in der Nachbarschaft von Wasirs Brüdern auf, in jedem Nachbarhaus lebte ein Onkel.
Baschir vermisste nie einen Vater – wie sollte er etwas vermissen, das er nie gekannt hatte?
Was Hala anging, gab es weiterhin nur einen Mann, den sie fürchtete. Jedes Mal, wenn der Name ihres verstorbenen Ehemanns genannt wurde, senkte sie den Blick und verbarg ihr Gesicht.
Jahr für Jahr starben mehr Menschen, und die meisten Opfer waren Zivilisten. Das Moskauer Politbüro schmerzte der Prestigeverlust mehr als der Verlust von Menschenleben. Die Invasion war ein Fiasko. Die Sowjetunion steckte in ihrem armen Nachbarland in der Klemme.
Hätte das Politbüro die Kriegsgeschichte vorher besser studiert. Kyros der Große, Dareios I., Alexander der Große – viele Heerführer hatten im Lauf der Jahrtausende versucht, die Afghanen zu erobern, alle trafen auf heftigen Widerstand. Alexander der Große besiegte sie schließlich mithilfe politischer Spaltung, Folter und Hinrichtungen, aber der Preis war hoch. Der Legende zufolge soll der Makedonier an einem Tag genauso viele Krieger verloren haben wie in den vier Jahren, die er brauchte, um die Länder vom Mittelmeer bis Persien zu erobern. Nach dem Tod des Eroberers bekämpften seine Nachfolger sich gegenseitig. Aus dem Schutz ihrer Berge heraus schlugen die Afghanen zurück – was die Sowjets über 2000 Jahre später ebenfalls erfahren sollten.
Erst im dreizehnten Jahrhundert schaffte es ein Eroberer, sich im Land festzubeißen. Dschingis Khan und seine mongolischen Horden hatten schon mehrere Zivilisationen zwischen China und dem Kaspischen Meer verheert. Seine Truppen schlachteten Tausende Afghanen in Kabul, Kandahar und Dschalalabad ab. Nach einem Aufstand in der heutigen Provinz Helmand ließ er alle Männer köpfen, und die Frauen wurden versklavt. Dschingis Khans Erben blieben dreihundert Jahre lang an der Macht, bis auch die Mongolen sich geschlagen geben mussten.
Die Okkupanten waren nie wirkliche Herrscher über die Afghanen geworden. »Wir erdulden innere Konflikte, wir erdulden Angriffe, wir erdulden Blutvergießen«, lautete ein Sprichwort, »aber niemals einen Herrscher.«
Hätte das Politbüro die Karten besser studiert. Schon die Ortsnamen zeugen von Gewalt. Hindukusch bedeutet »Hindu-Mörder«. Das Gebirge ist selbst im Sommer eine Kraftprobe für jeden Eindringling, und im Winter sind alle Pässe unpassierbar. Die schroffe Berglandschaft bietet ideale Bedingungen für Hinterhalte. Nur im Norden und Südwesten Afghanistans gibt es Hochebenen, wo ebenfalls harte Verhältnisse herrschen, was Ortsnamen wie Dascht-e Margo, die »Todeswüste«, veranschaulichen.
Hätte das Politbüro sich mehr um die eigenen Leute gekümmert. Die sowjetischen Soldaten waren schlecht ausgerüstet und nur selten im Gebrauch schwerer Waffen ausgebildet. Schon im ersten Monat der Invasion wurden tausend von ihnen getötet. Die betroffenen Familien standen unter Beobachtung, wenn ihr Junge in einem Sarg nach Hause kam. Öffentliche Trauer um ein Kind, das dem Vaterland geopfert worden war, galt als schädlich für das Kollektiv. Die Eltern riskierten Disziplinarstrafen oder wurden psychiatrischer Behandlung unterzogen.
Es gab keine öffentliche Statistik, keine bekannten Register. Die jungen Männer kehrten einfach nicht mehr heim. Oder sie taten es in zugeschweißten Zinksärgen. Die Eltern durften nicht sehen, was der Krieg aus ihren Kindern gemacht hatte, oder ob es überhaupt ihr Kind war, das in dem Sarg lag. Nach größeren Verlusten wurden sterbliche Überreste, Köpfe, Arme und andere Körperteile willkürlich in die Särge verteilt, bis sie schwer genug für eine Leiche waren.
Auf dem Grabstein durften nur Geburts- und Todesdatum stehen, niemals die Worte Krieg oder Afghanistan.
1986, im Jahr vor Mullah Wasirs Tod, nannte Michail Gorbatschow den Krieg eine »blutende Wunde«. Das waren neue Töne aus der Regierung der Supermacht. Gorbatschows Politik der Glasnost (»Offenheit«) und Perestroika (»Umbau«) stellte die Weichen für einen Rückzug und Frieden. Doch wie sollte der neue Generalsekretär dies ohne Gesichtsverlust bewerkstelligen? Das Marionettenregime in Kabul würde wahrscheinlich fallen und die strategischen Interessen der Sowjetunion geschwächt werden. Schlimmstenfalls würde ein Rückzug in den muslimischen Sowjetrepubliken zu einem verstärkten Nationalbewusstsein und zu Aufständen führen.
Die Sowjets hatten noch immer eine enorme Schlagkraft, bestehend aus mehreren Hunderttausend Soldaten, Spezialkräften und Schwadronen von Kampffliegern. Darüber hinaus gab es private Söldner sowie die eigenen Einsatzkräfte des KGB. Das sowjetische Heer verfügte über eine große Anzahl von Panzern und schweren Fahrzeugen, doch sie steckten in den engen Tälern fest und waren deshalb verwundbar. Die sowjetischen Soldaten nannten die Guerillas dukhi, Gespenster, weil sie plötzlich auftauchten und wieder verschwanden. Eine Taktik der Mudschahedin bestand darin, ganze Gebiete bei einem Angriff zu verlassen, um den Sowjets vorzugaukeln, sie hätten eine Schlacht gewonnen. Dann kamen die dukhi in der Nacht zurück, manchmal Wochen später, wenn die Alarmbereitschaft der Besatzer nachgelassen hatte.
Die Wunde blutete weiter – frisches, junges Blut.
Irgendwann wurde es für die Sowjets teurer zu bleiben, als sich zurückzuziehen. Es gab keine Aussicht auf einen militärischen Sieg.
Gorbatschow rief Präsident Nadschibullah in den Kreml. Die Afghanen sollten lernen, sich selbst zu regieren und eine Politik der nationalen Versöhnung zu führen. Moskau versprach massive Unterstützung, sowohl ökonomisch als auch technisch und militärisch. Ein Jahr nach Wasirs Tod, im April 1988, wurde das Genfer Afghanistan-Abkommen unterzeichnet.