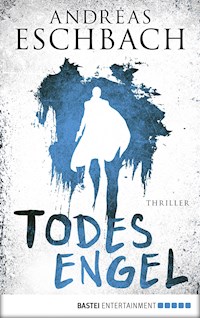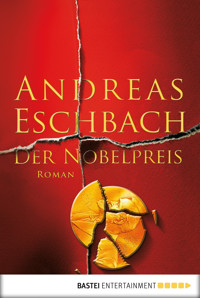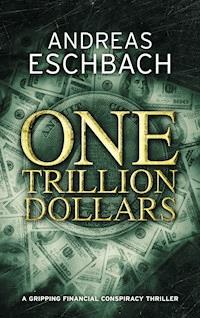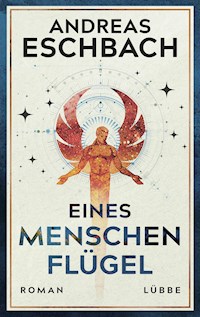
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine ferne Zukunft auf einem fernen, scheinbar paradiesischen Planeten - doch der Schein trügt. Etwas Mörderisches lauert unter der Erde, dessen auch die ersten Siedler nicht Herr wurden. Deswegen haben sie ihre Kinder gentechnisch aufgerüstet, sie mit Flügeln ausgestattet, mit denen sie fliegen können.
Doch nicht nur am Boden lauern Rätsel: Der Himmel ist allezeit undurchdringlich. Die Menschen wissen von den Sternen, haben sie aber noch nie gesehen. Das weckt die Neugier von Owen, einem Außenseiter, der alles daransetzt, die vertrauten Grenzen seiner Welt zu durchstoßen und dem Geheimnis auf die Spur zu kommen - mit verheerenden Folgen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1810
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Eine ferne Zukunft auf einem fernen, scheinbar paradiesischen Planeten – doch der Schein trügt. Etwas Mörderisches lauert unter der Erde. Daher haben die Siedler ihre Kinder gentechnisch aufgerüstet, sodass sie fliegen können. Es gibt jedoch weitere Rätsel: Noch nie haben die Menschen die Sterne gesehen. Der Himmel ist immer bedeckt, als würde sich dahinter etwas verbergen. Den Himmel, so heißt es, kann man nicht erreichen. Oder doch? Owen, einem Außenseiter, gelingt es – mit tödlichen Folgen …
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf.
Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
ANDREAS
ESCHBACH
EINESMENSCHENFLÜGEL
Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2020 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Kartenzeichnung: Markus Weber, Guter Punkt GmbH & Co KG, 80805 München
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Sylverarts Vectors/shutterstock.com; Reservoir Dots/shutterstock.com; white snow/shutterstock.com; takahiro/shutterstock.com; Klavdiya Krinichnaya/shutterstock.com; Tursunbaev Ruslan/shutterstock.com; Illustration: Max Meinzold
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-9439-9
luebbe.de
lesejury.de
Teil 1
HIMMELSFLIEGER
Owen
Der unerreichbare Himmel
»Was sind die Sterne?«, fragte Owen, als er noch ein Kind war.
»Die Sterne«, sagte der alte Hekwen, den man den Weisen nannte, »sind der Ort, von dem wir kommen.«
»Und wo sind die Sterne?«
»Jenseits des Himmels«, sagte Hekwen und deutete empor zum milchig-grauen Firmament, hinter dem das große Licht des Tages leuchtete und die Welt erhellte.
»Ich will sie sehen«, sagte Owen.
Der Weise, dessen Schwingen schon grau und schlaff waren vom Alter, schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Owen. Der Himmel ist unerreichbar hoch. Keines Menschen Flügel können ihn überwinden.«
Owen sah in die Höhe und fand das ungerecht. »Das glaube ich nicht«, sagte er. Noch am gleichen Tag erkletterte er einen der höchsten Startpunkte des Nestbaums, breitete seine jungen Flügel aus, ließ den auflandigen Wind hineinfahren und sprang. Er nutzte die aufsteigende Strömung und die Kraft seiner Flügel, um höher zu steigen als je zuvor. Die Welt fiel unter ihm zurück, bis die meilentiefen Schluchten mit ihren alles zermalmenden Wasserfällen aussahen wie Furchen und Rinnsale und die riesigen Nestbäume wie dürres Gewächs, und er stieg und stieg in einen Himmel von rauchigem Grauweiß, der gleichwohl nicht näher zu kommen schien, so sehr er sich auch anstrengte. Schließlich verließen ihn seine Kräfte, die Brustmuskeln schmerzten, die Flügelspitzen begannen zu zittern, und er musste aufgeben und nach Hause zurückkehren.
»Glaubst du es nun?«, fragte Hekwen, als Owen das Geflecht der Nestbauten in der Krone ihres Baumes keuchend wieder erreicht hatte.
»Nein«, sagte Owen dickköpfig, aber er versuchte es nicht noch einmal.
Doch er vergaß es nicht. Solange die Trockenzeit dauerte, badeten sie in den hohen Flüssen, da, wo es sicher war, weil Wasser floss, ließen sich von der Strömung über die Kante tragen und hinab in die fürchterlichen Tiefen, um sich möglichst spät aus der Gewalt des silbern herabschießenden Wasserfalls zu lösen – doch wenn Owen dann mit langen Flügelschlägen an der tosenden, gischtenden Säule entlang wieder hinaufflog zu den anderen, dachte er, dass es sich so anfühlen müsse, den Himmel zu durchstoßen. Als die Windzeit begann, zog er mit den anderen Kindern halbe Tage lang Kreise, weit draußen über dem grünen Meer, wo es kochte von den heißen Quellen und einem die Süßmücken schwarmweise in den Mund flogen – aber er behielt den Himmel im Auge wie einen Feind, studierte das strähnige Muster aus Dunkel und Hell darin und stellte sich vor, wie es sein mochte, dort anzukommen und hindurchzutauchen und die andere Seite zu erreichen.
Dann kam die Regenzeit, ein steter Sturzbach von Wasser, den auch die Riesenblätter nicht abhalten konnten. Die Kinder hockten in den nass an den Ästen des Nestbaums klebenden Hütten, lernten zählen und rechnen, die Schrift der Ahnen und die Geschichte ihres Volkes. Sie erfuhren, dass die Ahnen von den Sternen gekommen waren, ja, von jenseits des Himmels waren sie herabgestiegen in einem großen silbernen Fahrzeug. Sie hörten zu ihrem Erstaunen, dass die Ahnen noch keine Flügel besessen hatten, und versuchten sich vorzustellen, wie diese auf dem Boden gelebt hatten, im düsteren Unterholz, in Furcht vor dem Margor und geplagt von den grauen Ratzen. Doch die Ahnen hatten sich auf Künste verstanden, die seither verloren gegangen waren. Sie hatten es vermocht, von den Pfeilfalken die Flügel und die Kraft zu nehmen und beides ihren Kindern einzupflanzen, die seit dieser Zeit Flügel besaßen und fliegen konnten, als seien sie die Herren der Lüfte, und kein Mensch musste mehr im Unterholz leben, seit der letzte der Ahnen gestorben war vor tausend Jahren.
Dann folgte die Nebelzeit. Silberner Dunst lag morgens über den Wäldern, verdeckte die Abgründe der Schluchten wie ein undurchdringlicher Schleier, und die Wasserfälle schrumpften zu dünnen, dampfenden Rinnsalen. Die Schleier sahen undurchdringlich aus, doch sie waren es nicht. Wenn man hindurchflog, spürte man nur einen kalten Hauch, aber man musste vorsichtig sein, weil man nicht weit sah. Das brachte Owen auf den Gedanken, über die Natur des Himmels nachzudenken. »Ist der Himmel«, wollte er wissen, »womöglich nur eine Art ewiger Nebel? Eine Wolkendecke, die niemals verschwindet?«
Satwen, der die Kinder unterrichtete, prüfte, was die Schriften dazu wussten, und siehe da: Genau so verhielt es sich. Der Himmel war eine hohe, unvergängliche Wolkenschicht, das hatten schon die Ahnen gesagt, die sich in derlei Dingen nicht irrten.
Die Frostzeit brach herein, ließ die Wasserfälle erstarren und verstummen, überzog die riesigen Lederblätter der Nestbäume mit silbrigem Reif und erfüllte die Luft mit dem märchenhaften Klingen gefrorener Lianen, wenn sie der kalte Seewind gegeneinander schlagen ließ. In eisernen Schalen glommen Kiurka-Samen in der Glut und durchdrangen die Nesthütten mit ihrem würzigen Duft, und an hellen Tagen kletterten die Verwegensten ins Freie, um Eisfrüchte zu ernten. Dies war die Zeit der Lieder, des Flickzeugs und des Nachsinnens über das, was gewesen war, und das, was kommen würde im neuen Jahr.
Owen erlernte die Kunst, Entfernungen mittels Triangulation zu bestimmen, aber nicht um die Distanz zu Inseln draußen im Meer oder zu Bergen im Hinterland zu ermitteln wie die anderen: Er baute sich, als wieder Trockenzeit war, ein Triangulationsbesteck, um die Höhe des Himmels zu messen.
Ihm war aufgefallen, dass man manchmal Muster am Himmel ausmachen konnte, wenn man genau hinsah – Gestalten in Grau und Weiß, die für halbe oder viertel Tage sichtbar waren und sich dann wieder auflösten. Wann immer er ein solches Muster entdeckte, peilte er es mit seinem Triangulationsbesteck an, maß die Winkel und flog anschließend, das schwere Besteck an den Körper gepresst, weiter zu einer Klippe, deren Entfernung zum Nest er genauestens bestimmt hatte, um von dort aus noch einmal zu peilen und zu messen. Nach einigen Messungen war er sich seiner Sache sicher: Der Himmel war sehr hoch – aber nicht unendlich hoch. Tatsächlich war der Himmel vom Nestbaum nicht weiter entfernt als die heißen Quellen, nur eben in die Höhe.
Owen begann zu trainieren.
Den Himmel berühren
Zunächst fiel den anderen Kindern kaum auf, dass es plötzlich fast immer Owen war, der einen Wettflug vorschlug, zur Klippe, zu den heißen Quellen, zur Muschelbucht hinab. Zumal Owen so gut wie nie gewann. Aber Owen meldete sich auch, wenn die Erwachsenen Helfer brauchten zum Lastentransport, ließ sich bereitwillig Tragegeschirre anlegen, was allen anderen Kindern ein Graus war, und ging endlich dazu über, ein neugeborenes Hiibu jeden Tag einmal im Geschirr hinunter in den Fjord zu fliegen, um es zu tränken. Weil das Hiibu jeden Tag ein wenig größer und schwerer wurde, wurde Owen im Lauf der Zeit immer stärker, fast ohne etwas davon zu merken. Schließlich wollte niemand mehr gegen ihn um die Wette fliegen, weil Owen immer gewann. Als die nächste Frostzeit kam, war Owen der stärkste und schnellste Flieger des Stamms.
Das ganze Jahr über hatte er seine Messungen der Himmelshöhe fortgesetzt und herausgefunden, dass der Himmel in der Windzeit am höchsten, am niedrigsten dagegen am Ende der Nebelzeit war, kurz bevor die Frostzeit begann. Doch als er wieder einmal versuchte, ihn zu erreichen, war es wie beim ersten Mal: So sehr er sich auch bemühte, er schien dem Himmel nicht näher zu kommen.
»Glaubst du es immer noch nicht?«, fragte Hekwen mit gutmütigem Lächeln, als Owen klammgefroren und erschöpft aus dem Landenetz kroch.
»Nein«, sagte Owen grimmig.
Er flog wieder mit den anderen, aber ihre kurzatmigen Spiele begannen ihn zu langweilen, wie sie ihrerseits zunehmend davor zurückschreckten, ihn zu begleiten, wenn er eine neue Herausforderung suchte: ohne Zwischenlandung bis zu den Inseln des Leik-Stammes zu fliegen, beispielsweise. Das könne er allein machen, hieß es, und so machte er es allein. Er flog den ganzen Tag und die Nacht hindurch ohne Pause, im Dunkeln nur geleitet vom kleinen Licht der Nacht, das das Meer in verzaubernden Schimmer tauchte. Als er wieder zu Hause ankam, war er erschöpft und, obwohl er geschafft hatte, was er sich vorgenommen hatte, unzufrieden. Was er wollte, war ja nicht, weite Distanzen zu bewältigen, sondern große Höhen!
Er begann die Vögel zu studieren. Die Ahnen hatten ihnen die Flügel der Vögel gegeben, aber das war erst wenig mehr als tausend Jahre her. Zweifellos mussten die Tiere, die schon seit dem Anfang der Zeit fliegen konnten, die besseren Flieger sein – und vielleicht konnte er aus ihrer Beobachtung noch etwas lernen.
Nur einer, der schmächtige Jiuwen, begleitete ihn auf seinen Beobachtungszügen. Gemeinsam lagen sie in Höhlen an der Küste und verfolgten das Treiben der Strandsegler, Küstenflatterer, Tauchschwirrer und Raubdrifter. Jiuwen führte begeistert Buch über ihre Beobachtungen und hielt die Vögel in wunderbaren Zeichnungen fest. Owen kam zu dem Schluss, dass die Küstenvögel ziemlich faule und schwerfällige Gesellen waren – vermutlich, weil es ihnen so leicht fiel, Beute zu machen, denn die Küste war voller Würmer, Mücken und anderem Getier. Er drängte darauf, dass sie ins Hinterland vordrangen und die Vögel der kargeren Vorberge beobachteten. Damit verbrachten sie fast die gesamte Trockenzeit.
Schließlich waren es ausgerechnet die Pfeilfalken – von denen die Flügel der Menschen ja tatsächlich abstammten –, die Owen etwas darüber lehrten, wie man Höhe gewann.
Die Pfeilfalken waren mächtige Raubvögel, die weit über den anderen Vögeln kreisten, ausdauernd, ohne Flügelbewegung, auf schwache Tiere lauernd. Entdeckten sie eines, legten sie die Flügel an und schossen herab wie Pfeile, packten ihr Opfer mit ihren messerscharfen Krallen, rissen es mit sich in die Tiefe und verschwanden damit unter dem Blätterdach des endlosen Walds. Jiuwen geriet fast außer sich vor Begeisterung, als sie das beobachteten, doch Owen war von etwas ganz anderem fasziniert: wie der schwere Pfeilfalke seine enorme Ausgangshöhe erreichte.
Im ersten Anlauf erstieg er eine Höhe, die sogar noch unter der lag, in der sich die meisten Schwärme kleinerer Vögel bewegten. Doch dann begann er ein atemberaubendes Manöver, um Höhe zu gewinnen. Als ob er Beute ausgemacht hätte, legte der Pfeilfalke die Flügel an und stürzte sich in die Tiefe – breitete die Flügel jedoch gleich darauf wieder aus und vollführte kleine, treibende Schläge, die den Sturz noch beschleunigten. Der war zu diesem Zeitpunkt kein Sturz mehr, sondern begann, in eine flache, schnelle Schussbahn überzugehen. Ab einem bestimmten Moment hielt das Tier inne und raste mit starren Flügeln weiter, durch den tiefsten Punkt hindurch und wieder empor, mit weitaus mehr Geschwindigkeit als vorher. Wenn es die Ausgangshöhe erreichte, tat es das mit einem Schwung, der es von selbst darüber hinaustrug, und damit nicht genug: Der Pfeilfalke setzte nun abermals seine Flügel ein, machte seltsame, raumgreifende Bewegungen, wie Owen sie nie zuvor gesehen hatte. Sie ließen den Pfeilfalken immer weiter hinauf gelangen, weit über das anfängliche Niveau. Von dort aus vollführte er das Manöver, das er so graziös und elegant wie einen Tanz beherrschte, noch vier oder fünf Mal, bis er schließlich in einsamer Höhe am Firmament seine lauernden Kreise ziehen konnte.
»Das ist es!«, rief Owen aus. Jiuwen verstand nicht, was Owen meinte, und auch nicht, was ihn dazu antrieb, das Manöver der Pfeilfalken sogleich nachzumachen.
Was ihm gründlich misslang. Als er versuchte, den Sturz zu beschleunigen, geriet er ins Trudeln und überschlug sich. Als er die flache Kurve durchflog, schaffte er es nicht, wieder aufzusteigen. Und die seltsamen Flügelschläge, mit denen die Pfeilfalken den Schlussaufstieg bewerkstelligten, wollten ihm gleich überhaupt nicht gelingen.
In den folgenden Tagen musste Jiuwen feststellen, dass Owens Interesse an der Beobachtung von Vögeln erloschen war. Nur die Pfeilfalken und ihre Technik des Emporschwingens interessierten ihn noch, und auch das nur, weil er es ihnen nachmachen wollte. Da Jiuwen keine Lust hatte, Owen den ganzen Tag bei Flugversuchen zuzusehen, flogen sie bald wieder getrennte Wege. Jiuwen kehrte an die Küste zurück, wo die seiner Meinung nach hübscheren und interessanteren Tiere lebten, und widmete sich erneut seinen Zeichnungen.
Owen aber verbrachte von nun an bis zum Anbruch der Regenzeit jeden Tag im Hinterland und beobachtete die Pfeilfalken, studierte und imitierte sie, als sei es seine Absicht, einer von ihnen zu werden. Er erkannte bald, dass in dem, was ihn von den Tieren unterschied, die Antwort verborgen lag: Er besaß zwar die Flügel eines Pfeilfalken, nicht aber dessen Körper, und so war es nicht damit getan, die Bewegungen der Vögel zu imitieren – er musste sie für sich neu erfinden!
Aus dem Sturz Geschwindigkeit gewinnen, diese in Schwung für eine aufwärtsgerichtete Flugbahn umsetzen und mit Flügelschlägen, die keinerlei Auftrieb, sondern nur weitere Geschwindigkeit erzeugten, über die ursprüngliche Höhe hinaussteigen – das war das Prinzip. Jede einzelne Phase davon galt es für sich zu üben und zu entwickeln, um am Schluss alles zu einer einzigen, fließenden Bewegung zu verbinden.
Die Regenzeit begann mit ihren Gewittern und Schauern, und wie immer war es, als bräche das Meer über das Land herein. Owen hockte wieder mit den anderen in den dampfenden Zimmern über den Büchern, doch nachts träumte er von den Pfeilfalken und ihren Schwüngen, war einer von ihnen, glitt mit ihnen durch die Lüfte, höher und höher, bis er den Himmel berührte. Einmal träumte er das: den Himmel zu berühren. Und er erwachte genau in dem Moment, in dem es geschah, schreiend, und saß dann da und sah hinaus ins Dunkel, wo der Regen nachgelassen hatte, nur noch fern über dem Meer eine geisterhaft schimmernde Regenwand stand und der Wald erfüllt war von millionenfachem Trippeln und Tröpfeln.
Tag um Tag wurde es kühler, bis der Regen nachließ und die Nebelzeit begann. Owen fand, dass ihm die sich endlos dahinstreckenden Nebelbänke als Orientierung dienen konnten, wenn er sein Manöver ausprobierte: Er startete dicht über der weißen, dunstigen Ebene, tauchte hinab und wieder empor und konnte dann sehen, wie viel Höhe er dazugewonnen hatte. Tatsächlich war ihm, als verbinde sich bei diesen einsamen Flügen über dem Meer und den Schluchten das, was er vor der Regenzeit geübt, und das, was er während der Regenzeit geträumt hatte, zu einem fließenden, spielerisch leichten Manöver, das kaum Kraft zu kosten schien.
Mit seinem verbissenen Streben entfremdete er sich zusehends von den anderen seines Stammes. Die anderen Kinder gingen ihm aus dem Weg. »Owen ist einem irgendwie unheimlich«, hörte er ein Mädchen zu einer Freundin sagen.
»Warum tust du das?«, wollte seine Mutter von ihm wissen. »Du willst mit niemandem zu tun haben – warum? Ist es das, was du willst – ein Einzelgänger werden? Das kann nicht dein Ernst sein. Jeder ist ein Teil der Gemeinschaft, auch du.«
Owen wollte etwas sagen, aber er wusste nicht, was. Also schwieg er. Seine Mutter schüttelte schließlich seufzend den Kopf und ließ ihn in Ruhe.
Kurz vor der Frostzeit und beim tiefsten Stand des Himmels wagte Owen es zum dritten Mal. Er zog seinen wärmsten Anzug an, fettete sich die Flügel sorgfältig ein und startete im frühen Licht des Tages. Eine starke aufwärtstragende Strömung über der weiten Bucht brachte ihn rasch in eine Höhe, von der aus er seine Schwungmanöver beginnen konnte. Schon das erste glückte, und nach dem fünften oder siebten flog er höher als jemals zuvor. Er schrie vor Begeisterung.
Aber so hoch oben kostete es doch Kraft. Er musste verschnaufen, ruhige Kreise ziehen, etwas von dem Proviant essen, den er mitgenommen hatte. Dann zwei, drei weitere Schwünge und wieder Pause. Er fühlte sich immer noch großartig, doch er schrie nicht mehr, sondern sparte seine Kraft auf.
Immer so weiter. Zwei, drei Schwünge, Pause. Zwei weitere Schwünge, Pause. Immer weiter und weiter. Die Flügel begannen zu schmerzen wie damals bei seinem Flug zu den Leik-Inseln. Die kalte Luft brannte in den Lungen, trocknete ihm die Kehle aus. Er wusste nicht mehr, wie er sich fühlte, sah nur noch den Himmel über sich, der jetzt endlich, endlich näher kam, groß und gewaltig wurde, zum Greifen nahe, zum Dagegenprallen nahe. Schwung, Pause. Schwung, Pause. Aus der Nähe sahen die ewigen Wolken aus wie alte, verknotete Nebelbänke, staubig und ranzig geworden im Lauf der Zeit, weil sie sich niemals hatten auflösen dürfen. Das große Licht des Tages glomm irgendwo hinter ihnen, in ihnen, aber Owen hätte nicht mehr sagen können, woher es tatsächlich kam. Jeder weitere Schwung schien ihn zerreißen zu wollen, jede Pause wurde länger als die vorige. Er vergaß alles, spürte nichts mehr, dachte nicht darüber nach, ob es der hundertste Schwung war oder der zweihundertste. Und er sah längst nicht mehr zurück. Die Küste, die Schluchten mit den gewaltigen Nestbäumen, all das war zu Grau und Grün zerflossen, lag weit unter ihm, vergessen und verloren. Er griff nach dem Himmel, das war alles, was zählte.
Und schließlich – berührte er ihn.
Es war, als versetze ihm jemand einen Schlag. Ein eisiges, wirbelndes Etwas trat nach ihm, stieß ihn ab, ließ ihn taumeln und aufschreien, vor Entsetzen diesmal. Aber er fing sich wieder, glitt eine ganze Weile dahin, dicht unter dem schwer über ihm hängenden Himmel, mit langsamen Flügelschlägen, während sein Herz raste von dem Schreck und er keines klaren Gedankens fähig war.
Er konnte es nicht fassen. Er hatte den Himmel erreicht, schwebte in kalter Höhe, war höher hinauf gelangt als je ein Mensch vor ihm – konnte es wahr sein, dass dies das Ende bedeutete? Dass es weiter hinauf nicht ging?
Er hatte seine Kräfte aufgezehrt, war ausgelaugt, zitterte vor Kälte und Schwäche, aber er versuchte es noch einmal. Mit mühsamen Flügelschlägen, die ihm schier den Rücken zerreißen wollten, kletterte er Spanne um Spanne höher, dichter heran an das düstere Dach der Welt. Und je näher er den ewigen Wolken kam, desto deutlicher spürte er ein wütendes Brausen und Toben darin, eine bedrohliche Kraft, die dort oben tobte, bereit, jeden zu zerfetzen, der sich in ihr Territorium wagte. Er hatte geglaubt, in den Himmel eintauchen zu können wie in eine Nebelbank, hatte erwartet, in erhabenem Dunst weiter emporsteigen zu können, um endlich darüber hinaus zu gelangen, dorthin, wo man die Sterne sehen konnte. Das war ein Irrtum gewesen. Der Himmel war ein stärkerer Gegner, als irgendjemand geahnt hatte.
Owen überließ sich schließlich einem langen, weiten Sinkflug, abwärts, heimwärts. Ihm wurde fast schwarz vor Augen, als er wieder in wärmere Luft gelangte, und kurz bevor er die Küstenlande erreichte, begannen die Spitzen seiner Flügel vor Erschöpfung derart zu zittern, dass er es beinahe nicht mehr bis zum Nestbaum geschafft hätte. Und als er endlich im Landenetz lag, konnte er selber kaum glauben, was er getan hatte.
»Ich habe den Himmel berührt«, sagte er zu Hekwen, der an seinem gewohnten Platz auf der Galerie hockte und getrocknetes Hiibufleisch kaute.
»Das glaube ich nicht«, sagte der Alte.
»Dann lass es«, sagte Owen und zog sich mit schmerzenden Armen aus dem Netz.
Hekwen rieb sich das Kinn. »Den Himmel zu berühren ist eine Sache«, rief er Owen nach. »Ihn zu durchstoßen eine ganz andere.«
Die Tochter des Signalmachers
Owen verkroch sich in seine Schlafkuhle und bekam Fieber, das mehrere Tage dauerte. Seine Flügel wiesen Erfrierungen auf, wunde Stellen und geplatzte Blutgefäße, und sie sollten noch lange schmerzen. Er schlief und zitterte dabei, träumte heiße Träume, in denen er mit dem Himmel rang, und wenn er abstürzte, wachte er schreiend auf.
»Was ist nur anders mit dir, mein Sohn?«, hörte er seine Mutter einmal an seinem Lager sagen.
Als das Fieber endlich nachließ, hatte die Frostzeit begonnen.
Sie dauerte lange dieses Jahr, und diesmal schloss sich gleich die Windzeit an mit machtvollen Stürmen. Die Segelfischschwärme blieben aus, wie immer, wenn die Trockenzeit ausfiel. Owen kletterte mit den Männern des Stammes am Nestbaum hinab, mit Halteseilen gesichert, um stattdessen Frostmoos zu ernten.
Eines Nachts, als es stürmte wie noch nie, zerrissen donnernde Laute die Luft, und der rote Schein von Notsignalen flackerte von weither über dem Wald. »Das Nest der Ris!«, schrie jemand. »Sie brauchen Hilfe!«
Owen hatte von Signalen gehört, aber noch nie welche gesehen. Er konnte seinen Blick kaum von den Feuerbällen wenden, die im fernen Südwesten für Augenblicke die stürmische Nacht mit blutrot aufflammendem Licht durchschnitten. Und er schloss sich ganz selbstverständlich den Männern an, die es wagten, durch den Sturm und die Dunkelheit zu fliegen, um dem Stamm der Ris beizustehen.
Der Sturm hatte ein Gewitter mit sich gebracht, und der Blitz hatte in einen der Hauptäste des Nestbaums eingeschlagen. Zwei Nesthütten waren zerstört, sechzig vom Absturz bedroht, darunter die Hütten, in denen die Vorräte lagerten. Im Licht rußender Sturmfackeln, während der Sturm ihnen die Fetzen nasser Blätter um die Ohren schlug, reichten sie schreiende Kinder von Arm zu Arm, wuchteten Kisten und Fässer aus den bedrohlich schwankenden Hütten und versuchten gar, den Spalt in dem riesigen Ast mit Seilen zu verzurren. Alles andere gelang, doch das nicht: Eine heulende Bö fuhr ins Geäst, und mit markerschütterndem Krachen spaltete sich das Holz endgültig und riss die Hütten in die Tiefe. Als das große Licht des Tages endlich aufstieg, sahen die nassen, erschöpften Menschen ein Nest in Trümmern liegen.
Doch nun, da der Sturm sich gelegt hatte, kamen sie von überall zu Hilfe. Die Leik, die Non, die Heit, sogar die Mur vom Rand der Hochebene schickten Handwerker, Werkzeug und Holz, und bald wuselte der Nestbaum der Ris wie ein Süßmückennest. Als die Hütten wieder aufgebaut waren, wurde ein Fest gefeiert, wie man es nur feiern kann, wenn man gemeinsam eine Katastrophe bewältigt hat, und Omoris, die Älteste des Nests, dankte ihnen allen mit bewegenden Worten.
Bei diesem Fest lernte Owen Eiris kennen, die Tochter des Signalmachers.
Um genau zu sein, war sie ihm schon in der Nacht des Sturms aufgefallen. Er hatte neben ihr gestanden, als hundert Hände auf ein Kommando an den Spannseilen zogen, während der Sturm heulte und jaulte und sie alle von den Plattformen fegen wollte, und einmal hatte er sie festgehalten, als sie mit einem schweren Sack auf den Schultern ins Straucheln geraten war. Warm und anmutig hatte sie einen herrlichen langen Augenblick in seinen Armen gelegen, ehe sie sich fing, weil die Arbeit weitergehen musste.
Jetzt, bei Tag, gefiel sie ihm noch besser. Sie hatte ein schmales Gesicht, eine Figur von zarter Schönheit und schlanke, helle Flügel, sie hörte ihm aufmerksam zu, wenn er etwas sagte, und sah ihn mit dunklen, rätselhaften Augen dabei an. Oft wusste er allerdings nichts zu sagen, saß nur da und kam sich hilflos und dumm vor, aber Eiris blieb trotzdem bei ihm sitzen. Als es Zeit war, nach Hause zu gehen, fasste Owen endlich Mut und fragte sie, ob er sie wiedersehen dürfe. Sie zögerte einen Moment, der Owen das Herz bis zum Hals hinauf schlagen ließ, dann sagte sie: »Ja. Gern.«
In den Tagen, die folgten, sah man sie oft unter den Klippen spazieren, stundenlang am Strand entlang, Muscheln auflesen und ins Wasser werfen und reden dabei. Oder sie zogen weite Kreise über dem Meer, haschten und neckten einander, um sich später in einer bemoosten Astgabel hoch über einer verlassenen Schlucht auszuruhen. Dort küssten sie sich das erste Mal. Owen wäre beinahe vom Baum gefallen dabei.
»Was ist dein größter Traum?«, fragte Eiris ihn eines Tages.
»Die Sterne zu sehen«, erwiderte Owen und erschrak, denn das hatte er noch nie jemandem erzählt.
»Die Sterne? Aber man kann die Sterne nicht sehen. Sie sind jenseits des Himmels.«
»Ja«, sagte Owen. »Ich weiß.«
Sie sah ihn so seltsam an dabei, dass er es wagte und ihr alles erzählte. Wie er die Höhe des Himmels gemessen hatte. Wie er trainiert hatte, wie er den Schwung der Pfeilfalken erlernt und schließlich den Himmel berührt hatte. Und wie es dann nicht mehr weitergegangen war.
Eiris umarmte ihn, und ihm war, als habe sie Tränen in den Augen. »Du musst weitermachen«, flüsterte sie ihm zu. »So einen wunderbaren Traum darfst du nicht aufgeben. Ich glaube an dich, Owen. Jemand, der es geschafft hat, den Himmel zu berühren, wird es eines Tages auch schaffen, die Sterne zu sehen.«
Das zu hören ließ Owen sich unendlich stark fühlen. Hätte sie es verlangt, er wäre ohne zu zögern losgeflogen, den Himmel ein zweites Mal zu erklimmen. Aber sie verlangte es nicht.
So verging ein Jahr, und als die Trockenzeit wiederkam, versprachen Owen und Eiris einander endlich, wie es jeder geahnt hatte. Das gab wieder ein Fest. Die Handwerker der Wen und der Ris zimmerten den jungen Leuten eine Hütte, und anschließend wurde so viel vergorener Eisfrüchtewein getrunken, dass manch einer fast vom Baum gefallen wäre. Owen aber hatte beschlossen, bei Eikor, Eiris Vater, in die Lehre zu gehen und das Handwerk eines Signalmachers zu erlernen.
Der Signalmacher hatte seine Werkstatt in einer Höhle in einem einsamen, kantigen Felsen bei den Klippen, weil seine Arbeit zu gefährlich war, um sie im Nest auszuüben. Owen lernte, wo man nach den Mineralien für die Ingredienzen grub, welche Pflanzen man trocknen musste und wie man sie zerrieb, wie man Signalpulver anmischte und Treibmasse kochte, wie man eine Feuerschnur fertigte und wie man sie anbrachte. Für die Signale nahm man die ausgehöhlten Samenschoten des Ratzenstrauchs: Zuerst kam eine Ladung Signalpulver hinein, dann die zähe Treibmasse, in die man die Feuerschnur hineinschob, ehe sie erstarrte. Zum Schluss wurden drei Flügel angebracht, um den Flug zu stabilisieren, und alles zu einem griffbereiten, regendichten Paket verpackt. Eikor war der einzige Signalmacher der Küstenlande, er versorgte alle Stämme im weiten Umkreis.
Das erste Signal, das Owen allein machte, explodierte, als er die Feuerschnur zog, und hinterließ einen enormen schwarzen Fleck auf dem steinigen Strand, den erst die Flut wegspülte. Doch bereits das dritte Signal schoss hoch empor und verging in einem hellen, weißen Feuerball, neben dem das große Licht des Tages für einen Moment verblasste.
Und wenn Owen abends in die Hütte zurückkehrte, sich den Ruß aus dem Gesicht wusch, die Ratzenkleie aus den Haaren kämmte und endlich Eiris in die Arme schließen konnte, war er der glücklichste Mensch der Welt.
Die Regenzeit kam, in der die Feuerbeeren nicht trockneten und die Ratzenschoten weich wurden von der Feuchtigkeit. Owen und Eikor rieben Salpeterstein stattdessen, schnitzten Flügel aus Kiurkaholz und flochten Fasern zu Schnüren. Dann kam die Nebelzeit, und der Anblick der Nebelbänke über den Klippen und dem dunkelgrünen, stillen Meer rief in Owen die Erinnerung wieder wach an seinen Aufstieg zum Himmel und an seine Sehnsucht, die Sterne zu sehen.
Eines Tages, als die Frostzeit bereits wieder nahte, versuchte er es erneut. Diesmal war es Eiris, die ihm Hiibufett in die Flügel einrieb, und er fühlte sich stark und glücklich, als sie ihn zum Abschied umarmte. Schon als er sich von der Sprungkante stieß, wusste er, dass er es wieder schaffen würde. Diesmal flog er mit ruhigen, sparsamen Bewegungen, und obwohl er den Schwung der Pfeilfalken das ganze Jahr über nicht geübt hatte, glückte er ihm auf Anhieb wie selbstverständlich. Er stieg höher und höher, ließ die Welt unter sich zurück, rang mit der Höhe und dem Himmel, doch er war ruhiger diesmal, zuversichtlicher, und erst jetzt merkte er, wie viel Kraft ihn beim ersten Mal die Frage gekostet hatte, ob es überhaupt zu schaffen war.
Aber leicht war es dennoch nicht. Irgendwann war wieder alles vergessen, das Nest, Eiris, die ganze Welt, und es gab nur noch Schwünge und Pausen, Schwünge und Pausen, schmerzende Brustmuskeln und Flügelgelenke, beißende Kälte und einen Himmel, dem näher zu kommen mit alles durchdringender Erschöpfung bezahlt werden musste. Erst als er wieder dicht unter dem brodelnden Wolkendach des Himmels schwebte, erlaubte sich Owen ein Lächeln und einen Schrei des Triumphs.
Wie er es Eiris versprochen hatte, zog er ein Signal aus der Tasche, das er eigens für diese Gelegenheit gebaut hatte, mit grünem Signalfeuer statt dem roten, das einen Notfall anzeigte. Er hielt es mit ausgestrecktem Arm von sich, richtete es auf die Wolken über sich und riss die Feuerschnur. Mit heißem Fauchen schoss es davon, bohrte sich in das Firmament und verschwand, und einen Augenblick später loderte ein gewaltiges grünes Licht über ihm auf, größer und wilder, als er es erwartet hatte, fast so, als hätte der Himmel Feuer gefangen.
In diesem Augenblick kam ihm die Idee.
»Ich habe es gesehen!«, rief Eiris schon von Weitem, als er zurückkam. »Der ganze Himmel hat aufgeleuchtet, so hell wie das kleine Licht der Nacht!«
Owen war erschöpft und unsagbar ausgelaugt, doch es war nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Er schloss Eiris in die Arme und sagte: »Das Signal muss auf der anderen Seite des Himmels explodiert sein. Ich bin sicher, dass es so war.« Dabei dachte er an die Idee, die ihm gekommen war, doch inzwischen machte sie ihm Angst, und er wagte nicht, darüber zu sprechen.
Die Frostzeit brach an. Eiris und Owen rösteten ihre eigenen Kiurka-Samen, hörten dem Klirren der vereisten Lianen zu und freuten sich aneinander. Eikor lieh Owen seine alten Bücher über das Signalmachen, und Owen studierte sie im fahlen Licht der kurzen Tage. Als die Trockenzeit kam, zog er bisweilen los, um das Unterholz zu durchstreifen. Von diesen Streifzügen brachte er zu Eiris’ Verwunderung allerhand große Samen, Beeren und Nüsse mit, die er zu Hause sorgfältig zerlegte und untersuchte, als sei er unter die Naturforscher gegangen. Auf ihre Frage, was er vorhabe, meinte Owen nur, er müsse etwas ausprobieren.
Seine Wahl fiel schließlich auf die armlangen Riesenbaumnüsse. Er borgte sich von einem der Zimmerer einen Bohrer und ein Schabmesser und höhlte die Nuss von ihrem stumpfen Ende bis zur Spitze aus. Dazu brauchte er mehrere Abende, und am Schluss hatte er eine lange, hohle Nussschale, die er mit Treibmittel füllte. »Kein Signalpulver«, erklärte er dem verwunderten Eikor. »Ich will nur eine Rakete machen, kein Signal.«
»Und wozu soll das gut sein?«, fragte Eiris’ Vater.
»Einfach so«, sagte Owen und drückte die Feuerschnur hinein.
Die erste Rakete zerriss es in tausend Fetzen, kaum dass sie ein Stück gestiegen war. Owen nahm die nächste Nuss und machte sich wieder daran, sie auszuhöhlen, ließ diesmal aber eine Schicht Fruchtfleisch unter der Schale stehen. Diese zweite Rakete explodierte erst hoch über dem Meer. Als die Trockenzeit begann, flogen Owens Raketen weit und explodierten nicht mehr – bloß war keinem klar, wozu das gut sein sollte.
Einzig Eiris ahnte, was Owen vorhatte. Ihr Gesicht war voller Sorge, wenn sie ihm zusah, wie er an den Riesenbaumnüssen arbeitete.
Als Owen eines Abends eine Rakete auf eine Lastentrage band und die Feuerschnur zog, musste er feststellen, dass sie zu stark war für die hölzernen Tragegestelle. So flog er bei nächster Gelegenheit mit zum Luuki-Markt und erstand eine Trage aus Metall, die nicht nur stabiler, sondern auch leichter war als die normalen aus Holz. Auf dieser Trage befestigte er eine Rakete, die er mit besonderer Hingabe gefertigt hatte, dann stellte er alles in die Ecke und redete den Rest des Jahres nicht mehr darüber.
Die Regenzeit kam und ging wieder, die Nebelzeit brach an, und als die Frostzeit nahte, sah Owen manchmal abends zum Himmel hoch, aber er sagte nichts davon, es noch einmal zu versuchen. Als Eiris ihn fragte, wandte er sich ab und sagte: »Nächstes Jahr vielleicht.«
Doch Eiris nahm seine Hände in die ihren und sah ihm in die Augen mit jenem Blick, mit dem sie seine Seele erreichte. »Schau, Owen«, sagte sie, »es ist dein Traum und deine Sehnsucht. Du musst entscheiden, was du tun willst, und ich werde dich lieben, wie immer du dich entscheidest. Aber zwei Dinge musst du bedenken. Erstens wirst du nicht für alle Zeiten so stark sein, wie du jetzt bist. In ein paar Jahren wirst du es nicht mehr bis zum Himmel schaffen, erst recht nicht mit einem Gestell auf dem Rücken. Und zweitens werde ich vielleicht schon nächstes Jahr unser Kind tragen, und dann darfst du kein solches Risiko mehr eingehen. Wenn du es tun willst … wenn du es tun musst, dann tu es jetzt. Oder begrabe den Traum für alle Zeiten.«
Owen versank in ihrem Blick. »Ich habe Angst davor, was mich erwartet«, bekannte er leise. »Auf der anderen Seite des Himmels.«
Er sah Tränen in ihren Augen auftauchen. »Die Sterne, Owen«, flüsterte sie. »Die Sterne.«
»Ich könnte sterben dabei.«
»Ich weiß, Owen. Und es würde mir das Herz brechen. Aber ich werde dich nicht bitten zu bleiben, nur um meiner Angst willen. Wenn du deine Angst bezwingst, will ich meine auch bezwingen.«
Sie hielten sich an den Händen, sahen einander an für eine Zeit, die nicht zu enden schien. »Morgen Abend«, sagte Owen zuletzt. »Und ich werde zurückkommen und dir von den Sternen erzählen.«
Die Sterne sehen
Er startete von der Klippe über der Werkstatt. Das große Licht des Tages stand schon tief über dem Meer, das ruhig und sattgrün dalag, von einer Farbe wie wogendes Moos, gesprenkelt mit hell schimmernden Fetzen kühlen Dunstes, der den Horizont weiß gegen den Himmel verschwimmen ließ. Eiris half ihm, die Trage anzulegen und die gepolsterten Gurte aus Hiibu-Leder so eng zu schnüren, dass sie nicht reiben würden und ihn dennoch nicht in seinen Bewegungen einschränkten. Die Feuerschnur lag zusammengerollt an seiner Seite, mehrfach gefaltet, damit sie nicht aus Versehen gerissen werden konnte und gleichwohl gut zu erreichen war. Die Trage mitsamt der Rakete darauf wog schwerer, als Owen sie in Erinnerung hatte, aber er ließ sich nichts anmerken. Er war stark und hatte den Himmel schon zweimal bezwungen. Er würde ihn auch ein drittes Mal bezwingen.
Er entfaltete seine Flügel, weit, als wolle er sich von dem kühlen auflandigen Wind auf der Stelle davontragen lassen, und vollführte ein paar knallende Flügelschläge. Da, wo das Fett, das Eiris ihm einmassiert hatte, noch nicht ganz trocken war, kribbelte es auf der Haut. Die Luft rauschte leise in der Spanne seiner Flügel, und er spürte in Brust und Rücken das Ziehen der Muskeln, auf die eine Anstrengung ohne Beispiel wartete.
Eiris küsste ihn zum Abschied, ohne ein Wort, und als er sie umarmte, fühlte er die Ansätze ihrer schlanken, schmalen Flügel beben. Aber sie lächelte tapfer und sagte: »Nun geh schon.«
Da stieß sich Owen von der Klippe ab, griff weit in die Luft und segelte davon, hinaus auf den stillen, dunkel werdenden Ozean. So spät am Nachmittag war der Wind vom Meer her zu schwach für eine aufwärts tragende Strömung, aber er wusste, dass er um diese Jahreszeit eine wunderbare Thermik über den heißen Quellen finden würde, und genau so war es auch. Die Luft trug ihn empor, als wolle sie ihm zu verstehen geben, dass sie auf seiner Seite war. Ein, zwei Schläge nur waren nötig, ein bisschen manövrieren musste er, und im Nu stieg er höher hinauf, als er erwartet hatte. Als ihn die Thermik schließlich entließ, waren die Küstenlande zu Spielzeug geschrumpft.
Voll jubelnder Zuversicht zog er einen Kreis und begann das erste Schwungmanöver. Flügel anlegen, stürzen. Den Sturz mit Treibschlägen beschleunigen. Weit ausspannen und in einen flachen Bogen übergehen, bis in die Aufwärtsbewegung hinein, und dann ausholende, peitschende Schläge, hinauf, hinauf, hinauf …
Es durchfuhr ihn heiß und kalt, als er merkte, dass er nach dem ersten Schwung nicht nur keine Höhe gewonnen, sondern sogar Höhe verloren hatte, und nicht wenig. Fast hätte er aufgeschrien vor Enttäuschung. Wie konnte das sein? Er hatte diesen Schwung an die tausend Mal geübt, ihn bei seinen Aufsteigen zum Firmament Hunderte Male benutzt …
Aber eben niemals mit einer Lastentrage auf dem Rücken.
Es half nichts. Er würde abbrechen müssen. Er würde den Schwung der Pfeilfalken neu üben müssen, mit der Trage diesmal, und es dann neu versuchen. Doch da fiel ihm Eiris ein, die vielleicht bald ihr Kind erwarten würde und dass er wahrscheinlich nur noch dieses eine Mal hatte. Mit Anbruch der Frostzeit würde es vorüber sein. Und bis dahin waren es nur mehr wenige Tage.
Heute. Er musste es heute schaffen, oder er würde es niemals schaffen, die Sterne zu sehen.
Aber wie, wenn der Schwung nicht mehr funktionierte? Er glitt zurück in die Thermik, ließ sich wieder emportragen, versuchte es erneut. Diesmal ging es schon besser, oder zumindest weniger schlecht. Er musste beim Fallen eher mit den Treibschlägen beginnen, musste früher in die Abfangkurve übergehen und die Aufwärtsschläge weiter nach hinten durchziehen. Der dritte Versuch brachte ihn endlich über die ursprüngliche Höhe hinaus, wenn auch enttäuschend wenig. Er würde mindestens doppelt so viele Schwünge wie das letzte Mal brauchen, um den Himmel zu erreichen.
Nun, denn. Dann würde er eben doppelt so viele Schwünge machen.
Er begann. Schwung, Schwung, Pause. Schwung, Schwung, Pause. Die Routine kehrte zurück, die Konzentration stellte sich wieder ein. Es war wieder wie beim letzten Mal. Er würde es schaffen. Schwung, Schwung, Pause. Der Rhythmus des Aufstiegs, der ihn schon zweimal bis unter das Dach der Welt gebracht hatte.
Wieder versank die Welt hinter ihm, unter ihm. Wieder vergaß er alles, sogar Eiris, kannte nur noch die frostige Luft, den pfeifenden Wind in seinen Flügeln, das Keuchen seiner Lungen, den reißenden Schmerz in seinen Muskeln. Er stieg, und stieg, und stieg. Irgendwann verlosch das große Licht des Tages, und das kleine Licht der Nacht erschien. Das war ungewohnt, aber Eiris hatte ihn auf den Gedanken gebracht, dass er den Himmel ja nachts durchstoßen musste, wenn er die Sterne sehen wollte, denn das große Licht des Tages würde sie überstrahlen. Er hatte in den alten Büchern nachgelesen und gefunden, dass es sich auf den Welten, von denen die Ahnen stammten, in der Tat genau so verhalten hatte: Man hatte die Sterne nur nachts sehen können.
Der Himmel war eine graue, glimmende Glocke über ihm, das Meer ein schwarzer Abgrund unter ihm, und es war so still um ihn, als sei das Ende aller Zeiten gekommen. Doch Owen vollführte einen Schwung nach dem anderen, fiel, trieb, stieg auf und kletterte höher, unerbittlich, getrieben von einer Kraft, von der er nicht hätte sagen können, woher sie kam. Er schrie jetzt jedes Mal, wenn er den zum Zerreißen schmerzhaften tiefsten Punkt des Schwunges durchflog, aber es kam ihm gar nicht zu Bewusstsein, dass er schrie. Er merkte nicht, dass seine Flügel an den beiden Handschwingen eingerissen waren, und da es dunkel war, sah er auch das Blut nicht, das aus den Rissen quoll. Tränen rannen ihm über die Wangen, und er schmeckte sie nicht. Alles, was er sah, war der Himmel, dem er wieder näher kam, Spanne um Spanne, ein qualvoller Kampf, in dem jede Bewegung ihren Preis hatte. Doch, Hunger spürte er und Durst, aber er wagte es nicht, innezuhalten und etwas von seinem Proviant zu essen, weil er Angst hatte, er könnte danach nicht mehr die Kraft finden weiterzumachen. Dies war kein sportliches Ringen mehr, dies war ein verzweifelter Kampf geworden zwischen ihm und dem Himmel, und es ging in mehr als einem Sinn um sein Leben. Owens Keuchen war zu einem Schluchzen geworden, aber er machte weiter und weiter, stieg und stieg. Er würde es schaffen. Er würde vielleicht sterben dabei, aber er würde es noch einmal schaffen, den Himmel zu erklimmen. Und dann würde er … Er konnte noch nicht daran denken, was er dann tun würde. Er musste alle Kraft in den nächsten Schwung legen, musste zum Pfeilfalken werden, musste den Schmerz ertragen und alles in den Aufschwung legen, was noch in ihm war.
Die Nacht nahm kein Ende. Aber auch seine Kraft und sein Schmerz nahmen kein Ende.
Irgendwann begriff er, dass er angekommen war. Das Firmament, die ewige Wolkendecke, hing im kleinen Licht der Nacht über ihm wie ein hungriges, lippenleckendes Maul, brauste und brodelte unheilverkündend im Dunkeln. Owen glitt darunter dahin, weinend vor Erschöpfung und zitternd von der Kälte, nicht von der Angst. Nein, nicht von der Angst.
»Hier bin ich wieder«, schrie er irgendwann, oder flüsterte er es nur? Er wusste es nicht. Das graue, schwere Himmelsgewölbe, unter dem er sich so winzig vorkam wie ein Insekt, hörte ihn sowieso nicht.
Da war irgendetwas gewesen, das er hatte tun wollen, wenn er hier angelangt war. Ach ja. Nach und nach fiel es ihm wieder ein, wie eine Erinnerung aus einer unsagbar lange zurückliegenden Zeit. Die Trage. Die Rakete. Owen griff nach dem Bündel an seinem Gürtel, und alles tat ihm weh dabei. Es war so weit. Jetzt würde er den Himmel durchstoßen.
Er richtete den Oberkörper auf, flügelschlagend, brachte die Rakete in eine geeignete Position. Er sank allmählich abwärts, konnte die Höhe nur mit Mühe halten. Er dachte an Eiris, wollte irgendetwas sagen, aber ihm fiel nichts ein, und er hatte keine Zeit nachzudenken, weil er Höhe verlor, und so riss er einfach die Feuerschnur.
Es war, als träte ihn der größte aller Hiibu-Böcke mit aller Gewalt in den Rücken, so gewaltig traf ihn der Schlag, als die Rakete losging. Er konnte gerade noch daran denken, die Flügel einzufalten, damit sie nicht nach hinten gerissen wurden und in den Feuerstrahl gerieten, aber seine Fersen verbrannte er sich trotz allem in dem dröhnenden, unglaublich heißen Schweif. Unwillkürlich schloss er die Augen, und als er begriff, dass er vorwärtsgeschleudert wurde, riss er sie wieder auf und sah nur helles, flockiges Grau um sich herum, wirbelnde Schatten und den Widerschein des Raketenstrahls, der brannte und brannte und gar kein Ende nehmen wollte. War das der Himmel? Durchstieß er die ewigen Wolken? Er wusste es nicht, und was immer mit ihm geschah, er hatte ohnehin keinen Einfluss mehr darauf.
Dann war plötzlich ohrenbetäubende Stille und Dunkelheit, und Owen spürte, dass er sich immer noch bewegte, geradezu dahinschoss durch ein gestaltloses Nichts. Entsetzliche Enttäuschung griff nach seinem Herz. Es hatte nicht gereicht. Die Rakete war zu schwach gewesen, um ihn durch den Himmel auf die andere Seite zu stoßen.
Er spürte, dass ihm Tränen kamen, und es tat gut. Wenigstens hatte er es versucht, hatte getan, was menschenmöglich gewesen war. Nun, da alles vollbracht war, gab es ohnedies nichts mehr, was er darüber hinaus hätte tun können.
Doch plötzlich – wich das Grau, wich einer kühlen, erhabenen Dunkelheit …
Die Sterne. Owen sah sie, und der Anblick war großartiger, als er es sich jemals hätte vorstellen können. Tausende, Millionen von ihnen standen schweigend in klarer, endloser Schwärze, in Pracht und Herrlichkeit. Ihre herzzermalmende Majestät kündete von unfassbarer Weite und Größe, größer als alles, was Menschen in ihrer Welt kannten und kennen konnten. Mit Tränen in den Augen glitt Owen unter den Sternen dahin, in einem lautlosen Bogen über der grauen See ewiger Wolken, doch es waren Tränen unsagbarer Freude und Dankbarkeit, Tränen der Erfüllung, und er wusste, dass er sein Leben gewagt und gewonnen hatte in diesem Augenblick.
Lange dauerte er, Owens Flug unter den Sternen, oder vielleicht auch nicht, und es kam ihm nur so vor. Er breitete seine Flügel aus, weil er länger bleiben wollte, doch sie trugen nicht hier oben, und als die Wolken wieder nach ihm griffen und die Welt, faltete er sie zurück für den Sturz durch das Toben der Gewalten. Und als ihn das Weltendach endlich ausspie in den Luftraum, in dem er zu Hause war, riss er sich die Trage mit der leergebrannten Rakete vom Rücken und ließ sie in die Tiefe fallen, und so befreit und leicht breitete er die schmerzenden Flügel aus zu einem schlichten, ruhigen Gleitflug, der ihn nach Hause bringen würde, sofern er die richtige Richtung eingeschlagen hatte, oder jedenfalls zurück auf den Boden.
Er wusste nun, was er Eiris erzählen würde. »Die Sterne«, würde er ihr sagen, »sind nicht nur der Ort, von dem wir kommen.« Ihren Kindern würde er es ebenfalls sagen, und jedem, der es hören wollte. »Sie sind auch der Ort, zu dem wir einst zurückkehren müssen.«
Doch dann wurde ihm schwarz vor Augen. Er merkte noch, dass er zu stürzen begann, hinab in die grundlose Tiefe, dann wusste er nichts mehr.
Eiris
Der einsame Morgen
Eiris harrte die ganze lange Nacht hindurch auf der Klippe aus, von der Owen gestartet war. Blicklos starrte sie auf das schwarze Meer, bis das kleine Licht der Nacht erlosch und sie in vollkommener Finsternis zurückließ, und auch dann rührte sie sich nicht. Sie spürte weder die Kälte der Nacht noch, wie die Zeit verging, sie wartete einfach nur, dass Owen zurückkehrte. Doch als sich schließlich in der Ferne das Meer und der Himmel wieder voneinander schieden, weil das große Licht des Tages den Horizont mit einer blutroten Linie zeichnete, da war ihr, als zerbräche etwas in ihr auf immer.
Sie stand auf und wunderte sich, dass sie nicht weinte. Sie hätte sich gewünscht zu weinen, sich die Flügel zu raufen und zu wehklagen, doch ihr war nur kalt, und alles, was sie fühlte, war eine Leere in ihr, die wehtat.
Mein Herz ist gestorben, dachte sie, während sich die Dämmerung pastellfarben um sie herum erhob. Alles, was mir nun bleibt, ist zu warten, bis auch ich sterbe.
Dann breitete sie die Flügel aus und flog zurück zum Nest, um ihren Eltern zu sagen, was geschehen war.
»O Unglück!«, rief ihre Mutter und raufte sich die Federn. »Es ist alles meine Schuld!«
»Deine Schuld? Wieso das?«, fragte Eiris, maßlos verblüfft.
»Ich hätte dir rechtzeitig beibringen müssen, dass es nicht die Aufgabe der Frauen ist, Männer zu kühnen Taten zu ermutigen. Unsere Aufgabe, meine Tochter, ist es, sie davon abzuhalten!«
Eiris wollte etwas darauf entgegnen, etwas, an das sie noch am Tag zuvor felsenfest geglaubt hatte, doch sie hatte vergessen, was das gewesen war. So schwieg sie und neigte das Haupt, auf dass ihre Mutter es tröstend zwischen die Hände nahm, wie es Brauch war, wenn jemand untröstlichen Schmerz erlitt.
Inzwischen machte die Kunde von Owens Verschwinden im ganzen Nest die Runde. Die Männer der Ris zogen eilig ihre wärmsten Kleider an, fetteten sich rasch die Handschwingen ein und erklommen dann den obersten Startpunkt, wo sie sich absprachen, wer welches Gebiet absuchen würde. Die frühmorgendliche Luft rauschte vom Schlagen ihrer Flügel, als sie aufbrachen, in Gruppen zu dreien oder vieren. Es war kalt, und auf den Lederblättern lag der erste Raureif.
»Die Frostzeit steht bevor«, sagte Takaris, ein Holzbauer und einer der Kundschafter, die kurz nach Mittag zurückkehrten, um Bericht zu erstatten. »Das Meer ist kalt in der Bucht. Weiter draußen, bei den Inseln, haben wir schon Eis gesehen. Wenn Owen ins Meer gestürzt sein sollte, dann …« Er beendete den Satz nicht.
Sie fanden an diesem Tag keine Spur von Owen. Am darauffolgenden Tag brachte eine Gruppe sein Tragegestell zurück, das weit draußen im Meer getrieben hatte, in einer der starken, stets wechselnden Strömungen, sodass man nicht sagen konnte, woher es gekommen war. Der Zustand des Gestells gab zu schlimmsten Befürchtungen Anlass: Es war zerbeult wie von einem Sturz aus unbeschreiblichen Höhen, und die schulterseitigen Schwimmkörper wiesen Spuren auf, von denen alle, die sich mit derlei auskannten, sagten, es sei Blut. Dass es viel Blut gewesen sein musste, damit sich genug davon in dem porösen Holz festsaugen konnte, um trotz Wind, Wetter und dem salzigen Meerwasser Spuren zu hinterlassen, sagten sie nicht, aber Eiris verstand es auch so.
Die Männer des Ris-Stammes verbrachten zwei weitere Tage damit, nach Owen zu suchen. Sie flogen noch einmal die Orte ab, an denen sie schon am ersten Tag gesucht hatten, vor allem die vorgelagerten Inseln, die im Grunde die einzigen Plätze waren, wo Owen, sollte er einen Absturz überlebt haben, hätte am Leben bleiben können. Am Morgen des fünften Tages trat der Rat zusammen, und Omoris, die Älteste, verkündete den Beschluss: Nach menschlichem Ermessen bestehe keine Hoffnung mehr, Owen lebend wiederzufinden. Sie würden die Suche aufgeben und mit den Vorbereitungen für die Totentrauer beginnen.
Immer noch vermochte Eiris nicht zu weinen. Ihr Herz stak wie ein Stück Eis in ihrer Brust.
Ein Tag für das Abschiedsfest wurde festgesetzt, dann schickte man zwei Botschafter zum Nest der Wen. Diese knüpften sich, wie es Brauch war, lange schwarze Bänder um Fußknöchel und Handgelenke, was das Fliegen erschwerte, aber schon von Weitem von ihrer traurigen Mission kündete. Sie sollten Owens Stamm wissen lassen, was geschehen war, und alle einladen, gemeinsam mit den Ris um ihn zu trauern.
Die Nestlosen
Doch die Botschafter waren kaum aufgebrochen, als sie auch schon wieder zurückkehrten, um von einer beunruhigenden Beobachtung zu künden, die sie kurz nach dem Start gemacht hatten: Eine gewaltige Zahl von Fliegern nähere sich der Küste und dem Nestbaum der Ris, und alle Anzeichen sprachen dafür, dass es sich um einen Schwarm Nestloser handelte!
»Auch das noch«, meinte Eiris’ Vater. »Unheil kommt eben immer in Gesellschaft.«
Eiris verfolgte alles, was geschah, mit dem Gefühl, vollkommen gelähmt und innerlich tot zu sein. Von den Nestlosen hatte sie bislang nur erzählen hören. Räuber seien das, sagten manche, die den Nestern stählen, was sie zum Leben brauchten. Andere behaupteten, es seien Verstoßene, die sich zusammengetan hätten und sich bettelnd und auf andere ehrlose Weise durchs Leben schlügen. Andere wiederum meinten, das sei alles völlig übertrieben; Nestlose hätten, wie der Name schon sagte, einfach kein Nest, sondern zögen lieber umher, um mehr von der Welt zu sehen als ein normaler Mensch. Schon als Kind hatte Eiris gemerkt, dass die Nestlosen selbst denen, die sie vor Vorurteilen in Schutz nahmen, unheimlich waren, denn was ohne Zweifel feststand war, dass die Nestlosen den Lehren des Ahnherrn Wilian anhingen und sich auf das Verfemte Buch beriefen, von dem niemand wusste, was darin eigentlich geschrieben stand.
Alles geriet in helle Aufregung. »Sie werden uns die Vorräte für die Frostzeit wegnehmen«, unkte jemand. »Dann können wir selber betteln gehen bei den anderen Nestern.«
Der Rat beschloss, einen Kundschafter auszusenden. Dieser sollte den Nestlosen entgegenfliegen und sie nach ihrem Begehr fragen. Es sei nämlich, meinte Omoris, ungewöhnlich, dass Nestlose direkten Kurs auf ein Nest nähmen; normalerweise mieden sie die bewohnten Bäume.
Uktaris, ein Flugfischer und einer der schnellsten Flieger des Nests, meldete sich freiwillig. Er verlor keine Zeit, sondern startete, kaum dass Omoris ihr Einverständnis gegeben hatte, und flog, von allen beobachtet, mit atemberaubender Geschwindigkeit auf den sich nähernden Schwarm zu.
Er kehrte so rasch zurück, wie er gestartet war. »Sie bringen«, rief er noch im Landen, »Owen!«
Ein Schrei entrang sich Eiris’ Kehle. »Owen? Was ist mit ihm?«
»Er lebt«, erwiderte Uktaris keuchend, »aber er ist dem Tode näher als dem Leben.«
Der Schmerz drohte Eiris zu überwältigen. Sie durfte also noch einmal hoffen! Selbst auf die Gefahr hin, dass Owen ihr ein zweites Mal und endgültig genommen und der Verlust umso grausamer sein würde, konnte sie nicht anders als zu hoffen, zu hoffen mit jeder Faser ihres Seins und ohne Rücksicht darauf, was das Schicksal an Leid für sie bereithalten mochte.
Als die Nestlosen näher heran waren, sahen alle, dass sie jemanden transportierten. Zwölf von ihnen trugen ein Netz, das offensichtlich in aller Eile aus Schlammwasserlianen und dergleichen angefertigt worden war, nach dem Vorbild jener Tragenetze, die man seit jeher für den Transport Verletzter und Kranker verwendete. In diesem Netz lag reglos eine menschliche Gestalt mit bös zerzausten Flügeln. Dass es tatsächlich Owen war, sahen sie erst, als die Träger das Geflecht behutsam auf dem größten Landenetz des Ris-Baums absetzten.
Eiris stürzte zu ihm und war sich auf einmal köstlich gewiss, dass sie Owen zurückhatte, dass der Schrecken ausgestanden war, dass nun alles gut werden würde.
Dabei war Owen kaum wiederzuerkennen unter all den blauen Flecken, Schrammen und Beulen. Jemand hatte seine Flügel verbunden, und das, was nicht verbunden war, sah aus, als hätte man ihn brutal gerupft. Und er war bewusstlos und heiß vom Fieber.
Doch sie hatte ihn wieder. Er lebte.
»Wo habt ihr ihn gefunden?«, fragte sie, ohne den Blick von ihm zu wenden.
»Draußen bei den Inseln, die ihr die Tran-Leik-Inseln nennt«, sagte eine tiefe, ernste Stimme.
Eiris sah auf. Der Mann, der gesprochen hatte, war nur um weniges älter als sie selbst, doch sein Gesicht war von Narben gezeichnet und sein Haar von grauen Strähnen. Er trug die Kleidung der Nestlosen – Jacken und Hosen mit vielen Taschen und einen eng anliegenden Rucksack, der so geschnitten war, dass er die Flügel nicht behinderte –, und er hatte die prächtigsten Schwingen, die Eiris je bei einem Mann gesehen hatte.
»Ich bin Jagashwili«, sagte er. »Wir hatten unser Lager auf der äußersten der Leik-Inseln, und ich war wach in jener Nacht, in der dein Mann draußen ins Meer gestürzt ist. Er ist doch dein Mann?«
»Ja«, sagte Eiris, und es war wie ein süßer Schmerz, das sagen zu können. »Er ist mein Mann.«
Omoris kam über das Netz heran, unsicheren Schrittes, wie es alten Leuten auf den Netzen eigen war. »Ich bin Omoris, Älteste des Stammes und Mitglied des Rates«, wandte sie sich mit mühsam gewahrter Würde an den Nestlosen. »Bist du der Anführer eures Schwarms?«
Jagashwili neigte den Kopf in einer Geste der Verneinung. »Es ist allgemein bekannt, dass wir Kinder Wilians keine Nester bauen«, sagte er sanft. »Dass wir auch keine Anführer haben, wie ihr sie habt, wissen leider nur wenige. Ich führe diesen Transport, weil mir dadurch, dass ich Zeuge wurde, wie dieser Mann abstürzte, die Verantwortung für sein Leben übertragen war.«
»Woher wusstet ihr, wohin ihr ihn bringen müsst?«, fragte Omoris.
»Er ist einmal zu sich gekommen und hat einen Namen genannt: Eiris. Da wir wussten, dass einer der Ris-Stämme hier lebt, hat uns das auf die Idee gebracht, ihn zu euch zu bringen.«
»Eiris, das bin ich«, sagte Eiris. »Sein Name ist Owen. Was ist mit ihm geschehen? Was hat er?«
Jagashwili ging neben ihr und Owen in die Hocke, während alle anderen auf den Ästen, zwischen denen das Netz gespannt war, versammelt standen. »Es hat eine Weile gedauert, ehe wir ihn gefunden haben. Er trieb mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Meer. Mit Ausnahme von ein paar Rippen hat er nichts gebrochen, also denke ich, dass er, warum auch immer er abgestürzt ist, es im letzten Moment noch geschafft haben muss, den Sturz zu bremsen. Aber«, fuhr er mit Bedauern in der Stimme fort, »das hat ihn fast die Flügel gekostet. Und nun liegt er im Wundfieber. Das Meer war eiskalt an der Stelle, an der wir ihn aufgefischt haben.«
»Wird er wieder gesund werden?«
»Das kann niemand sagen. Aber wenn, dann wird er lange Zeit nicht fliegen können.«
»Owen ist der beste Flieger der Küstenlande«, verwahrte sich Eiris. »Niemand ist je so hoch geflogen wie er.«
»Dann«, sagte der Nestlose, »ist wohl auch niemand je so tief gestürzt.«
Eiris legte behutsam die Hand auf Owens Stirn. Jetzt, da sie die Geschichte gehört hatte, erschreckte sie die Hitze, die von ihm ausging.
Aber sie würde die Hoffnung nicht aufgeben.
»Er wird wieder gesund werden«, erklärte sie.
Sie brachten Owen in eine freie Hütte an der Gabelung des meerseitigen Hauptastes, legten ihn auf ein Lager aus Kollpok-Wolle und getrocknetem Stechgras, von dem man wusste, dass es Fieber senkte. Eiris wich nicht von seiner Seite, bereitete sich ein Lager neben ihm und wusch ihm unablässig den Schweiß vom Körper, den ganzen Tag lang. Ihre Mutter brachte ihr zu essen, andere brachten immer wieder frisches Wasser.
Eiris ging so vollkommen in der Pflege Owens auf, dass sie nichts mitbekam von dem, was ansonsten im Nest und darum herum geschah. Zur allgemeinen Verwunderung – und auch zum Verdruss mancher, die den Nestlosen immer noch nicht recht über den Weg trauten – zog der Schwarm, der Owen zurückgebracht hatte, nämlich nicht weiter. Stattdessen lagerten die Nestlosen ausgerechnet auf der Oberseite jenes Felsens, unter dem die Arbeitshöhle des Signalmachers lag und auf dem es keinen Margor gab: Sie brachten es tatsächlich fertig, auf dem blanken Felsboden zu schlafen!
Zwei Vertreter des Rates suchten die Nestlosen auf. Sie überbrachten ihnen große Körbe mit den erlesensten Speisen, die die Vorratskammern des Nests zu bieten hatten, einesteils als Zeichen der Dankbarkeit, hauptsächlich aber, um einen Anlass zu haben, mit den wild aussehenden Gestalten zu reden und sich nach ihren weiteren Plänen zu erkundigen.
»Wir sind noch an Owen gebunden«, erklärte Jagashwili. »Wir können erst weiterziehen, wenn wir wissen, welches Schicksal ihm beschieden ist.«
Diejenigen der Älteren, die schon einmal mit Nestlosen zu tun gehabt hatten, bestätigten, dass diese in derartigen Bahnen zu denken pflegten.
Wovon Eiris auch nichts mitbekam, war, dass die Rückkehr Owens und der Zustand, in dem er sich befand, auf das Nest regelrecht betäubend wirkten. Es gab keine lauten Gespräche in diesen Tagen, niemand sang mehr, niemand lachte. Die allgemeine Stimmung war ein großes, fast atemloses Warten. Alle waren überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Owen starb.
Alle außer Eiris.
»Du musst mit ihr reden«, sagte man zu Eiris’ Mutter, bis diese schließlich zu ihrer Tochter ging und ihr erklärte, dass Owen in einem Fieber zum Tode liege und sie sich keine Hoffnungen mehr machen dürfe.
»Owen ist stark«, erwiderte Eiris wütend und wollte nicht weiter zuhören, sodass ihre Mutter wieder ging.