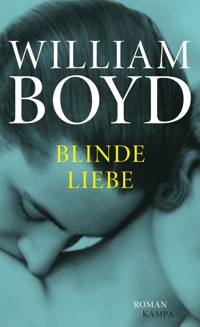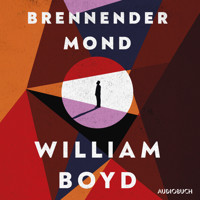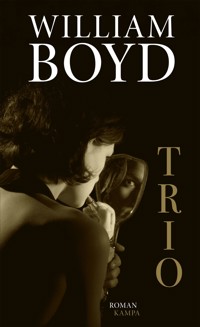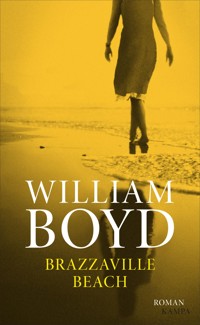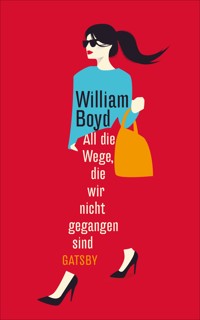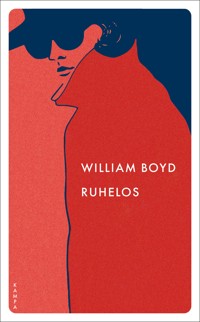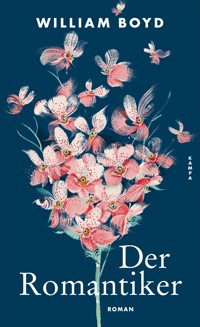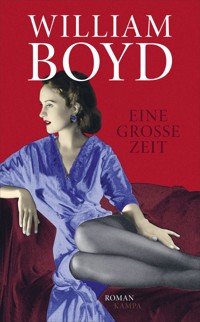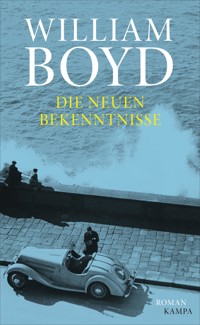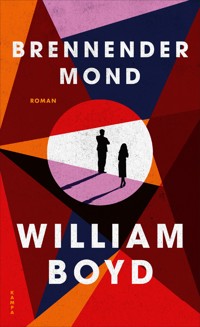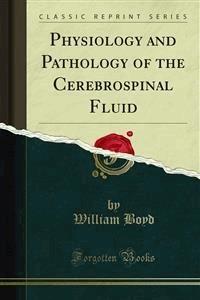Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Ein Mann. Eine Zufallsbekanntschaft. Ein Aktenordner. Ein Toter. Von einer Sekunde auf die andere muss Adam Kindred, angesehener Klimatologe, in London untertauchen. Er ist der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Jeder Weg in sein früheres Leben ist ihm versperrt - vollkommen undenkbar, Kontakt zur Familie aufzunehmen, Handy oder Kreditkarte zu benutzen, in sein Hotelzimmer zurückzukehren. Noch hofft Kindred, seine Unschuld schnell beweisen zu können. Natürlich ein Irrglaube. Doch dann wird aus dem Gejagten ein Jäger, der einem kriminellen Pharmakonzern das Handwerk legen will, und dabei geht Kindred eiskalt vor. Ein virtuoser literarischer Thriller, mitreißend und packend wie William Boyds Weltbestseller Ruhelos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Einfache Gewitter
Roman
Aus dem Englischen von Chris Hirte
Kampa
Für Susan
Einfache Gewitter vermögen es, sich zu Multizellengewittern von unbegrenzter Komplexität aufzubauen. Solche Multizellengewitter gewinnen dabei bedeutend an Schwere, und ihre Lebensdauer kann sich um den Faktor zehn verlängern. Der Urvater aller Gewitter jedoch ist das Superzellengewitter. Hierzu ist zu bemerken, dass selbst einfache Gewitter in der Lage sind, zu Superzellengewittern auszuarten. Solche Gewitter bauen sich nur sehr langsam ab.
L.D. Sax & W.S. Watson, Storm Dynamics and Hail Cascades
1
Beginnen wir mit dem Fluss – der Fluss ist der Ursprung aller Dinge und auch unser Ende, wie zu vermuten ist, aber warten wir ab, sehen wir, was wird. Gleich wird ein junger Mann erscheinen und am Fluss Aufstellung nehmen, hier an der Chelsea Bridge in London.
Und da, seht nur, kommt er schon. Zögernd steigt er aus dem Taxi, zahlt, schaut sich flüchtig um, richtet den Blick auf die helle Wasserfläche (es ist Flut und der Pegel ungewöhnlich hoch). Ein blasser, hochgewachsener junger Mann, Anfang dreißig, mit ebenmäßigen Zügen und müdem Blick, sein kurzes, dunkles Haar ist gut geschnitten, als käme er gerade vom Friseur. Er ist neu in der Stadt, ein Fremder, und heißt Adam Kindred. Soeben hat er ein Bewerbungsgespräch hinter sich gebracht (von dem einiges abhängt und das in der üblichen angespannten Atmosphäre verlief), nun will er, einem vagen Verlangen nach frischer Luft gehorchend, an den Fluss. Das Bewerbungsgespräch ist der Grund, weshalb er unter dem teuren Trenchcoat einen anthrazitgrauen Anzug mit neuem weißem Hemd und rotbrauner Krawatte trägt und weshalb er einen glänzenden, stabil wirkenden Aktenkoffer mit massiven Schlössern und Messingbeschlägen bei sich hat. Ohne zu wissen, dass sein Leben in den nächsten Stunden eine grundlegende, unwiderrufliche Wendung nehmen wird – er hat nicht die geringste Ahnung –, überquert er die Straße.
Adam stützte sich auf die Steinbalustrade, die im Bogen zur Chelsea Bridge führte, und blickte auf die Themse hinab. Die Flut war noch im Steigen begriffen, er sah, wie sich Treibgut mit überraschendem Tempo stromaufwärts bewegte, als würde das Meer seinen Unrat in den Fluss ergießen statt andersherum. Adam schlenderte weiter, den breiten Fußweg zur Brücke hinauf, und ließ den Blick von den vier Schornsteinen der Battersea Power Station (einer war von der Schraffur eines Gerüsts umwölkt) nach Westen schweifen, vorbei an der goldenen Spitze der Friedenspagode bis zu den zwei Schornsteinen der Lots Road Power Station. Die Platanen des Battersea Park auf dem anderen Ufer waren noch nicht voll belaubt – nur die Rosskastanien trugen ein dichtes, voreiliges Grün. London in den ersten Tagen des Mai … Er drehte sich zum Ufer von Chelsea um: Noch mehr Bäume – er hatte vergessen, dass manche Gegenden Londons dicht begrünt, ja geradezu waldig waren. Die Dächer der grandiosen viktorianischen Backsteinbauten erhoben sich hoch über die mit Platanen bestandene Uferstraße. Um wie viel? Zwanzig oder fünfundzwanzig Meter? Ohne das unablässige Rauschen des Verkehrs, das gelegentliche Hupen und Sirenengeheul wäre er nicht auf die Idee gekommen, sich mitten in einer Großstadt zu befinden: Die Bäume, die stumme Kraft der flutenden Wassermassen unter seinen Füßen, das besondere Leuchten, das von einer Wasserfläche ausgeht, übten eine wohltuende Wirkung auf ihn aus – es war genau das Richtige gewesen, zum Fluss zu fahren. Seltsam, wie einen solche Instinkte zu leiten vermögen, dachte er.
Als er kehrtmachte und zurücklief, wurde sein Blick auf ein klar umrissenes, schmales Uferdreieck gelenkt, das von der Brücke und der Uferstraße begrenzt war – dicht bewachsen mit Gras und einem Dickicht aus verwilderten Bäumen und Büschen. Beiläufig überlegte er, dass ein Grundstück in dieser Lage ein kleines Vermögen wert sein musste, selbst wenn es sich um ein langes, schmales Dreieck aus Gestrüpp handelte, und plante im Geiste einen keilförmigen Dreigeschosser mit Platz für ein Dutzend schmucke, balkonbewehrte Wohnungen. Dann sah er, dass er, um diese Idee umzusetzen, einen riesigen Feigenbaum würde fällen müssen, der dicht neben der Brücke wuchs und, wie er im Näherkommen schätzte, mit seinen großen glänzenden Blättern, die sich gerade entfalteten und noch ganz steif und frisch aussahen, viele Jahrzehnte alt sein musste. Ein ehrwürdiger Feigenbaum an der Themse. Seltsam, dachte er. Wie war der dorthin gekommen, und was geschah mit den Früchten? Schon sah er einen großen Teller mit Parmaschinken und halbierten Feigen vor sich. Wo hatte er so etwas gegessen? In Portofino, auf der Hochzeitsreise mit Alexa? Oder vorher? Während einer Ferienreise als Student vielleicht? Sofort bereute er, an Alexa gedacht zu haben. Die friedvolle Stimmung, die ihn eben noch erfüllt hatte, verwandelte sich in Trauer und Wut. Also konzentrierte er sich lieber auf seine kleinen Hungerschübe und bekam plötzlich, vom Gedanken an Feigen und Parmaschinken, Appetit auf italienisches Essen. Italienische Küche der einfachen, ehrlichen Art – Insalata tricolore, Pasta alle vongole, Scaloppine al limone, Torta della nonna. Das wäre jetzt genau das Richtige.
Er lief nach Chelsea hinein und fand in den stillen Straßen hinter dem Royal Hospital zu seinem nicht geringen Erstaunen fast sofort ein italienisches Restaurant – geradeso wie im Märchen. Da lag es vor ihm, geduckt unter den gelben Markisen mit dem venezianischen Löwenwappen, in einer schmalen Straße mit beigefarbenen, stuckverzierten Reihenhäusern – wie eine Fata Morgana, dachte er. Keine Läden, kein Pub, kein anderes Restaurant in Sicht – wie hatte es sich hier mitten in einer Wohnstraße etablieren können? Adam schaute auf die Uhr – zwanzig nach sechs. Ein wenig früh für eine Mahlzeit, aber er spürte jetzt richtigen Hunger, und er sah, dass Gäste im Lokal saßen. Schon kam ein gut gebräunter Kellner an die Tür, hielt sie strahlend auf und rief: »Treten Sie ein, Sir, treten Sie ein. Ja, wir haben geöffnet. Nur herein, nur herein.« Der Mann nahm ihm den Mantel ab und führte ihn an der kleinen Bar vorbei in den hellen, L-förmigen Gastraum, während er die anderen Kellner munter kommandierte und tadelte, als wäre Adam sein hoch geschätzter Stammgast und durch ihr Versagen in irgendeiner Weise in seinem Wohlbefinden gestört.
Er platzierte Adam an einem Zweiertisch mit dem Rücken zur Straße und bot ihm an, sich seines Aktenkoffers anzunehmen, doch Adam wollte ihn lieber bei sich behalten. Er ließ sich die Speisekarte bringen und sah sich um. Acht Touristen – vier Männer, vier Frauen – besetzten einen großen runden Tisch und aßen schweigend, alle blau gekleidet und mit identischen blauen Einkaufsbeuteln zu ihren Füßen. Zwei Tische von ihm entfernt saß noch ein einzelner Gast, ein Mann, der gerade die Brille abgenommen hatte und sein Gesicht mit einem Papiertaschentuch abwischte. Er wirkte aufgeregt, irgendwie verärgert, und sah zu ihm herüber, während er die Brille wieder aufsetzte. Als sich ihre Blicke begegneten, reagierte der Mann mit einer leichten Neigung des Kopfes, einem einverständigen Lächeln des Erkennens – allein Speisende unter sich –, das zu besagen schien: Ich bin keineswegs einsam oder traurig, ich esse gern allein, aus eigenem Entschluss, genauso wie Sie. Auf dem Tisch hatte er Papiere ausgebreitet. Adam lächelte zurück.
Er hatte den Salat des Hauses gegessen – Spinat, Schinken, Parmesanspäne mit Sahne-Dressing – und war gerade bei den Scaloppine al vitello (mit grünen Bohnen und Röstkartoffeln), als ihn der Mann mit einer Verbeugung nach der genauen Uhrzeit fragte. Sein Akzent war amerikanisch, sein Englisch fehlerlos. Adam gab ihm Auskunft – achtzehn Uhr zweiundfünfzig –, der Mann stellte sorgfältig seine Uhr, so kamen sie unweigerlich ins Gespräch. Sein Gegenüber stellte sich vor: Dr. Philip Wang. Adam nannte ebenfalls seinen Namen und erklärte, er sei seit seiner Kindheit nicht mehr in London gewesen. Dr. Wang bestätigte, auch er kenne die Stadt so gut wie gar nicht. Er wohne und arbeite in Oxford und komme nur gelegentlich zu kurzen Besuchen nach London – für einen oder zwei Tage, um Patienten aufzusuchen, die an einem seiner Forschungsprojekte teilnähmen. Adam sagte, er sei aus Amerika nach London gekommen, habe sich hier um einen Job beworben, weil er sich verändern wolle, nach Hause zurückkehren, mit anderen Worten.
»Einen Job?« Dr. Wang musterte Adams teuren Anzug. »Arbeiten Sie in einer Bank?« In seiner Vermutung schien so etwas wie Missbilligung anzuklingen.
»Nein, an der Uni – ich bewerbe mich für ein Forschungsstipendium am Imperial College«, fügte Adam hinzu und fragte sich, ob ihn das in den Augen von Dr. Wang entlastete. »Ich komme gerade vom Vorstellungsgespräch.«
»Gute Uni«, sagte Wang abwesend, als wäre er mit den Gedanken woanders. »Jaaa …« Dann kam er wieder zur Sache und fragte höflich: »Wie ist es gelaufen?«
Adam zuckte die Schultern. So etwas könne man nie wissen. Seine drei Gesprächspartner – zwei Männer und eine Frau mit fast kahl geschorenem Kopf – hatten nichts durchblicken lassen, waren von einer fast absurden Höflichkeit und Förmlichkeit gewesen, ganz anders als seine amerikanischen Kollegen.
»Imperial College. Sie sind also auch Wissenschaftler«, stellte Wang fest. »Welches Fach?«
»Klimatologie«, sagte Adam. »Und Sie?«
Wang dachte kurz nach, als wäre er sich nicht sicher. »Immunologie, vermutlich, ja … Oder man könnte sagen, ich bin Allergologe.«
Mit einem Blick auf seine neu gestellte Uhr brach er das Gespräch ab. Er müsse jetzt gehen, er habe zu tun, Anrufe zu erledigen. Er zahlte die Rechnung in bar, sammelte mit fahrigen Bewegungen seine Papiere zusammen, ließ einzelne Blätter zu Boden fallen, bückte sich, um sie aufzuheben, und murmelte dabei vor sich hin – plötzlich wirkte er ziemlich zerstreut, als hätte ihn nach beendeter Mahlzeit das Leben mit all seinen Sorgen und Ängsten wieder eingeholt. Beim Gehen schüttelte er Adam die Hand. Er wünsche ihm Glück und er hoffe, Adam werde die Stelle bekommen. »Ich habe ein gutes Gefühl«, fügte Wang unsinnigerweise hinzu, »ein wirklich gutes Gefühl.«
Beim Tiramisu stellte Adam fest, dass Wang etwas zurückgelassen hatte: eine durchsichtige Plastikmappe mit Reißverschluss unter einem Nachbarstuhl, halb verdeckt vom überhängenden Tischtuch. Er griff nach der Mappe und sah Wangs Visitenkarte, die in einem Einschub des Deckels steckte. Er zog sie heraus und las: Dr. Philip Y. Wang MD, PhD. (Yale), FBSI, MAAI und darunter Leiter der Abt. Forschung und Entwicklung Calenture-Deutz PLC. Auf der Rückseite fanden sich zwei Adressen mit Telefonnummern, eine lautete Cherwell Business Park, Oxford (Unit 10), die andere, eine Londoner, Anne Boleyn House, Sloane Avenue, SW3.
Beim Zahlen freute er sich, dass er seine neue Geheimnummer im Kopf hatte, und tippte sie, ohne überlegen zu müssen, in das Handset ein. Auf seine Frage, ob Dr. Wang öfter ins Lokal komme, erhielt er die Antwort, er sei hier noch nie gesehen worden, worauf Adam beschloss, ihm die Mappe nach Hause zu bringen – ein Akt der Hilfsbereitschaft, der ihm angebracht schien, zumal sich Wang so zuversichtlich zu seinen Karriereaussichten geäußert hatte –, und erkundigte sich nach dem Weg zur Sloane Avenue.
In der King’s Road, die noch immer von Einkäufern bevölkert war (fast ausschließlich Franzosen und Spaniern, wie es schien), kam ihm der Gedanke, dass Wang die Mappe vielleicht absichtlich zurückgelassen hatte, damit er sie fand, und fragte sich, ob sich dahinter der Versuch verbarg, ein Wiedersehen anzubahnen: zwei einsame, Zerstreuung suchende Männer … Oder war es gar eine homosexuelle Avance? Adam hatte sich schon öfter gefragt, ob es etwas an ihm gab, was ihn für Schwule attraktiv machte. Er konnte sich an drei Situationen erinnern, in denen er bedrängt worden war, und eine vierte, wo ihm ein Mann vor einer Restauranttoilette in Tucson, Arizona, aufgelauert und ihm einen Kuss aufgezwungen hatte. Adam hielt Wang nicht für schwul – nein, das war lachhaft –, aber er sah jetzt ein, dass es wohl klüger war, vorher anzurufen. Er zog Wangs Visitenkarte aus dem engen Plastikeinschub, setzte sich auf eine Holzbank vor einem Pub, griff nach dem Handy und tippte die Nummer ein.
»Philip Wang.«
»Dr. Wang, hier Adam Kindred. Wir haben uns gerade im Restaurant gesehen –«
»Ja, natürlich. Und Sie haben meine Mappe. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade dort angerufen, und man hat mir gesagt, Sie hätten sie mitgenommen.«
»Ich dachte, es geht am schnellsten, wenn ich sie einfach vorbeibringe.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen. Kommen Sie doch auf einen Drink herauf – oh, da ist jemand an der Tür. Das sind doch nicht Sie, oder?«
Adam lachte. Er werde vermutlich noch fünf Minuten brauchen, sagte er und klappte sein Handy zu. Kommen Sie auf einen Drink herauf – in aller Freundlichkeit, ohne anzüglichen Unterton –, aber vielleicht war das der amerikanische Akzent, flach, tonlos und professionell, der nichts verriet und bei Adam den Eindruck erweckte, dass Wang kaum überrascht gewirkt hatte, als er hörte, Adam sei zu ihm unterwegs und wolle ihm die Mappe bringen …
Anne Boleyn House war ein imposanter, fast festungsartiger Art-déco-Bau aus den dreißiger Jahren, mit einer halbkreisförmigen, von Buchsbaumhecken gesäumten Einfahrt und einem uniformierten Portier in der Lobby, der hinter einem langen Marmortresen saß. Adam trug sich ins Besucherbuch ein und wurde zur Wohnung G14 in der siebten Etage gewiesen. Nach seinem Anruf hatte er noch einmal überlegt, ob es wirklich nötig war, Wang in seiner Wohnung aufzusuchen – er hätte die Mappe ohne Weiteres beim Portier abgeben können, wie ihm jetzt klar wurde –, aber er hatte an diesem Abend nichts weiter vor, und es zog ihn auch nicht unbedingt in sein bescheidenes Hotel in Pimlico. Mit ein oder zwei Drinks bei Wang konnte er sich die Zeit vertreiben, außerdem schien Wang ein interessanter und gebildeter Mensch zu sein.
Adam trat aus dem Lift in einen langen Flur, der ohne jede Besonderheit war – dunkles Parkett, blassgrüne Wände, identische, nischenlose Türen, unterschieden nur durch ihre Nummern. Wie Zellen, dachte er. Oder, wäre das hier ein Film, die ideenlose Umsetzung kafkaesker Einförmigkeit. Dazu ein unangenehm in die Nase stechender Geruch – eine Mischung aus Bohnerwachs und ätzendem Toilettenreiniger. Kleine grelle Deckenstrahler begleiteten ihn auf dem Weg zu Wohnung G14. Dahinter machte der Flur einen rechtwinkligen Knick und öffnete den Blick auf einen weiteren seelenlosen Korridorschlauch, an dessen Ende eine grüne Notausgangsleuchte glomm.
Adam sah, dass Wang seine Tür offen gelassen hatte – ein Willkommenszeichen? Doch er klingelte trotzdem, er scheute sich, einfach einzutreten. Er hörte, wie Wang eine Tür öffnete, hörte, wie sie geschlossen wurde, nicht aber die Aufforderung »Adam? Bitte, treten Sie doch ein«.
Er klingelte noch einmal.
»Hallo?« Adam drückte leicht gegen die Tür. »Dr. Wang? Philip?«
Er öffnete die Tür und betrat ein kleines enges Wohnzimmer. Zwei Lehnstühle dicht an einem Couchtisch, ein riesiger Flachbildfernseher, Trockenblumen in Strohvasen, eine kleine Kochnische hinter einer halbhohen Schwingtür. Adam stellte seinen Aktenkoffer am Couchtisch ab und legte Wangs Mappe neben den aufgefächerten Golf-Magazinen ab – lächelnde Männer in Pastellfarben, die ihre Schläger schwingen. Dann hörte er Wangs Stimme, leise und drängend.
»Adam? Ich bin hier …«
Im Nachbarzimmer. Doch nicht das Schlafzimmer? Bitte nicht!, dachte Adam und bereute heftig, heraufgekommen zu sein, während er auf die Tür zuging.
»Ich kann aber nur fünf Minuten blei –«
Philip Wang lag auf dem Bett, in einer Blutlache, die sich schnell ausbreitete. Er war bei Bewusstsein, mit einer flossenartigen Handbewegung winkte er Adam näher. Das Zimmer war verwüstet, zwei kleine Aktenschränke umgeworfen und ausgeleert, Nachttischschubladen herausgezerrt, ein Kleiderschrank mit ein paar ausholenden Bewegungen ausgeräumt, Anzüge und Kleiderbügel wild verstreut.
Wang zeigte auf seine linke Seite. Adam hatte es nicht bemerkt – der Griff eines Messers ragte aus Wangs blutdurchtränktem Pullover.
»Ziehen Sie es raus«, sagte Wang. Sein Gesicht zeigte Spuren von Gewalteinwirkung – die Brille verbogen, aber nicht zerbrochen, seine Nase blutete, die Lippe war geplatzt, auf den Wangenknochen zeigte sich eine rote Prellung.
»Sind Sie sicher?«, fragte Adam.
»Bitte …«
Mit bebenden Händen schien er Adams rechten Arm zum Messergriff zu lenken. Adam umfasste ihn locker.
»Ich fürchte, das ist nicht die richtige Art –«
»Mit einem Ruck«, sagte Wang und hustete. Ein wenig Blut quoll aus seinem Mund und floss ihm übers Kinn.
»Sind Sie wirklich sicher?«, wiederholte Adam. »Ich weiß nicht, ob das die korrekte –«
»Bitte!«
Ohne weiter zu überlegen, packte Adam das Messer und zog es heraus, mühelos wie aus einem Futteral. Es war ein Brotmesser, stellte er fest, während ein Blutschwall aus der Wunde schoss und warm über seine Finger strömte.
»Ich rufe die Polizei«, sagte Adam, legte das Messer hin und wischte sich die Hand unbedacht an der Tagesdecke ab.
»Die Akte«, sagte Wang und bewegte die Finger, als würde er eine unsichtbare Tastatur anschlagen.
»Ich habe sie.«
»Auf keinen Fall dürfen Sie –« Mit diesen Worten, gefolgt von einem kurzen Röcheln, das wie ein Wutschnauben klang, verstarb Philip Wang.
Adam wich entsetzt zurück, stolperte über einen Kleiderhaufen aus Wangs Jacketts und Hosen und kehrte ins Wohnzimmer zurück, um nach dem Telefon zu suchen. Er fand es auf einer hübschen, eigens dafür angebrachten Konsole neben der Tür, und als er nach dem Hörer griff, sah er, dass noch Blut an seiner Hand klebte, dass es von einem Finger herabtropfte. Ein paar Tropfen fielen auf das Telefon.
»Scheiße …«, sagte er, es war, wie er merkte, seine erste verbale Reaktion auf den Schock. Was zum Teufel ging hier vor?
Dann hörte er, wie das Fenster in Wangs Schlafzimmer geöffnet wurde und jemand einstieg, mit schwerem Schritt. Augenblicklich verließ ihn das Gefühl des Schocks, das ihn eben noch beherrscht hatte. Oder zumindest glaubte er, dass es das Schlafzimmerfenster war – vielleicht auch das Badfenster –, aber er hatte das Klacken eines Fensterriegels gehört, typisch für die Messinggriffe, mit denen die industriegefertigten Stahlrahmen der aus vielen kleinen Scheiben bestehenden Fenster gesichert wurden, die dem Anne Boleyn House eine etwas gedrückte Anstaltsatmosphäre verliehen.
Adam griff seinen Aktenkoffer und Wangs Mappe und warf die Wohnungstür mit einem Knall hinter sich zu. Er schaute zum Lift, dann besann er sich anders, ging um die Ecke und schritt mit normalem Tempo, ohne zu rennen, nicht ungebührlich schnell, auf die grüne Notausgangsleuchte und die Feuertreppe zu.
Er stieg die sieben Etagen des schlecht beleuchteten Treppenhauses hinab, ohne jemandem zu begegnen, und gelangte zwischen zwei großen, robusten Müllcontainern hindurch auf eine Seitenstraße hinter dem Anne Boleyn House. Es stank entsetzlich nach faulenden Küchenabfällen, Adam musste würgen, und er spuckte aus, während er sich hinhockte, den Aktenkoffer öffnete und Wangs Mappe hineinschob. Er blickte auf und sah zwei junge Köche in weißen Jacken und blau karierten Hosen, die sich in einem Eingang, ein paar Meter entfernt, eine Zigarette anzündeten.
»Stinkt ganz schön, was?«, rief ihm einer grinsend zu.
Adam quittierte es mit erhobenem Daumen und machte sich betont lockeren Schrittes in die entgegengesetzte Richtung davon.
Eine Weile lief er ziellos durch die Straßen von Chelsea, um einen klaren Kopf zu bekommen, Sinn in das Ganze zu bringen, zu verstehen, was passiert war. In ihm überschlugen sich die Bilder des Schreckens – Wangs zerschundenes Gesicht, der Griff des Brotmessers, die zuckende, suchende Handbewegung –, aber er war nicht so verstört, dass er nicht begriff, was er getan hatte, welche Folgen sein unbedachtes, spontanes Handeln nach sich ziehen würde. Niemals hätte er Wangs Befehl Folge leisten dürfen, das war ihm jetzt klar. Auf keinen Fall hätte er das Messer herausziehen dürfen, sondern einfach zum Telefon gehen und die 911 oder besser 999 wählen müssen. Jetzt hatte er Wangs Blut an den Händen und unter den Nägeln, schlimmer noch, seine Fingerabdrücke befanden sich auf dem verfluchten Brotmesser. Aber wie hätte man in einer solchen Situation reagieren sollen?, brüllte ihm seine andere Gehirnhälfte zu, wütend und verzweifelt. Du hattest keine Wahl, es war die letzte Bitte eines Sterbenden. Wang hatte ihm ja die Finger förmlich um den Messergriff gelegt, ihn angebettelt, es herauszuziehen, regelrecht gebettelt …
Er blieb einen Moment stehen, um sich zu beruhigen. Sein Gesicht war schweißbedeckt, sein Brustkorb pumpte, als wäre er meilenweit gerannt. Er atmete tief durch. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Erinner dich, wie es gewesen ist … Angespannt lief er weiter. War er mitten in Wangs Ermordung hineingeplatzt? In einen Raubüberfall, der schrecklich danebengegangen war? Das Türenklappen, das er gehört hatte, als er die Wohnung betreten wollte, musste vom Täter stammen, der das Schlafzimmer verließ – und das Geräusch der Person, die in die Wohnung einstieg, musste ebenfalls der Täter verursacht haben – der Mörder. Er musste vom Balkon eingestiegen sein, überlegte er, während ihm jetzt einfiel, dass er weiter oben an der Fassade des Anne Boleyn House schmale Balkone bemerkt hatte. Also war der Mann auf den Balkon geflohen, als er Adam hatte kommen hören, hatte dort gewartet, bis Adam das Schlafzimmer verließ, um zu telefonieren … ja, die Polizei, ich muss anrufen, ermahnte sich Adam. Schlagartig wurde ihm klar: Es war ein schrecklicher, ein mordsdummer Fehler gewesen, einfach wegzulaufen, die Treppe runter … Aber wenn ihn dieser Kerl erwischt hätte? Nein, das war doch logisch, dass er von dort wegmusste, nichts wie weg, so schnell wie möglich, sonst könnte er jetzt auch tot sein, allmächtiger Gott … Er griff in die Jacke, nach dem Handy, und sah Wangs getrocknetes Blut an seinen Fingern. Erst einmal waschen!
Er kam zu einem Platz, der an eine Sportanlage und – zu seiner Überraschung – an eine Galerie grenzte; kleine Fontänen sprudelten aus den Gehsteigplatten, Pärchen saßen auf niedrigen Mauern, Kinder flitzten auf ihren teuren Alu-Rollern umher. Er hockte sich neben eine Fontäne und wusch die rechte Hand im kalten Wasser, in einer hüpfenden Wassersäule, die, der Schwerkraft trotzend, senkrecht nach oben schoss. Seine Hand war jetzt sauber – und sie zitterte, wie er feststellte. Er musste etwas trinken, er musste sich beruhigen, Ordnung in seine Gedanken bringen, dann würde er die Polizei anrufen: Irgendein Gedanke in seinem Hinterkopf quälte ihn, etwas, was er getan oder versäumt hatte, er brauchte nur ein wenig Zeit zum Nachdenken.
Adam erfragte den Weg nach Pimlico und lief weiter, jetzt mit einem Ziel. Auf dem Weg sah er ein Pub, beruhigend unauffällig – so als wollte es nichts anderes sein als »durchschnittlich«: ein durchschnittlich sauberer Teppichboden, die übliche Musikberieselung, drei Spielautomaten, die nicht zu laut vor sich hin lärmten, ein etwas heruntergekommenes Kleineleute-Publikum, eine vollkommen zufriedenstellende Auswahl an Biersorten und das zu erwartende Speisenangebot – Pasteten, Sandwiches und ein Tagesgericht (unsauber von der Anzeigetafel gewischt). Adam fand eine merkwürdige Befriedigung in seinem Entschluss, sich an die annehmbare Norm zu halten, nach nichts Höherem zu streben als dem erträglichen Mittelmaß. Diesen Ort würde er sich merken. Er bestellte einen großen Whisky mit Eis und ein Tütchen Erdnüsse, trug sein Glas zu einem Tisch in der Ecke und fing an zu trinken.
Er fühlte sich schuldig. Aber warum? Er hatte doch nichts Böses getan? War es, weil er weggelaufen war? Aber in dieser Situation wäre jeder weggelaufen, sagte er sich; der Schock, der Mörder im Nebenzimmer … Es war eine atavistische Angst – eine, die jedem unschuldigen Kind vertraut ist, das mit ernsten Problemen konfrontiert wird. Schnell das Weite zu suchen, sich in Sicherheit zu bringen, sich erst einmal zu sammeln war eine naheliegende, völlig natürliche Reaktion. Er brauchte ein bisschen Bedenkzeit, ein bisschen Spielraum …
Der Whisky brannte ihm wohlig im Rachen, er kaute Erdnüsse, leckte sich das restliche Salz von der Handfläche, pulte Erdnusssplitter mit dem Fingernagel aus den Zähnen. Was ließ ihm keine Ruhe? Waren es Wangs letzte Worte? »Auf keinen Fall dürfen Sie –« Aber was durfte er nicht? Die Akte mitnehmen? Die Akte liegen lassen? Dann holte ihn der Gedanke an den toten Wang wieder ein, der Schock befiel ihn erneut, und er begann zu zittern. Er ging an die Bar, bestellte noch einen Whisky und noch ein Tütchen Erdnüsse.
Adam trank seinen Whisky und verzehrte die Erdnüsse mit einer Gier, die ihn überraschte, er leerte das Tütchen in die Hand und warf die Nüsse hastig in den Mund, in fast affenartiger Manier (einzelne Nüsse fielen dabei herunter). Sekunden später war die Tüte geleert und lag zusammengeknüllt auf dem Tisch, wo sie sich in den nachfolgenden Sekunden knisternd wieder entknüllte, während Adam die vereinzelten Erdnüsse, die seinem plötzlichen Anfall von Fressgier entkommen waren, vom Tisch aufsammelte und den anderen folgen ließ. Den salzigen, wachsartigen Erdnussgeschmack auf der Zunge, fragte er sich, ob es eine nahrhaftere, angenehmere Speise überhaupt geben konnte – manchmal waren gesalzene Erdnüsse alles, was der Mensch zum Leben brauchte.
Er suchte die Herrentoilette, stieg geduckt eine schmale Treppe hinab, die sich krümmte, als hätte sie vergebens versucht, zur Spirale zu werden, und gelangte in den Keller, wo sich Bierdunst mit durchdringendem Uringestank vermischte. Beim Händewaschen unter der gnadenlos grellen Beleuchtung sah er, dass sein Hemd und seine Krawatte mit winzigen schwärzlichen Tupfen übersät waren – mit Blutspritzern, wie er vermutete, mit Dr. Wangs Blut –, und bekam weiche Knie. Sofort stand ihm die Szene in Dr. Wangs Wohnung wieder vor Augen, das herausgezogene Brotmesser und der Blutschwall, der ihm gefolgt war. Der Schock angesichts dessen, was er getan und erlebt hatte, holte ihn wieder ein – er musste zurück ins Hotel, beschloss er augenblicklich, das Hemd wechseln (und das getragene als Beweismittel behalten), dann die Polizei anrufen. Niemand würde ihm vorwerfen, dass er den Tatort verlassen hatte – war doch der Mann, der Mörder auf dem Balkon, wieder in die Wohnung eingestiegen. Unter solchen Umständen war es gar nicht möglich, Ruhe und kühlen Kopf zu bewahren – nein, nein, nein –, daraus konnte man ihm keinen Vorwurf machen.
Auf dem Rückweg nach Pimlico, zum Grafton Lodge, seinem bescheidenen Hotel, legte er sich seine Geschichte zurecht, blieb ein paarmal stehen, um sich in den fast identischen Straßen mit den stuckverzierten Reihenhäusern zu orientieren und dann, wenn er sicher war, auf dem richtigen Weg zu sein, mit neuer Zuversicht weiterzugehen, erfüllt von der Gewissheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, und erleichtert darüber, dass dieser schreckliche Abend – all das Furchtbare, das er erlebt hatte – seinen angemessenen juristischen Abschluss finden würde.
Grafton Lodge bestand aus zwei Reihenhäusern, die zusammengelegt ein kleines Hotel mit achtzehn Betten ergaben. Ungeachtet des bemerkenswert großspurigen Namens hatten die Besitzer – Seamus und Donal – in einem Parterrefenster den Schriftzug Zimmer frei aus pinkfarbenen Neonröhren angebracht, der vor sich hin blinkte wie in einem schlechten Film, und die Eingangstür war beklebt mit den Logos internationaler Reiseagenturen, Travelclubs und Hotelführer – eine bunte Collage aus Abziehbildern, Stickern und Plaketten. Von Vancouver bis Osaka schätzte man Grafton Lodge offenbar als eine Art Heimstatt in der Fremde.
Doch über sein kleines, sauberes Zimmer mit Blick auf einen gepflasterten Hof konnte sich Adam fairerweise nicht beklagen. Alles funktionierte: der Wasserkocher, die Dusche, die Minibar, der Fernseher mit seinen achtundneunzig Kanälen. Seamus und Donal waren freundlich und hilfsbereit und lasen ihm jeden Wunsch von den Augen ab, und doch durchfuhr ihn ein eisiger Schreck, als er in die Straße einbog und den pinkfarbenen Schriftzug Zimmer frei blinken sah. Er blieb stehen und zwang sich zum Nachdenken: Es war nun weit über eine Stunde, fast zwei Stunden her, seit er aus dem Anne Boleyn House geflohen war. Doch er hatte seinen Namen in das Besucherbuch geschrieben, das ihm der Portier hingeschoben hatte – Adam Kindred –, und als Adresse hatte er Grafton Lodge, SW1 angegeben. Das war der katastrophale Fehler, den er begangen hatte … Der letzte Besucher von Philip Wang hatte Namen und Adresse freundlicherweise ins Gästebuch eingetragen. Als er die Folgen seiner Arglosigkeit bedachte, wurde ihm übel. Doch alles schien in Ordnung, während er sich Grafton Lodge näherte. Durch die mit Logos beklebte Scheibe der Eingangstür sah er Seamus an der Rezeption mit einem der Zimmermädchen reden – Branca, so hieß sie wohl –, und in der nur für Hotelgäste bestimmten Lounge saßen ein paar Leute. Auf der anderen Straßenseite parkte ein schwarzes Taxi, der Fahrer döste hinter dem Steuer und wartete offensichtlich darauf, dass einer der zechenden Geschäftsreisenden die Lounge verließ.
Adam redete sich gut zu: Geh hinein, geh in dein Zimmer, wechsle deine blutbespritzten Sachen, ruf die Polizei und geh zum Polizeirevier – bring diesen Horror zu einem angemessenen, anständigen Abschluss. Das schien die einzig vernünftige Lösung, die einzige vollkommen normale Verhaltensweise zu sein, deshalb verstand er selbst nicht, warum er beschloss, zur Hofzufahrt am Ende der Straße weiterzugehen und von hinten zu seinem Fenster hinaufzuschauen. Irgendetwas anderes nagte jetzt an ihm, noch etwas, was er getan oder versäumt hatte, und diese Tat oder Nicht-Tat verfolgte ihn. Vielleicht wäre er ruhiger, wenn er wusste, was es war, und wenn er sich einen Reim darauf machen konnte.
Er stand auf dem dunklen Hof hinter dem Grafton Lodge, suchte an der Rückfront des Hauses nach seinem Fenster und fand es: dunkel, die Gardinen halb zugezogen, wie er sie vor seinem Vorstellungsgespräch im Imperial College hinterlassen hatte. Wozu das ganze Theater?, dachte er. Alles ist in Ordnung, nicht die geringste Auffälligkeit. Es war wirklich albern von mir, so misstrau-
»Adam Kindred?«
Seine heftige Reaktion verstand er später selbst nicht. Vielleicht war er stärker traumatisiert, als er geglaubt hatte; vielleicht hatte ihn die Stresssituation, in der er sich befand, zu einem Wesen gemacht, das sich auf bloße Reflexe statt auf vernünftige Überlegung gründete. Im selben Moment jedenfalls, als er die Stimme hörte, die dicht hinter ihm seinen Namen nannte, hatte er den Griff seines neuen, stabilen Aktenkoffers fest umklammert und einen kraftvollen Rückhandschwenk vollführt. Das Hindernis, auf das der Koffer traf, hatte ihm den Arm und die ganze Schulter verstaucht. Der Mann machte ein Geräusch, das halb wie ein Seufzer, halb wie ein Stöhnen klang, und Adam hörte ihn zu Boden plumpsen, begleitet von einem metallischen Klirren.
Adam drehte sich um, auf geradezu absurde Weise erschrocken: Mein Gott, was hab ich da getan? Er hockte sich neben den halb bewusstlosen Mann, der sich kaum merklich bewegte und aus dessen Mund und Nase das Blut schoss. Der kantige, schwere Messingbeschlag an der Unterkante des Aktenkoffers hatte die rechte Schläfe des Mannes getroffen, und selbst in der trüben Beleuchtung konnte er den klar umrissenen, roten, L-förmigen Abdruck erkennen, der sich in die Schläfe eingegraben hatte wie ein Brandzeichen. Der Mann stöhnte und bewegte sich, seine Hand tastete nach etwas. Adam, der Handbewegung folgend, sah, dass er nach einer Pistole greifen wollte (mit Schalldämpfer, wie er Millisekunden später erkannte), die neben ihm auf dem Pflaster lag.
Adam stand starr, sein Schuldgefühl wurde von Angst überlagert, und fast im selben Augenblick hörte er eine nahende Polizeisirene. Aber der Mann, der da zu seinen Füßen lag, das sah er sofort, war kein Polizist. Soviel er wusste, benutzten Zivilbeamte keine Automatikpistolen mit Schalldämpfer. Er versuchte, ruhig zu bleiben, während ihm das Ergebnis seiner Überlegungen vor Augen trat: Nicht die Polizei, jemand anders war hinter ihm her. Dieser Mann war losgeschickt worden, um ihn zu töten. Sein Hals schnürte sich zu. Was jetzt Besitz von ihm ergriff, war die nackte Angst. Wie ein Tier, sagte er sich. Wie ein gefangenes Tier. Er sah auf den Mann, der sich irgendwie aufgerichtet hatte und im Sitzen, unsicher schwankend wie ein Kleinkind, einen Zahn ausspuckte. Adam beförderte die Pistole mit einem Tritt ins Abseits, sie schlitterte holpernd über das Kopfsteinpflaster, und er trat ein paar Schritte zurück. Der Mann war kein Polizist, aber die Polizei war im Anmarsch – ein paar Straßen entfernt hörte er eine zweite Sirene, die sich mit der ersten zu einer schrillen Dissonanz vereinte. Der Mann machte Anstalten, mit fahrigen Bewegungen übers Pflaster zu kriechen, auf seine Pistole zu. Also gut: Dieser Mann machte Jagd auf ihn und ebenso die Polizei – er hörte den ersten Wagen vor dem Hotel halten und gleich darauf hastiges Türenknallen. Der Abend war in einer Weise schiefgelaufen, für die seine Vorstellungskraft nicht reichte. Er blickte sich zu dem kriechenden Mann um, der seine Pistole fast erreicht hatte, seine bebende Hand nach ihr ausstreckte – es sah aus, als hätte er einen schwerwiegenden Sehfehler, als könnte er seinen Blick nicht auf diesen Punkt konzentrieren. Der Mann kippte um und richtete sich unter Mühen wieder auf. Adam wusste, dass er jetzt eine Entscheidung treffen musste, in der nächsten Sekunde, und begleitet war dieses Wissen von der Erkenntnis, dass es wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung seines Lebens war. Sollte er sich der Polizei stellen oder nicht? Irgendeine undefinierbare Angst in seinem Kopf schrie: Nein! Nein! Du musst hier weg! Und er wusste, dass sein Leben damit an einen Wendepunkt gelangt war, von dem es kein Zurück mehr geben konnte – er konnte sich nicht stellen, nein, er würde sich nicht stellen; er brauchte Zeit. Mit Entsetzen begriff er, wie schlimm es um ihn stand, mit Entsetzen begriff er, in welche Kalamitäten ihn diese Geschichte stürzen würde, wenn er sie wahrheitsgemäß wiedergab. Daher brauchte er jetzt Zeit – die Zeit war sein einziger Verbündeter. Wenn er ein bisschen Zeit gewann, konnte er alles klären. Und so fällte er seinen Entschluss, einen der wichtigsten Entschlüsse seines Lebens. Ob er sich richtig oder falsch entschieden hatte, war jetzt nicht die Frage. Er musste einfach seinen Instinkten gehorchen, musste sich selbst treu bleiben. Er drehte sich um und rannte los, quer über den gepflasterten Hof, hinaus in die schützende Anonymität der Straßen von Pimlico.
Aber was, so fragte er sich, zog ihn zurück nach Chelsea? War es der Feigenbaum und sein flüchtiger Traum von teuren Luxuswohnungen am Ufer der Themse, der ihm die Hoffnung eingab, der schmale Streifen Dickicht an der Chelsea Bridge könne ihm Schutz und Zuflucht bieten, bis diese irrsinnige Nacht vorüber war? Er wartete, bis die Uferstraße für einen Augenblick autofrei war, und kletterte schnell über den Eisenzaun. Von der Brücke fortstrebend, deren Stahlseile von zuckenden Autoscheinwerfern erhellt wurden, zwängte er sich durch Dickicht und Gestrüpp, bis er ein freies Fleckchen zwischen drei dichten Büschen fand. Er breitete seinen Regenmantel aus und setzte sich. Die Arme um die Knie gelegt, wartete er, dass seine Gedanken zur Ruhe kamen, und währenddessen spürte er ein unwiderstehliches Bedürfnis zu schlafen in sich aufsteigen. Er schaltete sein Handy aus und legte sich auf den Mantel, benutzte den Aktenkoffer als Kissen und verschränkte die Arme. Endlich legte sich seine innere Unruhe, er versuchte nicht mehr zu analysieren, zu deuten, zu verstehen, er ließ einfach die Bilder des Tages durch seinen Kopf flackern wie eine widersinnige Diashow. Ruh dich aus, sagte sein Körper, du bist in Sicherheit, du hast dir wertvolle Zeit gekauft, aber jetzt brauchst du eine Pause – hör auf nachzudenken. Das tat er – und schlief auf der Stelle ein.
2
Rita Nashe wollte Vikram gerade erklären, warum sie Kricket hasste, warum ihr Kricket in jeder Form, traditionell oder modern, zuwider war, als der Funkspruch durchkam. Sie parkten gerade an der King’s Road, neben einem Starbucks, wo sie sich, kurz bevor er schloss, einen Kaffee geholt hatten. Rita wusste sofort, worum es ging – eine »Cocktailparty« im Anne Boleyn House. Sie notierte alle Angaben und startete den Wagen.
»Cocktailparty«, sagte sie zu Vikram.
»Wie bitte?«
»Häusliche Ruhestörung. Bei uns in Chelsea heißt das Cocktailparty.«
»Cool. Das merke ich mir: Cocktailparty.«
Sie kamen flott durch zur Sloane Avenue – ohne Blaulicht und Sirene. Eine Frau hatte auf dem Revier angerufen und sich über lautes Rumpeln und Krachen in der Wohnung über ihr beschwert – und über Flecken, die sich danach an ihrer Decke ausbreiteten. Rita hielt auf der anderen Straßenseite und überquerte die Fahrbahn. Vikram kam nicht so recht hinterher, sein Gurt schien zu klemmen – nicht gerade der Schnellste, der junge Mann. Ihr Handy klingelte.
»Rita, ich finde meine Brille nicht.«
»Dad, ich bin im Dienst. Nimm doch die Ersatzbrille.«
»Das ist es ja, verflucht noch mal! Ich hab keine. Sonst hätte ich nicht angerufen.«
Vor der Haustür blieb sie stehen, um auf Vikram zu warten.
»Hast du mal im Wandschrank nachgesehen, bei den Büchsen?«, fragte sie aufs Geratewohl. Sie konnte fast hören, wie es in seinem Kopf arbeitete.
»Warum denn im Wandschrank bei den Büchsen?«, fragte er gereizt.
»Weil du sie dort schon mal hingelegt hast, erinnerst du dich?«
»Wirklich? Oh … na gut, ich sehe nach.«
Schmunzelnd klappte sie das Handy zu: Sie hatte die Brille selbst im Wandschrank versteckt, um ihn für sein Geschimpfe und seinen Egoismus zu bestrafen. Neunzig Prozent seiner Nörgeleien richteten sich gegen sie, doch dass die meisten Gründe sofort wegfielen, wenn sich seine Laune besserte, hatte er nie bedacht. Dabei ist er ein intelligenter Mensch, sagte sie sich, während sie mit Vikram durch die Glastür ins Vestibül trat. Langsam müsste ihm das mal klar geworden sein.
Der Portier hinter dem breiten Marmortresen wirkte verwundert, dass sich zwei Polizisten – eine Polizistin und ein Polizist – an ihn wandten, und konnte nicht verstehen, warum die Beschwerdeführerin (eine anstrengende alte Frau) nicht einfach beim Empfang angerufen hatte, als er den trivialen Anlass des Polizeieinsatzes erfuhr. Für solche Dinge war er schließlich da. Rita sagte, es sei auch von Flecken an der Decke die Rede gewesen. Sie schaute in ihrem Notizbuch nach – Wohnung F14.
»Welche Wohnung liegt über Wohnung F14?«
»G14.«
Zusammen mit Vikram fuhr sie hoch.
»Hier würde ich auch gern wohnen«, sagte Vikram. »Nette kleine Atelierwohnung, Chelsea, King’s Road …«
»Wer nicht, Vik, wer nicht?«
Die Tür von G14 war angelehnt – das fand Rita schon merkwürdig. Sie ließ Vikram draußen warten und ging hinein. Es brannte Licht, alles war durchwühlt. Einbruch, dachte sie sofort, obwohl die allgemeine Verwüstung eher dafür sprach, dass jemand etwas Bestimmtes gesucht und nicht gefunden hatte. Der Fernseher stand noch da, der DVD-Player. Möglicherweise doch kein Einbruchdiebstahl …
Als sie den toten Mann sah, der im Schlafzimmer auf dem blutdurchtränkten Bett lag, erkannte sie die Ursache der Flecken in der Wohnung darunter. In ihrer Laufbahn hatte sie schon manchen Toten oder Verletzten gesehen, aber sie staunte immer von Neuem über die Masse an Blut, die dem menschlichen Körper entströmen konnte. Sie hielt sich die Nase zu und schluckte, ihr wurde leicht übel. Mit flachem Atem blieb sie in der Tür stehen, ließ das Zittern, das sie durchfuhr, verebben und warf einen schnellen Blick in die Runde – auch hier war alles auf den Kopf gestellt, die Tür zu dem kleinen Balkon stand offen, sie hörte den Verkehr auf der Sloane Avenue, die Tüllgardinen blähten sich im Nachtwind wie Segel.
Auf Zehenspitzen lief sie zurück zur Wohnungstür, wo sie ihr Funkgerät einschaltete und den Diensthabenden von Chelsea verlangte.
»Irgendwas Interessantes?«, fragte Vikram.
3
Unterhosen oder nicht? Ingram Fryzer musterte unschlüssig die Galerie von zwei Dutzend Anzügen in seinem Ankleidezimmer. Er trug ein cremefarbenes Hemd mit fertig gebundener Krawatte und seine gewohnten marineblauen langen Socken, die bis zu den Knien reichten. Ingram hatte Angst, dass seine haarigen, weißen Waden hervorlugten, wenn er sich hinsetzte und die Beine übereinanderschlug – in gewisser Hinsicht war das die typische, ständig lauernde englische Kleidersünde. Kleidersünde – er musste über sich selbst lächeln – oder sollte man besser Wadensünde sagen? Ganz egal; wenn er mit reichen und mächtigen Männern konferierte und sah, wie sie beim Verlagern ihrer Schenkel fünf Zentimeter bleicher, dürrer Wade entblößten, sanken diese Leute sofort in seiner Achtung, denn eine derartige Nachlässigkeit verriet einiges über sie. Das Thema Unterhosen jedoch war ein rein privates – niemand in seiner Firma wäre auch nur im Traum darauf gekommen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende und CEO unter seiner perfekt geschnittenen Anzughose nackt war, dass sein Schwanz und seine Eier frei herabhingen.
Ingram verweilte noch ein wenig bei diesem prickelnden Dilemma – Unterhosen oder nicht? – und malte sich die potenziellen Erregungen aus, die ihn an diesem Tag erwarteten. Er liebte es, wenn sich seine Eichel am Stoff der Anzughose rieb oder für eine Sekunde an einer Naht hängen blieb. In solchen Momenten konnte man nie sicher sein, ob es zu einer spontanen Halberektion kam, was natürlich besondere Risiken barg, wenn man gerade im Begriff war, sich zu einer wichtigen Sitzung zu begeben. War man unter der Anzughose nackt, verlief der Arbeitstag grundlegend anders, in all seinen Nuancen. Une journée de frottis-frotta, hatte das ein französischer Freund genannt, und Ingram erfreute sich an dieser Bezeichnung, die sein kleines Laster zu einem Stück raffinierter Lebensart stilisierte. Inzwischen hatte er sich entschieden – keine Unterhose heute – und einen Anzug im Prince-of-Wales-Karo ausgesucht, die Hose angezogen, seine roten Hosenträger angelegt und das Jackett übergestreift. Er suchte sich ein Paar dunkelbraune, quastenverzierte Slipper aus und ging die Treppe hinunter zu dem englischen Frühstück, das Maria-Rosa montags bis freitags pünktlich um sieben Uhr dreißig für ihn bereithielt.
Auf dem Weg zum Büro ließ er Luigi an der U-Bahn-Station Holborn halten. Das machte er oft so – fuhr ein paar Stationen U-Bahn, während Luigi mit dem Wagen weiterfuhr –, besonders an unterhosenfreien Tagen. Er liebte es, sich unters »Volk« zu mischen, die verschiedenen Typen zu studieren und sich vorzustellen, welche Art von Leben sie lebten. Nicht dass er sie verachtete oder sich über sie erhaben dünkte – es war einfach seine anthropologische Neugier, die durch diese andersartigen Exemplare seiner Spezies geweckt wurde, und er fühlte sich in besonderer Weise dazu berufen, denn er kannte niemanden in seiner gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Stellung, der Ähnliches tat. Für rund zehn Minuten wurde er zu einem von vielen gesichtslosen Pendlern, die auf der Central Line zur Arbeit fuhren.
Er bestieg das volle Abteil und blickte sich um – neugierig, unschuldig. Da standen zwei recht hübsche Mädchen, gar nicht weit von ihm, angeschlossen an ihre winzigen Ohrstöpsel, hörten ihre Musik. Gute Kleidung, viel Schmuck, ziemlich massives Make-up … Die eine musterte ihn mit leerem Blick, als hätte sie sein Starren bemerkt, und wandte sich ab. Ingram, der spürte, dass sich in seinem Schwanz etwas regte, fragte sich sofort, ob auch Phyllis heute davon profitieren würde. Mein Gott, was ist nur mit mir los? Denken auch andere neunundfünfzigjährige Männer ständig nur an Sex? Wie nannte man das? Wie war der Terminus? Ja, er war ein »Erotomane«. Nicht die schlechteste Sorte Triebtäter, aber manchmal fragte er sich, ob seine Obsessionen etwas Krankhaftes, etwas Klinisches hatten. Andererseits aber, so überlegte er, während er die Treppe der U-Bahn-Station Bank hinaufstieg und den Glasturm sah, in dem seine Firma CALENTURE-DEUTZPLC mit ihren zweihundert Angestellten residierte, die sich, verteilt über mehrere Stockwerke, soeben an ihr Tagewerk begaben – andererseits waren solche Gefühle, solche Triebe etwas ganz Normales und Gesundes.
Im Foyer erwarteten ihn schon Burton Keegan und Paul de Freitas – etwas musste passiert sein. Während er auf sie zuging, spielte er im Kopf die schlimmstmöglichen Szenarios durch, um sich zu wappnen: seine Frau, seine Kinder – verstümmelt, tot; ein Chemieunfall in den Labors von Oxford, Kontamination, Seuche, Börsenturbulenzen, ein Putsch im Aufsichtsrat, Ruin …
»Burton, Paul«, sagte er und hielt sein Gesicht genauso im Zaum wie sie. »Guten Morgen. Es kann sich nur um schlechte Nachrichten handeln.«
Keegan warf einen Seitenblick auf de Freitas – wer würde der Überbringer sein? Keegan übernahm die Rolle, nachdem de Freitas genickt hatte.
»Philip Wang ist tot«, murmelte Keegan mit tonloser Stimme. »Ermordet.«
4
Im Morgengrauen wachte Adam auf, über ihm das Geschrei von Seemöwen, die aggressiv dicht über ihn hinwegstrichen, und für einen kurzen Augenblick dachte er: Klar, logisch, das ist alles nur ein Traum, nichts davon ist wirklich passiert. Aber die Kälte in seinen Beinen, die klamme Feuchtigkeit, das Gefühl, ungewaschen zu sein, brachten ihm schlagartig die Lage zu Bewusstsein, in der er sich befand. Er richtete sich auf, verzweifelt und den Tränen nahe beim Gedanken an das, was ihm widerfahren war. Es herrschte Flut, wie ihm ein Blick auf die Themse bestätigte, das braune Wasser strömte kraftvoll vorbei. Er hatte Hunger und Durst, musste dringend pissen, brauchte eine Rasur … Die Blase zu leeren war die leichteste Übung – und während er den Reißverschluss hochzog, registrierte er betroffen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben unter freiem Himmel übernachtet hatte. Es war nicht nach seinem Geschmack.
Er zog den Regenmantel über, griff nach dem Aktenkoffer und zwängte sich durch die taufeuchten Büsche zum Chelsea Embankment hinauf. Auf der fast leeren Straße rasten die ersten Pendler vorbei, um dem Stoßverkehr zuvorzukommen. Er stieg über den Zaun, befreite den hängen gebliebenen Mantelzipfel und ging los. So früh am Morgen war es noch kühl, und Adam fröstelte, als er stehen blieb, um Laub und Grashalme vom schon fleckigen Regenmantel zu entfernen.
In einem Café auf der King’s Road bestellte er ein »englisches Frühstück« und verschlang es mit Heißhunger. Seine Börse enthielt Scheine und Münzen im Wert von 118,38 englischen Pfund. Wenn er sich der Polizei stellte, so überlegte er, musste er wenigstens präsentabel aussehen, also kaufte er in einer Drogerie ein paar Wegwerfrasierer und Rasierschaum. Da sein Hunger jetzt gestillt war, verlangte es ihn vor allem nach einer Rasur. Er fuhr mit der U-Bahn von Sloane Square bis Victoria Station, wo er zwei Pfund für die Benutzung eines der neuen »Executive Washrooms« bezahlte. Er rasierte sich sorgfältig und gründlich, kämmte sich das widerspenstige Haar aus der Stirn, wobei der Kamm Linien wie von samtigem Kord hinterließ – nach nur einer Nacht im Freien wirkte es schon unangenehm fettig. Auf dem Bahnhofsvorplatz fragte er einen Busfahrer nach dem Weg zum nächsten Polizeirevier und wurde in die Buckingham Palace Road gewiesen, dort befinde sich eins, nur ein paar Minuten Fußweg entfernt.
Er fand es ohne Mühe und blieb einen Moment stehen, um sich zu sammeln, bevor er zuversichtlich die Treppe zu dem relativ neu wirkenden Gebäude hochstieg – kantige Blöcke aus karamellfarbenen Backsteinen, hellblaue Geländer. Absichtlich hatte er nicht überlegt, was ihn dort erwartete oder was die unmittelbaren Folgen der zu erwartenden Verhöre waren. Es gab einfach zu viele zwingende Belastungsmomente gegen ihn, das war offensichtlich, aus diesem Grund war er ja am Abend geflohen. Seine düstere Vermutung war, dass man ihn verhaften und in eine Zelle sperren würde, bevor er überhaupt einen Anwalt zu sehen bekam. Er wusste, dass es nur zu bequem und verlockend war, ihn als Täter zu behandeln, statt seine Aussage zu protokollieren, ihn ins Hotel zurückzuschicken und auf ihren Anruf warten zu lassen. Und beim Gedanken an den Anruf fiel ihm plötzlich das Stipendium ein, für das er sich gestern Nachmittag beworben hatte. Sie hatten versprochen, ihn anzurufen. Auf seinem Handy – oder Mobile, wie man hier sagte – hatte sich niemand gemeldet. Er schaute kurz nach und sah, dass – abgesehen von den üblichen Begrüßungsnachrichten der Telefongesellschaften – keine Meldungen eingegangen waren. Seit er die USA verlassen hatte, war sein SMS-Verkehr so gut wie gänzlich zum Erliegen gekommen – keine Grüße oder Nachrichten von Freunden, Kollegen oder Studenten mehr –, ein schweigender Vorwurf … Trotzdem war er begierig, vom Imperial College zu hören. Hatten sie sich für ihn entschieden? Wollten sie ihn haben? Jetzt hatte er Grund, sich Sorgen zu machen. Was immer ihn als Nächstes erwartete: In seinem Lebenslauf würde es sich kaum besonders vorteilhaft ausnehmen.
Durch die automatische Tür gelangte er in einen kleinen Vorraum, der Empfangsschalter war unbesetzt. Das Display informierte ihn in roter Leuchtschrift: Unsere Mitarbeiter werden sich in Kürze um Sie kümmern. Ein Mann und eine Frau saßen schon da und starrten stumm zu Boden. Adam blieb stehen, um sein Spiegelbild in einem der verglasten Infokästen zu betrachten, die Warnhinweise enthielten, Ratschläge zum Umgang mit häuslicher Gewalt, Stellenangebote der Polizei, juristische Mitteilungen und Fotos diverser Missetäter. Sofort schweiften seine Augen über die Bilder und entdeckten seinen Namen: ADAMKINDRED – GESUCHTWEGENMORDES.
Mehr noch als sein Name erschreckte ihn der Anblick seines Bildes: ein Porträt, das er kannte, herausgeschnitten aus einem größeren Foto (in der rechten unteren Ecke sah man noch die Schulter einer anderen Person). Er wusste auf Anhieb, woher es stammte – von seiner Hochzeit. Damals hatte er einen Frack getragen, mit grauer Weste und silberner Seidenkrawatte, alles nach englischem Brauch, obwohl die Hochzeit in Phoenix, Arizona, stattfand und alle männlichen Gäste in Smoking mit Schleife erschienen. Er hatte deswegen milden Spott geerntet. Sein Lächeln auf dem Foto war breit, sein Haar um ein Beträchtliches länger, und sein dichter Schopf, gezaust vom böigen Wüstenwind, hing ihm verwegen in die Stirn. Verunsichert strich er sein jetzt kürzeres, fettigeres Haar zurück. Inzwischen sah er anders aus – schmaler, angegriffener. Dann überlegte er: Wie hatten sie das Bild beschafft? In dieser kurzen Zeit? Von seinem Vater? Sein Vater lebte mit seiner Schwester in Australien. Nein … Er fuhr erschrocken zusammen. Es musste von Alexa kommen, von seiner Ex-Frau. Er ging die Kette der Ereignisse noch einmal durch. Kein Wunder, dass sie ihn so schnell identifiziert hatten, konstatierte er bitter. Sein Name mitsamt Adresse im Besucherbuch des Anne Boleyn House hatte sie auf kürzestem Weg ins Grafton Lodge geführt (Seamus und Donal wussten von seiner Bewerbung); dann E-Mails, Telefonate mit seinem bisherigen Arbeitgeber, mit Verwandten. Ein Foto, beschafft von der Ex-Frau (»Adam? Sind Sie sicher?« Er konnte ihre Stimme hören, nur diesmal ohne den empörten Unterton), dann gescannt und binnen Sekunden nach London gemailt. Hatten sie etwa auch seinen Vater benachrichtigt? Ihm wurde übel. Er konnte sich ohne Weiteres in die Ermittler hineinversetzen. Sie suchten nur einen einzigen Mann, den Mann, der sich ins Besucherbuch des Anne Boleyn House eingetragen hatte, der Philip Wang als Letzter lebend gesehen hatte, dessen Fingerabdrücke sich auf der Mordwaffe befanden – ein praktisch schon gelöster Fall. Finden wir Adam Kindred, haben wir den Mörder.
Seine Brust krampfte sich zusammen, während er all die zwingenden Indizien ein weiteres Mal aneinanderreihte und gegen sich in Anschlag brachte. Er hatte sich nachweislich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten – exakt zum Zeitpunkt des Mordes. Seine Fingerabdrücke fanden sich überall. Seine Kleider waren mit dem Blut des Opfers besudelt. Er war der offenkundige Täter – jeder, aber auch wirklich jeder, musste annehmen, dass er Philip Wang getötet hatte. Aber wo war das Motiv? Welchen Anlass sollte er haben, einen namhaften Immunologen umzubringen? Doch schon fand sich eine Erklärung, die ihm bitter aufstieß: eine homosexuelle Beziehungstat. Später mutmaßte er, dass es sein argloser Gesichtsausdruck auf dem Foto gewesen sein musste, der ihn zu seinem nächsten Schritt veranlasst hatte. Irgendwie demonstrierte dieses Bild seine völlige Unschuld, und er war nicht bereit, sie aus freien Stücken zu beschmutzen. Er schnitt jeden weiteren Gedanken ab, wandte sich abrupt vom Abbild dieses glücklichen, sorglosen jungen Adam weg und ging durch die automatische Tür hinaus. (Auf der Treppe begegneten ihm drei angeregt plaudernde Polizisten.) Er wandte sich westwärts, bog rechts in die Pimlico Road ein und strebte der vermeintlichen Sicherheit zu, die ihm der Stadtteil Chelsea bot.
Während er sich vom Polizeirevier entfernte – den Aktenkoffer in der Hand, mit flatterndem Regenmantel, schwitzend, fast fiebrig vor Angst –, wurde ihm klar, dass er an einen Kreuzweg gelangt war. Nein, Kreuzweg war die falsche Metapher, vielmehr war es ein Scheideweg und darüber hinaus der dramatischste Scheideweg, den man sich vorstellen konnte. Er hatte a) die Wahl, sich zu stellen und den Mühlen der Justiz auszuliefern – mit Tatvorwurf, Verhaftung, abgelehnter Kaution, Untersuchungshaft, Prozess und Urteil – oder b) die Wahl, sich nicht zu stellen. Von Natur aus war er ein gesetzestreuer Mensch, jeder Rechtsordnung, die er kannte, hatte er naiv vertraut, doch plötzlich war alles anders. Nicht mehr die »Gesetzestreue« galt ihm als oberstes und grundlegendes Gebot, jetzt entschied er sich instinktiv für die Freiheit – seine persönliche Freiheit. Die musste er bewahren, um jeden Preis, wenn er heil aus dieser Sache herauskommen wollte. Frei zu bleiben schien seine einzige Option zu sein, er hatte keine andere Wahl. Seltsam, dieser philosophische Erkenntnisblitz, aber plötzlich begriff er, dass ihm die persönliche Freiheit, über die er im Moment verfügte, unendlich kostbar war – weil er nun wusste, wie schwach und zerbrechlich sie war –, und er dachte nicht daran, sie irgendjemandem zu opfern, und sei es nur vorübergehend.
Und außerdem, sagte er sich, während ihm mit jedem Schritt heißer wurde, bin ich unschuldig, Himmelherrgott noch mal. Er hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, und er wollte nicht für einen Mord büßen, den er nicht begangen hatte. So einfach diese Tatsache war, so klar war die Entscheidung, die er gefällt hatte – hatte fällen müssen. Es konnte gar keinen Zweifel geben: Jeder andere Mensch in dieser verzwickten Lage hätte das Gleiche getan. Und dann war da noch ein weiterer Faktor, der Faktor X, den er einkalkulieren musste. Wer war der Mann hinter dem Hotel, der seinen Namen kannte und eine Pistole mit Schalldämpfer besaß? War der nicht zwangsläufig der Mörder? Der Mann auf dem Balkon, den Adam überrascht hatte, als er die Wohnung von Philip Wang betrat?
Er kam an einem Pub vorbei und war versucht, sich einen Drink zu leisten, aber mit seinem neuen Glauben an die persönliche Freiheit hatte sich auch das Bewusstsein dafür eingestellt, wie teuer diese Stadt war – er musste sein Geld zusammenhalten, bis er die nächsten Schritte überlegt hatte und bis der wahre Schuldige identifiziert und gefasst war.
Auf einer kleinen Grünfläche suchte er sich eine Bank und starrte abwesend auf die Statue des Mozart-Knaben. Was hatte Mozart in diesem Teil von London zu suchen? Adam nahm sich zusammen: Das Beste war es vielleicht, eine Weile zu verschwinden – ein paar Tage, eine Woche – und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Wie nannte man das? »In den Untergrund gehen«. Wenn er nun ein paar Tage in den Untergrund ging, bis die anderen Tatspuren gesichert und angemessen ausgewertet waren? Er konnte das alles in der Zeitung verfolgen, im Fernsehen oder Radio – doch jetzt überfiel ihn ein neuer Gedanke: Was, wenn Wang wirklich schwul gewesen war? Wang und Adam hatten sich in einem Restaurant getroffen, waren ins Gespräch gekommen und wurden dabei beobachtet. Adam besuchte Wang in seiner Wohnung, Wang wurde zudringlich, es kam zum Streit, zum Handgemenge – alles geriet außer Kontrolle, ging schrecklich schief … Adam wurde von einem Gefühl der Schwäche befallen, wie gelähmt blickte er auf das Denkmal und versuchte, sich eine Mozart-Arie ins Gedächtnis zu rufen, irgendeine Melodie, um sich abzulenken, aber die Verse, die ihm in den Sinn kamen, stammten von einem Rocksong seiner Jugendjahre: »Going underground, going underground / Well the brass bands play and feet start to pound«.
Sehr hellsichtig, dieser Text, dachte er. Eher würde er in den Untergrund gehen, als sich brav auf einem Polizeirevier zu melden und sich eines Verbrechens bezichtigen zu lassen, das er nicht begangen hatte. Nur ein paar Tage, sagte er sich, dann tauchen andere Hinweise auf, die Polizei wird andere Erklärungen und andere Verdächtige ins Auge fassen. Nun fiel ihm endlich auch etwas von Mozart ein, die Ouvertüre zu Così fan tutte – die hatte ihn stets heiter gestimmt. Die Melodie auf den Lippen, machte er sich auf den Weg. Es wurde Zeit, ein paar wichtige Utensilien für sein neues Leben zu besorgen.
Später am Nachmittag, es dämmerte schon, warf Adam die drei Einkaufsbeutel mit seinen Besitztümern über den Zaun am Uferdreieck und folgte ihnen flink nach. Er zwängte sich zu der Stelle durch, wo er in der Nacht zuvor geschlafen hatte, und untersuchte sie genauer. Sie war von drei großen Büschen und zwei mittelgroßen Bäumen – einem Ahorn und einer Art Stechpalme – umschlossen und befand sich nahe der langen Spitze des Dreiecks, am westlichen, von der Chelsea Bridge entfernten Ende. Einer der Büsche war fast wie eine Höhle, man konnte bequem unter die Zweige kriechen. Um es auszuprobieren, duckte er sich: Ja, wenn er sich hier verkroch, war er von der Uferstraße, von der Chelsea Bridge und auch für vorbeifahrende Boote praktisch unsichtbar.
Er leerte die Tüten und nahm seine Einkäufe in Augenschein. Ein Schlafsack, eine Isomatte, ein Klappspaten, ein Campingkocher mit Reservekartuschen, eine Taschenlampe, eine Geldkassette, ein Campingbesteck, zwei Flaschen Wasser, ein kleiner Kochtopf und sechs Büchsen Baked Beans. Bei der Auswahl war er mit Bedacht vorgegangen, hatte nur die billigsten Sachen und Sonderangebote genommen – geblieben waren ihm zweiundsiebzig Pfund und ein wenig Kleingeld. Am Tage konnte er sich hier im Dreieck verstecken, nachts konnte er bei Bedarf losgehen, für Nachschub sorgen. So ließ es sich leben – einigermaßen.
Unter dem Busch richtete er sich häuslich ein, er brach ein paar Zweige ab, um mehr Raum zu schaffen, hängte die Isomatte wie ein umgedrehtes V über andere Zweige und schuf sich eine zeltartige Höhlung. Dann entrollte er den Schlafsack und schob ihn unter das provisorische Dach. Ja, so würde er trocken bleiben, geschützt vor den Unbilden der Witterung, wenn es nicht gar zu sehr regnete. Er blickte hoch, weil plötzlich ein Streifenwagen auf dem Chelsea Embankment vorbeifuhr, mit heulender Sirene, und lächelte erleichtert. Die ganze Londoner Polizei war hinter ihm her. Die Aufzeichnungen sämtlicher Überwachungskameras wurden ausgewertet, seine Ex-Frau und sein Vater in Sydney erneut angerufen, Verwandte und Bekannte aufgespürt. Wer hatte etwas von Adam Kindred gehört oder gesehen? Und wenn alles vorbei war, würden sie über sein Abenteuer lachen. Er wurde gesucht, doch er war nirgends zu finden. Nachdem er sein Lager aufgeschlagen hatte, zündete er den Kocher an und wärmte die Baked Beans auf. Er löffelte sie aus dem Topf – sie waren heiß und schmackhaft –, ein köstliches Mahl. Jeder Tag ein neuer Tag, sagte er sich. Möglichst nicht nachdenken. Er war in den Untergrund gegangen.
5
»Nelkenöl«, murmelte Jonjo Case. Wer hätte das gedacht? Wer hätte so was für möglich gehalten? Er tropfte Öl auf die Fingerspitze, verteilte es um den kaputten Zahn – und spürte fast sofort, wie der stechende Schmerz nachließ. Die große Füllung war flöten gegangen, als ihm dieses Schwein, dieser Kindred, seinen Aktenkoffer an den Kopf gehauen hatte. Der andere Zahn war einfach so rausgeflogen, wie vom Zahnarzt gezogen. Als er wieder auf die Beine kam, hatte er ihn auf dem Pflaster liegen sehen und in die Tasche gesteckt – nur keine Spuren hinterlassen.
Jonjo prüfte sein Gesicht im Spiegel. Sein Aussehen hatte ihm noch nie gefallen, aber Kindreds Aktenkoffer hatte die Sache keineswegs besser gemacht. Wenigstens war die Nase nicht gebrochen, nur geschwollen, und die Prellung zwischen Ohr und Kinn würde lange bleiben. Aber was ihn am meisten ärgerte, war der Abdruck, den ein Scharnier oder irgendein Kofferbeschlag an seiner rechten Schläfe hinterlassen hatte. Er drehte den Kopf zur Seite, um die Stelle genauer in Augenschein zu nehmen. Da war er, der deutliche und klare Umriss eines L, ein zornig-rotes Blutmal. L wie Loser, dachte Jonjo. Das L würde wahrscheinlich verschorfen, und er würde eine weiße, L-förmige Narbe zurückbehalten. Nein. Das nun auf keinen Fall. Er musste die Narbe mit der Messerspitze aufkratzen, verformen – später. Er würde nicht sein Leben lang mit einem L auf der Stirn rumlaufen – kam gar nicht infrage.
Er ging an den Tisch mit den Flaschen und schob den Hund behutsam mit dem Fuß zur Seite. Der Hund sah ihn vorwurfsvoll an, während Jonjo unter den zusammengeschobenen Flaschen nach seinem bevorzugten Malt Whisky suchte. Wie komme ich dazu, meiner Schwester einen jungen Basset abzunehmen, fragte er sich, während er einen kräftigen Schluck aus der Flasche nahm. Diese braunen Augen voller Anklage! Diese ständige Jammermiene, diese unverschämt langen, samtigen Ohren … Das war kein Hund, eher ein Kuscheltier, das man auf der Bettdecke platzierte oder auf die Türschwelle legte, damit es nicht so zog. Angewidert verzog er das Gesicht. Malt Whisky mit Nelkengeschmack. Eine ekelhafte Kombination!
Er blickte sich in seiner Behausung um und seufzte. Der Schmerz ließ schon spürbar nach. Er musste hier wirklich mal aufräumen. Der Abwasch einer Woche türmte sich im Spülstein, vier Jahrgänge Yachting Monthly stapelten sich hinter der Glotze. Was würde Sergeant Major Snell dazu sagen, wenn er diese Bude sähe? Fluchen würde er, toben würde er. Ich war der beste Soldat des ganzen Regiments. Und was ist aus mir geworden?
Er warf ein paar Klamotten vom Sessel und setzte sich. Der Hund kam angewackelt und starrte ihn an. Er hat Hunger, begriff Jonjo, wegen der Aufregung letzte Nacht hat das arme Viech seit vierundzwanzig Stunden nichts zu fressen gekriegt. Er tastete auf dem Sofa herum und fand unter dem Kissen eine halbe Packung Kekse, die er auf dem Teppich verstreute. Der Hund angelte sich die Kekse mit seiner langen rosa Zunge und fing an zu mampfen.
Jonjo dachte an den vergangenen Abend, ging alles noch mal durch, vorwärts, rückwärts, wie es kam. Zum Glück hatte er den Zahn gleich gefunden und die Pistole auch, denn überall wimmelte es von Polizei. Dann dachte er an Wang, wie er ihn ein bisschen rumgestoßen hatte, aufs Bett geworfen, ihm mit links die Kehle zugedrückt hatte, bis er blau anlief, dann mit rechts das Brotmesser in die Seite gerammt hatte. Leider ohne das Herz zu treffen – Snell hätte ihm für diesen Pfusch die Hölle heiß gemacht. Und dann kam auch noch irgend so’n Idiot in die Wohnung rein. Er natürlich gleich raus auf den Balkon, dabei wusste er schon, dass Wang nicht tot war … Scheißgeschichte. Was war da gelaufen, während er draußen stand?, fragte er sich traurig. Traurig deshalb, weil er irgendwie keinen Biss mehr hatte. Zwei Jahre früher, und er hätte den Kerl, der da reinkam, einfach weggepustet. Brutal, aber locker – ohne viel Getue. Und jetzt war dieser Kindred noch am Leben, auf freiem Fuß, irgendwo auf der Flucht, hier in London, wie die Zeitungen schrieben. Er gab dem Hund einen Mars-Riegel. Sich selbst gönnte er einen weiteren Schluck Whisky und noch ein paar Tropfen Nelkenöl.
Wang umlegen, alles durchwühlen und alle Aufzeichnungen einsacken, die dir in die Finger kommen, hatten sie ihm gesagt. Genauso hatte er’s gemacht, hatte Wang zur Sau und seine Wohnung zum Saustall gemacht und alle Papiere im Kofferraum seines Taxis verstaut. Inzwischen wussten sie, dass die Sache schiefgegangen war, verdammt schief – er konnte sich auf einen Anruf gefasst machen.