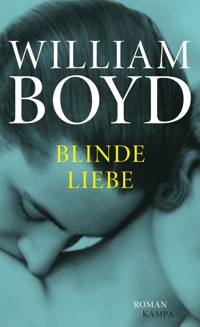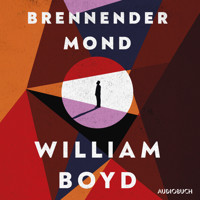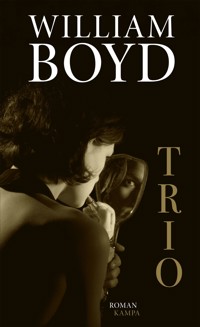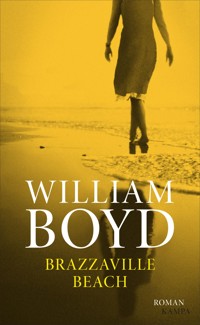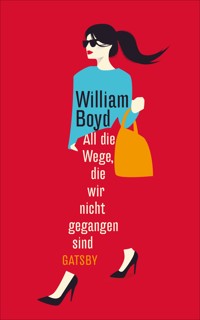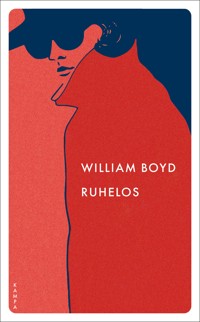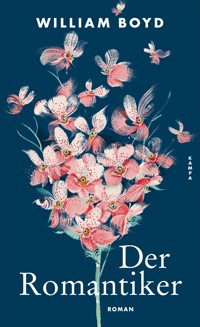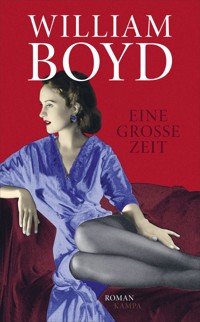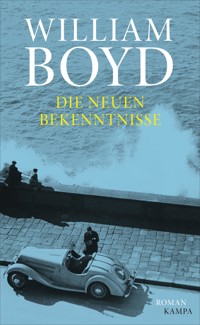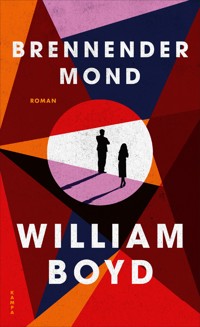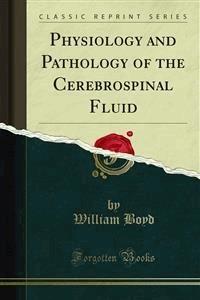Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
London in den 1990er Jahren: Lorimer Black ist zufrieden. Als Schadensregulierer einer großen Versiche- rungsgesellschaft hat er Karriere gemacht, weil er die Fälle stets zugunsten seines Arbeitgebers regelt. An einem kühlen Wintermorgen begibt sich Black zu einem Geschäftstermin - und findet dort einen Erhängten. Von diesem Tag an ist alles anders: Black wird zum Spielball von Großinvestoren, verliebt sich Hals über Kopf in die wunderschöne, aber verheiratete Schauspielerin Flavia Malinverno und freundet sich mit einem paranoiden Rockstar an. Immer tiefer versinkt er in einem Morast aus Lügen und Intrigen. Und dann wird er noch von seiner rumänischen Vergangenheit eingeholt, die alles andere als glamourös ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
William Boyd
Armadillo
Roman
Aus dem Englischen von Chris Hirte
Kampa
Für Susan
Armadillo (ˌarmaˈdiljo:): Armadill, Gürteltier (1577) [span. armadillo, Diminutiv von armado – Bewaffneter, Geharnischter, lat. armatus, Part. Prät. von armare – bewaffnen, rüsten].
Wir und andere Tiere bemerken,
was um uns herum passiert.
Das hilft uns, denn es gibt uns
Hinweise darauf, was wir zu
erwarten haben und wie wir es
womöglich verhindern können,
hilft uns also beim Überleben.
Doch es funktioniert nur
unvollkommen. Es gibt Überraschungen,
und sie sind störend:
Wie können wir wissen, wann wir
recht haben?
Wir werden mit dem Problem
des Irrens konfrontiert.
W.V. Quine, From Stimulus to Science
1. Kapitel
Irgendwann in unserer Zeit – auf das genaue Datum kommt es nicht an; jedenfalls war es noch sehr früh im Jahr – begab sich ein junger Mann knapp über dreißig, um die eins fünfundachtzig groß, mit pechschwarzem Haar und ernsten, feinen, aber bleichen Zügen, zu einem Geschäftstermin und fand einen Erhängten.
Lorimer Black starrte Mr Dupree entgeistert an, von jähem Entsetzen gepackt, zugleich jedoch merkwürdig teilnahmslos – offenbar die widerstreitenden Symptome einer inneren Panik, dachte er. Mr Dupree hatte sich an einem dünn isolierten Wasserrohr erhängt, das an der Decke des kleinen Raums hinter dem Foyer verlief. Ein Aluminiumtreppchen lag umgekippt unter seinen etwas gespreizten Füßen (die hellbraunen Schuhe brauchten dringend Pflege, bemerkte Lorimer). Mr Dupree war der erste Tote in seinem Leben, zugleich der erste Selbstmord und der erste Erhängte; Lorimer fand diese Häufung von Erstmaligkeiten zutiefst beunruhigend.
Sein Blick wanderte zögernd von Mr Duprees abgeschabten Schuhspitzen aufwärts, verweilte kurz am Hosenschlitz, wo er keine Anzeichen einer Spontanerektion entdeckte, wie sie für Erhängte angeblich typisch ist, und erfasste dann das Gesicht des Toten. Mr Duprees Kopf war ein bisschen zu weit vorgebeugt, seine Züge wirkten schlaff und schläfrig – genau wie bei den erschöpften Pendlern, die auf unbequemen Sitzbänken in überheizten Bahnabteilen einnicken. Hätte man Mr Dupree mit dieser verrenkten Kopfhaltung im Achtzehnuhrzwölfzug ab Liverpool Street sitzen und dösen sehen, hätte man vorahnend Mitleid mit ihm haben können, denn er würde mit einem steifen Hals erwachen.
Steifer Hals. Geknickter Hals. Gebrochener Hals. Meine Güte! Lorimer stellte behutsam den Aktenkoffer ab, ging lautlos an Mr Dupree vorbei und öffnete die Tür am anderen Ende des Vorraums. Ein Bild der Verwüstung bot sich ihm. Durch die geschwärzten und verkohlten Dachbalken der Fabrikhalle sah er den bleiernen Regenhimmel, der Boden war noch immer mit den verschmorten und geschmolzenen Leibern der etwa tausend nackten Schaufensterpuppen bedeckt (976 Stück laut Lieferschein, für eine amerikanische Ladenkette). All das verbrannte und verklumpte »Fleisch« jagte ihm einen künstlichen Schauder ein (künstlich deshalb, weil es schließlich nur Kunststoff war und weil niemand wirklich gelitten hatte, wie er sich sagte). Hier und da war der Kopf eines stereotypen Schönlings erhalten, oder ein gebräuntes Model warf ihm einen grotesk verführerischen Blick zu. Die unbeirrte Heiterkeit der Mienen verlieh der Szenerie eine anrührend stoische Note. Hinter der Halle befanden sich, wie Lorimer aus dem Bericht wusste, die niedergebrannten Werkstätten, die Ateliers, der Speicher für die Formen aus Ton und Gips, die Plastikgießerei. Das Feuer, außergewöhnlich bösartig, hatte ganze Arbeit geleistet. Offensichtlich hatte Mr Dupree angeordnet, dass alles unverändert blieb und keine der zerflossenen Schaufensterpuppen angerührt wurde, bevor er sein Geld erhalten hatte. Und Lorimer sah, dass Mr Duprees Anweisungen befolgt worden waren.
Lorimer machte leise ploppende Geräusche mit den Lippen. »Hmmm«, sagte er, dann: »Herr im Himmel!« Dann wieder: »Hmmmm.« Er merkte, dass seine Hände etwas zitterten, und schob sie in die Taschen. Üble Geschichte, dachte er, und immer wieder: Üble Geschichte. Die Redewendung kreiste sinnlos in seinem Kopf wie ein Mantra. Vage und mit Widerstreben stellte er sich vor, wie Hogg auf den Selbstmord Duprees reagieren würde: Hogg hatte ihm schon von anderen »Abgängern« erzählt, und Lorimer fragte sich, wie man in solchen Fällen verfuhr …
Er schloss die Tür und machte sich einen Moment lang Sorgen wegen der Fingerabdrücke. Aber warum sollten sie bei einem Selbstmord Spuren sichern? Erst als er im Foyer nach dem Telefon griff, kam ihm der Gedanke, dass es vielleicht, nur mal angenommen, gar kein Selbstmord war.
Der Kommissar, der auf seinen Anruf hin erschien, Detective Sergeant Rappaport, wirkte nicht viel älter als Lorimer, redete ihn aber ohne erkennbaren Grund durchgängig mit »Sir« an. Dennis P. Rappaport war auf seinem Ausweis zu lesen.
»Sie sagen, Sie hatten eine Verabredung mit Mr Dupree, Sir.«
»Ja. Vor über einer Woche hab ich den Termin gemacht.« Lorimer zückte seine Visitenkarte. »Ich war pünktlich um zehn Uhr dreißig hier.«
Sie standen jetzt draußen unter dem roten Plastikschild mit dem Schriftzug Osmond Dupree Schaufensterpuppen, gegr. 1957. Drinnen befassten sich die Polizei und andere Zuständige mit den sterblichen Überresten von Mr Dupree. Ein eifriger Beamter spannte flatternde Absperrbänder und befestigte sie an Laternenpfosten und Geländern, um den Zugang zur Fabrik pro forma zu blockieren und ein halbes Dutzend Gaffer, die frierend und ausdruckslos herumstanden, auf Distanz zu halten. Die warten auf die Leiche, dachte Lorimer. Wie reizend.
Detective Rappaport studierte sorgfältig die Visitenkarte und deutete dann mit einer theatralischen Geste an, dass er sie gern einstecken wollte. »Darf ich, Sir?«
»Aber sicher doch.«
Rappaport zog eine dicke Brieftasche aus seiner Lederjacke und schob Lorimers Karte hinein. »Ist nicht gerade Ihre gewohnte Art, den Tag zu beginnen, würde ich denken, Sir.«
»Nein … sehr bedrückend«, formulierte Lorimer vorsichtig. Rappaport war ein stämmiger Typ, muskulös und blond, mit kornblumenblauen Augen – eigentlich untypisch für einen Kommissar, dachte Lorimer aus irgendwelchen Gründen, eher würde man auf einen Surfer oder Tennisprofi tippen oder auf einen Kellner in Los Angeles. Außerdem wusste Lorimer nicht, ob Rappaports übertriebene Höflichkeit ihn irritieren oder in Sicherheit wiegen sollte – oder ob sie auf hinterhältige Art ironisch gemeint war. Wahrscheinlich Letzteres, entschied Lorimer. Rappaport würde sich später über ihn lustig machen, in der Kantine oder in der Kneipe oder wo immer sich die Kommissare trafen, um zu quatschen und ihren Frust loszuwerden.
»Jetzt wissen wir ja, wo Sie zu finden sind, Sir, und werden Sie nicht länger belästigen. Danke für Ihre Hilfe, Sir.«
Dieses penetrante »Sir«, das ist schon mehr als Ironie, dachte Lorimer. Das war herablassend, ganz ohne Frage, zugleich eine Art Stachel, ein versteckter Hohn, gegen den man sich nicht wehren konnte.
»Dürfen wir Sie irgendwohin zurückbringen, Sir?«
»Nein, vielen Dank, Mr Rappaport. Mein Wagen steht gleich um die Ecke.«
»Das T ist stumm, Sir: Rappapor. Ein alter normannischer Name.«
Altes normannisches Arschloch, dachte Lorimer, als er zu seinem Toyota auf dem Bolton Place ging. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Aktenkoffer habe, würde dir deine Selbstgefälligkeit vergehen. Der Gedanke besserte seine Laune ein wenig, doch nur vorübergehend. Als er den Wagen aufschloss, legte sich die Bedrückung wie ein schwerer Umhang auf seine Schultern. Was trieb einen Mr Dupree dazu, auf so klägliche Weise abzutreten? Eine Wäscheleine ans Wasserrohr zu binden, sich die Schlinge um den Hals zu legen und die Trittleiter unter den Füßen wegzustoßen? Was Lorimer vor sich sah, war nicht der grotesk verrenkte Kopf, sondern es waren eher diese abgeschabten Schuhe knapp einen Meter über dem Boden. Und dazu dieser elende Januartag, düster und trist, genau wie der Bolton Place. Die nackten Platanen mit ihrem Tarnmuster wie aus dem Golfkrieg, das trübe Tageslicht, die Kälte des schärfer gewordenen Winds und der Regen ließen die rußigen Backsteinfassaden der an sich völlig akzeptablen Jahrhundertwendehäuser fast kohlschwarz erscheinen. Ein Kind in moosgrüner Steppjacke tappte auf dem Rasenviereck in der Mitte des Platzes umher und suchte vergeblich nach Ablenkung, indem es über die matschigen Beete lief, einer kecken Amsel nachrannte, schließlich totes Laub zusammenscharrte und ziellos damit warf. In einer Ecke saß die Kinderfrau oder Aufpasserin oder Mutter auf der Bank, rauchte eine Zigarette und nippte an einer grellfarbenen Getränkedose. Eine Grünfläche in der Stadt, umgeben von ehrwürdigen Gebäuden, ein sorglos spielendes Kleinkind auf gepflegtem Rasen, beaufsichtigt von einer treu sorgenden Pflegeperson – unter anderen Umständen hätten diese Einzelheiten zu einem eher heiteren Gesamtbild beigetragen, aber nicht heute, dachte Lorimer. Heute nicht.
Er bog gerade vom Platz in die Hauptstraße ein, als ein Taxi so dicht vor ihm vorbeifuhr, dass er mit einem Ruck anhalten musste. Das Diorama des Bolton Place geisterte über das glänzende Heck des Taxis, und der Fluch blieb Lorimer im Halse stecken, als er das von der Heckscheibe umrahmte Gesicht sah. Das passierte ihm von Zeit zu Zeit, gelegentlich mehrmals in der Woche – er sah ein Gesicht in der Menge, durch ein Schaufenster oder auf der gegenläufigen Rolltreppe, das von so strahlender, überirdischer Schönheit war, dass er am liebsten vor Glück aufgeschrien und zugleich vor Enttäuschung geweint hätte. Wer hatte gesagt, ein Gesicht in der U-Bahn könne einem den ganzen Tag verderben? Alles lag in diesem einen Blick, in der flüchtigen Wahrnehmung, in der vorschnellen Analyse der verfügbaren optischen Erscheinung. Seine Augen drängten zum Urteil, sie waren zu gierig nach Schönheit. War ihm ein zweiter Blick vergönnt, führte der fast immer zur Enttäuschung; die gründliche Betrachtung war stets der strengere Richter. Und nun war es ihm wieder passiert – doch dieses Gesicht, dachte er, würde jeder nüchternen Überprüfung standhalten. Er schluckte und stellte die untrüglichen Anzeichen fest: leichte Kurzatmigkeit, gesteigerter Puls und Beklommenheit in der Brust. Das bleiche, makellose ovale Mädchengesicht – Frauengesicht? – war neugierig und hoffnungsvoll dem Fenster zugewandt, mit großen Augen, der Hals gereckt wie in freudiger Erwartung. Es kam und verschwand so schnell, dass der Eindruck – um ihm nicht den ganzen Tag zu verderben, so sagte er sich – einfach idealisiert gewesen sein musste. Er schauderte. Dennoch, es war auch eine Art wohltuender Zufallsausgleich, der ihn für ein Weilchen vom Anblick der baumelnden ungeputzten Schuhe des Mr Dupree erlöste.
Er bog rechts ab in Richtung Archway. Im Rückspiegel sah er, dass die Menschenansammlung vor Duprees Schaufensterpuppenfabrik noch immer lüstern lauerte. Das Taxi mit dem Mädchen war hinter dem Krankenwagen stecken geblieben, ein Polizist gab dem Fahrer Zeichen, die hintere Tür öffnete sich – und das war’s, er war abgebogen und fuhr nach Archway und zur Holloway Road, die Upper Street hinunter bis Angel, dann die City Road bis Finsbury Square, wo er kurz darauf die regengepeitschten Zackentürme und triefnassen Gehwege des Barbican Centre vor sich sah.
Er fand eine freie Parkuhr in der Nähe des Smithfield Market und eilte mit großen Schritten durch die Golden Lane zum Büro. Ein stechender Eisregen fiel so schräg, dass er ihn in Wangen und Kinn pikste, obwohl er den Kopf gesenkt hielt. Ein kalter, lausiger Tag. Die Lichter in den Geschäften glommen orange, Fußgänger hasteten vorbei, wie er mit eingezogenem Kopf, leidend, zusammengekrümmt und nur bemüht, so schnell wie möglich an ihr Ziel zu kommen.
An der Tür tippte er seine Kombination ein, dann stapfte er die Kiefernholztreppe zum ersten Stock hinauf. Rajiv sah ihn durch das Sicherheitsglas, der Summer ertönte, und Lorimer stieß die Tür auf.
»Regnet mal wieder Schusterjungen, Raj.«
Rajiv drückte seine Zigarette aus. »Was willst du denn hier?«
»Ist Hogg da?«
»Denkst du etwa, hier ist ein Ferienlager?«
»Sehr witzig, Raj. Echt satirisch.«
»Verdammte Faulenzer.«
Lorimer wuchtete den Aktenkoffer auf die Theke und ließ die Schlösser aufschnappen. Die schmucken Stapel neuer Scheine versetzten ihm immer einen kleinen Schock – ihr unwirklicher, befremdender Anblick, druckfrisch, unbefingert, ungeknickt und ungeknüllt, erst noch im Begriff, gegen Waren oder Leistungen eingetauscht zu werden, überhaupt als Geld in Dienst zu treten. Er begann die strammen Bündel auf den Tisch zu stapeln.
»Au Scheiße«, sagte Rajiv und schlurfte in die hintere Ecke seines Büros, um den großen Tresor zu öffnen. »Die Polizei hat angerufen und sich nach dir erkundigt. Dachte mir schon, dass es Ärger gibt.«
»Die Woche fängt jedenfalls gut an.«
»Hat einer gesungen?« Rajiv griff das Geld mit beiden Händen.
»Schön wär’s. ’n Abgänger.«
»Autsch. Da werd ich wohl lieber den Geldtransport zurückrufen. Das freut uns aber gar nicht.«
»Ich kann’s auch mit nach Hause nehmen, wenn du willst.«
»Hier unterschreiben.«
Lorimer unterschrieb das Übergabeprotokoll. 500000 Pfund. Zwanzig Bündel zu je fünfhundert Fünfzigpfundnoten, taufrisch mit ihrem strengen chemischen Geruch. Rajiv zog sich die Hose hoch und zündete sich eine neue Zigarette an. Als er sich vorbeugte, um das Protokoll zu prüfen, spiegelte sich der helle Streifen der Neonröhre genau in der Mitte seines glänzenden, vollkommen kahlen Schädels. Ein leuchtender Irokese, dachte Lorimer.
»Soll ich Hogg anrufen?«, fragte Rajiv, ohne aufzublicken.
»Nein, mach ich selbst.« Hogg meinte immer, Rajiv sei der beste Buchhalter des Landes – und sogar noch wertvoller für die Firma, weil er es nicht wisse.
»So ein Mist«, sagte Rajiv und schob das Papier in eine Mappe. »Hogg wollte, dass du das auf die Reihe bringst, wo doch jetzt der Neue kommt.«
»Welcher Neue?«
»Der neue Chef. Meine Güte, Lorimer, wie lange warst du weg?«
»Ach richtig.« Jetzt erinnerte er sich.
Er winkte Rajiv lässig zu und ging durch den Korridor zu seinem Büro. Die Lage der Räume erinnerte ihn an sein College: Vom grellbeleuchteten Korridor zweigten verschlagähnliche Kammern ab, jede Tür war mit einer rechteckigen Scheibe aus Sicherheitsglas versehen, sodass man nie wirklich Ruhe hatte. Vor seinem Verschlag blieb er stehen; und er sah Dymphna in ihrem Büro gegenüber sitzen, ihre Tür stand halb offen. Sie wirkte mitgenommen, die Augen waren müde, die große Nase wundgeschnaubt. Sie lächelte ihn lethargisch an und schniefte.
»Wo warst du denn?«, fragte er. »Im sonnigen Argentinien?«
»Im sonnigen Peru«, sagte sie. »Ein Albtraum. Was gibt’s?«
»Ich hab mir einen Abgänger eingehandelt.«
»Na, das bringt Ärger. Was sagt denn unser lieber Hogg dazu?«
»Hab’s ihm noch nicht gemeldet. Ich hatte ja keine Ahnung, dass so was vorkommt. Hätt ich nie gedacht. Hogg hat das nie erwähnt.«
»Nein, das macht er nie.«
»Er mag eben Überraschungen.«
»Doch nicht unser Mister Hogg.«
Sie zog eine abgeklärt resignierte Miene, wuchtete ihre schwere Tasche hoch – eine mit eckigen Kanten und vielen Innenfächern, wie sie angeblich von Piloten bevorzugt werden – und ging an ihm vorbei durch den Korridor, heimwärts. Sie war groß und kräftig gebaut – strammer Hintern, stramme Schenkel –, und die schwere Tasche machte ihr nichts aus. Dabei trug sie überraschend zierliche Schuhe mit hohen Absätzen, bei dem Wetter genau das Falsche. Ohne sich noch einmal umzudrehen, sagte sie: »Armer Lorimer. Wir sehn uns auf der Party. Ich würd’s Hoggy nicht sofort sagen. Der könnte ganz schön stinkig sein, wo doch jetzt der neue Chef kommt.« Dem stimmte Rajiv mit einem lauten Lacher zu. »Tschüs, Raji, alter Rabauke.« Und weg war sie.
Lorimer setzte sich untätig für zehn Minuten an den Schreibtisch und schob die Schreibunterlage hin und her, kramte in seinen Stiften, suchte welche aus und verwarf andere, bis er sich entschied, dass eine Aktennotiz an Hogg doch keine gute Idee war. Hogg konnte Aktennotizen nicht ausstehen. Auge in Auge, war seine Devise. Besser noch: Nase an Nase. Hogg musste in diesem Fall einfach Verständnis zeigen: Jedem konnte mal ein Abgänger unterlaufen. Das gehörte zu den Risiken in diesem Job. Die Leute waren an ihrem schwächsten Punkt, hoch anfällig und unberechenbar – Hogg erzählte einem das ständig –, und ging mal einer über Bord, war das eben Berufsrisiko.
Seine Wohnung lag in Pimlico; er bog von der Lupus Street in den Lupus Crescent und fand schließlich einen Parkplatz nur hundert Meter vom Haus entfernt. Es war entschieden kälter geworden, der Regen sah inzwischen aus wie Spucke, die schräg durch die Orangekegel der Straßenlampen segelte.
Lupus Crescent beschrieb keinen exakten Bogen, allerdings war die Straße mit den üblichen Reihenhäusern – Kellergeschoss und drei Etagen, Fassaden aus braunem Backstein und cremefarbenem Stuck – leicht geknickt, als hätte sie zur vollen Bogenform angesetzt, aber nicht genug Energie aufgebracht, sie zu Ende zu führen. Beim Kauf der Wohnung in der Nummer 11 war ihm der Straßenname unangenehm aufgestoßen. Er hatte sich gefragt, warum eine Straße ausgerechnet nach einem besonders unschönen Leiden benannt wurde: Seinem Lexikon zufolge war Lupus »eine für gewöhnlich schwärende tuberkulöse Erkrankung der Haut, die sich ins Gewebe frisst und tiefe Narben hinterlässt«. Er war erleichtert, als ihm seine unten wohnende Nachbarin, Lady Haigh – eine zierliche, lebhafte und in vornehmer Manier verarmte Endachtzigerin –, erklärte, dass Lupus der Familienname eines Earl of Chester war, der irgendwie mit der Sippe der Grosvenors zu tun hatte und dem einmal ganz Pimlico gehörte. Dennoch, fand Lorimer, war der Name Lupus mit seinem medizinischen Beiklang ein Unglücksname, und er hätte ernstlich erwogen, ihn zu ändern, wäre er an der Stelle des Earl of Chester gewesen. Namen waren wichtig, und das war Grund genug, sie zu ändern, wenn sie nicht passten, in irgendeiner Weise störten oder unerfreuliche Assoziationen erweckten.
Hinter Lady Haighs Wohnungstür dröhnte der Fernseher, als Lorimer die Post im Hausflur durchsah. Rechnungen, ein Brief (er erkannte die Handschrift); Country Life für Lady H.; etwas von der Universität Frankfurt für »Herrn Doktor« Alan Kenbarry ganz oben. Er schob die Zeitschrift unter Lady Haighs Tür durch.
»Alan, sind Sie das, Sie Schlingel?«, hörte er sie rufen. »Sie haben mich heute Morgen geweckt.«
Er verstellte die Stimme. »Hier ist – äh – Lorimer, Lady Haigh. Ich glaube, Alan ist unterwegs.«
»Ich bin noch nicht tot, mein guter Lorimer. Kein Grund zur Sorge, Herzchen.«
»Das hör ich gern. Gute Nacht dann.«
Die Zeitschrift wurde energisch hineingezogen, als Lorimer die Stufen zu seiner Wohnung hinauftappte.
Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen und das sanfte Schmatzen der neuen Abdichtung aus Aluminium und Gummi gehört, durchströmte ihn ein Gefühl der Erleichterung. Feierlich berührte er mit der Hand die drei antiken Helme auf dem Tisch im Flur und spürte die Kühle des Metalls auf der Haut. Er drückte auf Knöpfe, betätigte Schalter, gedämpftes Licht ging an, und ein Nocturno von Chopin schlich ihm nach, während er geräuschlos über den rußfarbenen Teppichbelag seiner Zimmer ging. In der Küche goss er sich zwei Fingerhoch eisgekühlten Wodka ein und öffnete den Brief. Er enthielt ein Polaroidfoto, auf dessen Rückseite mit Türkistinte gekritzelt war: Griechischer Helm, ca. 800 v. Chr. Magna Graecae. Für Sie zum absoluten Sonderpreis – £ 29500. Beste Grüße, Ivan. Er betrachtete das Foto einen Moment lang – es war einwandfrei –, dann schob er es in den Umschlag zurück und versuchte, nicht daran zu denken, wo er 29500 Pfund hernehmen sollte. Ein zweiter Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er noch mindestens eine Stunde Zeit hatte, bis er sich für die Party fertigmachen und zum Fort losfahren musste. Er zog das Buch der Verklärung aus der Schublade, schlug es auf dem Küchentresen auf, nahm einen winzigen, lippenbetäubenden Schluck aus dem Glas und ließ sich zum Schreiben nieder. Welches Pronomen sollte er wählen? Die mahnende, vorwurfsvolle zweite Person Singular oder die eher freimütig bekennende erste? Er wechselte je nach Stimmung zwischen dem Ich und dem Du, doch heute, so entschied er, hatte er nichts Unrechtes oder Kritikwürdiges getan, nichts, was eine strengere Objektivität erforderte – also war das Ich dran. 379, schrieb er in seiner winzigen, sauberen Handschrift. Der Fall Mr Dupree.
379. DERFALLMRDUPREE. Ich habe mit Mr Dupree nur ein einziges Mal gesprochen, und das war, als ich ihn anrief, um einen Termin mit ihm zu vereinbaren. »Warum kommt denn nicht Hogg?«, fragte er sofort, neurotisch wie ein enttäuschter Liebhaber. »Der hat wohl seinen Spaß gehabt, was?« Ich erwähnte, dass Mr Hogg sehr beschäftigt sei. »Richten Sie Hogg aus, er soll selbst kommen, oder die ganze Sache platzt«, sagte er und legte auf.
Ich erzählte das alles Hogg, der ein angewidertes Gesicht zog voller Verachtung und Abscheu. »Ich weiß nicht, warum ich mich darauf eingelassen hab, warum ich mir das aufgehalst habe«, sagte Hogg. »Ich hab ihn hier in der Hand«, sagte er und streckte seine breite Hand aus, voller Schwielen wie bei einem Harfenspieler. »Hier hockt er, mit runtergelassenen Hosen. Machen Sie das fertig, Lorimer, alter Junge. Ich hab einen dickeren Fisch am Haken.«
Ich kannte Mr Dupree nicht, daher hielt mein Schock nicht lange an, vermute ich – es ist zwar noch beunruhigend, daran zu denken, aber nicht sehr. Mr Dupree war für mich nur eine Stimme am Telefon, er war Hoggs Fall, einer von seinen wenigen Ausflügen in den Markt, wie er das gern nannte, um die Ware und das Klima zu testen, um mal die Nase reinzustecken, dann hat er ihn routinemäßig an mich abgegeben. Deshalb habe ich selbst nichts empfunden, oder vielmehr war das, was ich als echten Schock deutete, so kurz. Der Mr Dupree, dem ich begegnete, war schon zu einer Sache geworden, einer ziemlich unerfreulichen allerdings, aber wenn da ein gehäutetes Rind gehangen hätte, oder, sagen wir, wenn ich da auf einen Haufen toter Hunde gestoßen wäre, dann hätte mich das in ähnlicher Weise erschreckt, oder? Nein, vielleicht doch nicht. Aber Mr Dupree als menschliches Wesen war mir nie über den Weg gelaufen, alles, was ich von ihm kannte, war diese quengelnde Stimme am Telefon; er war nur ein Name auf einer Akte, nur einer von vielen Terminen, was mich betraf.
Nein, ich glaube nicht, dass ich ein kaltherziger Mensch bin, im Gegenteil, ich bin zu warmherzig, und das könnte tatsächlich mein Problem sein. Aber warum hat mich das, was ich heute gesehen habe, nicht mehr erschüttert oder betroffen gemacht? An Einfühlungsvermögen mangelt es mir ja nicht, aber meine Unfähigkeit, etwas Bleibendes für Mr Dupree zu empfinden, macht mich doch stutzig. Hat mir meine Arbeit, das Leben, das ich führe, die Gefühlstiefe eines überarbeiteten Sanitäters auf einem Schlachtfeld beschert, eines Mannes, der die Toten nur noch zählt und als potenzielle Traglast wahrnimmt? Nein, da bin ich mir sicher. Aber so etwas wie der Fall Mr Dupree wäre mir besser nicht begegnet, hätte nie in mein Leben treten dürfen. Hogg hat mich vorgeschickt, um seine Angelegenheiten zu erledigen. Wusste er etwa, dass so etwas passieren konnte? War es seine Absicherung, dass er mich geschickt hat, statt selbst hinzugehen?
Das Buch der Verklärung
Zum Fort nahm er ein Taxi. Er wusste schon, dass er wieder zu viel trinken würde, wie sie es alle immer taten bei diesen seltenen Zusammenkünften der gesamten Belegschaft. Manchmal konnte er nachts schlafen, wenn er eine Menge getrunken hatte, aber immer funktionierte das nicht, andernfalls hätte er sich dem Alkoholismus mit dem Eifer eines Konvertiten in die Arme geworfen. Manchmal hielt ihn der Alkohol nämlich wach, er blieb munter und aufgekratzt, und sein Verstand raste wie ein Schnellzug.
Als er aus dem Taxi stieg, sah er das Fort leuchten, es war heute Abend hell angestrahlt, die Scheinwerfer erfassten alle vierundzwanzig Stockwerke. Drei mit Schnüren und Lametta behangene Portiers standen an der porte cochère unter der aquamarinblauen Neonschrift aus kräftigen, imposanten Antiqualettern – Fortress Sure. Da muss etwas Großartiges im Konferenzsaal stattfinden, dachte er, das alles kann nicht für solche wie uns gedacht sein. Er wurde taxiert, begrüßt und durch die Lobby zu den Aufzügen gewiesen. Zweite Etage, Portcullis-Suite. Es gab eine richtige Catering-Küche im vierundzwanzigsten Stock, wie er vom Hörensagen wusste, mitsamt einem Gourmetkoch. Jemand hatte gemeint, die Küche könne ohne Weiteres als Dreisternerestaurant durchgehen, und soweit er informiert war, stimmte das, aber er hatte sich nie bis in diese Regionen erhoben. Als Erstes roch er den Zigarettenrauch, dann hörte er das an- und abschwellende Getöse überlauter Stimmen und dröhnendes Männerlachen, und er spürte auch gleich die elektrisierende Welle der Erregung, die stets durch die Aussicht auf Gratisgetränke ausgelöst wurde. Er hoffte, dass ein paar Kanapees den Weg nach unten zu den Proles gefunden hatten. Wegen Mr Dupree hatte er das Mittagessen versäumt, wie ihm jetzt einfiel, und er hatte Hunger.
Dymphnas Brüste waren für einen Moment sichtbar, als sie sich vorbeugte und eine Zigarette ausdrückte. Klein, mit blassen, spitzen Brustwarzen, stellte er fest. Sie sollte wirklich nicht so einen tiefen …
»… Der ist ja so was von geladen«, sagte Adrian Bolt mit genüsslicher Häme zu Lorimer. Bolt war der Älteste im Team, ein ehemaliger Polizeikommissar, Freimaurer und streberischer Leuteschinder. »Der schäumt vor Wut. Aber ein Hogg lässt sich das natürlich nicht anmerken. Diese Selbstbeherrschung, diese Disziplin …«
»Ist der Schaum nicht doch ein bisschen verräterisch?«, meinte Dymphna.
Bolt ignorierte sie. »Er ist ungerührt. Wie ein Stein. Hogg – ein Mann, der nicht viele Worte macht, selbst wenn er verdammt wütend ist.«
Shane Ashgable wandte sich an Lorimer. »In deiner Haut möchte ich nicht stecken, compadre.« Sein kantiges Gesicht war abgesackt vor lauter falschem Mitleid.
Lorimer drehte sich weg, er hatte plötzlich den sauren Geschmack von Übelkeit in der Kehle und hielt im bevölkerten Raum Ausschau nach Hogg. Keine Spur. Er sah, dass vorn am dekorierten Kiefernholzpodium ein Mikrophon angebracht wurde, und meinte, inmitten einer Gruppe strahlender Gefolgsleute die geölte graublonde Frisur von Sir Simon Sherriffmuir auszumachen, seines Zeichens Präsident und Leitender Geschäftsführer von Fortress Sure.
»Noch einen Drink, Dymphna?«, fragte Lorimer, damit er etwas zu tun bekam.
Dymphna reichte ihm ihr leeres Glas, lauwarm und verschmiert. »O danke, lieber Lorimer«, sagte sie.
Er schob und schlängelte sich durch das Gedränge der Trinkenden, alle schluckten gierig und hastig und hielten die Gläser an die Lippen, als könnte sie ihnen jemand entreißen, den ganzen Alkohol beschlagnahmen. Er kannte hier nur noch sehr wenige, höchstens ein paar aus der Zeit, als er selbst noch beim Fort war. Sie waren überwiegend jung, Anfang bis Mitte zwanzig (noch in der Ausbildung?), mit neuen Anzügen, grellen Krawatten, geröteten, angeheiterten Gesichtern. Freitagabend, morgen arbeitsfrei, bis Mitternacht total im Eimer, abgefüllt, sternhagelblau. Die Frauen, in der Minderheit befindlich, rauchten alle, lachten selbstgewiss und genossen es, dass die Männer sich um sie drängten. Lorimer bedauerte jetzt, dass er nicht netter gewesen war zu …
Jemand packte ihn eisenhart am Ellbogen. Er hatte kaum die Kraft, Dymphnas Glas in der Hand zu behalten, und fühlte sich zu einem kleinen Schmerzensschrei verpflichtet, als er wie auf dem Tanzparkett mühelos herumgewirbelt wurde, meisterhaft geführt.
»Wie geht’s denn Mr Dupree?«, fragte Hogg. Sein breites, knolliges Gesicht war ohne Ausdruck und ganz nah. Sein Atem roch sehr seltsam, eine Mischung aus Wein und etwas Metallischem, was an Brasso oder einen anderen Kraftreiniger erinnerte, oder als wären ihm vor nur einer Stunde sämtliche Löcher in den Zähnen plombiert worden. Hogg hatte auch, was kaum zu glauben war, winzige rubinrote Blutperlen von Rasierverletzungen am linken Ohrläppchen, auf der Oberlippe und zwei Zentimeter unter dem linken Auge. Er musste sehr in Eile gewesen sein.
»Ist Mr Dupree wohlauf?«, fragte Hogg weiter. »Springlebendig, gesund und munter, voller Saft und Kraft?«
»Aha«, hauchte Lorimer. »Sie haben es schon gehört.«
»Von der verdammten POLIZEI!«, stieß Hogg mit raspelnder Flüsterstimme hervor, seine schlichte Physiognomie schob sich immer näher heran und begann schon zu verschwimmen. Lorimer hielt die Stellung; jetzt kam es darauf an, nicht vor Hoggs verbalen Sturmspitzen zurückzuzucken, obwohl sie sich ebenso gut küssen konnten, wenn Hogg seinen Kopf nur noch ein wenig weiter vorschob. Hoggs erzener Atem wehte ihm über die Wangen und fächelte ihm sanft das Haar.
»Ich hatte keine Ahnung«, sagte Lorimer entschlossen. »Er war mit dem Besuch einverstanden. Ich dachte, ich könnte das ruck, zuck erledigen …«
»… Eine feine Wortwahl, Black!« Er stieß Lorimer heftig gegen die Brust und traf genau auf seine rechte Brustwarze, als wäre sie ein Klingelknopf. Lorimer jaulte erneut auf. Hogg zog sich zurück, sein Gesicht war eine Grimasse aus Abscheu und abgründigem, metaphysischem Ekel. »Sehen Sie zu, dass das in Ordnung kommt. Und dass mir alles quietschsauber bleibt!«
»Ja, Mr Hogg.«
Lorimer schüttete an der Bar zwei Glas Wein hinunter und atmete ein paar Mal tief durch, bevor er sich auf den Rückweg zu Dymphna und den Kollegen machte. Er sah, dass Hogg weiter drüben einen feist wirkenden Mann mit Nadelstreifen-Maßanzug und pinkfarbener Krawatte in seine Richtung wies. Der Mann setzte sich in Bewegung, steuerte auf ihn zu, und Lorimer spürte, dass sich seine Kehle zuschnürte. Was nun? Polizei? Nein, nicht im Maßanzug. Er senkte den Kopf, um an seinem nächsten Wein zu nippen, als der Kerl sich mit einem dünnen, heuchlerischen Lächeln an ihn heranschob. Sein Gesicht war gedunsen, merkwürdig wettergezeichnet mit den rosaroten, wie Glühfäden wirkenden geplatzten Äderchen auf Wangen und Nasenflügeln. Glänzende, unfreundliche kleine Augen. Aus der Nähe sah er, dass der Mann gar nicht mal so alt war, nicht viel älter als er selbst, er wirkte nur älter. Das Muster der pinkfarbenen Krawatte setzte sich aus winzigen gelben Teddybären zusammen.
»Lorimer Black?«, fragte der Mann und hob die tiefe Stimme mit dem trägen, gedehnten Aristokratenakzent, um gegen das Geplapper im Umkreis anzukommen. Lorimer bemerkte, dass er kaum die Lippen bewegte und durch die Zähne sprach wie ein ungeschickter Bauchredner.
»Ja?«
»Dackel Willi schön.« Der Mund hatte sich einen Spaltbreit geöffnet und diese Laute hervorgebracht, zumindest waren das die Worte, die Lorimer akustisch zuordnen konnte. Der Mann streckte die Hand aus. Lorimer jonglierte mit den Gläsern, verschüttete Wein und lieferte ihm einen hastigen, feuchten Händedruck.
»Wie bitte?«
Der Mann schaute ihn unverwandt an, sein heuchlerisches Lächeln wurde einen Hauch breiter und heuchlerischer. Er sprach erneut.
»Dachte, lieber Gin.«
Lorimer zögerte einen winzigen Moment. »Entschuldigen Sie. Wovon reden Sie überhaupt?«
»Donnern, liebe Jane.«
»Hören Sie, ich weiß nicht, was Sie …«
»Torkel lieber, Jane!«
»Welche Jane denn, um Gottes willen!«
Der Mann warf einen ungläubigen und verärgerten Blick in die Runde. »Herrgott im Himmel«, hörte Lorimer ihn sagen – diesmal klar und deutlich. Er wühlte in seiner Tasche, holte eine Visitenkarte hervor und hielt sie Lorimer entgegen. Torquil Helvoir-Jayne, Geschäftsführer, Fortress Sure AG, stand darauf gedruckt.
»Tor-quil-hell-voir-jayne«, las Lorimer laut wie ein Klippschüler und begriff. »Es tut mir wirklich leid. Dieser Lärm hier. Ich konnte einfach nicht …«
»Es wird ›Heever‹ ausgesprochen«, sagte der Mann verächtlich. »Nicht ›Hell-voir‹. ›Heever!‹«
»Ah. Ich verstehe. Torquil Helvoir-Jayne. Sehr erfreut, Sie zu –«
»Ich bin Ihr neuer Chef.«
Lorimer überreichte Dymphna das Glas und hatte nur den einen Gedanken, dass er hier verschwinden musste, und zwar pronto. Dymphna sah nicht betrunken aus, aber er wusste, dass sie es war. Er wusste nur zu gut, dass sie sturzbetrunken war.
»Wo hast du denn gesteckt, mein Liebchen?«, sagte sie.
Shane Ashgable äugte zu ihm herüber. »Hogg hat dich gesucht.«
Man hörte den Auktionshammer laut und heftig pochen, und eine kurzatmige Stimme bellte: »Äh-Ladies, äh-Gentlemen, bitte eine Sekunde Gehör für Sir Simon Sherriffmuir!« Der Pulk, der das Podium umlagerte, brach in scheinbar ehrlich begeisterten Applaus aus. Lorimer sah, wie Sir Simon zum Podium schritt, sich die Halbbrille aus schwerem Schildpatt aufsetzte, über sie hinwegschaute und mit erhobener Hand um Ruhe bat. Mit der anderen Hand zog er einen kleinen Notizzettel aus der Brusttasche.
»Well …«, begann er – und ließ eine Kunstpause folgen, lang und länger –, »ohne Torquil wird dieser Ort nicht mehr derselbe sein.« Seine bescheidene Pointe wurde mit energischem Gelächter belohnt, unter dessen Nachwehen sich Lorimer zur Flügeltür der Portcullis-Suite bewegte, doch nur, um sogleich zum zweiten Mal an diesem Abend am Ellbogen gepackt zu werden.
»Lorimer?«
»Dymphna, ich muss los. Hab’s eilig.«
»Wollen wir nicht was essen gehen? Nur wir beide, du und ich?«
»Ich esse bei meiner Familie«, log er schnell und ging weiter. »Ein andermal.«
»Und ich fliege morgen nach Kairo.« Sie lächelte und zog die Augenbrauen hoch, als hätte sie soeben die Antwort auf eine lächerlich einfache Frage gegeben.
Sir Simon sprach über die Verdienste, die sich Torquil Helvoir-Jayne um Fortress Sure erworben hatte, über seine Jahre rastlosen Einsatzes. Lorimer versuchte es in seiner Verzweiflung mit einem hilflosen Tja-was-soll-man-machen-Lächeln und zuckte die Schultern. »Tut mir leid.«
»Na gut, ein andermal«, sagte Dymphna tonlos und wandte sich ab.
Lorimer bat den Taxifahrer, das lärmende Fußballspiel, das im Autoradio übertragen wurde, noch lauter zu drehen, und ließ sich so – bei Getöse und Gekreisch – durch die eisige, ausgestorbene City fahren, über die schwarzbrodelnde, rückflutende Themse nach Süden, im Kopf den heiseren Tenor des Reporters, der die Steilpässe, die samtige Geschmeidigkeit der Ausländer beschrie, die messerscharfen Attacken, den nachlassenden Zugriff aufs Spiel und die Jungs, die trotzdem mehr als ihr Bestes gaben. Lorimer fühlte sich aufgeschreckt, durcheinander, verlegen, überrascht und auf schmerzhafte Weise hungrig. Und er stellte fest, dass er nicht annähernd genug getrunken hatte. In einem solchen Zustand, das wusste er aus Erfahrung, war die bedrückend stille Kabine eines schwarzen Taxis kein idealer Aufenthaltsort für ihn. Dann beschlich ihn verstohlen eine neue und willkommene Empfindung – als der Sand in der Uhr zur Neige ging und der Schlusspfiff ertönte –: Schläfrigkeit, Mattigkeit, Erschlaffung. Vielleicht würde es heute gehen, vielleicht würde es wirklich klappen. Vielleicht würde er schlafen.
114. SCHLAF. Wie hieß er nur, der portugiesische Dichter, der so schlecht schlief? Er nannte seine Schlaflosigkeit, wenn ich mich recht erinnere, »Verdauungsstörung der Seele«. Vielleicht ist das mein Problem – Verdauungsstörung der Seele –, auch wenn ich nicht unter echter Schlaflosigkeit leide. Gérard de Nerval sagte: »Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Er besänftigt die Kümmernisse unserer Tage und die Sorgen, die uns ihre Freuden bereiten; aber ich habe nie Ruhe im Schlaf gefunden. Für ein paar Sekunden bin ich benommen, dann fängt ein neues Leben an, befreit von den Bindungen an Raum und Zeit und ohne Zweifel ähnlich dem Zustand, der uns nach dem Tod erwartet. Wer weiß, ob es nicht ein Band zwischen den zwei Existenzen gibt und ob es der Seele dann nicht möglich ist, diese beiden zu vereinen?« Ich glaube, ich weiß, was er meint.
Das Buch der Verklärung
»Zu Doktor Kenbarry, bitte«, sagte Lorimer zu einem misstrauischen Pförtner. Er sprach den Namen immer überdeutlich aus, da er nicht gewohnt war, Alan so zu nennen. »Doktor Alan Kenbarry. Er muss im Institut sein, er erwartet mich. Ich bin Mr Black.«
Pedantisch sah der Pförtner zwei abgegriffene Listen durch und führte zwei Telefongespräche, bevor er Lorimer in die Fakultät für Soziologie der University of Greenwich vorließ. Lorimer fuhr mit dem klapprigen, verschandelten Fahrstuhl zu Alans Reich im fünften Stock hinauf, wo Alan ihn schon im Foyer erwartete. Zusammen gingen sie durch düstere Flure bis zu einer doppelten Schwingtür, die von der Inschrift (mit bauhausartigen Kleinbuchstaben) institut für klarträume geziert war, und weiter durch das abgedunkelte Labor zu den verhängten Kabinen.
»Sind wir heute allein, Doktor?«, fragte Lorimer.
»Nein, das sind wir nicht. Patient F. ist schon vorbereitet.« Er öffnete die Tür zu Lorimers Kabine. »Nach Ihnen, Patient B.«
Sechs Kabinen befanden sich in zwei Dreierreihen Rücken an Rücken am Ende des Labors. Aus jeder Kabine führten Drähte zu einem Metallträger und verliefen, lose miteinander verschlungen, an der Decke entlang bis zum Kontrollzentrum mit einer Galerie von Tonbandgeräten, blinkenden Monitoren und EEG-Geräten. Lorimer bekam immer dieselbe Kabine zugewiesen und war nie einer anderen Laborratte begegnet. Alan wollte es so – kein Austausch über Symptome, keine Mogelei mit Placebos, keine Tricks. Und kein Gequatsche über den netten Doktor Kenbarry.
»Wie geht es uns?«, fragte Alan. Eine einsame Neonröhre verwandelte seine Brillengläser, als er den Kopf bewegte, für einen Moment in zwei weiße Scheiben.
»Eigentlich sind wir ziemlich müde. Der Tag war die Hölle.«
»Armer Junge. Dein Schlafanzug liegt dort. Müssen wir noch mal aufs Klo?«
Lorimer zog sich aus, hängte seine Sachen sorgfältig auf und schlüpfte in die frische Baumwollpyjamahose. Alan kam einen Moment später zurück, schwenkte stolz eine Tube Kontaktgel und eine Rolle Transparentpflaster. Lorimer stand geduldig da, während sich Alan mit den Elektroden abmühte: eine auf jede Schläfe, eine unters Herz, eine auf den Puls am Handgelenk.
Alan klebte die Brustelektrode mit dem Pflaster fest. »Eine kleine Rasur könnte nicht schaden bis zum nächsten Mal. Es stachelt ein bisschen«, sagte er. »So, das wär’s. Träume süß.«
»Hoffen wir das Beste.«
Alan zögerte noch. »Ich hab schon öfter gedacht, wir sollten auch eine am Schwanz des Patienten anbringen.«
»Haha! Lady Haigh sagte, du hättest sie heute Morgen geweckt.«
»Ich hab nur den Müll rausgebracht.«
»Sie war sauer und hat Schlingel zu dir gesagt.«
»Diese Schlange. Das ist nur, weil sie in dich verknallt ist. Sonst alles in Ordnung?«
»Aber klar doch.«
Lorimer kroch in das schmale Bett, Alan stand mit verschränkten Armen am Fußende und lächelte liebevoll wie eine Mutter, nur der weiße Kittel widersprach diesem Eindruck. Alles geheuchelt, dachte Lorimer, und völlig überflüssig.
»Irgendwelche Wünsche?«
»Meeresrauschen bitte«, sagte Lorimer. »Einen Wecker brauche ich nicht. Gegen acht etwa bin ich weg.«
»Nacht, mein Junge. Schlaf süß. Ich bleibe noch ungefähr eine Stunde.«
Alan schaltete das Licht aus und ließ Lorimer in völliger Dunkelheit und fast absoluter Stille zurück.
Jede Kabine war sorgfältig isoliert, sodass die Geräusche, die von außen hereindrangen, bis zur Unkenntlichkeit gedämpft wurden. Lorimer lag in der betäubenden Finsternis und wartete, dass die Blitzlichter vor seinen Augen zur Ruhe kamen. Er hörte das Tonband mit den Ozeanwellen einsetzen, das einschläfernde Rauschen der Brandung, die auf Sand und Steine klatschte, das Zischen und Rasseln der Kiesel im Rücksog, und er drückte den Kopf tiefer ins Kissen. Er war wirklich müde, was für ein katastrophaler Tag … Er verscheuchte die Bilder von Mr Dupree aus dem Bewusstsein und stellte fest, dass an ihre Stelle das wenig liebenswürdige Gesicht von Torquil Helvoir-Jayne trat.
Das war wenigstens was. Chef, hatte er gesagt, sehr gespannt sei er, neue Herausforderungen, aufregende Entwicklungen und so weiter. Verlässt das Fort und kommt zu uns. Und er hatte immer gedacht, Hogg wäre der einzige Chef, der große Zampano – oder wenigstens der einzig sichtbare. Warum sollte Hogg da mitmachen? Das war doch seine Kiste, warum sollte der sich so einen wie Helvoir – o Verzeihung, »Heever« – Jayne gefallen lassen? Der war doch völlig daneben. Peinliche Begegnung, das. Maulfaul, der brauchte dringend Sprechunterricht, zumal bei diesem Namen. Torquilheeverjayne. Arrogantes Arschloch. So ein Fatzke. Aufgeblasenes Ego. Schon komisch, so einen im Büro zu haben. Gar nicht unser Typ. Totale Fehlbesetzung. Torquil. Hatten sie Hogg den vor die Nase gesetzt? Wie war das möglich? … Das musste aufhören, entschied Lorimer, oder er würde nie einschlafen. Themawechsel angesagt. Deshalb war er ja hier. Woran denken? An Sex? Oder an Gérard de Nerval? Sex. Na dann: Dymphna, die stämmige, breitschultrige Dymphna mit den kleinen Brüsten und der offenen Aufforderung. Aus heiterem Himmel, einfach so. Nie hätte er sich das träumen lassen. Sich Dymphna nackt vorstellen, wie sie beide es trieben. Diese albernen Schuhe. Kräftige, eher kurze Beine … Während er absackte und wegtrieb, schob sich ein anderes Bild über das von Dymphna – ein Diorama, das über die glänzende Heckklappe eines Taxis huschte, und darüber ein Mädchengesicht, ein bleiches, ovales, makelloses Gesicht, hoffnungsvoll, mit großen Augen, der Hals gereckt …
Ein brutales Pochen; zwei harte Schläge mit eisernen Knöcheln gegen die Kabinentür rissen ihn jäh aus dem Schlaf. Er saß senkrecht, mit hämmerndem Herzen in der undurchdringlichen Dunkelheit, imaginäre Brandung rauschte an einem imaginären Meeresstrand.
Das Licht ging an, und Alan trat ein, im Gesicht ein resigniertes Lächeln, in der Hand einen Computerausdruck.
»Wow«, sagte er und zeigte Lorimer eine zerklüftete Gebirgskette. »Hätt mir fast ’ne Rippe gebrochen.«
»Wie lange war ich weg?«
»Vierzig Minuten. War es wieder das Klopfen?«
»Ja. Faustschläge gegen die Tür. Bum, bum. Aber laut.«
Lorimer legte sich wieder hin und dachte, dass es aus irgendeinem unerfindlichen Grund immer öfter so kam. Immer öfter in diesen Nächten riss ihn ein lautes Pochen, das Bimmeln oder Schrillen von Türklingeln aus dem Schlaf. Die Erfahrung sagte ihm, dass diese Art des Erwachens dem Nachtschlaf ein abruptes Ende bereitete. Nie gelang es ihm, wieder einzunicken, als hätte der Schock seine Nerven so sehr aufgeschreckt und zerrüttet, dass sie volle vierundzwanzig Stunden brauchten, um sich zu beruhigen.
»Absolut faszinierend«, sagte Alan. »Gewaltiges hypnopompes Traumgeschehen. Ich bin begeistert. Zwei Schläge, sagtest du?«
»Ja. Fein, dass ich dir was bieten kann.«
»Hast du geträumt?« Er zeigte auf das Traumtagebuch neben dem Bett. Alle Träume mussten aufgeschrieben werden, egal, wie fragmentarisch sie waren.
»Nein.«
»Wir zeichnen weiter auf. Versuch wieder einzuschlafen.«
»Wie Sie wünschen, Herr Doktor.«
Die Wellen rauschten. Die Dunkelheit kam zurück. Lorimer lag in der engen Kabine und dachte diesmal an Gérard de Nerval. Es klappte nicht.
2. Kapitel
Als er in den Lupus Crescent einbog, sah Lorimer Detective Sergeant Dennis Rappaport behände aus dem Auto springen und mit eingeübt lungernder Haltung an einem Laternenpfahl Aufstellung nehmen, als wollte er den Eindruck einer rein zufälligen und kaum dienstlich begründeten Begegnung erwecken. Der Tag war ausgesprochen grau und kalt, der Himmel hing tief, und das tote Licht ließ selbst das unglaublich nordische Naturell des Detective Rappaport trist und angegriffen erscheinen. Rappaport war froh, hereingebeten zu werden.
»Sie sind also in der Nacht nicht zu Hause gewesen«, bemerkte Rappaport aufgeräumt und nahm dankbar eine Tasse dampfenden, gut gesüßten Instantkaffee von Lorimer entgegen, der sich mit Mühe eine Bemerkung über die geradezu unheimliche Kombinationsgabe des Kommissars verkniff.
»Das ist korrekt«, sagte er. »Ich nehme an einem Forschungsprojekt zum Thema Schlafstörungen teil. Ich habe einen sehr leichten Schlaf«, fügte er hinzu, um dem Kommissar die nächste Bemerkung abzuschneiden. Vergebens.
»Sie leiden also unter Schlaflosigkeit«, sagte Rappaport. Lorimer fiel auf, dass er das servile »Sir« nicht mehr benutzte, und fragte sich, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Rappaport lächelte ihn wohlwollend an. »Ich schlafe wie ein Bär. Ein Brummbär. Gar kein Problem. Bin sofort weg. Ich hau mich in die Kissen, und weg bin ich. Schlafe wie ’n Klotz.«
»Ich beneide Sie!« Lorimer meinte das aufrichtig, Rappaport hatte ja keine Ahnung, wie aufrichtig er war. Der fuhr fort, seine heroischen Schlafleistungen aufzuzählen, darunter war auch ein Sechzehnstundentriumph bei einer Wildwasserexpedition auf dem Floß. Er schlief regelmäßig acht Stunden, wie sich herausstellte, und er nahm es mit einer gewissen Genugtuung für sich in Anspruch. Lorimer hatte schon des Öfteren registriert, dass das Eingeständnis von Schlafstörungen derlei harmlose Prahlereien provozierte. Nur wenige andere Leiden riefen ein vergleichbares Echo hervor. Wer eine Verstopfung beichtete, musste kaum damit rechnen, dass die Gesprächspartner ihren regelmäßigen Stuhlgang priesen. Auch Klagen über Akne, Hämorriden oder Rückenschmerzen lösten im Allgemeinen Mitgefühl und keine großspurigen Verlautbarungen über stabile Gesundheit aus. Aber Schlafstörungen wirkten so auf die Leute, fand Lorimer. Sie hatten fast magischen Charakter, diese treuherzigen Protzereien, als wären es Beschwörungsformeln gegen die untergründige Angst vor der Schlaflosigkeit, die in jedem lauerte, auch in den gesündesten Schläfern, in den Rappaports der ganzen Welt. Der Kommissar erläuterte jetzt seine Fähigkeit, erholsame Nickerchen einzuschieben, sollten ihn die Pflichten seines Berufs jemals um den geruhsamen und ungetrübten Nachtschlaf bringen.
»Und was kann ich für Sie tun?«, fragte Lorimer höflich.
Rappaport zog sein Notizbuch aus der Jackentasche und blätterte darin. »Eine sehr schöne Wohnung, die Sie hier haben, Sir.«
»Danke.« Komm zur Sache, dachte Lorimer. Rappaport runzelte die Stirn beim Lesen einer seiner Notizen.
»Wie viele Besuche haben Sie bei Mr Dupree gemacht?«
»Nur den einen.«
»Er hatte zwei Stunden für Sie vorgemerkt.«
»Das ist ganz normal.«
»Warum so lange?«
»Das hing mit der Art unseres Geschäfts zusammen. Es ist zeitaufwändig.«
»Sie sind bei der Versicherung, nehme ich an.«
»Nein. Doch. Wenn man so will. Ich arbeite in einer Firma für Schadensregulierungen.«
»Dann sind Sie also Schadensregulierer.«
Und du bist die Zierde deines Berufs, dachte Lorimer, aber er sagte nur: »Ja, ich bin Schadensregulierer. Mr Dupree hatte nach dem Brand eine Schadensforderung an die Versicherung gestellt. Seine Versicherungsgesellschaft …«
»Welche ist das?«
»Fortress Sure.«
»Fortress Sure. Ich bin bei der Sun Alliance. Und bei Scottish Widows.«
»Beides erstklassige Unternehmen. Fortress Sure hatte den Eindruck – und das ist oft so, fast der Normalfall –, dass Mr Duprees Forderung ein wenig hochgegriffen war. Sie beauftragen uns mit der Untersuchung, ob die Schäden tatsächlich so groß sind wie behauptet, und gegebenenfalls damit, die Entschädigungssumme nach unten zu regulieren.«
»Daher der Name ›Schadensregulierer‹.«
»Genau.«
»Und Ihre Firma, die GGH Ltd., ist unabhängig von Fortress Sure.«
»Nicht unabhängig, aber unparteiisch.« Dieser Satz war in Stein gemeißelt. »Fortress Sure bezahlt uns für unsere Dienste.«
»Eine faszinierende Verfahrensweise. Haben Sie vielen Dank, Mr Black. Das war äußerst nützlich. Ich werde Sie nicht länger behelligen.«
Dieser Rappaport ist entweder äußerst clever oder äußerst beschränkt, dachte Lorimer, der sich unauffällig neben das Erkerfenster gestellt hatte und auf den blonden Kopf des Kommissars hinabblickte, aber ich weiß nicht, was von beidem. Lorimer beobachtete, dass Rappaport, nachdem er die Eingangstreppe hinabgestiegen war, auf der Straße stehen blieb und sich eine Zigarette anzündete. Dann starrte er mit gerunzelter Stirn das Haus an, als könnte es ihm irgendeinen Hinweis zum Fall Dupree liefern.
Lady Haigh kam die Außentreppe aus dem Keller hochgeklettert, in der Hand zwei funkelnde leere Milchflaschen, die sie auf der obersten Stufe neben dem Müllkübel absetzte, und Lorimer sah, dass Rappaport sie in ein Gespräch verwickelte. Aus dem eifrigen Kopfnicken der Lady Haigh schloss er, dass sie über ihn redeten. Und obwohl er wusste, dass sie sich zu seiner unbeugsamen Fürsprecherin machen würde, löste dieses Gespräch, das inzwischen weitergegangen war – Lady Haigh wies streng auf ein gigantisches Motorrad, das auf der anderen Seite geparkt war –, eine merkwürdige Unruhe in ihm aus. Er ging in die Küche und wusch Rappaports Kaffeetasse ab.
37. GÉRARDDENERVAL. Bei meinem ersten Besuch im Institut für Klarträume fragte mich Alan nach meiner gegenwärtigen Lektüre, und ich sagte ihm, ich läse eine Biographie von Gérard de Nerval. Alan belehrte mich dann, ich solle mich zur gezielten Schlafförderung entweder auf das Leben de Nervals konzentrieren oder mich sexuellen Phantasien hingeben. Entweder – oder. Dies wäre meine Auswahl an »Schlafmitteln«, von der ich für die Dauer der Behandlung im Institut nicht abweichen sollte. Es musste de Nerval sein oder Sex.
Gérard de Nerval, Guillaume Apollinaire oder Blaise Cendrars. Jeder von ihnen hätte sich geeignet. Ich habe ein widernatürliches Interesse an diesen drei französischen Schriftstellern, und das aus einem einfachen Grund – sie alle haben ihre Namen geändert und sich unter einem anderen Namen neu erfunden. Ihr Leben begonnen hatten sie als Gérard Labrunie, Wilhelm-Apollinaris de Kostrowitzky und Frédéric-Louis Sauser. Gérard de Nerval war mir jedoch der Nächste: Auch er hatte ernstliche Schwierigkeiten mit dem Schlaf.
Das Buch der Verklärung
Lorimer kaufte eine stattliche Lammkeule für seine Mutter und nahm noch zwei Dutzend Schweinswürstchen dazu. In seiner Familie wurden Fleischgeschenke höher geschätzt als alles andere. Als er aus der Metzgerei kam, zögerte er kurz an Marlobes Blumenstand – gerade lange genug, wie sich zeigte, um Marlobes Aufmerksamkeit zu erwecken. Marlobe redete mit zwei Kumpeln und rauchte seine grässliche Pfeife mit dem Edelstahlrohr. Als er Lorimer entdeckte, brach er das Gespräch mitten im Satz ab, streckte ihm eine Blume entgegen und rief: »Im ganzen Land finden Sie keine Lilie, die süßer duftet!«
Lorimer schnupperte, nickte zustimmend und willigte resignierend in den Kauf von drei Stängeln ein, worauf Marlobe sich beeilte, sie einzuwickeln. Sein Blumenstand war eine komplizierte kleine Konstruktion auf Rädern, die aus Türen und Klappflügeln bestand und in geöffnetem Zustand mehrere abgestufte Regalreihen mit blumengefüllten Zinkeimern enthüllte. Marlobe pflegte lautstark zu verkünden, dass er auf Quantität und Qualität achte, doch er verstand darunter hohe Stückzahlen und begrenzte Auswahl, und folglich war sein Angebot sehr schmal, um nicht zu sagen enttäuschend banal. Nelken, Tulpen, Narzissen, Chrysanthemen, Gladiolen, Rosen und Dahlien, das war alles, was er seinen Kunden ungeachtet der Jahreszeit zu bieten hatte, doch dafür in unglaublichen Mengen (man konnte bei Marlobe sechs Dutzend Gladiolen erwerben, ohne seine Vorräte zu erschöpfen) und in jeder Farbe, die es gab. Sein einziges Zugeständnis an einen exotischen Geschmack waren Lilien, und auf die war er besonders stolz.
Lorimer hatte Freude an Blumen und kaufte regelmäßig welche für seine Wohnung, aber Marlobes Sortiment verabscheute er fast ohne Ausnahme. Auch bei den Farben bevorzugte Marlobe die Grundfarben oder möglichst grelle Töne (alle zarten Farben schmähte er lauthals), weil er der Meinung war, dass die Leuchtkraft das wichtigste Kriterium für eine »gute Blume« sei. Dasselbe Wertsystem bestimmte auch den Preis: Eine scharlachrote Tulpe war teurer als eine rosafarbene, Orange galt mehr als Gelb, gelbe Narzissen rangierten höher als weiße und so weiter.
»Wissen Sie was«, fuhr Marlobe fort, wühlte in der Hosentasche nach Kleingeld und hielt in der anderen Hand die Lilien. »Wenn ich ’ne MPi hätte, irgend’ne verdammte MPi, dann würde ich verdammt noch mal da reingehen und die ganze verfluchte Bande an die Wand stellen.«
Lorimer wusste, dass er die Politiker und das Parlament meinte. Die Litanei war ihm vertraut.
»Tacka-tacka-tacka-tack«, die imaginäre MPi ratterte und zuckte in seiner Hand, als Lorimer ihm die Lilien abgenommen hatte. »Die ganze verfluchte Bande würde ich abknallen, bis auf den letzten Mann.«
»Danke«, sagte Lorimer und nahm eine Hand voll warme Münzen entgegen.
Marlobe strahlte ihn an. »Schönen Tag noch.«
Aus irgendeinem bizarren Grund mochte Marlobe ihn und versorgte ihn stets mit seinen ätzenden Kommentaren zum Zeitgeschehen. Er war klein, untersetzt und, abgesehen von ein paar rötlich-sandfarbenen Fusseln um die Ohren und im Nacken, völlig kahl; er hatte ständig den leicht überraschten Unschuldsblick der Blondbewimperten. Lorimer kannte seinen Namen, weil er auf den fahrbaren Blumenkiosk aufgemalt war. Wenn er keine Blumen verkaufte, war er in lärmende Unterhaltungen mit einer seltsamen Mischung von Kumpeln verwickelt – jung und alt, vermögend und unvermögend –, die gelegentlich verschwanden, um geheimnisvolle Aufträge für ihn zu erledigen oder ihm Bier aus der Eckkneipe zu holen. Im Umkreis einer halben Meile hatte er keine Blumenkonkurrenz und verdiente, wie Lorimer wusste, eine hübsche Stange Geld. Seine Ferien verbrachte er an der australischen Ostküste und auf den Seychellen.
Lorimer fuhr mit dem Bus nach Fulham. Die Pimlico Road bis Royal Hospital Road, durch die King’s Road, dann die Fulham Road zum Fulham Broadway. An den Wochenenden mied er die U-Bahn – sie kam ihm unpassend vor, mit ihr fuhr man zur Arbeit –, und für sein Auto hätte er keinen Parkplatz gefunden. An einer Ampel auf dem Broadway stieg er aus und schlenderte durch die Dawes Road, wobei er versuchte, sich Einzelheiten aus seiner Kindheit und Jugend in diesen engen und autoverstopften Straßen ins Gedächtnis zu rufen. Er machte sogar einen Umweg von ein paar hundert Metern, um seine alte Schule, St. Barnabus, in Augenschein zu nehmen, die beschmierten Backsteinmauern, den Schulhof mit dem löchrigen Asphalt. Es war eine wertvolle Übung in schmerzlicher Nostalgie und der eigentliche Grund, weshalb er den beharrlichen Einladungen seiner Mutter zum Essen (am Samstag, nie am Sonntag) hin und wieder Folge leistete. Es war wie das Abreißen des Schorfs von einer Wunde; er wünschte sich Narben, es wäre falsch, das Vergessen zu suchen, alles auslöschen zu wollen. Jede befrachtete Erinnerung, die hier lauerte, hatte ihre Bedeutung: Alles, was er heute darstellte, war indirekt das Resultat seines früheren Lebens und bestätigte ihm die Richtigkeit eines jeden seiner Schritte seit der Flucht nach Schottland … Nein, das ist nun doch ein bisschen übertrieben, ein bisschen hochgegriffen, dachte er. Es war nicht fair, Fulham und der Familie die Verantwortung dafür aufzubürden, was er heute war – was ihm in Schottland passiert war, spielte in diesem Zusammenhang ebenfalls eine gewichtige Rolle.
Trotzdem spürte er, als er von der Filmer Road abbog, dieses vertraute Gefühl in der Speiseröhre – ein Magenproblem, das Sodbrennen. Er musste sich nur auf hundert Meter dem Haus seiner Familie, seinem Geburtshaus, nähern, und schon ging es los, die Magensäure fing an zu schäumen und zu brodeln. Andere Leute – die meisten, wie er großzügig vermutete – wurden bei ihrer Rückkehr nach Hause von einem altvertrauten (in der Kindheit viel bekletterten) Baum begrüßt, vom Klang der Kirchenglocken hinterm Anger oder vom freundlichen Gruß eines älteren Nachbarn … Doch nicht er: Er nuckelte eine Pfefferminzpastille und klopfte sich sacht gegen das Brustbein, als er um die Ecke bog und die schmale, keilförmige Häuserzeile vor sich sah. Die unansehnliche Reihe von Geschäften – mit der Post, dem Getränkeladen, dem pakistanischen Lebensmittelhändler, dem einstigen Fleischerladen mit den heruntergelassenen Jalousien, dem Immobilienbüro – lief in einer Spitze aus, der Nummer 36 mit den verstaubten, in doppelter Reihe geparkten ehemals stolzen Limousinen davor und den Milchglasscheiben der Firma B. & B. Kleintaxis und internationale Kurierdienste im Parterre.
Ein neues Plastiknamensschild, das er bei seinem letzten Besuch noch nicht gesehen hatte, war über dem Klingelknopf angebracht, schwarzkupferne Lettern auf bronziertem Gold: FAMILIEBLOC̣̣J. »Das J ist stumm«, hätte der Wahlspruch der Familie Bloc̣j lauten müssen, wenn man sich ein solches Ruhmeszeichen überhaupt vorstellen konnte, oder auch: »Unter dem C ist ein Punkt.« Aus ferner Zeit hörte er den geduldigen, tief tönenden Akzent seines Vaters an zahllosen Postschaltern, Ferienhotelrezeptionen und Mietwagenzentralen: »Das J ist stumm, und unter dem C ist ein Punkt: Familie Bloc̣j.« Und wie oft in seinem Leben hatte er selbst, verlegen murmelnd, diese Anweisung gegeben? Lieber nicht dran denken – all das lag nun hinter ihm.
Er drückte auf die Klingel, wartete, klingelte erneut und hörte schließlich kleine Füße im Rhythmus eines unregelmäßigen Anapäst die Stufen heruntertrappeln. Seine Nichte Mercy öffnete ihm. Sie war winzig, trug eine Brille wie alle weiblichen Mitglieder der Familie und wirkte wie ein vierjähriges Kind, obwohl sie schon acht war. Er sorgte sich ständig um sie wegen ihrer Winzigkeit, wegen ihres unglückseligen Namens (die Kurzform für Mercedes, was er immer französisch aussprach, um davon abzulenken, dass sie so hieß, weil ihr Vater, sein Schwager, Teilhaber der Taxifirma war) und wegen ihres ungewissen Schicksals. An die Tür geklammert, stand sie da und schaute neugierig-schüchtern zu ihm hoch.
»Hallo, Milo«, sagte sie.
»Hallo, Darling.« Sie war das einzige Wesen, das er »Darling« nannte, und auch das nur, wenn es keiner hörte. Er küsste sie zweimal auf jede Wange.
»Hast du mir was mitgebracht?«
»Feine Würstchen. Aus Schweinefleisch.«
»O fein.«
Sie stapfte die Treppe hinauf, und Lorimer folgte mit müdem Schritt. Der Geruch in der Wohnung war scharf und beißend von Küchendunst und Gewürzen. Offenbar liefen außer dem Fernseher noch irgendwo ein oder zwei Radios mit Werbung und Rockmusik. Mercedes ging ihm voraus in das große dreieckige Wohnzimmer, das voller Licht und Lärm war; es war der Raum an der Spitze der Häuserzeile und direkt über dem Büro und Einsatzstab von B. & B. Kleintaxis und internationale Kurierdienste gelegen. Die Musik (irgendeine Kreuzung aus Country und Rock) kam hier aus einem dunklen, blinkernden Hi-Fi-Turm. Das Radio (Werbegebrüll) drang aus der Küche zur Linken herüber, begleitet vom Klappern und Scheppern energisch betriebener Haushaltsgeräte.
»Milo ist es«, verkündete Mercedes, und seine drei Schwestern drehten sich träge um, drei Augenpaare musterten ihn stumpf durch drei Paare dicker Brillengläser. Monika nähte, Komelia trank Tee und Drava (Mercys Mutter) aß – was zehn Minuten vor dem Mittagessen schon erstaunlich war – einen Nussschokoladenriegel.
Als Kind hatte er seine drei älteren Schwestern in burlesker Laune »die Herrische«, »die Alberne« und »die Schmollende« genannt, oder auch die Dicke, die Dünne und die Kurze: Und seltsamerweise schienen seine wenig schmeichelhaften Bezeichnungen mit dem wachsenden Alter der so Charakterisierten immer zutreffender zu werden. Als jüngstes Kind der Familie war er von ihnen, die in seiner Erinnerung immer schon Frauen waren, herumkommandiert und gepiesackt worden. Selbst die jüngste und hübscheste der Schwestern, die trübsinnige kleine Drava, war sechs Jahre älter als er. Nur Drava hatte geheiratet, hatte Mercedes zur Welt gebracht und sich dann scheiden lassen. Monika und Komelia hatten immer zu Hause gewohnt und mal im Familienbetrieb, mal in Teilzeitjobs gearbeitet. Jetzt waren sie Vollzeit-Hauspflegerinnen, und wenn sie je ein Liebesleben hatten, führten sie es insgeheim, irgendwo anders, weit weg.
»Tag, die Damen«, sagte Lorimer mit mattem Witz. Sie waren so viel älter als er; er sah in ihnen eher Tanten als Schwestern und sträubte sich gegen den Gedanken, durch so enge Blutsbande an sie gefesselt zu sein. Vergeblich suchte er nach irgendeinem genetischen Abstand, nach einem angeborenen Anderssein.
»Mum, Milo ist es«, brüllte Komelia zur Küche hinüber, aber Lorimer war schon dorthin unterwegs und schwenkte den schweren Beutel mit dem Fleisch. Die Mutter füllte mit ihrer breiten Statur den Türrahmen aus, als sie ihm entgegentrat, die Hände an einem Geschirrtuch abwischte und ihn durch ihre beschlagenen Brillengläser anstrahlte.
»Milomre«, seufzte sie mit einer Liebe in der Stimme, die mit Händen zu greifen war und vor der es kein Entkommen gab. Sie küsste ihn viermal heftig, das Plastikgestell ihrer Brille prallte zweimal gegen jeden seiner Wangenknochen. Hinter ihr, zwischen den dampfenden und klappernden Töpfen, sah Lorimer seine Großmutter beim Zwiebelschneiden. Sie winkte ihm mit dem Messer zu, dann schob sie die Brille hoch, um sich die Tränen wegzuwischen.
»Sieh mal, wo du kommst, ich weine vor Freude, Milo«, sagte sie.
»Hallo, Gran, schön, dich zu sehen.«
Seine Mutter hatte die Lammkeule und die Würstchen schon auf die Arbeitsplatte gepackt und prüfte das Gewicht der Keule staunend in den roten, rissigen Händen.
»Der ist aber ein großer Teil, Milo. Sind das da Schwein?«
»Ja, Mum.«
Seine Mutter wandte sich ihrer Mutter zu, und sie sagten schnell etwas in ihrer Sprache. Inzwischen hatte sich die Großmutter die Augen getrocknet und schlurfte auf ihn zu, um auch ihre Küsse loszuwerden.
»Ich sag zu ihr, sieht er nicht schmuck aus, der Milo? Sieht er nicht schmuck aus, Mama?«
»Is ’n Hübscher. Und reich ist er. Nicht wie die ollen Kühe da!«
»Geh zu Papa, Tag sagen«, meinte seine Mutter. »Wird sich freuen. In sein Kabinett.«
Lorimer musste Mercy bitten, aus dem Weg zu gehen, damit er durch die Tür kam, vor der sie mit ihrem Computerspiel kniete. Zögernd räumte sie den Platz, und Drava nutzte die Gelegenheit, sich an ihn heranzumachen und mit gereizter, unschöner Stimme zu fragen, ob er ihr vierzig Pfund borgen könne. Lorimer gab ihr zwei Zwanziger, aber sie hatte das schlanke Bündel in seiner Brieftasche gesehen.
»Kannst du nicht auf sechzig hochgehen, Milo?«
»Ich brauch das Geld, Drava. Es ist Wochenende.«
»Ist auch mein Wochenende. Mach schon.«
Er gab ihr einen weiteren Schein und empfing ein Nicken der Bestätigung, kein Wort des Dankes.
»Bist du beim Austeilen, Milo?«, rief Komelia. »Wir könnten einen neuen Fernseher brauchen, vielen Dank.«
»Und ’ne Wäscheschleuder, wo du schon dabei bist«, ergänzte Monika. Beide lachten schrill, diesmal echt, als ob sie, dachte Lorimer, ihn nicht ernst nähmen, als ob seine Verwandlung in einen anderen Menschen nur eine Finte, nur eines seiner seltsamen Spiele wäre.
Im Flur hatte er einen kurzen Panikanfall und versuchte es mit seiner Atemübung. Auch aus dem »Kabinett« seines Vaters am Ende des Flurs lärmte ein Fernseher. Sechs Erwachsene und ein Kind wohnten im Haus. (»Sechs Frauen in einem Haus«, hatte sein älterer Bruder Slobodan gesagt, »das ist zu viel für einen Mann. Deshalb musste ich da raus, Milo, genau wie du. Meine Männlichkeit hatte gelitten.«) Er zögerte an der Tür – eine Sportsendung, laute australische Stimmen über Satellit (hatte er dafür bezahlt?) dröhnten durch die Tür. Er senkte den Kopf, schwor sich, dass er durchhalten würde, und machte sacht die Tür auf.
Sein Vater schien auf den Bildschirm zu blicken (auf dem Experten in grünen Jacken debattierten); zumindest stand sein Sessel genau davor. Er saß reglos, mit Hemd und Krawatte, die Hose mit scharfer Bügelfalte, die Hände flach auf den Lehnen; sein gleich bleibendes Lächeln wurde von einem gestutzten weißen Bart eingerahmt, die Brille saß etwas schief, das dicke, drahtige Haar war feucht und klebte noch am Kopf.
Lorimer ging zum Fernseher und stellte den Ton leise. »Hallo, Dad«, sagte er. Die Augen seines Vaters blickten ihn leer und verständnislos an und blinkerten ein paar Mal. Lorimer streckte die Hand aus und rückte ihm die Brille gerade. Er staunte jedes Mal, wie adrett sein Vater aussah, und hatte keine Ahnung, wie sie das hinkriegten, seine Mutter und seine Schwestern, wie sie ihn mit allem Nötigen versorgten, ihn badeten, rasierten, verwöhnten, im Haus herumführten, in seinem Kabinett absetzten, sich (mit äußerster Diskretion) um seine Notdurft kümmerten. Lorimer wusste es nicht und wollte es nicht wissen und begnügte sich damit, diesen lächelnden Homunkulus alle paar Wochenenden zu sehen. Offenbar war er glücklich und wohl versorgt, den ganzen Tag vom Fernseher unterhalten, abends wurde er ins Bett gesteckt und morgens sanft geweckt. Mal folgten einem die Augen des Vaters, wenn man sich bewegte, mal nicht. Lorimer trat zur Seite, und der Kopf von Bogdan Bloc̣j wandte sich ihm zu, als wollte er seinen jüngsten Sohn begutachten, der in seinem teuren blauen Anzug groß und elegant aussah.
»Ich stelle wieder laut, Dad«, sagte er. »Das ist Kricket. Du magst doch Kricket, Dad.« Er könne alles hören und verstehen, behauptete seine Mutter, man sehe es an seinem Blick. Aber Bogdan Bloc̣j hatte seit über zehn Jahren kein einziges Wort gesprochen.
»Dann lass ich dich mal in Ruhe, Dad. Mach’s gut.«
Lorimer verließ das Kabinett und traf im Flur auf seinen Bruder Slobodan. Er schwankte leicht und hatte eine deutliche Bierfahne, sein Bauch wölbte sich unter dem zu engen Sweatshirt, sein langes silbriges Haar war glatt zurückgekämmt, und das Ende seines Pferdeschwanzes hing ihm über die Schulter wie eine hochgewehte Krawatte.
»Heeej, Milo!« Er breitete die Arme aus und drückte ihn. »Kleiner Bruder. Alter Dandy.«
»Hallo, Lobby«, erwiderte Lorimer und korrigierte sich gleich. »Slobodan.«
»Wie geht’s Dad?«
»Scheint ihm gut zu gehen, denk ich. Bleibst du zum Essen?«
»Nee, bin heut knapp dran. Hab ’n Spiel in Chelsea.« Er legte Milo seine überraschend kleine Hand auf die Schulter. »Hör mal, Milo, könntest du mir vielleicht ’n Hunderter leihen?«
17. EINEFRAGMENTARISCHEGESCHICHTEDERFAMILIEBLOC̣J