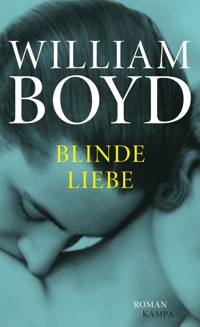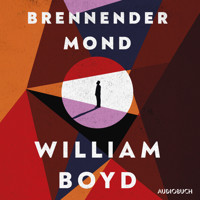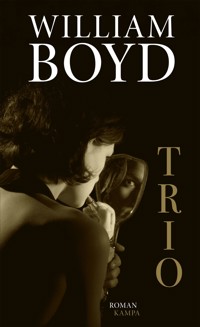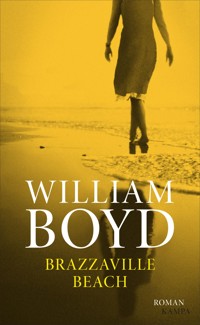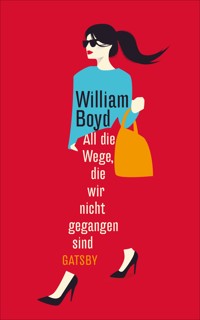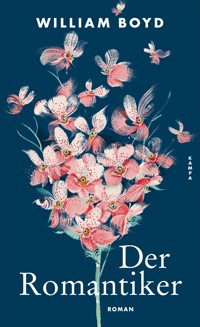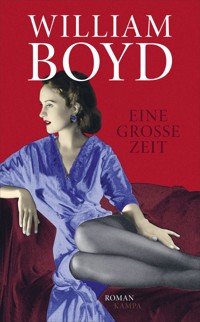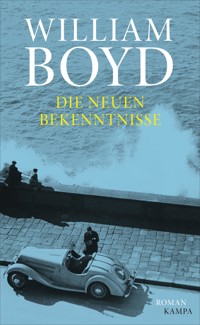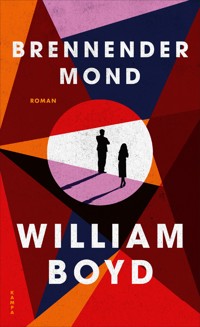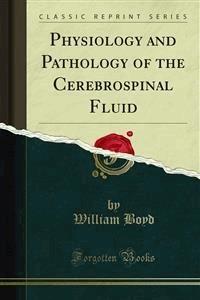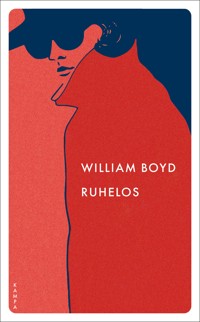
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eines Tages kommt jemand und bringt mich um«, hat Sally Gilmartin ihrer Tochter schon vor Jahrzehnten gesagt. Nun, da sie alt ist, macht Ruth sich ernsthaft Sorgen und fragt sich, ob ihre Mutter unter Wahnvorstellungen leidet. Schließlich offenbart Sally ihrer Tochter, dass sie in Wahrheit nicht Sally Gilmartin heißt, sondern Eva Delektorskaja, und dass sie als russische Emigrantin 1939 in Paris vom britischen Geheimdienst angeworben wurde. Während alles, was Ruth je meinte, über ihre Mutter gewusst zu haben, langsam in sich zusammenfällt, spürt sie schon bald, dass ihre Mutter all das nicht ohne Hintergedanken erzählt. Die ehemalige Spionin hat noch einen letzten Auftrag, den sie nicht allein erledigen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Ruhelos
Roman
Aus dem Englischen von Chris Hirte
Kampa
für Susan
Wir sagen wohl, die Stunde des Todes sei ungewiss, aber wenn wir es sagen, stellen wir uns diese Stunde in weiter, vager Ferne vor, wir denken nicht daran, dass sie irgendeine Beziehung zu dem bereits begonnenen Tage haben und dass der Tod – oder sein erster partieller Zugriff, nach dem er uns nicht mehr loslassen wird – am gleichen Nachmittag noch erfolgen könne, der uns so gar nicht ungewiss schien, für den der Gebrauch der Stunden bereits im Voraus festgelegt war. Man hält an seinem Spaziergang fest, um im Monat die erforderliche Menge an frischer Luft zusammenzubekommen, man hat sich bei der Wahl des Mantels verweilt, den man mitnehmen will, oder des Kutschers, der geholt werden soll, man sitzt im Wagen, der Tag liegt vor einem und erscheint kurz nur aus dem Grunde, weil man zurzeit wieder zu Hause sein möchte, um eine Freundin zu empfangen; man wünschte, es wäre morgen schön, und man ahnt nicht, dass der Tod, der auf einer anderen Ebene schon selbst durch undurchdringliches Dunkel wandelnd, zu einem gelangt ist und gerade diesen Tag für seinen Auftritt gewählt hat, die nächsten Minuten schon …
Marcel Proust, Guermantes
1Ins Herz von England
Wenn ich als Kind frech war, widersprach oder mich irgendwie schlecht benahm, wies mich meine Mutter zurecht, indem sie sagte: »Eines Tages kommt jemand und bringt mich um. Dann wird es dir leidtun.« Oder: »Sie kommen aus heiterem Himmel und holen mich ab – was sagst du dann?« Oder: »Eines Morgens wachst du auf, und ich bin weg. Einfach verschwunden. Wart’s nur ab!«
Es ist merkwürdig, aber man denkt nicht ernsthaft nach über diese Drohungen, wenn man jung ist. Doch wenn ich heute auf die Ereignisse des Sommers 1976 zurückblicke, als England unter einer nicht enden wollenden Hitzewelle ächzte und stöhnte, weiß ich genau, wovon meine Mutter sprach: Heute kenne ich die dunkle Unterströmung der Angst unter der glatten Oberfläche ihres Alltags, die auch nach vielen Jahren friedlichen Dahinlebens nicht versiegte. Heute weiß ich, dass sie ständig Angst hatte, umgebracht zu werden. Und das aus gutem Grund.
Es begann, wie ich mich erinnere, in den ersten Junitagen. Den genauen Tag weiß ich nicht mehr, aber es muss ein Samstag gewesen sein, weil Jochen nicht in der Vorschule war und wir beide wie gewöhnlich nach Middle Ashton fuhren. Auf der Fernstraße von Oxford nach Stratford bogen wir in Chipping Norton nach Evesham ab, dann noch einmal und noch einmal, als wollten wir die Rangordnung der Straßen in abfallender Folge durchfahren; Fernstraße, Provinzstraße, Landstraße, Verbindungsstraße, bis wir uns auf dem befestigten Feldweg befanden, der durch den dichten und hohen Buchenwald in das schmale Tal hinabführte, in dem das Dörfchen Middle Ashton lag. Diese Fahrt machte ich mindestens zweimal die Woche, und jedes Mal war es so, als würde ich in eine versunkene Welt eintauchen, ins Herz des alten England – ein grünes, vergessenes Shangri-La, wo alles älter, modriger und baufälliger war als anderswo.
Middle Ashton war vor Jahrhunderten um Ashton House herum entstanden, ein jakobinisches Landhaus, das noch immer von einem entfernten Verwandten der einstigen Eigentümer bewohnt wurde. Deren Vorfahr, Trefor Parry, ein zu Wohlstand gekommener walisischer Wollhändler des siebzehnten Jahrhunderts, hatte, um mit seinem Reichtum zu protzen, seine großartige Domäne ausgerechnet im tiefsten England errichtet. Jetzt, nach vielen Generationen verschwenderischer Parrys und beharrlicher Vernachlässigung, fiel das Gutshaus, nur noch von ein paar wurmstichigen Balken gestützt, in sich zusammen und überantwortete seine ausgedörrte Seele der Entropie. Durchhängende Planen bedeckten das Dach des Ostflügels, rostende Gerüste kündeten von vergeblichen, längst aufgegebenen Sanierungsvorhaben, und der weiche gelbe Cotswold-Sandstein der Außenmauern blieb, wenn man ihn berührte, an den Händen kleben wie nasser Toast. Nahebei befanden sich die kleine Kirche, ein feuchtes, düsteres Bauwerk, beinahe erdrückt von dichten schwarzgrünen Eiben, die das Tageslicht aufzusaugen schienen; dann der trübsinnige Pub, The Peace and Plenty, wo man mit dem Kopf die fettige, nikotingebeizte Decke streifte, wenn man an die Bar ging; sowie das Postamt mit Lebensmittel- und Spirituosenverkauf; schließlich die verstreuten Cottages, manche strohgedeckt und grün bemoost, aber es gab auch ansehnliche alte Häuser mit großen Gärten. Die Dorfstraßen waren von mannshohen wilden Hecken gesäumt, die zu beiden Seiten wucherten, als hätte sie der Verkehr vergangener Zeiten in kleine Täler verwandelt und sich wie ein reißender Bach mit jedem Jahrzehnt einen Fuß tiefer eingeschnitten. Die riesigen und uralten Eichen, Buchen und Kastanien versenkten das Dorf während des Tages in einen immerwährenden Dämmer und vollführten des Nachts ihre atonale Sinfonie aus Knarren, Flüstern und Seufzen, wenn der Wind durchs dichte Geäst strich und das alte Holz zum Stöhnen und Klagen brachte.
Ich freute mich auf das wunderbar schattige Middle Ashton, denn es war wieder ein brütend heißer Tag – jeder Tag kam einem heiß vor in jenem Sommer –, aber die Hitze ging uns noch nicht so auf die Nerven wie später. Jochen saß hinten und blickte aus dem Rückfenster – er sah gern zu, wie sich die Straße »abspulte« –, und ich hörte Musik im Radio, als er mir eine Frage stellte.
»Wenn du zum Fenster sprichst, kann ich dich nicht hören«, sagte ich.
»Entschuldige, Mummy.«
Er drehte sich nach vorn, stützte die Ellbogen auf meine Schulter und sprach mir leise ins Ohr.
»Ist Granny deine richtige Mummy?«
»Natürlich. Warum fragst du?«
»Ich weiß nicht … Sie ist so seltsam.«
»Jeder ist seltsam, bei Lichte besehen«, sagte ich. »Ich bin seltsam, du bist seltsam …«
»Das stimmt«, sagte er. »Ich weiß.« Er legte den Kopf auf meine Schulter, bearbeitete den Nackenmuskel über meinem rechten Schlüsselbein mit seinem spitzen kleinen Kinn, und mir kamen sofort die Tränen. Ab und zu machte er so etwas mit mir, Jochen, mein seltsamer Sohn – und brachte mich damit fast zum Heulen, aus Gründen, die ich mir selber nicht richtig erklären konnte.
Am Dorfeingang, gegenüber dem Peace and Plenty, hielt ein Brauereifahrzeug und lieferte Bier. Es blieb nur eine schmale Lücke, durch die ich mich quetschen musste.
»Hippo kriegt Schrammen«, warnte mich Jochen. Mein Auto war ein Renault 5 aus siebter Hand, himmelblau mit karminroter (weil ausgetauschter) Motorhaube. Jochen hatte ihn taufen wollen, und ich schlug Hippolyte vor, weil ein französisches Auto meiner Meinung nach einen französischen Namen brauchte (aus irgendeinem Grund hatte ich gerade Taine gelesen), und so wurde Hippo daraus – zumindest für Jochen. Ich persönlich kann Leute nicht ausstehen, die ihren Autos Namen geben.
»Nein«, sagte ich. »Ich passe schon auf.«
Ich hatte mich beinahe durchmanövriert, Zentimeter um Zentimeter, als der Bierfahrer aus dem Pub kam, sich in den Weg stellte und mich mit theatralischem Gefuchtel vorwärts dirigierte – ein ziemlich junger Kerl noch. Sein dicker Bauch zerdehnte das Morrell-Logo auf seinem Sweatshirt, und seine rot glänzende Biervisage wurde von breiten Koteletten eingerahmt, die einem viktorianischen Dragoner alle Ehre gemacht hätten.
»Weiter, weiter, ja, gut so, du kriegst es hin, Schätzchen.« Genervt winkte er mich durch und knurrte abschätzig: »Ist ja wohl kein Sherman-Panzer.«
Als ich neben ihm war, kurbelte ich lächelnd die Scheibe herunter und sagte: »Wenn Sie Ihre Wampe einziehen würden, wäre es ein ganzes Stück leichter, Sie dummes Arschloch.«
Ich gab Gas, bevor er wusste, wie ihm geschah, und beim Hochkurbeln des Fensters spürte ich, dass meine Wut verflog, so schnell, wie sie gekommen war – ein köstlich kribbelndes Gefühl. Ich war nicht gerade in Hochstimmung, wohl wahr, weil ich mir an dem Morgen bei dem Versuch, ein Poster im Arbeitszimmer aufzuhängen, mit slapstickartiger Zwangsläufigkeit und Ungeschicklichkeit mit dem Hammer auf den Daumen – der einen Wandhaken festhielt – geschlagen hatte. Charlie Chaplin wäre stolz auf mich gewesen, so wie ich jaulte und hüpfte und mit der Hand wedelte, als wollte ich sie abschütteln. Mein Daumennagel unter dem hautfarbenen Pflaster war nun pflaumenblau, und ein kleines Schmerzzentrum in meinem Daumen pulsierte wie eine organische Uhr, die die Sekunden bis zu meinem Ableben zählt. Aber während ich davonfuhr, spürte ich den adrenalinbefeuerten Herzschlag, den Freudentaumel über meine Dreistigkeit; in Momenten wie diesen war aller Ärger in mir begraben – in mir und unserer ganzen Spezies.
»Mummy, du hast ein schlimmes Wort benutzt«, sagte Jochen sanft, aber unnachsichtig.
»Tut mir leid, der Mann hat mich echt aufgeregt.«
»Er wollte doch nur helfen.«
»Nein, er wollte mich bevormunden.«
Jochen saß da und kaute eine Weile an dem neuen Wort, dann gab er auf.
»Endlich sind wir da«, sagte er aufatmend.
Das Cottage meiner Mutter stand inmitten dichter, üppiger Vegetation und wurde von einer unbeschnittenen, ausufernden Buchsbaumhecke umgeben, die von Kletterrosen und Klematis durchwuchert war. Der büschelige und handgeschnittene Rasen war von einem geradezu unanständigen Sattgrün, das der gnadenlosen Sonne hohnsprach. Aus der Luft, dachte ich, mussten Cottage und Garten aussehen wie eine grüne, wild wuchernde Oase – wie eine Aufforderung an die Behörden, sofort ein Rasensprengverbot zu erlassen. Meine Mutter war eine passionierte, aber eigensinnige Gärtnerin: Sie pflanzte eng und schnitt kurz. Wenn ein Busch gut gedieh, ließ sie ihn gewähren und scherte sich nicht darum, ob er andere Pflanzen erstickte oder zu viel Schatten erzeugte. Ihr Garten, verkündete sie, sollte eine kontrollierte Wildnis sein – da sie nicht einmal einen Rasenmäher hatte, schnitt sie das Gras mit der Gartenschere –, und sie wusste, dass sich andere im Dorf darüber ärgerten, weil hier schmucke und ordentliche Gärten als wichtigste Vorzeigetugend galten. Aber niemand konnte sich beschweren, dass ihr Garten vernachlässigt und ungepflegt war; keiner im Dorf verwendete so viel Zeit auf den Garten wie Mrs Sally Gilmartin, und die Tatsache, dass sie mit ihrem Fleiß auf üppigen Wildwuchs abzielte, konnte man vielleicht kritisieren, nicht aber verurteilen.
Wir nannten es Cottage, aber in Wirklichkeit war es ein kleines zweigeschossiges Haus aus Cotswold-Sandsteinquadern und Feuersteindachziegeln, das im achtzehnten Jahrhundert umgebaut worden war. Im Obergeschoss gab es noch die alten Flügelfenster, und die Zimmer waren dunkel und niedrig, während das Erdgeschoss Schiebefenster und einen hübsch geschnitzten Eingang mit ionischem Ziergiebel und gekehlten Halbsäulen besaß. Irgendwie hatte sie Huw Parry-Jones, dem dipsomanischen Eigentümer von Ashton House, das Cottage abgeluchst, als er noch betrunkener gewesen war als sonst, und die Rückseite grenzte an die bescheidenen Überreste von Ashton House Park – nun eine ungemähte und unbeweidete Wiese und alles, was den Parrys von den Hunderten Hektar Hügelland, die sie in diesem Teil von Oxfordshire besessen hatten, geblieben war. Seitlich stand ein Holzschuppen mit Garage, der fast vollkommen von Efeu und wildem Wein überwachsen war. Ich sah ihr Auto dort stehen, einen weißen Austin Allegro, also war sie zu Hause.
Jochen und ich öffneten die Pforte und hielten Ausschau nach ihr. Jochens Ruf »Granny, wir sind da« wurde sofort von einem lauten »Hip-hip, hurra!« erwidert, das hinter dem Haus hervorkam. Und dann kam sie selbst, im Rollstuhl über den Plattenweg. Sie hielt an und streckte die Arme aus, als wollte sie uns beide miteinander umarmen, aber wir blieben wie angewurzelt stehen.
»Warum in aller Welt sitzt du im Rollstuhl?«, fragte ich.
»Schieb mich rein, Liebes«, sagte sie, »und alles klärt sich auf.«
Als ich sie mit Jochen ins Haus schob, sah ich, dass eine kleine Holzrampe zur Türschwelle hinaufführte.
»Wie lange sitzt du da schon drin, Sal?«, fragte ich. »Du hättest mich anrufen sollen.«
»Oh, zwei, drei Tage«, sagte sie. »Nicht der Rede wert.«
Weil meine Mutter so auffallend gesund aussah, spürte ich nicht die Betroffenheit, die ich vielleicht hätte empfinden müssen. Ihr Gesicht war leicht gebräunt, ihr dichtes graublondes Haar glänzte und war frisch geschnitten. Und wie um diese Schnelldiagnose zu bestätigen, entstieg sie, kaum hatten wir sie hineingeschoben, dem Rollstuhl, beugte sich mühelos vor und gab Jochen einen Kuss.
»Ich bin gestürzt«, sagte sie und zeigte auf die Treppe. »Die letzten zwei oder drei Stufen – gestolpert, gefallen, und hab mir am Rücken wehgetan. Der Rollstuhl ist eine Empfehlung von Doktor Thorne, damit ich nicht so viel herumlaufe. Vom Laufen wird es nämlich schlimmer.«
»Wer ist Doktor Thorne? Was ist mit Doktor Brotherton?«
»Der hat Ferien. Doktor Thorne ist die Vertretung – war die Vertretung … Netter junger Mann«, fügte sie hinzu. »Jetzt bin ich ihn wieder los.«
Sie ging voraus zur Küche. Ich suchte in ihrer Haltung, ihrem Gang nach Anzeichen für einen schmerzenden Rücken, konnte aber nichts entdecken.
»Er ist wirklich nützlich«, sagte sie, als spürte sie meine wachsende Verunsicherung, meine Ungläubigkeit. »Der Rollstuhl, meine ich, beim Wirtschaften. Nicht zu glauben, wie viele Stunden am Tag man auf den Beinen ist.«
Jochen schaute in den Kühlschrank. »Was gibt’s zu Mittag, Granny?«
»Salat«, sagte sie. »Zum Kochen ist es zu heiß. Gieß dir was zu trinken ein, mein Schatz.«
»Salat ess ich gern«, sagte Jochen und nahm sich eine Dose Coca-Cola. »Was Kaltes hab ich am liebsten.«
»Guter Junge.« Meine Mutter zog mich beiseite. »Ich fürchte, heute kann er nicht bleiben. Das wird mir zu viel, wegen des Rollstuhls und überhaupt.«
Ich unterdrückte meine Enttäuschung und meine egoistischen Regungen – die Samstagnachmittage für mich zu haben, während Jochen den halben Tag in Middle Ashton verbrachte, war mir zur lieben Gewohnheit geworden. Meine Mutter ging ans Fenster und spähte unter vorgehaltener Hand hinaus. Von der Essecke sah man in den Garten, und der Garten grenzte an die Wiese, die nur sporadisch gemäht wurde, manchmal in Abständen von zwei oder drei Jahren, daher war sie voller Wildblumen und bestand aus unzähligen Grassorten und Unkraut. Und jenseits der Wiese begann der Wald, der aus irgendeinem vergessenen Grund Witch Wood hieß – ein uralter Bestand aus Eichen, Buchen und Kastanien, nur die Ulmen fehlten natürlich oder gingen gerade ein. Ich fand es merkwürdig, dass sie so angestrengt hinausblickte. Das passt nicht zu ihren üblichen Marotten und Eigenheiten, sagte ich mir. Ich legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Ist alles in Ordnung, altes Haus?«
»Hmm. Es war nur ein Sturz. Ein Schock für den Organismus, wie es heißt. In ein, zwei Wochen bin ich wieder auf dem Posten.«
»Sonst ist nichts? Du würdest es mir doch sagen, oder?«
Sie wandte mir ihr hübsches Gesicht zu und bedachte mich mit dem offenherzigen Blick, den ich so gut kannte – große blassblaue Augen. Aber inzwischen, nach allem, was ich hinter mir hatte, konnte ich diesem Blick standhalten, ich ließ mich nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen.
»Was soll denn sein, meine Liebe? Glaubst du, ich werde senil?«
Ungeachtet dessen bat sie mich, sie im Rollstuhl durchs Dorf bis zur Post zu fahren, um unnötigerweise eine Flasche Milch und eine Zeitung zu kaufen. Mit Mrs Cumber, der Postfrau, redete sie ausführlich über ihren schlimmen Rücken, und auf der Rückfahrt ließ sie mich halten, um über den Steinwall hinweg mit dem jungen Bauunternehmer Percy Fleet und seiner langjährigen Freundin (Melinda? Melissa?) zu plaudern, während die ihren Gartengrill anheizten – eine Ziegelkonstruktion mit Schornstein, die sich stolz auf der Betonfläche vor dem neuen Wintergarten erhob. Sie bedauerten meine Mutter: Ein Sturz, das war wirklich das Schlimmste. Melinda führte das Beispiel ihres alten, von Schlaganfällen heimgesuchten Onkels an, der nach einem Sturz im Badezimmer wochenlang verwirrt gewesen war.
»So was will ich auch, Percy«, sagte meine Mutter und zeigte auf den Wintergarten. »Sehr schön.«
»Ein Voranschlag kostet nichts, Mrs Gilmartin.«
»Wie hat es Ihrer Tante hier gefallen? Hat sie sich amüsiert?«
»Meiner Schwiegermutter«, berichtigte Percy.
»Ach ja, natürlich. Ihrer Schwiegermutter.«
Wir verabschiedeten uns, und ich schob sie unwillig die holprige Straße entlang, während in mir Ärger darüber hochstieg, dass sie mich zur Mitwirkenden in dieser Theatervorstellung gemacht hatte. Überhaupt kommentierte sie ständig das Kommen und Gehen der Leute, als würde sie alle überwachen und jedes Mal die Stechuhr betätigen wie ein übereifriger Vorarbeiter, der seine Untergebenen schikaniert – das machte sie schon, solange ich denken konnte. Reg dich nicht auf, sagte ich mir. Nach dem Essen fahre ich mit Jochen zurück, er kann im Garten spielen, wir können in den Parks der Uni spazieren gehen …
»Du darfst mir nicht böse sein, Ruth.« Sie blickte über die Schulter zu mir auf.
Ich hörte auf zu schieben und zündete mir eine Zigarette an. »Ich bin dir nicht böse.«
»O doch, das bist du. Lass mich einfach sehen, wie ich zurechtkomme. Nächsten Samstag ist vielleicht alles wieder in Ordnung.«
Als wir zurück waren, sagte Jochen mit Grabesstimme: »Vom Rauchen kann man Krebs kriegen.« Ich fuhr ihn an, und wir aßen unsere Mahlzeit in ziemlich angespannter Stimmung mit langen Schweigephasen, die meine Mutter ab und zu mit heiter-banalen Bemerkungen über das Dorf unterbrach. Sie überredete mich zu einem Glas Wein, und ich wurde etwas lockerer. Ich half ihr beim Abwasch und trocknete ab, während sie die Gläser im heißen Wasser spülte. Mutter-Tochter, Tochter-Mutter, sucht die Tochter in der Butter, reimte ich vor mich hin, plötzlich froh, dass Wochenende war, ohne Unterricht, ohne Studenten, und dachte mir, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, einmal ein wenig Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Da sagte meine Mutter etwas Merkwürdiges.
Sie hielt wieder die Hand über die Augen und blickte zum Wald hinüber.
»Was ist?«
»Siehst du jemanden? Ist da jemand im Wald?«
Ich schaute. »Niemand, den ich sehen würde. Warum?«
»Mir war, als hätte ich jemanden gesehen.«
»Wanderer, Spaziergänger – heute ist Samstag, die Sonne scheint.«
»Na klar: Die Sonne scheint, und die Welt ist in bester Ordnung.«
Sie ging zur Anrichte, holte das Fernglas, das dort immer lag, und richtete es auf den Wald.
Ich ignorierte ihren Sarkasmus, machte mich auf die Suche nach Jochen, damit wir losfahren konnten. Demonstrativ setzte sich meine Mutter in den Rollstuhl und fuhr zur Haustür. Jochen erzählte ihr vom Bierfahrer und meinem schamlosen Gebrauch von Schimpfwörtern. Meine Mutter nahm sein Gesicht in die Hände und lächelte ihn liebevoll an.
»Deine Mutter kann sehr wütend werden, wenn sie will, und dieser Mann war ganz bestimmt sehr dumm«, sagte sie. »Deine Mutter ist eine zornige junge Frau.«
»Na, vielen Dank auch, Sal«, sagte ich und beugte mich über sie, um sie auf die Stirn zu küssen. »Ich ruf dich heute Abend an.«
»Tust du mir einen kleinen Gefallen?«, sagte sie, und dann bat sie mich, es in Zukunft zweimal klingeln zu lassen, aufzulegen und neu zu wählen. »Dann weiß ich, dass du’s bist«, erklärte sie. »Mit dem Rollstuhl komm ich nicht so schnell durchs Haus.«
Jetzt machte ich mir zum ersten Mal wirklich Sorgen. Waren das nicht schon Wahnvorstellungen oder Anzeichen geistiger Zerrüttung? Aber sie sah den Blick in meinen Augen.
»Ich weiß, was du denkst, Ruth«, sagte sie. »Du liegst falsch, völlig falsch.« Sie erhob sich aus dem Rollstuhl und stand plötzlich hoch aufgereckt und starr da. »Warte einen Augenblick«, sagte sie und stieg die Treppe hinauf.
»Hast du Granny wieder geärgert?«, fragte Jochen mit leisem Vorwurf.
»Nein.«
Meine Mutter kam die Treppe herunter – ohne Anstrengung, wie mir schien – und trug einen dicken gelbbraunen Schnellhefter unter dem Arm. Sie hielt ihn mir hin.
»Ich möchte, dass du das liest«, sagte sie.
Ich nahm ihr den Hefter ab. Er schien etliche Dutzend Seiten zu enthalten – verschiedene Papiersorten und Formate. Ich schlug ihn auf. Es gab eine Titelseite: DIE GESCHICHTE DER EVA DELEKTORSKAJA.
»Eva Delektorskaja«, sagte ich verdutzt. »Wer ist das?«
»Ich«, erwiderte sie. »Ich bin Eva Delektorskaja.«
Die Geschichte der Eva Delektorskaja
Paris 1939
Zum ersten Mal hatte Eva Delektorskaja den Mann bei der Beerdigung ihres Bruders Kolja gesehen. Auf dem Friedhof stand er ein wenig abseits der Trauergemeinde. Er trug einen Hut – einen alten braunen Schlapphut, was ihr seltsam vorkam. Sie hielt sich an diesem Detail fest: Welche Sorte Mann würde mit einem braunen Schlapphut zur Beerdigung gehen? Was war das für eine Art von Pietät? Und sie hing dem Gedanken weiter nach, um das übermächtige Gefühl der Trauer halbwegs im Zaum zu halten, um nicht vollends die Fassung zu verlieren.
Aber danach zu Hause, bevor die Trauergäste eintrafen, fing ihr Vater zu schluchzen an, und da konnte auch Eva die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ihr Vater hielt ein gerahmtes Foto von Kolja in den Händen, umklammerte es krampfhaft – wie ein rechteckiges Lenkrad. Eva legte ihm die Hand auf die Schulter, und mit der anderen wischte sie sich schnell die Tränen ab. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Irène, ihre Stiefmutter, kam mit einem klirrenden Tablett herein, darauf eine Karaffe Brandy und ein paar winzige Gläschen, nicht größer als Fingerhüte. Sie setzte es ab und ging in die Küche zurück, um einen Teller mit Zuckermandeln zu holen. Eva beugte sich über ihren Vater und bot ihm ein Glas an.
»Papa«, sagte sie mit versagender Stimme, »nimm einen kleinen Schluck – hier, siehst du, ich trinke auch etwas.« Sie nippte an ihrem Brandy und spürte das Brennen auf den Lippen.
Seine dicken Tränen fielen auf das Bild. Er blickte zu ihr auf, zog sie an sich und küsste sie auf die Stirn.
»Er war erst vierundzwanzig … vierundzwanzig …«, flüsterte er, als wäre Koljas Alter etwas Unglaubliches, als hätte jemand zu ihm gesagt: Ihr Sohn hat sich in Luft aufgelöst, oder: Ihr Sohn hat Flügel bekommen und ist davongeflogen.
Irène kam herüber, bog sanft seine Finger auseinander und nahm ihm behutsam das Bild weg.
»Mange, Serge«, sagte sie, »bois – il faut boire.«
Sie stellte das Bild auf dem Tischchen ab und begann die kleinen Gläser auf dem Tablett zu füllen. Eva hielt ihrem Vater den Teller mit den Zuckermandeln hin. Achtlos nahm er sich eine Handvoll und ließ ein paar zu Boden fallen. Sie schlürften ihren Brandy, knabberten Mandeln und tauschten Banalitäten aus: wie froh sie waren, dass der Tag trübe und windstill war, dass Sonnenschein unpassend gewesen wäre; wie schön es war, dass Monsieur Dieudonné die weite Reise von Neuilly gewagt hatte, und wie schäbig und geschmacklos, dass die Lussipows mit einem Trockenstrauß gekommen waren. Getrocknete Blumen! Allen Ernstes! Eva schaute immer wieder zum Bild von Kolja hinüber, der in seinem grauen Anzug lächelte, als würde er ihnen amüsiert zuhören, mit einem schelmischen Glitzern in den Augen, bis das Unfassbare des Verlusts, der Affront seiner Abwesenheit, über ihr zusammenschlug wie eine Flutwelle und sie wegschauen musste. Zum Glück klingelte es, und Irène stand auf, um die ersten Gäste zu empfangen. Eva blieb bei ihrem Vater sitzen, hörte, während Mäntel und Hüte abgelegt wurden, das gedämpfte Geräusch taktvoller Worte und sogar ein ersticktes Lachen als Anzeichen jener seltsamen Mischung aus Trauer und unbändiger Erleichterung, welche die Menschen nach einer Beerdigung zu befallen pflegt.
Als Evas Vater das Lachen hörte, schaute er sie an, schniefte und zog die Schultern hoch, verzagt und hilflos wie ein Mann, dem selbst die einfachsten Antworten entfallen sind, und sie sah, wie alt er plötzlich geworden war.
»Nur noch du und ich, Eva«, sagte er. Sie wusste, dass er an Marja dachte, seine erste Frau, seine Mascha, ihre Mutter – und an ihren Tod vor vielen Jahren am anderen Ende der Welt. Eva war vierzehn gewesen, Kolja zehn, und zu dritt hatten sie Hand in Hand auf dem Ausländerfriedhof von Tientsin gestanden, umweht von den Blütenblättern der riesigen weißen Glyzinie, die auf der Friedhofsmauer wuchs – wie von Schneeflocken, wie von dickem, weichem Konfetti. »Nur noch wir drei«, hatte er damals gesagt, als sie am Grab der Mutter standen und sich fest bei den Händen hielten.
»Wer war der Mann mit dem braunen Schlapphut?«, fragte Eva. Er war ihr gerade wieder eingefallen, und sie wollte das Thema wechseln.
»Ein Mann mit einem braunen Schlapphut?«, fragte ihr Vater.
Da schoben sich die Lussipows schüchtern und vage lächelnd ins Zimmer, gefolgt von Evas molliger Cousine Tanja und ihrem neuen, sehr kleinen Mann, und ihre seltsame Frage nach dem Mann mit dem braunen Schlapphut war vergessen.
Aber sie sah ihn wieder, drei Tage später, am Montag – ihrem ersten Arbeitstag nach der Beerdigung –, als sie mittags das Büro verließ, um essen zu gehen. Er stand unter der Markise der Épicerie auf der anderen Straßenseite, trug einen langen Tweedmantel – dunkelgrün – und seinen unpassenden Schlapphut. Er fing ihren Blick auf, nickte, lächelte, überquerte die Straße und nahm den Hut, um sie zu begrüßen.
Er sprach ein hervorragendes, akzentfreies Französisch: »Mademoiselle Delektorskaja, mein aufrichtiges Beileid wegen Ihres Bruders. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie während der Beerdigung nicht ansprach, aber es kam mir nicht angemessen vor, zumal uns Kolja nie vorgestellt hat.«
»Ich wusste nicht, dass Sie Kolja kannten.« Diese Tatsache warf sie schon aus der Bahn; in ihrem Kopf rumorte es, leichte Panik erfasste sie – etwas stimmte nicht.
»Aber ja. Nicht direkt befreundet, aber gute Bekannte, könnte man sagen.« Er machte eine leichte Verbeugung und fuhr fort, diesmal in fehlerlosem Englisch: »Verzeihen Sie, mein Name ist Lucas Romer.«
Der Akzent war Upperclass, aristokratisch, aber Eva dachte sofort, dass dieser Mr Lucas Romer überhaupt nicht aussah wie ein Engländer. Er hatte welliges schwarzes Haar, zurückgekämmt und vorn schon dünner werdend, und seine Gesichtsfarbe war geradezu – sie suchte nach dem treffenden Wort – schwärzlich, mit dichten Augenbrauen, die aussahen wie zwei horizontale Striche zwischen der hohen Stirn und den Augen, die von einem schlammigen Blaugrau waren (sie achtete immer auf die Augenfarbe der Leute). Sein Kinn wirkte metallisch hart und zeigte, obwohl frisch rasiert, einen Anflug von Bart.
Er spürte, dass sie ihn musterte, und strich unwillkürlich über sein dünnes Haar. »Hat Kolja nie mit Ihnen über mich gesprochen?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Eva, nun ebenfalls auf Englisch. »Nein, einen Lucas Romer hat er mir gegenüber nie erwähnt.«
Aus irgendwelchen Gründen lächelte er über ihre Feststellung und zeigte seine sehr weißen, ebenmäßigen Zähne.
»Sehr gut«, sagte er nachdenklich und nickte, um seine Zufriedenheit zu signalisieren, dann fügte er hinzu: »Das ist übrigens mein wirklicher Name.«
»Etwas anderes hätte ich auch nicht vermutet«, sagte Eva und reichte ihm die Hand. »Es war mir ein Vergnügen, Mr Romer. Wenn Sie mich entschuldigen wollen. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit für meinen Lunch.«
»Nein. Sie haben zwei Stunden Zeit. Ich habe Monsieur Frellon gesagt, dass ich Sie in ein Restaurant führe.«
Monsieur Frellon war ihr pünktlichkeitsbesessener Chef.
»Warum sollte Monsieur Frellon das erlauben?«
»Weil er glaubt, dass ich vier Dampfschiffe bei ihm chartern werde, und da ich kein Wort Französisch spreche, muss ich die Details mit seiner Dolmetscherin aushandeln.« Er deutete mit dem Hut in die andere Richtung. »In der Rue du Cherche-Midi kenne ich ein kleines Lokal. Vorzügliche Fischgerichte. Mögen Sie Austern?«
»Ich hasse Austern.«
Er lächelte nachsichtig wie über ein launisches Kind, aber diesmal waren seine weißen Zähne nicht zu sehen.
»Dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie man Austern genießbar macht.«
Das Restaurant hieß Le Tire Bouchon, und Lucas Romer zeigte ihr tatsächlich, wie man Austern genießbar machte (mit Rotweinessig, gehackten Schalotten, schwarzem Pfeffer und Zitronensaft, gefolgt von einem Happen gebutterten Schwarzbrots). Eigentlich aß sie Austern ab und zu ganz gern, aber sie wollte der maßlosen Selbstsicherheit dieses seltsamen Mannes die Spitze abbrechen.
Beim Essen (Seezunge bonne femme nach den Austern, Käse, Tarte tatin, eine halbe Flasche Chablis und eine ganze Flasche Morgon) sprachen sie über Kolja. Eva wurde klar, dass Romer über alles, was Kolja betraf, Bescheid wusste – über sein Alter, seine Erziehung, die Flucht der Familie aus Russland nach der Revolution von 1917, den Tod der Mutter in China, über die Irrfahrt der Delektorskis von St. Petersburg über Wladiwostok, Tientsin, Schanghai nach Tokio, bis sie 1924 in Berlin landeten und von dort 1928 schließlich nach Paris weiterzogen. Er wusste auch von der Eheschließung Sergej Pawlowitsch Delektorskis mit der kinderlosen Witwe Irène Argenton im Jahr 1932 und dem bescheidenen finanziellen Aufschwung der Familie dank der von Madame Argenton eingebrachten Mitgift. Er wusste sogar noch mehr, wie sie herausfand, nämlich dass ihr Vater in letzter Zeit Herzprobleme hatte und seine Gesundheit zu wünschen übrig ließ. Wie viel weiß er über mich, fragte sich Eva, wenn er so viel über Kolja weiß?
Er hatte zweimal Kaffee bestellt und für sich einen Schnaps. Aus einem zerbeulten silbernen Etui bot er ihr eine Zigarette an – sie nahm eine, er gab ihr Feuer.
»Sie sprechen ein exzellentes Englisch«, sagte er.
»Ich bin ja auch halb englisch«, erklärte sie, als wüsste er das nicht. »Meine Mutter war Engländerin.«
»Also sprechen Sie Russisch, Englisch und Französisch. Noch etwas?«
»Ein wenig Deutsch. Mäßig, nicht fließend.«
»Gut … Wie geht es übrigens Ihrem Vater?«, fragte er, während er seine Zigarette anzündete und den Rauch mit dramatischer Geste zur Decke blies.
Eva zögerte. Was sollte sie diesem wildfremden Menschen erzählen, der sich wie ein Vertrauter benahm, wie ein Cousin, ein besorgter Onkel, der sich nach der Familie erkundigte? »Es geht ihm nicht gut. Er ist untröstlich – wie wir alle. Dieser Schock – Sie können sich nicht vorstellen … Ich fürchte, Koljas Tod bringt ihn noch um. Meine Stiefmutter macht sich große Sorgen.«
»Ah ja. Kolja hat Ihre Stiefmutter bewundert.«
Eva wusste nur zu gut, dass Koljas Verhältnis zu Irène bestenfalls ein angespanntes gewesen war. Madame Argenton hatte in ihm so etwas wie einen Taugenichts gesehen, einen Träumer der irritierenden Art.
»Der Sohn, den sie nie hatte«, fügte Romer hinzu.
»Hat Ihnen Kolja das erzählt?«, fragte Eva.
»Nein. Ich vermute es.«
Eva drückte ihre Zigarette aus. »Ich werde jetzt besser gehen«, sagte sie und stand auf. Romer lächelte unangenehm. Sie spürte, dass er sich über ihre plötzliche Kälte, ihre Abruptheit freute – als hätte sie irgendeine kleine Prüfung bestanden.
»Haben Sie nicht etwas vergessen?«, sagte er.
»Ich glaube nicht.«
»Ich wollte doch vier Dampfschiffe bei Frellon, Gonzales & Cie. chartern. Nehmen Sie noch einen Kaffee, und wir besprechen die Details.«
Wieder im Büro, konnte Eva plausibel darlegen, welche Tonnagen, Zeiträume und Zielhäfen Romer im Sinn hatte. Monsieur Frellon zeigte sich hocherfreut über den Ertrag ihrer verlängerten Mittagspause. Romer sei ein »dicker Fisch«, wiederholte er ständig, »den müssen wir an Land ziehen«. Eva fiel auf, dass Romer ihr, obwohl sie zwei- oder dreimal das Gespräch darauf gebracht hatte, nicht erzählt hatte, wann, wo und wie er mit Kolja zusammengetroffen war.
Zwei Tage später, als sie mit der Metro zur Arbeit fuhr, stieg Romer an der Place Clichy in ihren Wagen ein. Er stand ein paar Fahrgäste entfernt und winkte ihr freundlich zu. Eva wusste sofort, dass es kein Zufall war, und glaubte ohnehin nicht, dass der Zufall eine besondere Rolle im Leben Lucas Romers spielte. Am Bahnhof Sèvres-Babylone stiegen sie aus und machten sich zusammen auf den Weg zu ihrem Büro, nachdem Romer ihr erklärt hatte, er habe einen Termin bei Monsieur Frellon. Es war ein trüber Tag, der Himmel war von Wölkchen überzogen, nur ab und zu brach die Sonne durch; ein plötzlicher Windstoß zerrte an ihrem Rock und dem blauvioletten Halstuch. Als sie das kleine Café an der Ecke Rue de Varenne und Boulevard Raspail erreichten, schlug Romer eine Pause vor.
»Was wird aus Ihrem Termin?«
»Ich sagte, dass ich irgendwann am Vormittag vorbeikomme.«
»Aber ich komme zu spät«, wandte sie ein.
»Er wird nichts dagegen haben. Wir reden geschäftlich. Ich rufe ihn an.« Er ging zur Theke, um Telefonmünzen zu kaufen. Eva setzte sich ans Fenster und musterte ihn – nicht mit Abscheu, eher mit Neugier. Welches Spiel spielen Sie, Mr Lucas Romer?, dachte sie. Geht es um Sex mit mir oder um Geschäfte mit Frellon, Gonzales & Cie.? Wenn es um Sex ging, verschwendete er seine Zeit. Sie fand Lucas Romer nicht attraktiv. Zu viele Männer begehrten sie, während sie, im Gegenzug, nur sehr wenige begehrenswert fand. Das war der Preis, den die Schönheit manchmal forderte: Wir machen dich schön, entscheiden die Götter, aber zugleich sorgen wir dafür, dass du unglaublich schwer zufriedenzustellen bist. So früh am Morgen wollte sie nicht an ihre wenigen komplizierten und unglücklichen Liebesaffären denken, also nahm sie eine Zeitung vom Haken. Erotische Absichten schieden wohl doch aus, dachte sie sich – aber irgendetwas führte er im Schilde. Die Schlagzeilen handelten vom Spanischen Bürgerkrieg, dem Anschluss, Bucharins Hinrichtung in der Sowjetunion. Die Vokabeln starrten von Aggressivität: Aufrüstung, Territorium, Reparationen, Waffen, Drohungen, Warnungen, Krieg und zukünftige Kriege. Ja, dachte sie, er hat andere Absichten, aber sie musste abwarten, um herauszubekommen, welche es waren.
»Überhaupt kein Problem.« Er stand über ihr, auf seinem Gesicht spielte ein Lächeln. »Ich habe Ihnen Kaffee bestellt.«
Sie fragte nach Monsieur Frellons Reaktion, und Romer versicherte ihr, Monsieur Frellon sei hocherfreut gewesen über diese vielversprechende Begegnung. Der Kaffee kam, Romer lehnte sich entspannt zurück, tat reichlich Zucker in seinen express und rührte hingebungsvoll um. Eva musterte Romers dunkles Gesicht, als sie die Zeitung weghängte, seinen angeschmuddelten und knautschigen Kragen, seine schmale Krawatte. Was würde man in ihm vermuten? Einen Dozenten? Einen mäßig erfolgreichen Schriftsteller? Einen mittleren Beamten? Auf keinen Fall aber einen Schiffsmakler. Warum also saß sie mit diesem seltsamen Engländer in diesem Café, wenn sie nicht die geringste Lust dazu hatte? Sie beschloss, ihm auf den Zahn zu fühlen und über Kolja auszufragen.
»Seit wann kannten Sie Kolja?« Sie nahm eine Zigarette aus der Packung in ihrer Handtasche, ohne ihm eine anzubieten.
»Seit etwa einem Jahr. Wir trafen uns auf einer Party … Jemand feierte das Erscheinen eines Buches. Wir kamen ins Gespräch … Ich fand ihn sehr sympathisch …«
»Welches Buch war das?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
Sie setzte ihr Kreuzverhör fort – zu seinem wachsenden Vergnügen, wie sie nun bemerkte. Es machte ihm offensichtlich Spaß, und das ärgerte sie. Sie saß nicht zu ihrem Zeitvertreib hier oder zum Flirten – ihr Bruder war tot, und sie vermutete, dass Romer weit mehr über seinen Tod wusste, als er zuzugeben bereit war.
»Warum ist er zu der Kundgebung gegangen?«, fragte sie. »Action Française ausgerechnet! Kolja war doch kein Faschist!«
»Natürlich nicht.«
»Warum war er also dort?«
»Weil ich ihn darum gebeten hatte.«
Das war ein Schock für sie. Warum, fragte sie sich, hätte Lucas Romer Kolja Delektorski bitten sollen, zu einer Kundgebung der Action Française zu gehen, und warum, fragte sie sich weiter, hätte Kolja dieser Bitte entsprechen sollen? Aber sie fand keine schnelle oder einfache Antwort.
»Warum haben Sie ihn darum gebeten?«, fragte sie.
»Weil er für mich gearbeitet hat.«
Den ganzen Tag im Büro dachte Eva an Romer und seine verblüffenden Antworten. Nach der Behauptung, Kolja habe für ihn gearbeitet, hatte er abrupt das Gespräch beendet, in vorgebeugter Haltung, fest in ihre Augen blickend, womit er zu bekräftigen schien: Jawohl, Kolja hat für mich, Lucas Romer, gearbeitet. Er müsse jetzt gehen, sagte er unvermittelt, er habe Termine, meine Güte, es ist ja schon spät.
Nach Feierabend, während der Heimfahrt in der Metro, versuchte Eva methodisch vorzugehen, die losen Bruchstücke zu einem Puzzle zusammenzufügen, aber es wollte ihr nicht gelingen. Lucas Romer hatte Kolja auf einer Party getroffen, sie waren Freunde geworden – mehr als Freunde offenbar –, Kollegen gewissermaßen, und Kolja hatte in irgendeiner unbekannten Eigenschaft für Romer gearbeitet … Welche Art von Arbeit war das, die ihn zum Besuch einer Kundgebung der Action Française in Nanterre veranlasst hatte? Während dieser Kundgebung war Kolja laut den Ermittlungen der Polizei ans Telefon gerufen worden. Zeugen erinnerten sich, dass er mitten im Hauptreferat von Charles Maurras, man bedenke, hinausgegangen war, dass ihm einer der Ordner einen Zettel gebracht hatte, dass mit seinem Aufbruch einige Unruhe verbunden gewesen war. Und dann das Zeitloch von fünfundvierzig Minuten – die letzten fünfundvierzig Minuten seines Lebens –, für die es keine Zeugen gab. Leute, die den Saal durch die Seitenausgänge (es war ein großes Kino) verließen, fanden seine Leiche in der Gasse hinterm Kino, er lag verdreht in einer glänzenden Blutlache auf dem Kopfsteinpflaster, getötet durch mehrere Schläge auf den Hinterkopf. Was war in den letzten fünfundvierzig Minuten seines Lebens geschehen? Als er gefunden wurde, fehlte seine Brieftasche, auch seine Uhr und sein Hut. Aber welcher Raubmörder stiehlt einen Hut?
Eva ging die Rue des Fleurs hinauf und fragte sich, was Kolja dazu bewogen haben mochte, für einen Mann wie Romer zu »arbeiten«, und warum er nie über diesen sogenannten Job gesprochen hatte. Und wer war Romer, dass er Kolja, einem Musiklehrer, einen Job antrug, der lebensgefährlich war? Einen Job, der ihn das Leben gekostet hatte? In welcher Eigenschaft und aus welchem Grund? Wegen Romers Schiffsfirma? Wegen seiner internationalen Geschäfte? Sie musste grinsen über die Absurdität dieser Vorstellung, während sie ihre üblichen zwei Baguettes kaufte, und ignorierte Benoîts leutseliges Lächeln, der ihr Grinsen als Entgegenkommen missverstand. Sofort wurde sie wieder ernst. Benoît – auch einer, der scharf auf sie war.
»Wie geht’s, Mademoiselle Eva?«, fragte er und nahm das Geld in Empfang.
»Nicht so gut«, erwiderte sie. »Der Tod meines Bruders … Sie wissen schon.«
Sein Gesicht veränderte sich, zog sich vor lauter Mitgefühl in die Länge. »Eine schreckliche Geschichte«, sagte er. »Was sind das nur für Zeiten!«
Wenigstens lässt er mich jetzt eine Weile in Ruhe und stellt mir keine Fragen, dachte Eva im Gehen. Sie bog in den kleinen Vorhof des Mietshauses ein, öffnete im großen Hof die kleine Tür und nickte der Concierge, Madame Roisanssac, zu. Sie stieg die zwei Treppen hoch, schloss auf, ließ die Brote in der Küche, ging weiter zum Salon und dachte: Nein, heute bleibe ich nicht schon wieder zu Hause, nicht mit Papa und Irène; ich sehe mir einen Film an, den Film, der im Rex gezeigt wird, Je suis partout. Ich brauche ein bisschen Abwechslung, dachte sie, ein bisschen Raum, ein bisschen Zeit für mich selbst.
Als sie den Salon betrat, erhob Romer sich mit einem matten Begrüßungslächeln von seinem Platz. Ihr Vater stellte sich vor ihm auf und sagte in seinem schlechten Englisch und mit gespieltem Vorwurf in der Stimme: »Also wirklich, Eva! Warum sagst du mir nicht, dass du Mr Romer getroffen hast?«
»Ich habe nicht gedacht, dass es von Bedeutung ist«, erwiderte Eva, ohne den Blick von Romer abzuwenden, und versuchte, absolut neutral, absolut unbeeindruckt zu wirken. Romer lächelte und lächelte – er wirkte sehr entspannt und war eleganter gekleidet, wie sie jetzt sah, in dunkelblauem Anzug mit weißem Hemd und einer anderen englischen Streifenkrawatte.
Ihr Vater war ganz aufgeregt, er zog ihr einen Stuhl heran und sagte im Plauderton: »Mr Romer hat Kolja gekannt, hält man das für möglich?« Aber Eva hörte nur die empörten Fragen und Ausrufe, die ihr durch den Kopf fuhren. Wie können Sie es wagen, hier aufzutauchen! Was haben Sie Papa erzählt? Diese Unverschämtheit! Was ich davon halte, ist Ihnen wohl egal? Sie sah die Gläser und die Portflasche auf dem Silbertablett, sah den Teller mit Zuckermandeln und wusste, dass Romer sich diesen Empfang mühelos verschafft hatte, ganz im Vertrauen auf den Trost, den er mit seinem Besuch spenden würde. Wie lange ist er schon da?, fragte sie sich und schaute, wie viel noch in der Flasche war. Die Stimmung ihres Vaters ließ vermuten, dass sie schon mehr als ein Glas getrunken hatten.
Ihr Vater zwang sie förmlich auf den Stuhl; sie lehnte das Glas Portwein ab, nach dem es sie so dringend gelüstete. Sie sah, dass sich Romer diskret zurücklehnte, mit übergeschlagenen Beinen, sie sah dieses feine, berechnende Lächeln in seinem Gesicht. Das Lächeln eines Mannes, dachte sie, der genau zu wissen glaubt, was als Nächstes passiert.
Entschlossen, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen, stand sie auf. »Ich muss los«, sagte sie. »Ich komme zu spät ins Kino.«
Irgendwie gelangte Romer vor ihr zur Tür, seine Finger ergriffen ihren rechten Ellbogen.
»Mr Delektorski«, sagte er zu ihrem Vater, »kann ich irgendwo unter vier Augen mit Eva sprechen?«
Sie wurden in sein Arbeitszimmer geleitet, eine kleine Kammer am Ende des Flurs, die mit steif wirkenden Porträtfotos der Familie Delektorski ausgestattet war, einem Schreibtisch, einem Diwan und einem Regal voller Bücher seiner russischen Lieblingsautoren: Lermontow, Puschkin, Turgenjew, Gogol, Tschechow. Es roch nach Zigarren und der Pomade, die sich ihr Vater ins Haar rieb. Sie trat ans Fenster und sah Madame Roisanssac beim Wäscheaufhängen. Plötzlich war ihr mulmig zumute. Sie hatte geglaubt, spielend mit Romer fertigzuwerden, aber nun, allein mit ihm im Zimmer ihres Vaters, sah alles ganz anders aus.
Und als hätte er das gespürt, veränderte sich auch Romer: Seine maßlose Selbstsicherheit wich einer direkteren, verbindlicheren Art. Er drängte sie, sich zu setzen, und zog einen Stuhl für sich hinter dem Schreibtisch hervor, setzte sich ihr gegenüber, als wollte er mit ihr so etwas wie ein Verhör beginnen. Er hielt ihr sein verbeultes Zigarettenetui hin, sie nahm eine Zigarette, sagte gleich darauf: Nein, lieber nicht, und gab sie zurück. Sie verfolgte, wie er sie wieder einsteckte, offensichtlich ein wenig irritiert. Wenigstens ein winziger Sieg, dachte sie – alles zählte, wenn es galt, diese Fassade aus lässiger Arroganz zu durchbrechen, und sei es nur für einen Augenblick.
»Kolja hat für mich gearbeitet, als er umkam«, begann Romer.
»Das sagten Sie schon.«
»Er wurde von den Faschisten ermordet, den Nazis.«
»Ich dachte, es sei Raubmord gewesen.«
»Er hat … er hat gefährliche Aufträge ausgeführt – und er wurde entdeckt. Ich glaube, es war Verrat.«
Eva wollte etwas sagen, entschied sich aber dagegen. In der jetzt entstehenden Stille holte Romer sein Etui erneut heraus und durchlief das ganze Ritual – er steckte die Zigarette in den Mund, klopfte die Taschen nach dem Feuerzeug ab, nahm die Zigarette aus dem Mund, stauchte sie an beiden Enden auf das Etui, zog den Aschenbecher auf dem Schreibtisch ihres Vaters näher heran, zündete die Zigarette an, inhalierte und stieß energisch den Rauch aus. Eva verfolgte den ganzen Vorgang und versuchte, völlig unbeteiligt zu wirken.
»Ich arbeite für die britische Regierung«, sagte er. »Sie verstehen, was ich meine …«
»Ja«, sagte Eva. »Ich glaube.«
»Auch Kolja hat für die britische Regierung gearbeitet. Auf meine Anweisung hat er versucht, die Action Française zu infiltrieren. Er hat sich der Bewegung angeschlossen und mir über alle Entwicklungen berichtet, die für uns von Bedeutung sein könnten.« Er wartete ab, ob sie nachfragen würde, beugte sich vor und erklärte mit ruhiger Stimme: »Es wird Krieg geben in Europa, in sechs Monaten oder einem Jahr – zwischen Nazideutschland und etlichen europäischen Ländern, so viel ist sicher. Ihr Bruder war Teil des Kampfes gegen diesen bevorstehenden Krieg.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass er ein tapferer Mann war. Dass er nicht umsonst gestorben ist.«
Eva unterdrückte das sarkastische Lachen, das ihr in der Kehle saß, und fast im selben Augenblick spürte sie Tränen in sich aufsteigen.
»Ich wünschte, er wäre ein Feigling gewesen«, sagte sie und versuchte, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken, »dann wäre er noch am Leben. Dann könnte er im nächsten Moment durch diese Tür kommen.«
Romer stand auf und stellte sich ans Fenster, wo auch er nun verfolgte, wie Madame Roisanssac ihre Wäsche aufhängte, bis er sich wieder abwandte, sich auf die Schreibtischkante setzte und ihr in die Augen sah.
»Ich möchte Ihnen Koljas Job anbieten«, sagte er. »Ich möchte, dass Sie für uns arbeiten.«
»Ich habe einen Job.«
»Sie bekommen fünfhundert Pfund pro Jahr. Sie werden britische Bürgerin mit britischem Pass.«
»Nein, danke.«
»Sie werden in Großbritannien ausgebildet und arbeiten in verschiedenen Eigenschaften für die britische Regierung – genauso wie Kolja.«
»Danke, nein. Ich bin sehr zufrieden mit meiner jetzigen Arbeit.«
Plötzlich wollte sie nur noch, dass Kolja hereinkam, was ja ganz unmöglich war – Kolja mit seinem ironischen Lächeln und seinem müden Charme –, und ihr sagte, was sie tun sollte, was sie dem Mann mit dem beharrlichen Blick und den beharrlichen Forderungen sagen sollte. Was soll ich machen, Kolja? Sie hörte die Frage in ihrem Kopf. Sag mir, was ich tun soll, und ich tu’s.
Romer stand auf. »Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen und schlage vor, dass Sie es auch tun.« Er ging zur Tür, tippte mit zwei Fingern an seine Stirn, als hätte er etwas vergessen. »Ich sehe Sie morgen – oder übermorgen. Denken Sie ernsthaft über meinen Vorschlag nach, Eva, und was das für Sie und Ihre Familie bedeutet.« Dann schien seine Stimmung abrupt zu wechseln, als hätte ihn eine plötzliche Erregung gepackt, als würde er seine Maske für einen Moment fallen lassen. »Zum Teufel noch mal, Eva«, sagte er. »Ihr Bruder ist von diesen Gangstern ermordet worden, diesem widerwärtigen Pack – Sie kriegen die Chance, ihn zu rächen, sie büßen zu lassen.«
»Auf Wiedersehen, Mr Romer, es war reizend, Sie zu sehen.«
Eva schaute aus dem Zugfenster, draußen zog die schottische Landschaft vorüber. Es war Sommer, doch ihr schien, als wäre die Landschaft unter dem niedrigen weißen Himmel von den Spuren harter Winter gezeichnet – die kleinen, zähen, von einem beständigen Wind gekrümmten und deformierten Bäume, das büschelige Gras, die sanften grünen Hügel mit ihrem dunklen Schorf aus Heidekraut. Es mag ja Sommer sein, schien das Land zu sagen, aber ich bleibe lieber auf der Hut. Sie dachte an andere Landschaften, die sie aus dem Zug gesehen hatte, und tatsächlich war ihr manchmal so, als wäre ihr Leben aus vielen Zugfahrten zusammengesetzt, aus einer Abfolge fremder Gegenden, die an ihrem Fenster vorübergehuscht waren – von Moskau nach Wladiwostok, von Wladiwostok nach China … Luxuriöse wagons lits, Truppenzüge, Güterzüge, Bummelzüge auf Nebenstrecken, Tage des Wartens auf eine Ersatzlok. Mal in überfüllten Zügen, fast erstickend im Mief der zusammengepressten Leiber, dann wieder in der melancholischen Einsamkeit leerer Abteile, Nacht für Nacht das eintönige Rattern der Räder im Ohr; mal mit leichtem Gepäck, nur mit einem Köfferchen, dann wieder befrachtet mit der gesamten Habe, wie ein Flüchtling ohne Ziel. All diese Reisen: von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach Paris und jetzt von Paris nach Schottland. Noch immer mit unbekanntem Ziel, dachte sie und sehnte sich ein wenig nach der alten Erregung, der alten Romantik.
Eva schaute auf die Uhr – noch zehn Minuten bis Edinburgh. Ein älterer Geschäftsmann saß im Abteil und nickte ständig über seinem Roman ein, der Kopf mit den hässlich erschlafften Zügen fiel von einer Seite zur anderen. Eva nahm ihren neuen Pass aus der Handtasche und betrachtete ihn vielleicht zum hundertsten Mal. Er war 1935 ausgestellt worden und trug die Einreisestempel mehrerer europäischer Länder: Belgiens, Portugals, der Schweiz und interessanterweise auch der USA. Alle diese Länder hatte sie offenbar bereist. Das Foto war unscharf und überbelichtet: Es ähnelte ihr – einer strengeren, trotzigeren Eva (wo hatten sie das aufgetrieben?) –, aber selbst sie konnte nicht entscheiden, ob es wirklich echt war. Ihr Name, ihr neuer Name, lautete Eve Dalton. Aus Eva Delektorskaja war Eve Dalton geworden. Warum nicht Eva? Sie vermutete, dass »Eve« englischer klang, aber Romer hatte ihr ohnehin keine Wahl gelassen.
An dem Abend, als sich Romer so abrupt verabschiedet hatte, war sie in den Salon gegangen, um mit ihrem Vater zu reden. Ein Job für die britische Regierung, sagte sie, fünfhundert Pfund jährlich, ein britischer Pass. Er tat überrascht, aber es war klar, dass Romer ihn bis zu einem gewissen Grad eingeweiht hatte.
»Du wärst englische Staatsbürgerin, mit Pass«, sagte ihr Vater mit einem ungläubigen Gesichtsausdruck, der schon fast tölpelhaft wirkte – als wäre es undenkbar, dass ein so unbedeutender Mensch wie er eine Tochter mit britischem Pass haben könnte. »Weißt du, was ich dafür geben würde, englischer Staatsbürger zu sein?«, sagte er und machte mit der rechten Hand eine Sägebewegung am linken Arm.
»Ich traue ihm nicht«, sagte Eva. »Und warum sollte er das für mich tun?«
»Nicht für dich, für Kolja. Kolja hat für ihn gearbeitet. Kolja ist dafür gestorben.«
Sie goss sich ein Gläschen Portwein ein, trank es aus und behielt den süßen Schluck ein paar Sekunden im Mund.
»Für die britische Regierung arbeiten«, sagte sie, »du weißt, was das bedeutet.«
Er ging auf sie zu und nahm ihre Hände. »Es gibt tausend Möglichkeiten, für die britische Regierung zu arbeiten.«
»Ich werde ablehnen. Ich fühle mich wohl in Paris – und in meinem Beruf.«
Wieder reagierte ihr Vater mit einem übertriebenen, fast parodistischen Gesichtsausdruck: Diesmal war es Verblüffung, ein so komplettes Unverständnis, dass ihm schwindlig wurde. Er setzte sich hin, wie um es unter Beweis zu stellen.
»Eva«, sagte er mit ernster, getragener Stimme. »Überleg doch mal: Du musst es tun. Aber nicht wegen des Geldes oder wegen des Passes oder damit du in England leben kannst. Es ist doch ganz einfach: Du musst es für Kolja tun – für deinen Bruder.« Er zeigte auf Koljas Foto. »Kolja ist tot«, sagte er, und es klang einfältig, fast idiotisch – als hätte er die Tatsache seines Todes eben erst zur Kenntnis genommen. »Ermordet. Was bleibt dir da anderes übrig?«
»Gut, ich werde darüber nachdenken«, erwiderte sie kühl, um sich nicht von seinen Gefühlen überrumpeln zu lassen, und ging hinaus. Aber ungeachtet dessen, was die rationale Seite ihres Verstandes sagte – alles abwägen, nichts übereilen, es ist dein Leben, um das es hier geht –, wusste sie, dass ihr Vater schon alles Wesentliche gesagt hatte. Es ging weder um Geld noch um den Pass, noch um ihre Sicherheit. Kolja war tot. Kolja war ermordet worden. Sie musste es für Kolja tun. So einfach war das.
Sie sah Romer zwei Tage später auf der anderen Straßenseite stehen, als sie zum Essen ging, unter der Markise der Épicerie wie an jenem ersten Tag. Diesmal wartete er, dass sie auf ihn zuging, und als sie die Straße überquerte, spürte sie einen starken Widerstand – als wäre sie abergläubisch und soeben mit einem bösen Omen konfrontiert worden. Ein absurder Gedanke kam in ihr hoch: Fühlen sich Menschen so, wenn sie in eine Ehe einwilligen?
Sie tauschten einen Händedruck, und Romer führte sie in das Café. Nachdem er bestellt hatte, überreichte ihr Romer einen gelbbraunen Umschlag. Er enthielt einen Pass, fünfzig Pfund in bar und eine Fahrkarte von Paris, Gare du Nord, nach Edinburgh, Waverley Station.
»Und wenn ich Nein sage?«
»Dann geben Sie mir alles zurück. Niemand wird Sie zwingen.«
»Aber Sie hatten den Pass schon fertig.«
Romer zeigte beim Lächeln die Zähne. Vielleicht ist das Lächeln diesmal echt, dachte sie.
»Sie ahnen ja nicht, wie leicht es ist, einen Pass zu fälschen. Nein, ich dachte mir …« Er zog die Stirn kraus. »Ich kenne Sie nicht so, wie ich Kolja kannte, aber ich dachte mir, seinetwegen und weil Sie mich an ihn erinnern, gäbe es eine Chance, dass Sie bei uns mitmachen.«
Eva musste fast lachen beim Gedanken an das Gespräch, diese Mischung aus Aufrichtigkeit und abgrundtiefer Verlogenheit, und beugte sich zum Fenster, als der Zug unter Dampf in Edinburgh einfuhr. Sie verrenkte den Hals, um die Burg auf dem Felsen zu sehen – fast schwarz, wie aus Kohle auf einen Kohlefelsen gebaut, ragte sie über ihr auf, während der Zug langsamer wurde und in den Bahnhof einfuhr. Jetzt erschienen Streifen von Blau zwischen den dahinjagenden Wolken, es wurde heiterer, der Himmel war nicht mehr weiß und neutral – vielleicht wirkten deshalb die Burg und der Felsen so schwarz.
Sie stieg mit ihrem Koffer aus dem Zug (»nur einen Koffer«, hatte Romer insistiert) und lief den Bahnsteig entlang. Er hatte ihr lediglich gesagt, dass sie abgeholt würde. Ihr Blick streifte Familien und Pärchen, die sich begrüßten und umarmten, höflich lehnte sie die Dienste eines Gepäckträgers ab und betrat die große Bahnhofshalle.
»Miss Dalton?«
Sie drehte sich um – und staunte, wie schnell sie sich an ihren neuen Namen gewöhnt hatte, denn Miss Eve Dalton war sie erst seit zwei Tagen. Vor ihr stand ein etwas feister Mann mit zu engem grauem Anzug und zu engem Kragen.
»Ich bin Staff Sergeant Law«, sagte der Mann. »Bitte folgen Sie mir.« Er bot ihr nicht an, den Koffer zu tragen.
2Ludger Kleist
»Yes, Mrs Amberson thought, it was my doing nothing that made the difference.«
Hugues blickte noch verstörter drein als gewöhnlich, beinahe entsetzt. Die englische Grammatik machte ihm sowieso zu schaffen – er ächzte, stöhnte, murmelte Französisches –, aber heute trieb ich ihn zur Verzweiflung.
»My doing nothing – was?«, sagte er hilflos.
»My doing nothing – nichts. Das ist ein Gerundium.« Ich versuchte, munter und motiviert auszusehen, beschloss dann aber, zehn Minuten früher Schluss zu machen. Im Kopf spürte ich den Druck erzwungener Konzentration – ich hatte mich mit wahrem Feuereifer in die Arbeit gestürzt, nur um meinen Verstand zu beanspruchen –, aber nun war es vorbei mit meiner Geduld. »Das Gerundium und das Gerundiv nehmen wir uns morgen vor«, sagte ich, klappte das Buch zu (Life with the Ambersons, Vol. III), und da ich sah, wie sehr ich ihn verunsichert hatte, fügte ich begütigend hinzu: »C’est très compliqué.«
»Ah, bon.«
Nicht nur Hugues, auch ich hatte die Amberson-Familie und ihre anstrengenden Ausflüge durch die englische Grammatik gründlich satt. Und doch war ich an die Ambersons und ihren schrecklichen Lebenswandel gefesselt wie ein Lohndiener, denn der nächste Schüler war schon im Anmarsch – also noch zwei Stunden in ihrer Gesellschaft.
Hugues zog seine Jacke über – sie war olivgrün und schwarz kariert und vermutlich aus Kaschmirwolle. Offenbar sollte es eine Jacke sein, wie sie von typischen Engländern getragen wurde, wenn sie nach ihren Hunden schauten, ihren Gutsinspektor aufsuchten, Tee mit ihrer alten Tante tranken, aber ich musste zugeben, dass mir ein Landsmann mit so edler und gut geschnittener Kleidung noch nicht über den Weg gelaufen war.
Hugues Corbillard stand in meinem kleinen, engen Arbeitszimmer, noch immer mit verstörtem Gesicht, und strich über seinen blonden Schnurrbart – sicher denkt er über das Gerundium und das Gerundiv nach, dachte ich. Er war eine junge, aufstrebende Führungskraft bei P’TITPRIX, einer französischen Discounterkette, und seine Chefs hatten ihn dazu verdonnert, sein Englisch aufzubessern, damit P’TITPRIX neue Märkte erschließen konnte. Ich mochte ihn – eigentlich mochte ich die meisten meiner Schüler –, aber Hugues war von einer seltenen Faulheit. Oft sprach er die ganze Stunde hindurch Französisch, während ich Englisch mit ihm redete, aber heute hatte ich ihn über die Eskaladierwand gejagt. Normalerweise redeten wir über alles, nur nicht über englische Grammatik, um uns die Ambersons und ihre Abenteuer zu ersparen – ihre Reisen, ihre kleinen Katastrophen (tropfende Wasserhähne, Windpocken, gebrochene Gliedmaßen), Verwandtenbesuche, Weihnachtsfeiertage, Schulprüfungen und so weiter –, und immer öfter landete unsere Unterhaltung bei der außergewöhnlichen Hitze dieses Sommers, bei den Qualen, die Hugues in seinem stickigen Bed & Breakfast auszuhalten hatte, bei seiner Empörung, dass ihm abends um sechs, während die Sonne auf den versengten und ausgedörrten Garten niederbrannte, eine reguläre Mahlzeit in drei Gängen zugemutet wurde. Wenn ich Gewissensbisse bekam und Hugues ermahnte, Englisch zu sprechen, erwiderte er mit schüchternem Lächeln und im Wissen, dass er gegen die strengen Vertragsbestimmungen verstieß, es sei schließlich alles Konversation, n’est-ce pas?, und diene daher der Verständigung, oder? Ich widersprach nicht, schließlich bekam ich sieben Pfund dafür, dass ich eine Stunde mit ihm plauderte – und wenn er zufrieden war, war ich’s auch.
Ich führte ihn durch die Wohnung zur hinteren Treppe. Wir befanden uns im ersten Stock, und im Garten sah ich Mr Scott, meinen Vermieter und Zahnarzt, bei seinen skurrilen Lockerungsübungen – er wedelte mit den Armen und stampfte mit seinen großen Füßen, bevor er sich in der Praxis unter mir einen neuen Patienten vorknöpfte.
Hugues verabschiedete sich, ich setzte mich in die Küche, bei offener Tür, und wartete auf die nächste Schülerin von Oxford English Plus. Das war ihre erste Stunde, und außer ihrem Namen – Bérangère Wu –, ihrem Status – Anfänger/Fortgeschritten – und ihrem Stundenplan – vier Wochen lang zwei Stunden täglich – wusste ich wenig über sie. Gut verdientes Geld. Dann hörte ich Stimmen im Garten und trat hinaus auf die schmiedeeiserne Treppe und sah, wie Mr Scott auf eine kleine Frau im Pelzmantel einredete, wobei er wiederholt auf den Ausgang zeigte.
»Mr Scott«, rief ich, »ich glaube, die Dame will zu mir.«
Die Frau – eine junge Frau, eine junge orientalische Frau – erklomm die Treppe zu meiner Küche. Sie trug trotz der Sommerhitze ihren langen, teuer aussehenden gelbbraunen Pelzmantel lose über der Schulter, und soweit ich es auf die Schnelle beurteilen konnte, sahen auch ihre anderen Sachen – die Satinbluse, die Camel-Hose, der schwere Schmuck – sehr teuer aus.
»Hallo, ich bin Ruth«, sagte ich. Wir gaben uns die Hand.
»Bérangère«, erwiderte sie und blickte sich in der Küche um wie eine Herzoginwitwe zu Besuch bei ihren armen Pächtern. Sie folgte mir ins Arbeitszimmer, wo ich ihr den Mantel abnahm und sie Platz nehmen ließ. Den Mantel hängte ich an den Türhaken, er war beinahe schwerelos.
»Ein wunderschöner Mantel«, sagte ich. »Und so leicht. Woraus ist er denn?«
»Das ist ein Fuchs aus Asien. Er wird rasiert.«
»Ein rasierter asiatischer Fuchs.«
»Ja … Ich spreche Englisch nicht so gut«, sagte sie.
Ich griff nach Living with the Ambersons, Vol. I. »Dann fangen wir doch einfach am Anfang an.«
Ich glaube, ich mag Bérangère, dachte ich, als ich die Straße hinablief, um Jochen von der Schule abzuholen. Während der zwei Stunden Unterricht (in denen wir die Familie Amberson kennenlernten – Keith und Brenda, ihre Kinder Dan und Sara sowie den Hund Rasputin) hatten wir beide vier Zigaretten geraucht (alles ihre) und zwei Tassen Tee getrunken. Ihr Vater sei Vietnamese, sagte sie, ihre Mutter Französin. Sie, Bérangère, arbeite in einem Pelzgeschäft in Monte Carlo – FOURRURES MONTE CARLO –, und wenn sie ihr Englisch verbessere, werde sie zur Geschäftsführerin befördert. Sie war unglaublich zierlich, von der Statur einer Neunjährigen, dachte ich, eine dieser Kindfrauen, in deren Gegenwart ich mir vorkam wie eine derbe Bauernmaid oder eine Ostblock-Athletin. Alles an ihr wirkte gehegt und gepflegt: ihr Haar, ihre Nägel, ihre Brauen, ihre Zähne – und ich war mir sicher, dass sie diese penible Sorgfalt auch den Regionen ihres Körpers zuteilwerden ließ, die für mich unsichtbar blieben: ihren Zehennägeln, ihrer Unterwäsche – ihrem Schamhaar, wie ich mir denken konnte. Neben ihr kam ich mir räudig und ausgesprochen schmuddelig vor, aber hinter dieser manikürten Perfektion verbarg sich, so viel spürte ich, eine andere Bérangère. Beim Abschied fragte sie mich, wo man in Oxford Männer treffen könne.
Ich war die erste Mutter vor dem Eingang zur Vorschule Grindle’s in der Rawlinson Road. Nach dem zweistündigen Nikotinexzess mit Bérangère gierte ich nach einer weiteren Zigarette, aber vor der Schule wollte ich es mir doch lieber verkneifen, und um mich abzulenken, dachte ich an meine Mutter.
Meine Mutter Sally Gilmartin, geborene Fairchild. Nein, meine Mutter Eva Delektorskaja, halb Russin, halb Engländerin, ein Flüchtling der Revolution von 1917