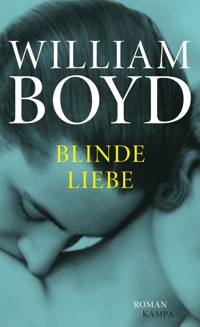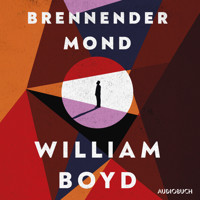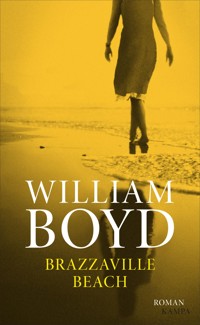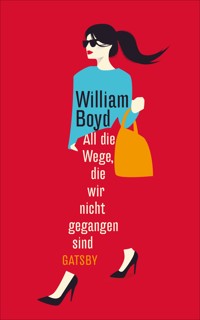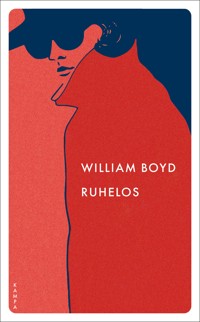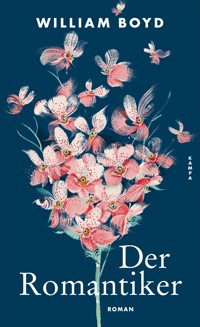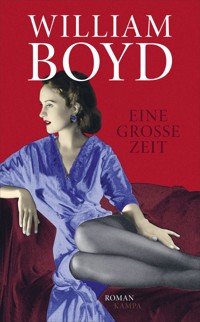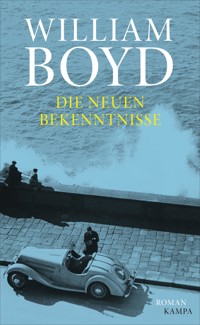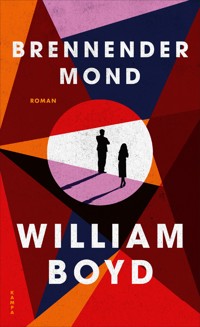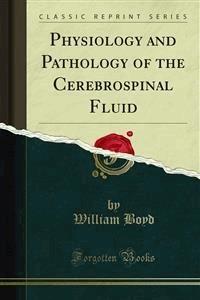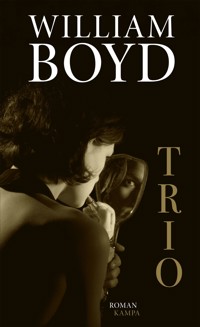
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist der Sommer 1968: In Paris gehen die Studenten auf die Straße, in Vietnam wütet der Krieg, Martin Luther King wird ermordet. Während die Welt in Aufruhr ist, wird im sonnigen Brighton ein aparter Kinofilm gedreht. Hier kreuzen sich die Wege eines Filmproduzenten, einer Schriftstellerin und einer Schauspielerin. Alle drei führen ein Doppelleben: Elfrida, der keine Zeile mehr einfällt und deren Ehe zerrüttet ist, ertränkt ihren Frust in Wodka. Talbot, der Filmproduzent, hat ein geheimes Hobby und macht gute Miene zum bösem Spiel, denn er weiß, dass sein Geschäftspartner versucht ihn auszubooten. In Anny, die umwerfende Hauptdarstellerin, ist die ganze Welt verliebt, aber ihre Liebschaften bereiten dem Filmstar nur Scherereien: Sie hat eine Affäre mit ihrem Filmpartner, und natürlich taucht ihr Liebhaber, ein Philosoph aus Paris, überraschend am Set auf. Außerdem sitzt Anny ihr Ex-Mann im Nacken - und das FBI. Während die Dreharbeiten bei scheinbar ausgelassener Stimmung voranschreiten, rumort es hinter den Kulissen gewaltig. Die Geheimnisse des Trios drohen aufzufliegen. Wie lange kann jeder seine Rolle spielen? Und wer inszeniert das größte Drama?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Trio
Roman
Aus dem Englischen von Patricia Klobusiczky und Ulrike Thiesmeyer
Kampa
Für Susan
Das wahre und interessante Leben eines menschlichen Wesens spielt sich im Verborgenen ab.
Anton Tschechow
Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten.
Albert Camus
Falsches Spiel
Brighton, England. 1968
1
Als die sommerlich strahlende Morgensonne ins Zimmer fiel und neben ihrem Kopfkissen eine Art Rechteck aus leuchtend zitronengelbem Licht auf die olivgrün gesprenkelte Tapete zeichnete, zuckte Elfrida Wing, ächzte und warf sich verschlafen in ihrem Bett herum. Aufgeweckt von dem Gleißen, das ihr immer näher rückte, öffnete sie die Augen und richtete ihren Blick auf die Tapete, die sie zunächst nur sehr verschwommen wahrnahm, während sie versuchte, ihr komatöses Gehirn in Betrieb zu nehmen. Es ging ihr furchtbar schlecht, wie immer beim Aufwachen. Offenbar hatte sie kleine, scharf umrissene Blätter vor Augen, wohl in stilisierter Form – oder waren es Vögel? Vogelsilhouetten? Vielleicht waren es auch nur olivgrüne Flecken und Spritzer, die an Blätter und Vögel erinnerten.
Egal. Ob Blätter, Vögel oder irgendwelche Kleckse – was spielte das schon für eine Rolle im großen Weltgefüge? Sie wälzte sich aus dem Bett und zog in Zeitlupe den Morgenmantel über ihren Pyjama. So leise wie möglich ging sie die Treppe hinunter, fuhr bei jedem Knarren zusammen, umklammerte fest das Geländer und versuchte, die schier schädelsprengenden Kopfschmerzen zu ignorieren, die nun, da sie sich in die Vertikale begeben hatte, hinter ihren Augen pochten und sie im Gleichtakt hervortreten ließen, jedenfalls kam es ihr so vor. Da fiel ihr ein, dass Reggie längst weg war, im Morgengrauen aufgestanden, um sich seinem Film zu widmen. Sie konnte die Zügel schleifen lassen.
Elfrida hielt inne, hustete, furzte ungeniert und ging die restlichen Stufen hinunter, ohne sich um das Knarren zu scheren, trat in die Küche und riss den Kühlschrank auf, um ihren Orangensaft herauszunehmen. Den oberen Teil des Kartons schnitt sie mit einer Schere ab und schenkte sich ein halbes Glas ein, bevor sie an den Gewürzschrank ging und die Flasche Sarson’s Weißweinessig hinter der Zuckerpackung hervorholte. Sie goss einen tüchtigen Schluck in ihren Orangensaft. Manchmal wünschte sie sich, dass Wodka aromatischer wäre, so wie Gin, aber gleichzeitig war ihr bewusst, dass er gerade wegen seiner Neutralität ihr mächtigster Verbündeter war. Wenn Reggie zugegen war, süffelte sie ihre tägliche Ration Wodka zusammen mit Leitungswasser aus einem schlichten Trinkglas. Über ihren praktisch unstillbaren Durst wunderte er sich zum Glück nie, und auch nicht über den beachtlichen Vorrat an Sarson’s Weißweinessig im Schrank. Elfrida setzte sich an den Küchentisch und genoss ihren Wodka Orange, trank ihn rasch aus und schenkte sich noch einen ein, spürte das Prickeln, den wohltuenden Kick. Schon ließen ihre Kopfschmerzen nach.
Merkwürdigerweise kam ihr spontan der Titel für einen Roman in den Sinn: Der Zickzack-Mann. Sogar den Umschlag hatte sie förmlich vor Augen. Die beiden »z« raffiniert eingesetzt, »Zick« und »zack« unter Umständen in verschiedenen Farben … Sie schenkte sich Orangensaft nach und ging wieder zum Schrank mit dem Sarson’s, kippte den letzten Schluck in ihr Glas. Am besten später noch ein Fläschchen Wodka besorgen. Oder zwei. Sie suchte nach ihrer Kladde und schrieb den Titel auf. Elfrida Wing, Der Zickzack-Mann. Beim Zurückblättern stellte sie fest, dass sie sich schon Dutzende Titel für mögliche Romane notiert hatte: Sommer der Wespen, Freezy, Der Akrobat, Umwerfend schön, Eine Woche in Madrid, Die goldene Regel, Dunkle Lobrede, Jazz, Tagundnachtgleiche des Frühlings, Blitzprozess, Kühle Sonne, Kleinstädtische Geheimnisse, Entfremdung, Künstlereingang, Berlin-Hamburg, Grasschwaden, Die Rivierakluft, Gute Weiterreise, Steil nach unten – ein Titel nach dem anderen für ungeschriebene Romane. Und jetzt kam noch Der Zickzack-Mann hinzu. Titel waren leicht – die unmögliche Herausforderung bestand im Schreiben des Romans. Sie trank ihren Saft in kleinen Schlucken, plötzlich von Traurigkeit ergriffen. Inzwischen war es mehr als zehn Jahre her, dass ihr letzter Roman erschienen war, wie sie sich reumütig in Erinnerung rief: Das große Spektakel, veröffentlicht im Frühjahr 1958. Zehn lange Jahre, ohne ein einziges Werk verfasst zu haben – nur unzählige Titellisten. Sie trank den Saft aus und wurde von einer gewissen Benommenheit überwältigt, während ihr die Augen tränten. Vergiss die blöden Romane, dachte sie verärgert. Gönn dir noch einen Drink.
2
Talbot Kydd erwachte jäh aus seinem Traum. Darin hatte er an einem weiten Strand gestanden, und ein junger Mann war nackt aus der sanften Brandung hervorgekommen und hatte ihm zugewinkt. Er setzte sich auf, noch halb schlafend, halb traumtrunken, und sah sich im Zimmer um. Na klar, er war in einem Hotel, natürlich, nicht zu Hause. Schon wieder ein Hotel – manchmal hatte er den Eindruck, sein halbes Leben in Hotels verbracht zu haben. Sei’s drum, es kümmerte ihn nicht wirklich. Das Zimmer war großzügig bemessen, und im Bad funktionierte alles. Das reichte für seinen Aufenthalt. Und das Wichtigste war ohnehin die Nähe zu London.
Er schwang die Beine aus dem Bett und stand dann gemächlich auf, blinzelte und rieb sich die Wange, während sein Wecker klingelte. Sechs Uhr. Was für eine absurde Zeit für einen Start in den Tag, dachte er wie immer, wenn sein unmöglicher Beruf ihm so etwas abverlangte. Er dehnte sich behutsam, reckte kurz die Arme über den Kopf, als wollte er die Decke berühren, lauschte dem befriedigenden Knacken seiner Gelenke und trottete ins Bad.
In der dampfenden Wanne dachte er an seinen Traum zurück. War es ein Traum oder eine Erinnerung? So oder so, schön erotisch jedenfalls, mit diesem jungen Mann, blass und anmutig … Oder war es Kit gewesen, sein Bruder? Oder jemand, den er mal fotografiert hatte, eins seiner Modelle? An den Körper konnte er sich erinnern, an das Gesicht jedoch nicht. Er versuchte, mehr Details heraufzubeschwören, aber die Traum-Erinnerungen wollten sich nicht fügen, und der junge Mann blieb nach wie vor austauschbar – attraktiv, rank und schlank, ohne eigene Identität.
Talbot rasierte sich, kleidete sich an – klassischer dunkelgrauer Anzug, weißes Hemd, seine Regimentskrawatte der East Sussex Light Infantry – und fuhr mit zwei Bürsten über den beinahe weißen Haarkranz oberhalb seiner Ohren. Die Deckenlampen im Bad strahlten auf seine sommersprossige Glatze herab. Fünfundzwanzig und schon kahl, hatte sein Vater einmal bemerkt: Ich hoffe, du bist wirklich mein Kind. Unfreundliche Worte für einen jungen Mann, dem sein früher Haarausfall ohnehin zu schaffen macht, dachte Talbot und rief sich seinen Vater in Erinnerung, mit dem vollen, strohblonden Haar, in dichten Wellen zurückgestrichen, als wehte ihm eine steife Brise ins Gesicht. Freundlichkeit war Peverell Kydd zwar stets fremd gewesen, doch vielleicht zeigte diese Gehässigkeit, dass er tatsächlich einen Verdacht hegte …
Er ging zum Frühstück in den Speisesaal hinunter und verscheuchte jeden Gedanken an den alten Mistkerl. Peverell Kydd war schon zwanzig Jahre tot. Gut so. Zum Teufel mit ihm und seinem Schatten.
Zu dieser frühen Stunde war er fast allein im Speisesaal des Grand. Ein in Tweed gekleidetes Paar mittleren Alters und ein rauchender, rundlicher Mann mit schulterlangem Haar waren seine einzigen Gefährten. Talbot bestellte und verzehrte wie üblich einen Kipper, trank vier Tassen Tee, aß zwei Scheiben weißen Toast mit Himbeermarmelade und betrachtete dabei in aller Ruhe, wie sich auf dem weinroten Teppich eine Raute aus Sonnenlicht ganz allmählich in ein gleichschenkliges Dreieck verwandelte. Ein strahlender Tag – perfekt für Beachy Head.
Er hatte die fünfte Tasse Tee fast ausgetrunken, als sein Aufnahmeleiter Joe Swire auftauchte und bei der hübschen Kellnerin mit dem Feuermal am Hals ein Kännchen Kaffee bestellte. Warum nehme ich solche Makel wahr, fragte Talbot sich, anstatt die unverdorbene Schönheit dieser jungen Frau zu würdigen? Und ihm gegenüber auch noch Joe, ein gut aussehender junger Mann, bis auf die schlechten Zähne, brüchig und unregelmäßig, die seine Attraktivität minderten.
»Bring es mir bitte schonend bei«, sagte Talbot, als Joe einen Blick auf sein Klemmbrett mit dem heutigen Drehplan und den anstehenden Aufgaben warf.
»Die Applebys haben den Termin verschoben«, hob Joe an.
»Wunderbar.«
»Aber sie wollen noch eine Ausfertigung von Troys Vertrag.«
»Wieso? Sie haben ihn doch vorliegen. Sie haben ihn gegengezeichnet.«
»Keine Ahnung, Boss. Außerdem hat Tony sich krankgemeldet.«
»Welcher Tony?«
»Der Kameramann.«
»Was fehlt ihm denn?«
»Er ist etwas erkältet.«
»Schon wieder? Und was machen wir jetzt?«
»Frank springt für ihn ein.«
»Frank?«
»Sein Assistent.«
»Ach, dieser Frank. Ist RT einverstanden?«
»Glaub schon.«
Und so redeten sie weiter, gingen den Plan durch und überlegten, wo sich eventuell Probleme ergeben könnten. Dabei fiel Talbot auf, dass er sich zu sehr auf Joes Kompetenz verließ, was den reibungslosen Ablauf des Drehs anging. Er hatte selbst keine Freude an diesen kleinen, aber entscheidenden Details des Filmhandwerks, das lag ihm nicht. Darum hatte er ja jemanden wie Joe eingestellt, damit er tapfer die Last auf sich nahm, die eigentlich Talbot hätte schultern sollen. Ihm war bewusst, dass er sich stärker bemühen und mehr Interesse zeigen müsste, zum Beispiel, indem er sich die Namen seiner Leute merkte. Das war einer von Peverell Kydds markigen Tipps gewesen: Wenn man sich ihre Namen merkt und das, was sie tun, werden sie dich für einen Gott halten – oder zumindest für einen Halbgott. Talbot sträubte sich dagegen, wie gegen fast alle weisen Ratschläge, die sein Vater ihm einst erteilte. Was immer du mit deinem Leben auch anstellen willst, mein Junge, lass die Finger vom Filmgeschäft, hörst du, dafür bist du einfach nicht der Typ, hatte ihm sein Vater beschieden. Und trotzdem war er nun hier – als Produzent, der für mehr als ein Dutzend Filme verantwortlich zeichnete. Genau wie sein Vater, wenn auch keine Legende, das ganz gewiss nicht, und bestimmt nicht so reich.
Talbot lehnte sich zurück und seufzte. Warum war er heute nur so griesgrämig? Die Sonne schien, sie hatten die fünfte Woche erreicht, fast die Hälfte des Drehs, natürlich nicht ohne Krisen, aber ohne Katastrophen. Er hatte genug Geld, führte eine gute Ehe, erfreute sich bester Gesundheit, seine Kinder waren erwachsen und auf ihre Weise erfolgreich … Was also nagte an ihm?
»Alles in Ordnung, Boss?«, fragte Joe, als spüre er, wie Talbots Stimmung immer düsterer wurde.
»Aber ja. Alles bestens. Machen wir uns an die Arbeit?«
3
Anny Viklund wachte auf und überlegte wie jeden Morgen, während sie langsam wieder zu Bewusstsein kam, ob der heutige Tag sich wohl als ihr Todestag entpuppen würde. Warum kam ihr ausgerechnet diese makabre Frage jeden Morgen aufs Neue in den Sinn, gleich nach dem Aufwachen? Warum war ihr erster Gedanke, dass dieser Tag, der gerade begonnen hatte, ihr letzter Tag auf Erden sein könnte? Blödsinn. Schluss damit. So lag sie eine Weile da und besann sich, bis sie schließlich den jungen Mann bemerkte, der tief und fest neben ihr schlief. Troy. Na klar, Troy hatte die ganze Nacht hier verbracht … Sie rieb sich die Augen. Er war so lieb zu ihr gewesen, und der Sex gut und belebend – genau was sie sich gewünscht, was sie gebraucht hatte.
Sie schlüpfte aus dem Bett und ging nackt ins Badezimmer. Beim Blick in den Spiegel verspürte sie wieder diesen leichten Schock über ihre neue Frisur, tiefschwarzes Stoppelhaar mit kurzem Pony. So radikal, dass es sie vollkommen verwandelte. Vielleicht würde sie dabei bleiben und nie wieder zur Blondine werden. Nach dem Toilettengang putzte sie sich die Zähne und kehrte ins Schlafzimmer zurück.
Troy saß auf ihrer Seite des Betts und fuhr sich zaghaft durchs volle braune Haar. Als er sie hereinkommen sah, lächelte er.
»Nicht übel, letzte Nacht, was?«, sagte er selbstzufrieden.
»Ach ja?« Sie ging wieder ins Bett und umfasste ihre Knie.
Troy deutete auf seinen morgenmunteren Penis.
»Wie’s aussieht, hat er noch nicht genug.« Er lehnte sich vor und küsste ihr linkes Knie.
»In einer Stunde müssen wir am Set sein. Und sie wissen ja nicht, wo du steckst.«
»Mist. Ja, da hast du recht.« Troy runzelte die Stirn. Dann sah er sie an und sagte: »Wie kommt’s, dass dein Schamhaar eine andere Farbe hat als das Haar auf deinem Kopf? Na?«
Anny lächelte. Inzwischen wusste sie, dass solche Fragen für Troy typisch waren.
»Es ist gefärbt. Das Haar auf meinem Kopf.«
»Also eine echte Blondine? Find ich gut.«
»Meine Familie stammt aus Schweden.«
»Sicher. Aber du bist Amerikanerin.«
»Das ändert nichts an meiner Abstammung.«
Troy stand auf und ging in der Suite herum, um seine Kleider einzusammeln.
»Sollte wohl besser in mein Zimmer zurück«, erklärte er vage.
Anny sah ihm beim Anziehen zu. Sie wusste, dass er vierundzwanzig war, fast vier Jahre jünger als sie. Vielleicht hatte sie deswegen mit ihm geschlafen. Ich habe mich zu oft mit alten Männern eingelassen, dachte sie – erst Mavrocordato, dann Cornell, dann Jacques –, darüber habe ich vergessen, wie es sich mit einem jungen anfühlt. Troy war süß, geradezu unschuldig, befand sie – ja, er glaubte immer noch, das Leben wäre ein einziger Spaß. Sie beugte den Kopf, legte die Stirn auf ihre Knie. Da musste sie gleich wieder an Jacques denken. Einer von seinen Sprüchen war: Die Welt besteht aus jenen, die das Haupt beugen, und denen, die es nicht tun … Wo steckte Jacques eigentlich? Paris? Nein, er wollte doch nach Afrika reisen, um einen abgesetzten Präsidenten im Exil zu treffen. Wie hieß der noch mal? Nkrumah. Ja. Das sah Jacques ähnlich. Mal eben nach Afrika jetten, um mit einem Präsidenten zu reden – sie musste sich immer wieder vor Augen führen, was für eine Berühmtheit Jacques in Frankreich war. Sie hob den Kopf. Und sah Troy vor sich stehen, in Jeans und mit seiner Wildlederjacke. Er musterte sie.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ja. Es war so schön. Ich bin wunschlos glücklich.«
Er setzte sich und gab ihr einen Kuss.
»Was jetzt?«
»Das muss unter uns bleiben«, sagte sie. »Keiner darf davon wissen.«
»Ich will dich aber wiedersehen. Ganz oft.« Er strich ihr sanft über die Wange. »Ich finde dich toll, Anny. Du gefällst mir wirklich. Einer Frau wie dir bin ich noch nie begegnet.«
»Dann müssen wir sehr aufpassen. Behalte es bitte für dich. Keiner darf davon wissen. Keiner soll etwas mitbekommen oder auch nur Verdacht schöpfen.« Sie dachte angestrengt nach. »Am Set müssen wir uns wie Profis verhalten – wie Freunde, mehr nicht.«
»Wird mir schwerfallen. Jetzt.«
»Keiner darf davon Wind bekommen, Troy. Mein Leben ist schon kompliziert genug.«
Er zuckte die Achseln. »Na gut. Dann werden wir eben aufpassen. Sind ja schließlich Schauspieler. Du jedenfalls.« Er warf ihr einen wissenden Blick zu. »Du bist doch nicht etwa verheiratet?«
»Ich bin geschieden. Aber ich habe … noch einen Freund.«
»In Amerika?«
»In Paris.«
»Prima.« Troy lächelte. »Aus den Augen, aus dem Sinn, wie es so schön heißt.«
»Aus den Augen ja, aber ganz und gar nicht aus dem Sinn.«
Unvermittelt packte sie ihn am Nacken und küsste ihn leidenschaftlich.
Als sie sich voneinander lösten, wirkte Troy etwas verdutzt.
»Geh jetzt«, sagte sie.
»Anny, ich könnte …«
»Geh schon.«
»Nein.«
4
Talbot richtete sich mit einem Lächeln an Reggie Tipton und versuchte, seine Übellaunigkeit zu verdrängen, sich freundlich zu geben, verständnisvoll und zugewandt, auch wenn er insgeheim dachte: Was für ein unerträglicher, verblendeter kleiner Wichtigtuer Reggie doch ist.
»Wenn ich mich nicht irre, sollten wir heute Morgen doch in Beachy Head sein?«, fragte er betont ruhig.
»Gleich. Ich brauche nur diese eine Pickup-Aufnahme.«
»Pickup? Laut Joe war das im Drehplan nicht vorgesehen.«
»Eine spontane Eingebung. Jetzt weiß Joe ja Bescheid. Anny allein. In Nahaufnahme. Nachdenklich, sie braucht keinen Text.« Reggie formte mit beiden Daumen und Zeigefingern ein Rechteck und hielt es sich vors Gesicht – als wäre »Nahaufnahme« für Talbot eine Art Fremdwort. Reggie konnte einem wirklich auf die Nerven gehen.
»Nur eine Aufnahme. Eine einzige Einstellung, höchstens zehn Minuten. Keine Sorge, Talbot. Wir schaffen alles, was wir uns für heute vorgenommen haben.«
»Schon gut, du bist der Regisseur. Aber wo ist Anny?«
»Noch in der Maske. Sie war spät dran. Leider.«
»Ist der Grund bekannt?« Talbot behielt den Anflug eines Lächelns bei.
»Nein. Mir jedenfalls nicht. Sie wusste, um welche Uhrzeit wir sie abholen würden, wir waren pünktlich. Aber sie ging nicht mal ans Telefon. Also haben wir gewartet. Nach einer Stunde kam sie runter.«
»Verstehe. Geht es ihr gut?«
Reggie lachte hämisch. »Wie soll es Anny Viklund ›gut‹ gehen, angesichts ihrer Geschichte? Sie hält sich einigermaßen – Glück gehabt. Mehr können wir nicht erwarten.«
»Du wolltest sie doch für diese Rolle.«
»Das ist jetzt nicht fair, Talbot. Du und Yorgos, ihr habt mächtig Druck gemacht, damit ich sie besetze.«
»Falsch. Yorgos wollte sie, warum auch immer. Ich wollte Suzy Kendall. Oder Judy Geeson.«
»Suzy Kendall wäre eine gute Wahl gewesen. Hätte sich großartig gemacht …« Nun schien Reggie sich seinen Film in einem Paralleluniversum auszumalen.
»Sonst wäre auch diese Sängerin infrage gekommen. Wie hieß sie noch?«
»Lulu?«
»Nein. Sandra Shaw.«
»Sandie Shaw … Kann sie denn spielen?«
»So schwer ist das nicht, Reggie. Zumindest nicht in diesem Film. Sandie Shaw wäre perfekt gewesen, als Gegenüber für Troy Blaze. Und deutlich preiswerter als Anny Viklund.«
»Diese Rolle zu spielen ist alles andere als leicht«, schnaubte Reggie. Dann zog er Talbot außer Hörweite der Kameracrew und fuhr leiser fort: »Könntest du mir einen Riesengefallen tun, Talbot? Nenn mich am Set bitte nicht ›Reggie‹, sondern Rodrigo, wenn du unbedingt einen Namen brauchst. Bitte. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe meinen Führerschein ändern lassen, meinen Pass, alles – so möchte ich der Öffentlichkeit bekannt sein, zumindest in der Branche. Es liegt mir sehr am Herzen.«
»Tut mir leid. Ich versuch’s mir zu merken. Seltsam ist das aber schon, nach all den Jahren, die ich dich als ›Reggie‹ kenne.«
»Diesen Film zeichne ich als Rodrigo Tipton. Es ist ein Neuanfang für mich – wer weiß, was sich daraus alles ergeben kann.«
»Na gut. Rodrigo.«
»Danke.« Reggie/Rodrigo seufzte. »Dass Anny Viklund in einer kleinen britischen Produktion mitspielt, ist an sich schon eine Sensation. Ist dir klar, wie viel Der gelbe Berg eingespielt hat? Unzählige Millionen. Außerdem sieht sie phantastisch aus. Und Troy kommt offenbar gut mit ihr zurecht. Das ist eine ganze Menge.« Er hob die rechte Hand und rieb die Fingerspitzen aneinander. »Das wird sich an den Kinokassen auszahlen.«
»Na hoffentlich.« Talbot lächelte nicht mehr.
»Hallo, Schatz. Was führt dich denn hierher?«, sagte Reggie und blickte über Talbots Schulter hinweg.
Als Talbot sich umdrehte, sah er Reggies Frau Elfrida auf sich zukommen. Eine höchst eigenartige Erscheinung, wie ihm wieder einmal auffiel. Groß, schlank und offenbar bestrebt, ihr Gesicht hinter dem kräftigen dunklen Haar zu verstecken. Ihr Pony reichte an die Wimpern heran, Ohren und Wangen wurden von zwei kinnlangen Vorhängen verdeckt, die eine Art Helm bildeten. Oft trug sie eine dicke Brille mit schwarzem Rand, die sie noch unzugänglicher wirken ließ, obwohl ihre Lippen ebenso eigenartigerweise stets knallrot geschminkt waren. Intelligent war diese Frau zweifellos, aber auch sehr merkwürdig. Talbot fragte sich, wie Reggie und sie überhaupt hatten heiraten können.
»Elfrida, wie schön, Sie zu sehen.« Talbot schüttelte ihr die Hand. Vor vielen Jahren hatte er mal einen ihrer Romane gelesen, durchaus mit Vergnügen – der Titel war ihm entfallen.
»Ach, Talbot, hallo«, erwiderte sie, und ein Lächeln huschte über ihre roten Lippen. Ihre Stimme war so heiser, dass man sie für eine Kettenraucherin hätte halten können, aber er hatte sie noch nie mit Zigarette gesehen.
»Mir ist das Geld ausgegangen«, sagte sie zu Reggie. »Und dem Scheckbuch sind die Schecks ausgegangen.«
»Einen Moment bitte, Talbot«, sagte Reggie.
Talbot blickte den beiden hinterher, die sich leise redend entfernten. Elfrida war so groß wie Reggie, wenn nicht sogar einen Tick größer. Wie seltsam Paare doch sind, dachte er und verscheuchte den Gedanken, als ihm plötzlich einfiel, was Naomi und er für ein Paar bildeten – sicher nicht weniger kurios als Reggie Tipton und Elfrida Wing.
Er machte sich auf die Suche nach Joe und einer Antwort auf die Frage, wann zum Teufel sie sich endlich nach Beachy Head aufmachen würden. Während er inmitten der Transporter, Wohnwagen und LKW am Set nach Joe Ausschau hielt, merkte er allmählich, dass fast alle Radios im Umkreis denselben Sender eingestellt hatten und denselben dämlichen Song spielten. Er hatte das Gefühl, von einer akustischen Zone in die andere zu geraten, der Song verhallte, und als Talbot an der nächsten Gruppe untätiger Männer vorbeiging, die sich die Wartezeit mit Rauchen und Kaffeetrinken vertrieben, erklang er aufs Neue. Er handelte von Torten, Parks und einer tropfenden grünen Glasur. O nein! Wie lange musste er sich das noch anhören? Er schnappte immer wieder den gleichen Refrain auf. Ein Park, der einem gewissen Mr MacArthur gehörte und wo eine Torte im Regen vergessen worden war, und irgendein unauffindbares Rezept. Hilfe! Mit moderner »Popmusik« konnte Talbot ohnehin nichts anfangen, aber dieser Song schien ganz besonders abwegig zu sein, den Textfetzen nach, die er aufgeschnappt hatte.
Dann wurde er endlich fündig.
»Joe! Hol mich aus diesem Irrenhaus raus. Bring mich nach Beachy Head.«
5
Elfrida stand am Tresen des Nebenzimmers im The Repulse und bestellte noch einen Gin Tonic. In Brighton war das ihr Lieblingspub, zwei Straßen entfernt von der Esplanade. Recht klein, mit Nebenzimmer und Salonbar, dazu eine wenig ansprechende Ausstattung in tristen Braun-, Grün- und Grautönen – nichts Lustiges, nichts Grelles. Keine plärrende Musik, keine Spielautomaten oder sonstige Zerstreuungen für die männliche Kundschaft. Den Namen verdankte er einer Fregatte aus dem frühen 19. Jahrhundert, die bei einer entlegenen Schlacht irgendwo in der Ost-Javasee mit Mann und Maus untergegangen war – fern von England, doch in diesem bescheidenen Pub in Brighton, den die Witwen der Seeleute mit Spendengeldern finanziert hatten, wurde ihrer auf ewig gedacht. Im kleinen Korridor zur Salonbar hing ein gerahmtes Pergament, das den historischen Hintergrund erläuterte. Schön, dass auf diese Weise an die ertrunkene Besatzung erinnert wurde, dachte Elfrida: So konnte man seinen Kummer hier getrost in Alkohol ertränken … Ein Pub als Gedenkort – damit könnte sie sich anfreunden. Besser als eine Reihe Bücher auf einem Regal. Ein kleiner Pub an irgendeiner Ecke, auf dessen Schild »The Elfrida Wing« stünde. Auf dem Weg zu ihrem Tisch in der Nische malte sie sich aus, wie der Pub aussehen würde – ihr stilisiertes Porträt auf dem Schild, Kästen mit bunten Blumen vor den Fenstern, ein paar Bänke draußen auf der Straße, hinten ein kleiner Biergarten …
Im Nebenzimmer war es ruhig, die nachmittägliche Schließzeit rückte näher, und es gab nur drei andere Gäste, alles Männer. Sie nahm einen Schluck Gin Tonic, bevor sie ihre Kladde aus der (nunmehr von einer neuen Flasche Wodka beschwerten) Handtasche holte und vor sich aufklappte. Dann wühlte sie nach ihrem Füllfederhalter. Sie hatte nicht die geringste Absicht, etwas zu schreiben, sie wollte nur beschäftigt wirken – als hätte sie noch etwas anderes im Sinn als das Trinken. Sie kritzelte ein bisschen auf einer neuen Seite herum, zeichnete ein paar Kästchen und schraffierte sie aus.
Aus dem Augenwinkel nahm sie einen Mann wahr, der sie zu beobachten schien. Ein Mann in ihrem Alter, Mitte vierzig, mit Anzug und Krawatte, der ein Buch las. Er blickte immer wieder zu ihr herüber. Sie zupfte an ihrem Haar, an ihrem Pony, und setzte schließlich die Brille auf. Vielleicht hatte er sie ja erkannt? Schreckliche Vorstellung. Vielleicht hatte er einen ihrer Romane gelesen und dachte gerade: Ist das nicht Elfrida Wing? Nun trank er den letzten kleinen Schluck seines Biers aus, stand auf und kam auf sie zu. Sie starrte auf ihre Kladde.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber Sie sind nicht zufällig Elfrida Wing?«
Sie hob den Kopf.
»Nein. Ich heiße Jennifer Tipton.«
»Verzeihung. Sie ähneln ihr wirklich sehr. Beziehungsweise ihrem Foto.«
»Wer ist diese Elsbeth Wing?«
»Elfrida. Eine großartige Schriftstellerin. Ich habe alle ihre Romane gelesen.«
»Ich bin Hebamme. Tut mir leid.« Sie deutete auf ihren Gin. »Heute habe ich frei.«
Er lächelte sie an, ohne wirklich überzeugt zu wirken.
»Ich wünschte, ich wäre in der Lage, einen Roman zu schreiben«, sagte Elfrida. Das immerhin war nicht gelogen.
»Tja, tut mir leid, dass ich Sie behelligt habe«, wiederholte der Mann. »Genießen Sie Ihren freien Tag.« Dann schlenderte er zur Tür und sah sich noch einmal flüchtig nach ihr um, bevor er hinausging.
Eine verstörende Begegnung. Dass es überhaupt noch solche anhänglichen Leser gab, die Elfrida nach zehn Jahren des eisernen Schweigens, zehn Jahren eherner Schreibblockade wiedererkannten. Da wurde einem angst und bange. Ja, man hatte sie oft und gern fotografiert und interviewt, vor allem nach dem Erfolg ihres letzten Romans, und dann, als der Film herauskam und auch danach, als sie und Reggie im Rathaus von Islington heirateten. Reggie hatte eine Menge Fotografen einbestellt. Er trug damals Weiß und sie Schwarz – das schien die Leute zu amüsieren. Elfridas Gesicht, ihr »öffentliches« Image – als junge Autorin, die ihre Anerkennung genießt –, hatte wohl etwas an sich, das ihnen in Erinnerung blieb. Von allen mehr oder weniger bedeutenden Berühmtheiten sollten Schriftsteller die obskursten sein, dachte sie, und meistens waren sie ja auch geradezu unsichtbar. Dirigenten, bildende Künstler, Tänzer, Athleten, Zauberer, Sportler, Meteorologen, Quizshow-Moderatoren standen viel stärker im Rampenlicht. Doch manche Autoren prägten sich offenbar im kollektiven Gedächtnis ein. Vielleicht lag es an ihrer Frisur – ihrem Pony. Ob sie die Frisur ändern sollte? Sie trank ihren Gin aus und ging zum Tresen, um den nächsten zu bestellen.
Sie verweilte im schummrigen Pub, wartete beim Trinken auf den Aufruf zur »letzten Runde« und dachte an den Mann und seine Worte zurück. »Eine großartige Schriftstellerin.« Bestimmt hatte er ihren ersten Roman gelesen, Ein Tag im Leben der Mrs Bristow. Wie sie diesen Roman inzwischen hasste. Er war kurz, umfasste rund hundertsechzig Seiten, und erzählte äußerst detailfreudig von jenem Tag im Leben einer gewöhnlichen Frau mittleren Alters, der titelgebenden Mrs Bristow, Ehefrau und Mutter von drei erwachsenen Söhnen, die einfach vor sich hin lebt, bis es mit dem Leben vorbei ist. Sie kauft ein, gerät mit einer Nachbarin in Streit, weil deren Hund unaufhörlich bellt, geht zum Zahnarzt. Im Wartezimmer liest sie Zeitschriften und denkt über ihre Söhne nach, darüber, wo die drei gerade sind und was sie so treiben. Sie lässt eine alte Backenzahnfüllung auffrischen und kehrt dann heim, unterwegs kauft sie eine Abendzeitung. Zu Hause bereitet sie den Tee für ihren Mann zu, der bald von der Arbeit kommen wird, und wirft einen Blick auf die Schlagzeilen, grübelt über die Nachrichten aus der Heimat und aus aller Welt. Sie hört ein Geräusch, und als sie dem nachgeht, entdeckt sie einen jungen Mann, der durch das Fenster der Spülküche eingebrochen ist. Er gerät in Panik und bringt Mrs Bristow um.
Das Problem, das sich danach ergeben hatte, hatte nichts mit dem Überraschungserfolg dieses Romans zu tun, wie Elfrida jetzt klar wurde. Für ein Debüt war die Resonanz außergewöhnlich gewesen, und sie war damals erst fünfundzwanzig und hatte gerade ihr Studium in Cambridge (Girton College) absolviert. Nein, das Problem war, dass ein berühmter Literaturkritiker sie in seiner hymnischen Besprechung als »die neue Virginia Woolf« bezeichnet hatte, als wäre Ein Tag im Leben der Mrs Bristow eine raffinierte, zeitgemäße Neuinterpretation von Mrs Dalloway. Zunächst hatte Elfrida sich nichts dabei gedacht, sie hatte Mrs Dalloway ja nicht einmal gelesen, doch als ihr bei Erscheinen ihres zweiten Romans Ausschweifungen wieder dieses Etikett angehängt wurde (»Elfrida Wing, die gemeinhin als die neue Virginia Woolf gilt, legt mit Ausschweifungen ein weiteres Meisterwerk vor«), reagierte sie allmählich etwas gereizt. Andere Kritiker nahmen den Vergleich auf, gedankenlos – verantwortungslos, wie ihr schien. Es war, als würde auf einmal Virginia Woolfs Geist in ihrem Leben umherspuken. Erwähnte man Elfrida Wing, sagte unweigerlich jemand: »Ah, die neue Virginia Woolf.« Als sie ihren dritten Roman veröffentlichte, Das große Spektakel, musste sie einsehen, dass ihr Name bis zum Ende ihrer schriftstellerischen Laufbahn untrennbar mit dem ihrer Vorgängerin verknüpft bleiben würde: »Elfrida Wing, als würdige Nachfolgerin Virginia Woolfs gerühmt und gepriesen, sorgt mit Das große Spektakel für Furore.«
Das Ganze war umso schlimmer, als ihr die Romane von Virginia Woolf eher nicht gefielen. Inzwischen hatte sie Mrs Dalloway gelesen und war alles andere als angetan. Sie fand ihre Werke schrullig und überspannt. Sie sah keinerlei Übereinstimmung zwischen ihrem Denken, ihrem Temperament oder Schreibstil und dem von Virginia Woolf. Im Gegensatz zu sämtlichen Kritikern, die Elfridas Bücher besprachen. Und zur wachsenden Schar ihrer treuen Leser, denn die Verleger wiederholten diese Behauptung – fett gedruckt – auf den Taschenbuchausgaben. Irgendwann konnte sie den Anblick ihrer eigenen Romane nicht mehr ertragen. Wahrscheinlich hatte sie deswegen mit dem Schreiben aufgehört. Schuld war einzig und allein Virginia Woolf.
Sie nahm einen großen Schluck Gin Tonic und schloss die Augen, um die wohltuende, himmlische Wirkung auszukosten. Wer hätte denn gedacht, dass ausgerechnet die Beeren des bescheidenen Wacholders einen solchen Zaubertrank hervorbringen konnten? Ihr wurde auf angenehme Weise schwindelig, sie malte wieder ein Kästchen in ihre Kladde und schraffierte es.
Möglicherweise diente ihr das nur als Ausrede für einen eklatanten Mangel an Inspiration, dachte sie und zeichnete eine Reihe von großen und kleinen Pfeilen. Ob ihr nach drei erfolgreichen Romanen die Schaffenskraft einfach ausgegangen war? Vielleicht – vielleicht – lag es doch nicht daran, dass man sie zur neuen Virginia Woolf gekürt hatte …
Nach Erscheinen von Das große Spektakel (in sechzehn Sprachen übersetzt, der Verkauf der Taschenbuchlizenz erzielte einen hohen fünfstelligen Betrag) hatte sie Reggie Tipton kennengelernt. Reggie, ein äußerst angesagter junger Regisseur, wollte Das große Spektakel verfilmen. Die Filmrechte wurden für einen noch höheren fünfstelligen Betrag vergeben, und eine Zeit lang war Elfrida bewusst, dass sie ziemlich wohlhabend war. Sie kaufte sich ein Häuschen im Vale of Health in Hampstead, und natürlich hatte sie mit Reggie eine Affäre. Am Ende spielten Melanie Todd und Sebastian Brandt die Hauptrollen in Reggies Film, dessen Titel schlicht Spektakel! lautete, aber selbst die Strahlkraft dieser beiden Stars konnte ihn nicht retten. Dennoch führte der Film zu vielen weiteren Buchverkäufen, und Elfrida wurde noch wohlhabender. Dann verließ Reggie seine Frau (und seine Kinder), und sie und Reggie heirateten. Und dann erlitt sie die Fehlgeburt. Danach ging alles schief, ja, das hatte wohl die Krise ausgelöst.
Es widerstrebte ihr, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, an alten Erinnerungen zu rühren. Als sie Reggie kennengelernt hatte, war er mit einer humorlosen, überheblichen Frau namens Marion verheiratet (»Der denkbar größte, schlimmste, absurdeste Fehler meines Lebens«, wie er Elfrida zu Beginn ihrer Affäre gestanden hatte). Die beiden hatten zwei Töchter, Butterfly und Evergreen, die damals acht und sechs waren. Nachdem Reggie sich offiziell von Marion getrennt hatte, bei Elfrida eingezogen und die Scheidung über die Bühne gegangen war, fiel ihr auf, dass sein Besuchsrecht kontinuierlich eingeschränkt wurde. Mit sechzehn schrieb Butterfly ihrem Vater, sie wolle ihn nie mehr wiedersehen. Reggie hatte Elfrida den Brief gezeigt, er schien ihn nicht weiter zu beunruhigen. Der kalte, unversöhnliche Ton, in dem dieser Brief verfasst war, hatte sie mehr schockiert als ihn. Mit Evergreen traf er sich noch gelegentlich, bis Marions nicht nachlassende Verbitterung auch sie dazu brachte, sämtliche Verbindungen zu ihrem Vater zu kappen. Reggie nahm das erstaunlich gelassen hin – vom Panzer seines Egos gewappnet.
Elfrida hingegen hatte stets leise Schuldgefühle verspürt. Die Vorstellung, sie hätte zu diesem schwärenden Unglück im Hause Tipton maßgeblich beigetragen, war ihr verhasst, aber die berauschende Dynamik ihrer Affäre hatte sämtliche anderen Gefühle überlagert. Und als sie kurz nach ihrer Hochzeit selbst schwanger wurde, hoffte sie, dass dieses neue Kind Reggie über den Verlust der beiden anderen hinwegtrösten würde. Doch dann erlitt sie im dritten Monat eine Fehlgeburt. Ihr anschließender Aufenthalt im Krankenhaus und der unmerkliche, aber lang anhaltende Nervenzusammenbruch sorgten dafür, dass ihre Ehe kippte. Nach und nach wurde ihr bewusst, dass Reggie in Wahrheit eher erleichtert war, nicht wieder Vater zu werden. Die Fehlgeburt hatte passenderweise zu einer Fehlehe geführt, wie Elfrida es für sich ausdrückte. Sie versuchten zwar, erneut ein Kind zu zeugen, aber vergebens, und Reggie schien sein ohnehin nur schwaches Interesse daran bald komplett zu verlieren. Damit war ihr Traum, Mutter zu werden, gestorben. Danach wurde es nie wieder wie früher. Reggie fing an fremdzugehen, und sie hörte auf zu schreiben.
»Letzte Runde!«, rief die Barfrau.
Elfrida trank ihren Gin aus und ging zum Tresen, um einen letzten Drink sowie ein Päckchen Erdnüsse zu ordern. Das musste als Mittagessen reichen.
6
Anny und Troy saßen im bananengelben Mini am Felsen von Beachy Head, vom warmen Sonnenlicht eingelullt, und blickten auf den silbern funkelnden Ärmelkanal. Am hohen Himmel über ihren Köpfen zerschnitt ein schnurgerader Kondensstreifen das Blau.
»Es hat keiner was gemerkt«, sagte Troy. »Du bist phantastisch. So gelassen. Ich meine: so abgeklärt.«
»Abgeklärt oder abgebrüht?«
»Beides. Ja wirklich. Du siehst so cool aus mit dieser Sonnenbrille. Man merkt dir kein bisschen an, wie rasend verliebt du in mich bist.«
»Sehr witzig.«
Troys Hand lag auf ihrem Oberschenkel, seine Finger tasteten sich unter den kurzen Rock vor, und sie spürte, wie Hitze durch die Maschen ihrer elfenbeinfarbenen Seidenstrumpfhose drang.
In unmittelbarer Nähe drängte sich ein komplettes Filmteam um eine riesige Kamera, die auf einen Kran montiert war. Ungeachtet des strahlend hellen Tags brannten starke Bogenlampen. Der Regieassistent richtete sein Megaphon auf die Schauspieler.
»Kamera läuft! Und Action!«
Anny und Troy stiegen aus dem Auto, reichten sich die Hände und rannten auf die Kamera zu. Dann trennten sie sich und blieben zu beiden Seiten der Kamera stehen. Die nächste Szene sollte von hinten aufgenommen werden, unter Einsatz von Annys Stuntfrau und Troys Stuntmann – sie würden Hand in Hand über die Klippe springen und ins Netz fallen, das ein paar Meter unterhalb der Felskante aufgespannt war. Die vorletzte Szene des Films.
Den Dreh der letzten Szene konnte Anny sich noch gar nicht vorstellen. Laut Skript würden die Figuren, die sie und Troy spielten, beim Sturz nicht sterben, sondern wundersamerweise emporfliegen und im Himmel verschwinden – wie die Raketen, die von Cape Kennedy aus gestartet und nie wieder gesichtet worden waren.
Rodrigo Tipton trat hinter der Kamera hervor und kam auf sie zu.
»Klasse«, sagte er. »Und jetzt bitte noch einmal ohne Sonnenbrille, Anny.«
»Ohne Brille mache ich das nicht«, sagte sie unwillkürlich.
»Am Ende werden wir die Aufnahme wohl nicht verwenden, es wäre aber eine interessante Alternative. Nur so, für alle Fälle.« Rodrigo lächelte.
Anny wollte schon abwinken – was sie normalerweise getan hätte –, doch die Nähe zu Troy brachte sie dazu, einzulenken. Warum auch immer.
»Okay.«
Nachdem sie noch zweimal ohne Sonnenbrille zur Felskante gerannt war, zeigte Reggie sich hochzufrieden und setzte die Szene mit den Stuntleuten an. Für Anny und Troy war der Drehtag zu Ende. Sie flüsterte ihm zu, er solle schon losfahren, während sie noch eine Weile blieb. Das würde einen besseren Eindruck machen, als wenn sie zusammen wegfuhren. Troy war einverstanden.
»Ja, aber heute Nacht komme ich zu dir«, sagte er. »Schlag Mitternacht.«
»Nein.«
»Doch. Sieht ja keiner.«
»Wer weiß, ob ich um Mitternacht in meinem Zimmer bin.«
»Bist du, Baby.«
Troy begab sich zu seinem Wagen und Chauffeur. Anny bat ihre Assistentin Shirley um eine Tasse Tee, während sie mit Rodrigo hinter der Kamera stand und die Szene begutachtete, in der die Doppelgänger von Anny Viklund und Troy Blaze sich am Beachy Head in die Tiefe stürzten. Was für ein Abgang, dachte sie, und ihr fiel die makabre Frage wieder ein, die sie sich im Morgengrauen gestellt hatte. So war es in gewisser Hinsicht vielleicht doch wahr geworden. Sie war an diesem Tag tatsächlich »gestorben«. Diese Vorstellung hatte etwas seltsam Befreiendes, und dann dachte sie an Troy und seine nächtlichen Besuchsabsichten. Wie selbstsicher er war, aber auf eine nette Art, eine …
»Wie läuft es denn so, Anny?«
Sie drehte sich nach der Stimme um und sah einen großen kahlköpfigen Mann, der ihr lässig entgegenkam. Der Produzent. Tony? Terence? Anny war ihm erst ein- oder zweimal begegnet und wollte lieber auf Nummer sicher gehen, also antwortete sie, es laufe bestens, ja, wunderbar, danke der Nachfrage, alle seien so reizend.
»Gut, fein, freut mich«, sagte Tony oder Terence. Er hatte diese typisch englische Redeweise, schnell und schroff. Wie machten sie das nur, dieses Sprechen, ohne merklich die Lippen zu bewegen? Unmöglich zu erraten, was sie wirklich dachten oder fühlten, alles hatte den gleichen Klang. Genauso gut hätte er sagen können: »Schlimm, schlecht, bin entsetzt.«
Er trat noch einen Schritt auf sie zu und senkte die Stimme.
»Heute Morgen haben wir im Büro einen merkwürdigen Anruf erhalten. Von der Polizei. Sie wollten wissen, ob ein gewisser Cornell Weekes versucht hat, Sie zu kontaktieren.«
Umgehend bildete sich Schweiß unter Annys Achseln und an ihren Handflächen. Allein seinen Namen zu hören hatte diese Wirkung auf sie. Cornell: ihr dämonischer Geliebter, ihr einstiger Guru, ihr Erzfeind.
»Nein.«
»Cornell Weekes ist doch Ihr Ehemann?«
»Exmann.«
»Ach so.«
»Er sitzt im Gefängnis«, sagte Anny.
»Jetzt offenbar nicht mehr.«
»Was soll das heißen?«
»Die Umstände sind mir nicht bekannt …« Er vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war, und fuhr fort: »Aber er ist wohl bei einer Bewährungsanhörung entkommen. Sie gehen davon aus, dass er sich nach Kanada abgesetzt hat. Nach Montreal.«
Anny beruhigte sich allmählich wieder.
»Wieso glauben sie dann, er sei in England? Er saß doch in Kalifornien ein«, sagte sie.
Der große, kahlköpfige Mann lächelte milde.
»Offenbar haben sie in seinem Hotelzimmer einen Stadtplan von London gefunden. In Montreal.« Er zuckte die Achseln. »Eine logische Schlussfolgerung. Warum war Ihr Exmann überhaupt im Gefängnis, wenn ich fragen darf?«
»Er hat versucht, eine Bundesbehörde in die Luft zu jagen.«
»Verstehe.« Er rieb sich die Nase. »Das war bestimmt nur eine Routineanfrage.«
»Cornell mag völlig durchgeknallt sein, aber er würde sicher nicht nach England kommen. Er war noch nie in England.«
»Wie beruhigend.« Er deutete auf das Filmteam im Hintergrund. »Schließlich läuft alles so gut.« Dann wandte er sich um und musterte sie eindringlich. Anny schätzte ihn auf sechzig oder siebzig, wie ihren Großvater. Auf einmal fiel ihr auf, dass er seinem Alter und seiner Glatze zum Trotz noch immer ein schöner Mann war, von schlanker und aufrechter Statur.
»Mein Name ist übrigens Talbot. Talbot Kydd.«
7
Gegen Abend setzte Talbot sich im Büro mit Joe zusammen.
»Was steht morgen auf dem Plan?«
»Kostümanprobe für Sylvia Slaye und Ferdie Meares.«
»Um Himmels willen. Beide am selben Tag? Ist das wirklich ratsam?«
»Aber ja, Boss. Kurz und schmerzlos. Zwei Fliegen mit einer Klappe – darum geht’s. Beide haben schon eine Liste mit ihren ›Ersuchen‹ eingereicht.«
Talbot straffte unwillkürlich die Schultern, als wollte er einen Hieb parieren. Diese alten Hasen. Einst große Stars. Inzwischen verblasst. Schwierige Persönlichkeiten. Die schlimmsten. Er zündete sich eine Zigarette an.
»Sag mal, Joe: Wissen wir eigentlich schon, wie die letzte Szene gedreht werden soll?«
»Tja. Also: Es war die Rede von … Trickfilm. Im weitesten Sinne. In irgendeiner Form.« Joe wand sich geradezu auf seinem Stuhl.
Ein anständiger junger Mann, dachte Talbot. Ich sollte ihn unbedingt halten.
»Das können wir uns nicht leisten«, stellte er gleichmütig fest. »Es würde ohnehin nicht zu diesem Film passen. Erst recht nicht zum Ende dieses Films.«
»Das müssen Sie mit Reggie – Pardon, Rodrigo – ausklamüsern, Boss. Offenbar schwebt ihm bereits eine Trickfilmsequenz vor.«
»Das ist im Drehbuch aber nicht vorgesehen. Und auch nicht im Budget.«
»Das Drehbuch wird gerade umgeschrieben.«
»Was? Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall!«
»Tut mir leid. Die Sache ist die: Als ich hörte, dass Rodrigo Janet Headstone beauftragt hat, dachte ich natürlich …«
»Das ist mir ja ganz neu.«
»Yorgos hat ihm wohl grünes Licht gegeben.«
Talbot spürte Wut in sich aufsteigen. Yorgos war doch sein Koproduzent. Was sollten diese Spielchen? Er seufzte. Eines nach dem anderen. Immer mit der Ruhe, sicher gab es dafür eine ganz einfache Erklärung.
Er holte seine Flasche Whisky aus dem Schrank und schenkte sich großzügig ein – nur um diesen neuen Geisteszustand zu wahren, diese kühle Gelassenheit, diese zen-artige innere Erhabenheit über die nervtötenden, aufreibenden Einzelheiten aus dem Alltag eines Filmproduzenten.
Wie weise die Japaner waren, dachte Talbot, als ihm einfiel, dass es im Japanischen mehrere Bezeichnungen für das Ich gab. Wer hatte ihm eigentlich davon erzählt? Offenbar gab es ein Wort für das Ich in der Privatsphäre und ein anderes für das Ich in der Öffentlichkeit. Warum verfügte die englische Sprache nicht auch über diese kluge Differenzierung? Er hängte sein öffentliches Ich an den Nagel, genoss den Whisky und kehrte zu seinem privaten Ich zurück, froh, sich in die Pläne zu vertiefen, die er für das Wochenende geschmiedet hatte. Die Leiter zum Mond und der damit verbundene Ärger wären bald wie ausgelöscht – sein privates Ich würde für einen Tag oder zwei die Oberhand gewinnen.
8
Anny lag reglos in Troys Armen. Er atmete flach und regelmäßig, ein warmer Hauch an ihrer rechten Schulter, und sie fragte sich, ob er wohl schlief. Sie hatte leichte Kopfschmerzen und war hellwach, obwohl es mittlerweile gegen zwei Uhr früh sein musste. Sie hätte nicht von dem Rotwein trinken dürfen, den er mitgebracht hatte. Wenn sie ihre Tabletten mit Alkohol mischte, konnte sie danach nie einschlafen – dabei sollten die Tabletten ihr doch beim Einschlafen helfen.
Die Neuigkeiten über Cornell und seine Flucht hatten sie zutiefst aufgewühlt – auf einmal war sie nervös und verunsichert. Und besorgt. Wie hatte er entkommen können? Und warum hatte die britische Polizei beim Produktionsbüro angerufen? Soweit sie wusste, war er noch nie in England gewesen, warum sollte er ausgerechnet jetzt hierherreisen? Wahrscheinlich wusste er, dass sie sich in England aufhielt. Über den Film war bereits berichtet worden, man hatte sie bei ihrer Landung in Heathrow fotografiert. Das war Cornell sicher nicht entgangen: Auch wenn er sich angeblich nicht fürs »Kintopp« interessierte, verfolgte er ihre Karriere aufmerksam. Es fiel ihr nicht schwer, sein Gesicht heraufzubeschwören – hager und schön, die Denkerfalten tief in die Stirn gemeißelt. Wie er dieses Wort herauszuspucken pflegte: »Kintopp!« Sie hatte seine Züge lebhaft vor Augen, obwohl sie sich seit ihrer Scheidung – an die sie sich kaum erinnern konnte – nicht mehr gesehen hatten. Sie waren beide irgendwie in diese Scheidung hineingestolpert. Warum hatten sie sich überhaupt scheiden lassen? Ihr fiel ein Streit ein, bei dem sie Cornell als »anarchistisches Schaf« beschimpft hatte. Das erzürnte ihn so sehr, dass er ein paar Tage lang nicht nach Hause kam. Als er schließlich heimkehrte, bat er um Verzeihung, drängte sie aber, aus dem Film auszusteigen, den sie damals drehte, Nächte im Hotel. Sie weigerte sich und fragte ihn, wovon sie denn beide leben sollten, wenn ihre Gage ausfiel. Er nannte sie eine Verräterin und suchte wieder das Weite. Dann reichte er unvermittelt die Scheidung ein, und sie fügte sich, erschöpft von dem ganzen Hin und Her. Ihr war bewusst, dass sie Cornell keineswegs hasste, sie hatte nur nicht die Kraft, mit ihm und seinen verrückten Idealen zurechtzukommen. Für ein Eheleben mit Cornell fehlte ihr die Energie.
Das Problem war nur, dass seit der Scheidung, seit dem Bombenanschlag, ihr Name ständig mit seinem in Verbindung gebracht wurde. In jedem Interview oder Artikel, der Anny betraf, wurde ihre Ehe mit dem »Stadtguerillero« Cornell Weekes erwähnt. Da konnte sie den Journalisten noch so oft erklären, dass diese Ehe nur ein paar Monate gedauert hatte, deutlich kürzer als ein Jahr – Cornell Weekes war inzwischen aus ihrer Biographie nicht mehr wegzudenken. Sie atmete tief durch und biss sich auf die Unterlippe, weil ihr urplötzlich die Tränen kamen. Warum hatte sie ihn überhaupt geheiratet? Was hatte sie sich bloß dabei gedacht? Ja, er sah gut aus und besaß dieses Charisma, das offenbar allen Visionären eigen ist, während er sich endlos über das »American Reich« ausließ, was immer das auch sein sollte. Sie war so jung gewesen, als sie ihn kennenlernte, erst dreiundzwanzig, aber da war Mavrocordatos Tage des Wassermanns bereits in die Kinos gekommen und Anny plötzlich ein großer Star. Auf einmal hatte sie einen Namen. Die kleine Unbekannte aus Minnesota. Sie erhielt ein Filmangebot nach dem anderen, verdiente eine Menge Geld. Und da trat Cornell Weekes in ihr Leben.
Er hatte nichts mit der Filmbranche zu tun – darum. Er hasste Filme, hasste Hollywood – die Unterhaltungsabteilung des »American Reich«, wie er sagte. Er war älter als sie, grauhaarig – weise, so kam es Anny zumindest vor, bevor sie selbst weiser wurde. Außerdem erinnerte er sie an ihren Vater. Sie hätte es also wissen müssen, hätte …
»Anny?«, flüsterte Troy. »Kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Wie heißt du wirklich?«
Wieder eine dieser typischen Troy-Fragen. Diesmal freute sie sich darüber, nahm die alberne Ablenkung dankbar an. Sie drehte sich zu ihm, froh, dass er wach war.
»Anny Viklund. So heiße ich tatsächlich. Anny Makjen Viklund. Warum?«
»Die meisten Leute, die ich im Showbiz kenne, verwenden nicht ihren richtigen Namen. Ich ja auch nicht.« Er zählte die Namen auf: Billy Fury, Cliff Richard, Adam Faith, Danny Storm, Tommy Steele, Bobby Hero, Georgie Fame, Mickie Most.
Sie küsste ihn zärtlich. »Nicht, dass du denkst, ich hätte auch nur eine Sekunde geglaubt, dass Troy Blaze dein richtiger Name ist«, sagte sie. »Aber er gefällt mir.«
»Klingt jedenfalls besser als mein richtiger Name. Kannst du dir ja denken.«
»Wie heißt du wirklich?«
»Das sage ich dir besser nicht. Für dich will ich immer Troy sein.«
»Das wirst du auch immer sein. Wie heißt du nun wirklich?«
»Nigel Farthingly.«
»Gefällt mir gut. Vielleicht nenne ich dich ab jetzt Nigel.«
»Ich hätte ihn dir nie verraten sollen.«
»Ich mach doch nur Spaß, Nigel.« Wieder küsste sie ihn. »Verzeihung, Troy. Mir ist schon klar, warum Nigel Farthingly für einen Popstar nicht der passendste Name ist.«
»Eben. Darum haben die Applebys darauf bestanden, dass ich mich anders nenne.«
»Wer sind die Applebys?«
»Meine Manager. Jimmy und Bob Appleby.«
»Heißen die wirklich so?«
»O ja.«
Er strich ihr sanft über die Brust. Sie berührte sein Glied. Prall und hart. Ein junger Mann – im Gegensatz zu Cornell, der stets vorgab, »Probleme mit der Libido« zu haben, weil seine Jugend so unglücklich gewesen sei. Mehr hatte er nie preisgegeben.
»Ich kann nicht schlafen«, sagte Anny mit Kleinmädchenstimme. »Was sollen wir nur machen?«
9
Nach ihrer Einkehr im Repulse hatte Elfrida in einem Spirituosenladen eine Flasche Amontillado-Sherry der Marke Tio Pepe gekauft, eine Requisite ihrer – wie sie meinte – so trickreichen Inszenierung für Reggie. Sie fuhr mit dem Taxi zum Haus in Rottingdean, das die Filmgesellschaft für Reggie gemietet hatte. Es war ungünstig, in einem Dorf am Rande von Brighton zu wohnen: Ständig mussten Taxis bestellt werden, weil sie keinen Führerschein besaß, und sie fragte sich, warum Reggie gerade dieser Unterbringung zugestimmt hatte. Als sie sich bei ihm über die Unannehmlichkeiten beschwerte, riet er ihr, sie solle einfach beim Produktionsbüro anrufen und jemanden aus der Fahrbereitschaft anfordern – das sei im Budget enthalten. Diesen Dienst hatte sie aber noch nie gern in Anspruch genommen – die Fahrer belauschten jedes Gespräch und tratschten alles weiter. Sie wusste, dass sie den ganzen Tag herumsaßen und sich gegenseitig die pikantesten Neuigkeiten erzählten. Wie konnte sie da einen Wagen anfordern, der sie vor dem Repulse abholte?
Das Haus an sich war schön – sehr schön sogar. Eine große, zweistöckige viktorianische Villa aus grauem Backstein mit roten Ornamenten, die den bizarren Namen »Peelings« trug – vielleicht zu Ehren der Familie, die das Haus einst erbaut und bewohnt hatte. Es stand inmitten eines großzügigen Gartens, mit zwei hohen Affenschwanzbäumen auf der vorderen Seite, und verfügte über fünf Schlafzimmer, drei Bäder, ein geräumiges Wohn- und Speisezimmer, eine »moderne« Küche und sogar über einen Billardraum, alles viel zu groß für zwei Personen, und da Reggie fast immer beim Dreh war, kam es Elfrida meist so vor, als lebte sie allein in dieser weitläufigen Villa, wie eine Herzoginwitwe, die man auf ihrem Witwensitz vom Rest der Familie fernhielt.
Genau das dürfte Reggies Absicht gewesen sein, als er sich für Peelings entschied – so konnte er sie auf Abstand halten. Normalerweise wohnten sie im Hotel, wenn er einen Film oder eine Fernsehserie drehte, doch bei diesem Film mit dem dämlichen Titel Emily Bracegirdles außerordentlich hilfreiche Leiter zum Mond hatte Reggie erklärt, es gehe ums Prestige. Eine derartige Unterkunft würde die Produktionsfirma eine Menge Geld kosten, weshalb man ihm mehr Respekt zollte, behauptete er. »Man muss eben aus allem das Beste rausholen, Liebling« – was immer das heißen mochte.
Elfrida saß eine Weile im Garten, auf einer Bank im Schatten der großen Kastanie, trank von dem neu erworbenen Wodka, den sie bereits in ihre Essigflasche umgefüllt hatte, und las einen Brief ihres Bruders Anselm, den man ihr aus London weitergeleitet hatte. Es war sein üblicher Jahresrundbrief an Freunde und Familie (den er stets an seinem Geburtstag verschickte), und nach der ersten Seite brachte sie es kaum über sich weiterzulesen, da Anselms Leben als herausragender orthopädischer Chirurg in Vancouver sich durch gnadenlose Langeweile auszeichnete. Die sportlichen Höchstleistungen seiner beiden Söhne Jerold und Roldan nahmen einen besonders breiten Raum ein – Elfridas kraftstrotzende Neffen waren offenbar ständig auf Baseballfeldern, Tennisplätzen, Skipisten oder Eisbahnen zugange. Nachdem ihre Eltern gestorben waren – beide binnen drei Monaten, und das in dieser quälenden Zeit unmittelbar vor der Veröffentlichung ihres ersten Romans –, glaubte Elfrida, dass sie und ihr sieben Jahre älterer Bruder sich unweigerlich annähern würden. Anselm wanderte jedoch unverzüglich nach Kanada aus, heiratete, und dann kamen in rascher Folge Jerold und Roldan. Bruder und Schwester sahen einander nur selten, den Kontakt hielt man aus Pflichtgefühl, nicht aus Zuneigung. Daher diese Rundbriefe. Da hätte er gleich seinem Sachbearbeiter bei der Bank schreiben können, dachte sie, knüllte den Brief zusammen und schleuderte ihn auf den Rasen.
Die Lektüre dieses Briefes regte sie jedoch an, selbst einen zu verfassen. Sie holte Papier und Füller und schrieb sowohl ihrem Agenten als auch ihrem Verleger bei Muir & Melhuish, dass sie gern einen Termin für die kommende Woche vereinbaren würde. Calder McPhail, ihrem Agenten, teilte sie unverblümt mit, dass sie Geld brauchte. Ihm gegenüber konnte sie so frei sein – sie kannten sich schon sehr lange –, außerdem hatten der Wodka und der zuvor genossene Gin zu ihrer Enthemmung beigetragen. Beiden, dem Agenten und dem Verleger, schrieb Elfrida, sie verlange einen Vorschuss auf ihren neuen Roman Der Zickzack-Mann, der bald abgeschlossen sei. Da würden die Herren schon aufmerken.
Sie schaute die Abendnachrichten, machte sich etwas zu essen – Baked Beans auf Toast –, und als sie gegen acht mit Reggies Heimkehr rechnete, schenkte sie sich etwas Tio Pepe ein. Die kaum angebrochene Flasche ließ sie demonstrativ auf der Anrichte stehen und bereitete sich dann einen besonders starken Drink zu, einen vierfachen Wodka mit Wasser. Und so fühlte sie sich herrlich selbstsicher, als Reggie zu deutlich späterer Stunde nach Hause kam.
Sie schaltete den Fernseher aus, als er ins Wohnzimmer trat, stand auf, ohne zu schwanken, und blickte ihn so kalt wie eindringlich an.
»Sag mir eins: Mit wem treibst du es eigentlich bei diesem Dreh?«
10
Am nächsten Morgen verspürte Talbot nach seinem gewohnten Frühstück plötzlich Magenbeschwerden. Er ging in sein Zimmer zurück und nahm einen Schluck Previzole, in der Hoffnung, die kreidige Flüssigkeit würde Wunder wirken, und mit der Befürchtung, dass sein verfluchtes Geschwür sich wieder bemerkbar machte. Es lag nicht an seinem täglichen Kipper – es war die bevorstehende Auseinandersetzung mit Reggie, wegen Janet Headstone und der fragwürdigen Neufassung des Skripts, die Talbots Magensäure strudeln und schäumen ließ und an seinen Eingeweiden zerrte.
Er wusste genau, wer Janet Headstone war, hatte sie jedoch nie kennengelernt. Eine junge, freche, selbst ernannte »Cockney-Schriftstellerin«, deren Romane im Londoner East End spielten und sehr flotte Gegenwartsgeschichten aus dem Arbeitermilieu erzählten. Bemerkenswert, wie hartnäckig sich diese kitchen sink-Tradition behauptet, dachte Talbot. Einer ihrer Romane, Canada Dock, war verfilmt worden (mit Samantha Frost in der Hauptrolle) und hatte sich zum geheimen Publikumsrenner entwickelt, so paradox das anmuten mochte, mit diesem jungen Cockney-Liebespaar, das so unfassbar schön und traumhaft schick und schrecklich arm war. Janet Headstone hatte das Drehbuch selbst verfasst und war in der britischen Filmbranche auf einmal sehr gefragt, wenn man es gern »trendy«, »innovativ« und »groovy« haben wollte. Die hübsche, dralle junge Frau mit der markanten Zahnlücke war oft in der Boulevardpresse zu sehen, begleitet von diversen berühmten Schauspielern, Fußballspielern, Fernsehmoderatoren und anderen Prominenten, mit denen sie ins Londoner Nachtleben eintauchte. Was Talbot anging, so fand er Canada Dock grässlich, und ihm war völlig schleierhaft, was Yorgos und Reggie mit dieser Mauschelei bezweckten. Eine Autorin wie Janet Headstone passte doch überhaupt nicht zu Emily Bracegirdles außerordentlich hilfreiche Leiter zum Mond, sie zu engagieren war geradezu pervers.
Talbot wies Joe an, Reggie während der nächsten Drehpause ins Produktionsbüro zu bringen. Von diesem Gespräch durfte kein Mitglied des Filmteams etwas mitbekommen. Talbot ging in den Garten und nahm noch einen Schluck Previzole. Sein Magen brannte wie Feuer. Das Büro befand sich in einer zweistöckigen, rauverputzten Doppelhaushälfte in der Napier Street und verfügte im oberen Stockwerk über ein paar Fachwerkelemente im Pseudo-Tudorbethanischen Stil. Die Lage war sehr komfortabel und günstig, die meisten ihrer Locations in Brighton waren schnell zu erreichen. Der Garten war etwas ungepflegt und überall mit Plastikstühlen vollgestellt – in diesem strahlenden Sommer fanden die meisten Besprechungen unter freiem Himmel statt. Talbot wanderte umher und richtete einen umgekippten Liegestuhl wieder auf. Er fragte sich, wie Peverell Kydd in einer solchen Situation gehandelt hätte. Vermutlich hätte er zunächst Reggie gefeuert und dann eventuell seinen Koproduzenten Yorgos verklagt. Der alte Peverell war alles andere als zimperlich. Wieder eine Eigenschaft, die sein Sohn nicht geerbt hatte. Na und? Talbot dachte: Verbrannte Erde ist meine Sache nicht. À chacun sa méthode.
Gegen zehn klopfte Reggie an die Tür von Talbots Arbeitszimmer – die nur angelehnt war – und trat ein. Talbot bat ihn, Platz zu nehmen, bestellte bei Rosie zwei Tassen von dem lausigen Kaffee, und dann steckten sich beide Männer eine Zigarette an.
Talbot fiel eine Schramme an Reggies Wange auf und darunter drei parallele Kratzer an seinem Hals.
»Was ist passiert?«, fragte er und zeigte mit dem Finger darauf.
»Nenn mich ruhig einen Tollpatsch. Beim Rasenmähen bin ich über einen Maulwurfshaufen gestolpert und gegen den Maschendrahtzaun gefallen.«
»Seit wann mähst du den Rasen?«
»Ich gärtnere gern. Hilft mir beim Nachdenken.«
Talbot ließ das Thema fallen. Ihn ließen die Kratzer eher an Fingernägel denken. Spitze Fingernägel, die Reggies Gesicht beharkt hatten.
»Tja …«, sagte Talbot und hielt dann inne.
»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir gleich einen Tadel einfange«, sagte Reggie.
»Den hast du höchstwahrscheinlich auch verdient. Was zum Teufel hast du mit Janet Headstone vor?«
»Ach das. Verstehe. Janet Headstone.«
»Genau. Ich verlange eine Erklärung.«
Reggie lehnte sich vor. »Pass auf: Ich bin ihr auf einer Party begegnet und habe ihr von unseren Schwierigkeiten mit dem Skript erzählt. Und sie meinte, sie würde uns nur zu gern helfen. Am nächsten Tag hatte ich eine Besprechung mit Yorgos, kam auf Janet zu sprechen, da sagte er, fantastico, die ist genial, stell sie doch für vier Wochen ein. Einfach so. Und ich dachte, er würde das mit dir klären.«
»Hat er aber nicht. Ich habe es gerade erst erfahren.«
»Tut mir leid. Du kennst Yorgos ja besser als ich.«
»Kann man wohl sagen. Wie viel bekommt Janet Headstone für ihren vierwöchigen Einsatz?«
»Ich glaube … pro Woche einen Tausender.«
Talbot achtete darauf, sich nicht das kleinste bisschen anmerken zu lassen.
»Das bedeutet für dich zwei Drehtage weniger.«
»Yorgos sagte, dafür könnte man auf die Notfallreserve zurückgreifen.«
»Das hier ist aber keineswegs ein Notfall, Reggie. Wir haben ein Skript, ein sehr gutes, sauteures Skript aus der Feder keines Geringeren als Andrew Marvell. Was glaubst du wohl, wie er reagieren wird, wenn er mitkriegt, dass Janet Headstone seinen Text umschreibt? Der Typ ist ein Rüpel, der reinste Albtraum. Wer informiert ihn? Du vielleicht?«
Reggie überging die Frage geflissentlich.
»Von Umschreiben kann keine Rede sein, es ist lediglich eine Ergänzung. Was Jan vorschwebt, würde Marvell nie machen. Liegt ihm nicht.«
»Ach, du nennst sie schon ›Jan‹?«
»Ja, stimmt – inzwischen sind wir befreundet. Haben uns ein paarmal getroffen. Wir sind auf derselben Wellenlänge. Sie ist bezaubernd – unverbraucht, anders. Du würdest sie mögen.«
»Das tut nichts zur Sache. Ich ärgere mich, weil du keine Sekunde daran gedacht hast, zuerst mit mir zu reden, Reggie – um meine Meinung zu hören. Du hast mich komplett übergangen und dich stattdessen an Yorgos gewandt. Weil du genau weißt, wie butterweich er ist. Du bist mir in den Rücken gefallen.«
»Das würde ich dir doch niemals antun, Talbot.«
»Hast du aber, mein Lieber. Für den Film, den ich produziere, wurde eine neue Autorin angeheuert, die pro Woche einen Tausender kostet, und ich – der Produzent – erfahre es als Letzter.«
Das Gespräch endete weitaus weniger freundlich, als es begonnen hatte. Talbot wollte Reggie »Rodrigo« Tipton leiden sehen, und er stellte befriedigt fest, dass ihm das durchaus gelungen war. Reggie kehrte äußerst übellaunig zum Set zurück, und Talbot verspürte eine gewisse Genugtuung.
Seinen Magen spürte er allerdings auch. Stress und Streit waren Gift für Talbot, doch ihm stand noch ein weiterer Streit bevor, diesmal mit Yorgos. Er teilte Joe mit, dass er nach London fahre und am nächsten Morgen zurück sei.
Er ließ sich den Alvis aus der Garage des Grandhotels bringen und steuerte die A23 an. Es tat gut, am Steuer zu sitzen, das kraftvolle Surren des Dreilitermotors durch die Karosserie hindurch vibrieren zu hören, die breite silbrige Motorhaube zu bestaunen, die vor seinen Augen »Meile um Meile fraß«, wie es in der Werbebroschüre so schön hieß. Dieses Modell, ein TF21 Cabriolet, gerade mal ein Jahr alt, brachte es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 192 km/h. Und so überholte er mit müheloser Beschleunigung andere Autos und sich abschuftende Lastwagen. Er sog den Duft der Polsterung ein, die nach neuem Leder roch, während sein Blick über die Armaturen mit den zitternden Zeigern huschte, als wäre er ein Kampfpilot im Tiefflugeinsatz über Feindesland. Zuweilen konnte ein Auto Wunder wirken: Der rasende Alvis schenkte Talbot das Gefühl, wieder jung zu sein.
Die Büros der YSK Films Ltd lagen in der Great Marlborough Street, südlich der Oxford Street. Talbot sagte gern North Soho, wenn man ihn nach seinem Arbeitsort fragte. YS stand für Yorgos Samsa und K für Kydd. Yorgos besaß 51 Prozent der Anteile und hatte Talbot einst darauf hingewiesen, dass ihre Firma KYS heißen würde, falls er unbedingt als Erster genannt werden wollte. Der Klang dieses Akronyms behagte Talbot ganz und gar nicht, und so ließ er sich bereitwillig auf YSK ein.
Mit einem übertrieben breiten Lächeln im fahlen Gesicht stand Yorgos Samsa von seinem Schreibtisch auf, als Talbot dessen Büro betrat. Er küsste Talbot dreimal auf die Wangen – links, rechts, links – und zog einen Stuhl zum kleinen Beistelltisch am Fenster, wo sie ihre spontanen Besprechungen abhielten. Zigaretten und Kaffee für beide: Alles so wie immer, nur dass Reggies hinterhältiges Vorgehen das an sich beneidenswerte Einvernehmen zwischen den beiden Geschäftspartnern trübte.
Yorgos Samsa war noch keine zwanzig Jahre alt gewesen, als er nach Hitlers Machtergreifung 1933 aus Deutschland floh und sich nach England durchschlug. So lautete eine Version seiner Geschichte. Talbot hatte mitbekommen, wie Yorgos im Gespräch mit anderen behauptete, er wäre nach einem Schiffbruch im Schwarzen Meer der einzige Überlebende gewesen und hätte vom Völkerbund einen Nansen-Pass erhalten; bei anderer Gelegenheit hieß es, Yorgos wäre Opfer eines Schauprozesses in Transnistrien geworden, wo immer das auch liegen mochte, und hätte sich vor diesem Unrechtssystem in Sicherheit bringen müssen. In Bezug auf seine Biographie sorgte Yorgos gern für Unklarheit. Tatsächlich wusste Talbot nicht so recht, welche Nationalität oder Nationalitäten er früher besessen hatte und welche jetzt. Er hatte oft versucht, auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu erhalten, wurde jedoch stets mit vagen Andeutungen abgespeist: »Ich bin wie Obstsalat, Talbot, in mir steckt von allem etwas« oder »Ich stamme von überall und nirgendwo« oder »Meine Eltern waren wohl Zigeuner, Roma, sie wollten es mir nicht sagen« und dergleichen mehr. »Sagen wir, ich bin ein englischer Gentleman der besonderen Art – so wie du«, hatte Yorgos mal entgegnet. Mehr sollte Talbot nie erfahren, und irgendwann hörte er auf zu fragen.
Yorgos war ungeheuer beleibt, auch wenn seine Schneider aus der Savile Row passgenaue Zweireiher mit langen Schößen für ihn anfertigten, die ihn eher wuchtig und stattlich erscheinen ließen als fett. Sein Haar war schwarz gefärbt und sein flächiges Gesicht mit den Spuren einer verheerenden Pubertätsakne übersät. Er sprach ein nahezu vollkommenes Englisch mit fast unmerklichem, nicht lokalisierbarem Akzent und benutzte gern umgangssprachliche Wendungen, um seine Zugehörigkeit zu demonstrieren, nur dass er sie nicht immer richtig gebrauchte.