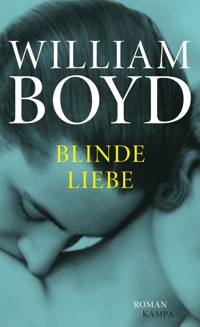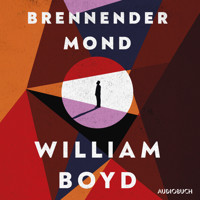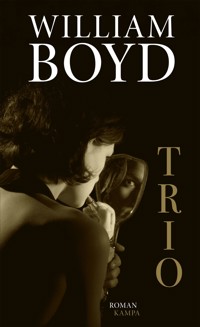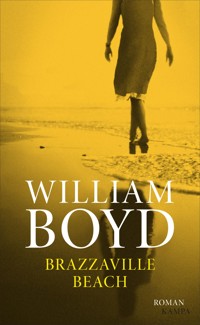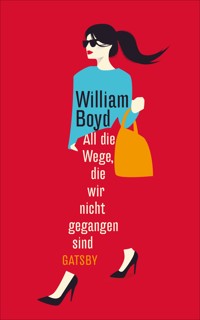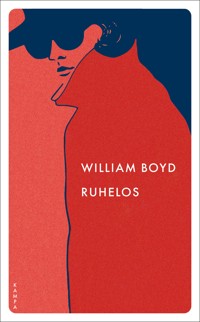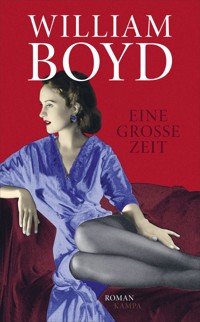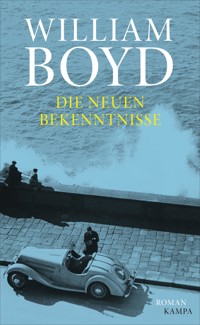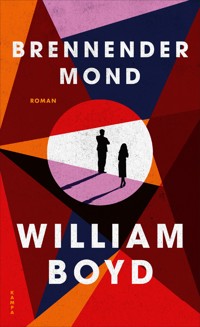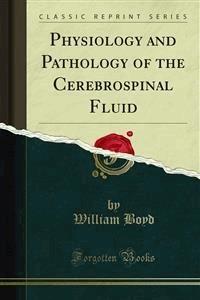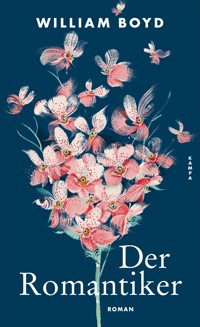
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit sechzehn Jahren erfährt Cashel Greville, dass er nicht ist, wer er glaubte zu sein. 1799 im irischen Cork geboren, hätte er seine Eltern früh bei einem Schiffsunglück verloren, hat seine Tante Elspeth ihm gesagt. Jetzt eröffnet sie ihm: Sie selbst ist seine Mutter, er der uneheliche Sohn eines Adeligen. Sein ganzes Dasein eine himmelschreiende Lüge! Immerhin, sagt er sich, gehört sein Schicksal jetzt ihm, und keiner kann ihn daran hindern, sich neu zu erfinden. Und das tut er nicht zu knapp im Lauf seines Lebens, das das gesamte 19. Jahrhundert währt und Cashel um den ganzen Erdball treibt. Als Trommler der britischen Armee wird er bei der Schlacht von Waterloo verwundet, als Soldat der East India Company Zeuge eines Massakers in Sri Lanka, in Pisa trifft er auf die Shelleys und Byron, in Ravenna verliebt er sich unsterblich. Cashel wird Reisender, Schriftsteller, Gefangener, Farmer, Bierbrauer, Konsul, Liebhaber, Ehemann, Vater und vieles mehr. Bösewichte und Betrüger kommen ihm in die Quere, doch immer eilt ihm auch ein treuer Freund zu Hilfe. Cashels Lebensgeschichte ist abenteuerlich, romanhaft, ja romantisch, und doch ist sie wahr - oder nicht? Ein lebenspraller, weltumspannender, funkelnder Roman, der uns tief in die Epoche der Romantik eintauchen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Boyd
Der Romantiker
Das wahre Leben des Cashel Greville Ross
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Thiesmeyer
Kampa
Für Susan
Das Leben eines bedeutenden Menschen ist eine immerwährende Allegorie, und nur wenige Augen können das Geheimnis seines Lebens schauen.
John Keats
Ein Roman ist ein Spiegel, der eine Landstraße entlangspaziert.
Stendhal
Vorbemerkung des Verfassers
»Ich bin geboren irgendwo in Schottland, frühmorgens am 14. Dezember 1799. Später an jenem Tag verstarb der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington, in seinem Haus in Mount Vernon, Virginia. Ich glaube nicht, dass zwischen den beiden Ereignissen ein Zusammenhang bestand. Ich habe morgen Geburtstag und werde dann zweiundachtzig Jahre alt.«
Und so beginnt sie, die unvollendete, unordentliche und ein wenig verwirrende Autobiographie von Cashel Greville Ross (1799–1882), eine Autobiographie, die – nebst dazugehörigem Material – vor einigen Jahren in meinen Besitz gelangt ist. Sie besteht aus rund einhundert Seiten handgeschriebener Erinnerungen, datiert Dezember 1881, zusammen mit verschnürten Bündeln erhaltener Briefe, Abschriften verschickter Briefe, einigen kleinen Skizzen, Landkarten und Plänen, einigen Fotografien, einigen veröffentlichten Büchern voller Notizen und Randbemerkungen, einigen kleinen Gemälden, Radierungen und Schattenrissen sowie einer Anzahl Gegenstände – eine Zunderbüchse, eine Musketenkugel, eine Gürtelschnalle, eine winzige brüchige Haarlocke, umwunden mit einem Band aus verblichener Seide, eine Handvoll Silberdollars, die Scherbe einer griechischen Amphore und so weiter.
Dieser kleine, aber interessante Fund war alles, worauf sich das Leben dieses Individuums letzten Endes belaufen hatte. Es war alles, was ganz konkret von ihm blieb, und war eine bruchstückhafte Geschichte der Zeit, die er auf diesem kleinen Planeten zugebracht hatte. Er hatte den Versuch unternommen, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, war aber daran gescheitert.
So faszinierend diese vollgekritzelten Seiten und diese paar Artefakte auch sein mögen, so sind sie doch nicht viel, woraus man ein Porträt des Mannes konstruieren könnte – nicht viel für eine Lebensspanne von etwas über achtzig Jahren jedenfalls. Was hinterlassen wir, wenn wir sterben? Nicht gerade wenig, auf den ersten Blick: dieser riesige Berg von »Zeug«, das wir uns zulegen, all die Besitztümer, der Schnickschnack und die Fülle von Dokumenten, die sich im Lauf eines Durchschnittslebens anhäufen. Unerbittlich aber und verblüffend schnell beginnt all das dahinzuschwinden, und nach wenigen Jahrzehnten, nach einem halben Jahrhundert, nach einem Jahrhundert kann davon praktisch nichts mehr übrig sein.
Es kommt natürlich darauf an, wer man ist – von den meisten Menschen jedoch bleibt kaum eine Spur oder ein Zeugnis zurück, wenn ihr Hab und Gut erst in alle Winde zerstreut ist; wenn die Erinnerungen an diese oder jene Person rasch verschwimmen und verblassen, weil die jüngeren Vertrauten ihrerseits sterben. Tagebücher und Briefe vermodern und werden nichtssagend oder unverständlich; Rechtsdokumente, die niemanden mehr interessieren, vergilben in Aktenschränken oder Bankgewölben; Fotos von Familie und Freunden lassen sich nicht mehr identifizieren – werden zu Fotos von anonymen Menschen –, und wenn auch Anekdoten und Legenden womöglich ein wenig länger überdauern, sofern die betreffende Person irgendetwas Nennenswertes geleistet oder irgendeine Art Berühmtheit erlangt hat, bescheiden oder sonst wie, fest steht, dass es das Los der erdrückenden Mehrheit in der menschlichen Geschichte ist, nach zwei oder drei Generationen praktisch in der Anonymität zu verschwinden, vergessen, ein Geist. Alles, was bleibt, ist ein Name auf einem Grabstein, ein Vermerk in einer Volkszählungsliste, ein Online-Nachruf, eine Erwähnung in einer Zeitung und, wenn sie Glück haben, ein Geburts- sowie ein Sterbedatum.
Also, wer war dieser Cashel Greville Ross? Wie war sein wirkliches Leben beschaffen? Wie kann seine einzigartige Ontologie rekonstruiert werden? Zunächst einmal liegt zumindest einiges an Zeugnissen vor, doch inwieweit kann man diesem Material trauen? Es gibt viele große, auffällige Lücken. Den Versuch zu wagen, eine Biographie dieses Menschen zu schreiben – eines Wildfremden –, eines Mannes, der vor über zweihundert Jahren geboren wurde, kam mir, wenn schon nicht völlig unmöglich, dann doch wie ein Unterfangen vor, das letzten Endes aus dürftigen, unbefriedigenden Mutmaßungen bestehen würde – aus lauter »vielleicht«, »eventuell«, »könnte sein«, »möglicherweise«. Es wäre nur ein halbes Leben.
Vielleicht gilt das für Biographien ganz allgemein. Ein kluger Mann hat einmal gesagt: »Alle Biographie ist Fiktion, aber Fiktion, die zu den dokumentierten Fakten passen muss.«1 Wenn der erste Teil dieser Aussage zutrifft, dann ist es womöglich ein reizvollerer Ansatz, diese Freiheit auszudehnen. Das Ziel sollte sein, über die dokumentierten Fakten hinauszugehen, die Grenze der Faktenpalisade hinter sich zu lassen. Und es ist interessanterweise nur die Fiktion, die uns das ermöglicht. Statt zu versuchen, eine Biographie von Cashel Greville Ross zu schreiben, schien mir sehr viel dafürzusprechen, dass der Geschichte seines Lebens, seines wirklichen Lebens, paradoxerweise weit besser gedient wäre, wenn sie stattdessen – unverhohlen, absichtsvoll, frank und frei – als Roman verfasst würde.
W.B.
Triest
Februar 2022
1
Seine erste Erinnerung, behauptete Cashel stets, sei ein Mann in Schwarz gewesen, der ein schwarzes Pferd am Zügel führte. Ein Mann, der ihn – so seine damalige Vermutung – aus irgendeinem Grund umbringen wollte. Dies geschah, als er etwa vier oder fünf oder sechs Jahre alt war (wie er sich undeutlich erinnerte), und die Begegnung trug sich zu, als er eines späten Winternachmittags in dem großen Wäldchen herumstrolchte, hinter dem Cottage im County Cork, Irland, das sein Zuhause war. Er hörte den Klang ferner Jagdhörner und schnappte Hallo-Rufe von den jenseitigen Feldern auf, und dann, dichter bei ihm am Rande des Wäldchens, außer Sichtweite, knackte und raschelte es in der Vegetation; etwas Großes bahnte sich gewaltsam seinen Weg durchs Unterholz.
Cashel spürte, wie ihn aus irgendeinem Grund das kalte Grausen packte. Und dann kam um ein wucherndes Stechpalmengesträuch ein Mann gebogen, der ein Pferd am Zügel führte, einen großen, muskulösen Hengst, schwarz wie Ebenholz, der wild schnaubte und pustete, beigegelber Schaum an Hals und Schultern. Cashel konnte das Zaumzeug riechen, den Pferdeschweiß, dessen moschusartiges, salziges Aroma dick in der Luft unter den Bäumen hing. Der groß gewachsene Mann trug einen schwarzen Jagdrock mit silbernen Knöpfen und einen Zylinder, der ihn noch größer erscheinen ließ. Seine Reitstiefel waren auf Hochglanz poliert und mit kleinen, stumpfen Silbersporen versehen.
Das war der Tod, dachte Cashel – so behauptete er jedenfalls später –, gekommen, um ihn zu holen. Oder der Mann in Schwarz war der Teufel höchstpersönlich.
Doch es war nicht der Tod, und es war auch nicht der Teufel – es war ein Mann, der ein erschöpftes Pferd durch einen Wald führte. Ein Mann mit kantigem Kinn und einem breiten, tabakbraunen Schnurrbart.
»Wie heißt du, Kleiner?«, fragte er.
»Ich bin Cashel, Sir.«
»Wo wohnst du, Cashel?«
»Im Cottage an der Glanmire Lane.«
»Ah. So, so, sieh an …«
Der Mann musterte ihn eingehend von oben herab und streckte seine freie Hand vor, als wollte er ihn im Gesicht berühren – oder mich am Hals packen, dachte Cashel, und erwürgen. Dann aber stampfte der Hengst mit den Hufen auf und wieherte, zerrte an den Zügeln, die der Reiter in seiner behandschuhten Linken hielt.
»Er hat ein Eisen verloren, deshalb kann ich nicht jagen«, sagte der Mann in sachlichem Tonfall, als sei er Cashel eine Erklärung schuldig. »Diesem Trottel von einem Hufschmied verpasse ich einen Tritt in den Hintern, der sich gewaschen hat.«
Er sprach mit einem merkwürdigen Akzent, fiel Cashel auf, im selben Tonfall wie die Mädchen, die auf Stillwell Court lebten. Englische Stimmen. Sie sprachen nicht so wie er oder die anderen Leute, die er kannte.
»Ja, Sir.«
»Mach besser, dass du nach Hause kommst, Cashel, alter Knabe«, fuhr der Mann fort. »Die Jagd kommt hier durch, und man könnte dich für einen Fuchs halten.«
»Ja, Sir.«
Cashel wandte sich um und flitzte atemlos nach Hause zum Cottage, in dem er mit seiner Tante Elspeth wohnte.
Er traf sie in der Spülküche an, beim Kartoffelschälen.
»Ich habe gerade den Teufel gesehen«, keuchte er, heftig um Atem ringend, und beschrieb den Mann in Schwarz mit dem breiten Schnurrbart, der das Riesenpferd am Zügel führte, und den merkwürdigen Akzent, den er hatte.
»Red keinen Unsinn«, sagte seine Tante und trocknete sich energisch die Hände an der Schürze ab. »Das wird einer von Sir Guys Freunden gewesen sein, die für die Jagd aus England herübergekommen sind. Sei kein Dummkopf. Der Teufel kommt dich noch nicht holen, nein, nein.« Sie lachte kurz vor sich hin. »Er hat eine Menge mehr zu erledigen, ehe er sich auf die Suche nach dir macht, Cashel Greville.«
Sie hievte ihn vom Boden hoch – sie war eine große, starke junge Frau –, küsste ihn auf die Wange und trug ihn in die Stube, um durchs Fenster dort zu blicken. Ein halbes Dutzend Jäger preschten achtlos im Galopp die kleine Straße entlang, dass der Matsch nur so spritzte, in großen Klumpen aufgewirbelt von den Pferdehufen.
»War er nett zu dir, dieser Mann im Zylinderhut? War er ein netter Mann?«
»Keine Ahnung.«
»Hat er gefragt, wie du heißt?«
»Ja.«
»Hast du es ihm gesagt?«
»Ja.«
»Schön. Gut.«
»Und er hat gefragt, wo ich wohne.«
»Und, hast du es ihm gesagt?«
»Ja.«
Sie setzte ihn auf dem gefliesten Fußboden ab.
»War das falsch, ihm das zu sagen, Tante?«
»Komm mit und trink deinen Tee.«2
Elspeth Soutar, Cashels Tante, eine Schottin aus der Gegend Dumfries, war unverheiratet und Anfang dreißig. Sie war eine gebildete Frau und die Gouvernante der beiden Töchter von Sir Guy und Lady Evangeline Stillwell, ansässig auf Stillwell Court, County Cork, Irland. Bei den Mädchen handelte es sich um Rosamond (sechzehn) und Hester (vierzehn), und Elspeth war nun seit fast zehn Jahren für ihre Erziehung zuständig. Es war aller Welt stillschweigend bewusst, dass ihre Tage als Gouvernante gezählt waren, da die Einführung der Mädchen in die Gesellschaft immer näher rückte. Danach bestünde an pädagogischer Verfeinerung kein weiterer Bedarf mehr.
Cashel kannte Rosamond und Hester gut. Sie spielten immer mit ihm, als er noch klein war, beinahe so wie mit einem Haustier. Manchmal zogen sie ihn an wie eine Puppe, mit einem Rüschenrock und einer Haube, oder wie einen Spielzeugsoldaten, oder als wilden Eingeborenen. Sie hatten ihn lieb, küssten und herzten ihn ausgiebig und trugen ihn viel durch die Gegend, bis er zu grob und unhandlich wurde. An der Vertrautheit allerdings änderte sich nichts. Sie hatten viele Spitznamen für ihn: der Cashelmite, Cash-Cash-Coo, Cashelnius der Große. Sie hätten fast seine großen Schwestern sein können, wäre da nicht die gesellschaftliche Kluft gewesen. Elspeth Soutar gehörte schließlich zur Dienerschaft, und so galt dasselbe auch für ihren kleinen Neffen.
Sir Guy bekam Cashel nie zu Gesicht. Dieser war eine unnahbare, fast schon mythische Gestalt, die immer verreist zu sein schien – in Dublin, in London, auf dem Kontinent –, und in die prächtigen Salons des Hauses wagte Cashel sich nie so recht vor. In der Regel hielt er sich mit den Mädchen im Kinderzimmer auf. Infolgedessen sah er auch Lady Evangeline nur sehr selten, die, so schien es, dauernd krank war und monatelang ihre Zimmerflucht im ersten Stock nicht verließ, wo sie von einer Krankenschwester umsorgt wurde und einmal die Woche, das ganze Jahr hindurch, den alten Dr. Killigrew aus der nahe gelegenen Stadt Castlemountallen empfing, der mit seinen Patentarzneien zu Besuch kam. Die wenigen Blicke und Begegnungen, die er zu erhaschen vermochte, hinterließen bei ihm den Eindruck von jemandem, der sehr steif und aufrecht, aber dabei zugleich sehr blass und zerbrechlich war. So dünn wie Papier, dachte er – so dünn wie zerknittertes Wachspapier.
Einmal, als Rosamond und Hester ihn in einem kleinen Spielzeugkarren durch die Flure schoben, liefen sie zufällig Lady Evangeline in die Arme. Sie stieg gerade mithilfe der Pflegerin die Treppe hinunter, angekleidet mit einer Spitzenhaube und einem Kleid aus ultramarinblauer Seide, unterwegs zu irgendeiner häuslichen Geselligkeit.
»Wer ist denn der kleine Junge?«, fragte sie Rosamond.
»Das ist Elspeths Mündel, Mama«, sagte Rosamond. »Ihr kleiner Neffe. Der Waise, du erinnerst dich?«
»Ich kann mich nicht entsinnen«, sagte Lady Evangeline gleichgültig. »Oder vielleicht doch, jetzt, wo du es erwähnst. Der Waise. Ja. Ist er ein artiger kleiner Junge?«
»O ja. Weil er weiß, dass er von uns den Hintern versohlt bekommt, wenn er ungezogen ist«, sagte Hester.
Lady Evangeline lächelte schmal, und die Schwester geleitete sie behutsam weiter die Treppe hinunter, zum Wohnzimmer.
Als er alt genug war, um zu verstehen – als er fünf war –, setzte Tante Elspeth sich mit ihm hin und erzählte ihm die traurige Geschichte vom Tod seines Vaters und seiner Mutter, Moira und Findley Graville, beide im Jahr 1800 ertrunken, als das Paketboot nach Belfast bei einem Sturm in der Irischen See untergegangen war. Auf dem Kaminsims im Wohnzimmer stand das amateurhaft gepinselte kleine Doppelporträt eines Paares mit hölzernen Gesichtern, die einzige bildliche Erinnerung an seine Eltern.
»Sie haben sich vor dir nach Belfast eingeschifft«, erklärte Elspeth. »Du solltest eigentlich mit ihnen reisen, aber du warst krank, du hattest Krupp, deshalb sollte ich mit dir eine Woche später nachkommen. Dem Herrn sei Dank, dass du hiergeblieben bist.«
»War es ein Schiffsuntergang?«, fragte Cashel.
»Ja. Das Schiff ist mit Mann und Maus untergegangen.«
»Was heißt das?«
»Dass es keine Überlebenden gab. Alle sind ertrunken.« Elspeth lächelte traurig. »Deswegen lebst du bei mir, mein Schatz.« Sie streichelte ihm das kräftige, helle Haar, durchpflügte es mit ihren steifen Fingern. »Ich werde nie deine richtige Mutter sein, aber in jeder anderen Hinsicht und Beziehung bin ich deine Mutter, mein Kleiner, keine Sorge.«
Elspeth hatte ihm das Doppelporträt auf den Schoß gelegt, während sie ihm behutsam die Geschichte nahebrachte. Cashel betrachtete die Puppen mit den aschfahlen Gesichtern, die seine Mutter und seinen Vater darstellen sollten. Der Mann hatte einen dichten, spatenartigen Bart. Die Frau trug eine eng anliegende Haube und schien mit ausdruckslosen Augen aus dem Bild herauszustarren.
»Das ist Findlay Greville.« Elspeth deutete mit dem Finger hin. »Und das ist meine liebe kleine Schwester Moira, Gott hab sie selig.«
»Wenn ich auf dem Schiff gewesen wäre, wäre ich also auch ertrunken«, sagte Cashel, in dessen jungem Kopf sich die Realität seiner Lage nach und nach zu verfestigen begann. Zu jener Zeit kannte er zwar die Worte noch nicht, doch er begriff langsam den Umstand, dass er elternlos war, eine Waise.
»Ich bin sehr froh, dass ich nicht auf diesem Schiff war, Tante«, sagte er. »Und ich bin sehr froh, dass ich bei dir lebe.«
Es verwunderte ihn, wie heftig sie ihn umarmte, und auch, dass ihr Tränen in den Augen standen.
»Du bist ein guter Junge, Cashel Greville. Der beste.«
Als sehr tüchtige Gouvernante achtete Elspeth Soutar selbstverständlich darauf, dass Cashel eine ebenso gute Bildung erhielt wie die Stillwell-Mädchen. Schon mit fünf konnte er lesen und schreiben. Als er mit sieben auf die private Grundschule in Castlemountallen kam, durfte er gleich zwei Klassen überspringen, um mit den Neun- und Zehnjährigen zu lernen. Den Unterricht – Latein, Griechisch, Aufsatzschreiben, Mathematik, Religion – fand er trotzdem immer noch sehr leicht und unkompliziert, sagte er.3
Das Leben auf Stillwell Court Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ging so geordnet und scheinbar unveränderlich seinen Gang wie im achtzehnten Jahrhundert. Der ausgedehnte Grundbesitz war einem gewissen Colonel Gervase Stillwell, einem Offizier aus Oliver Cromwells Armee von 1649, als Geschenk übereignet worden. Die Schenkung bestand alles in allem aus etwa fünftausend Morgen Land, überwiegend am Nordufer des Flusses Baillybeg, im Tal zwischen Castlemountallen und Fermoy gelegen, mit weiteren Pflanzungen und Ackerland an anderen Orten, im County Kerry und County Waterford. Darüber hinaus wurde Gervase Stillwell 1659 in den Rang eines Baronet erhoben. 1782, nachdem er den Besitz von seinem verstorbenen Vater Fielding geerbt hatte, verkaufte Sir Guy Stillwell, der fünfte Baronet, die fernen Farmen und Waldgebiete in Kerry und Waterford und nutzte den Erlös dafür, Stillwell Court zu errichten, ein Vorhaben, das annähernd zehn Jahre in Anspruch nahm, viele Tausende Pfund kostete und dazu führte, dass die Familie Stillwell sich dauerhaft hoch verschuldete. Bei Banken in Dublin, London und Amsterdam wurden Hypotheken aufgenommen – und dann wurden die Hypotheken refinanziert, die Schulden neu verbürgt durch den nie versiegenden Zustrom von Pachteinnahmen, die die Pachtbauern auf dem Land der Stillwells erwirtschafteten. Was indes die Stillwells betraf, so änderte sich an ihrer Lebensqualität und ihrem Lebensstil nicht das Geringste. An Geld dafür, genau ihren Wünschen gemäß zu leben, schien es nie zu mangeln – in Irland, ganz wie anderswo, gab es für die privilegierte Minderheit des Adels viele Mittel und Wege, um es sich gut gehen zu lassen.
Und während das Haus über die Jahre langsam errichtet wurde, entstanden auch die Gartenanlagen. Man legte einen breiten Repräsentationsgarten an, pflanzte Hunderte Bäume, dämmte ein Flüsschen ein, um einen ansehnlichen See mit Kaskaden zu erschaffen, und schlug für einen »Reitweg« eine lange Schneise durch dichten Buchenwald. Sir Guy war fest entschlossen, das Wunschbild, das ihm für den Sitz der Familie Stillwell vorschwebte, exakt umzusetzen, ohne Kompromisse, ohne Abstriche. Kurz nach Rosamonds Geburt konnten sie das Haus endlich beziehen, und fünfzehn Jahre später, zu der Zeit, als Cashel damit anfing, sich eine Art Überblick über den Ort zu verschaffen, an dem er aufwuchs, hatte das Anwesen bereits eine Patina von Fortdauer angenommen, von Langlebigkeit. Die Kalksteinfassade des großen Hauses war verwittert; eine Giebelseite des Ostflügels war komplett mit Efeu bedeckt; die Stallungen hatten schon zwei Generationen von Jagdpferden kommen und gehen sehen; die Bäume im landschaftlich gestalteten Park waren prächtig gediehen und die Ufer des künstlichen Sees mit Erlen und dichtem Schilf bewachsen; die reich verschnörkelten Tore – Zugänge zu den östlichen und westlichen Auffahrten – mit ihren Zwillingstorhäusern zu beiden Seiten schienen kundzutun, dass Stillwell Court hier schon seit Ewigkeiten bestand und noch ebenso lange weiterbestehen würde.4
Elspeth Soutars Beziehung zu Cashel war herzlich und eng. Als er zum Hochheben und Knuddeln zu groß geworden war, ließ sie ihn stattdessen vor dem Torffeuer auf ihrem Knie sitzen und erzählte ihm Geschichten von ihrer Kindheit in Dumfries. Sie hatte einen schottischen Akzent, den Cashel von ihr übernahm, wobei sich jedoch mit dem Besuch der Grundschule sein irischer Tonfall unausweichlich verstärkte und alle Reste seines schottischen Zungenschlags verdrängte.
Es war eine linguistische Reise, die unbeabsichtigt durch die Häuslerkinder ermuntert wurde, mit denen er weiter unten in der Glanmire Lane spielte, vor den hohen Mauern, die Stillwell Court und seinen Park umgaben. Sir Guy Stillwell hatte auf seine Kosten zu beiden Seiten der Straße zehn Unterkünfte, katenähnliche kleine Häuschen, für seine sogenannten Häusler errichten lassen, Schuldpächter und zuverlässige Gelegenheitsarbeiter. Cashel war mit zweien der älteren Jungs der Familie Doolin befreundet. Pádraig Doolin war ein Viehhirte und Holzfäller. Er und seine Frau, Aoife, hatten sechs Kinder, von acht Jahren bis hin zu einem Neugeborenen, und Cashel war mit den beiden ältesten Jungen befreundet, Callum und Lorcan. Callum war knochig und reizbar; Lorcan pfiffig und offensichtlich begabt. Sir Guy finanzierte ihm den Besuch der Grundschule in Castlemountallen, in der Hoffnung, ein wenig Unterweisung – Bildung sogar – könnte ihm einen Weg eröffnen, der immerwährenden Armut zu entkommen, die das lebenslange Los der Häusler zu sein schien.
Hin und wieder, einmal im Monat etwa, mitunter zweimal, sagte Elspeth zu Cashel, er solle »gehen und mit den Doolin-Jungs spielen«. Was, wie Cashel bewusst war, weniger ein Vorschlag als eine Aufforderung war; und auch wenn er wenig Lust dazu verspürte, erriet er aus ihrem Tonfall, dass es sich nicht lohnte, Widerworte zu geben. Sie gab ihm bei diesen Gelegenheiten ein Geschenk für Mrs Doolin mit – eine Pastete, ein Glas Marmelade, einen alten Schal –, wie um den Besuch zu rechtfertigen. Es war immer nachmittags, und sie pflegte hinzuzusetzen: »Komm nicht vor dem Abendessen zurück, hörst du.« Und so zog Cashel also los und trottete die Straße hinunter zu den Häuschen, die Geschenke in der Hand, um zwei, drei Stunden bei der Familie Doolin verbringen zu dürfen.
An diesem speziellen Frühlingstag – es war bewölkt und nieselte, und die Straße schimmerte vor dünner, schmutziger Pfützen in ihrer zerfurchten Oberfläche, die vernarbt war vom Verkehr der Karren und Rollwagen – brach Cashel mit einem Knäuel Flachsgarn auf und legte die halbe Meile zu den Häuschen zurück. Er war etwas verstimmt, weil er gerade stillvergnügt an einer kunstvollen Zeichnung einer riesigen befestigten Burg gearbeitet hatte (angeregt durch einen Besuch auf Charles Fort in Kinsale), und auf seinen Protest hin hatte Elspeth ihn angefahren: »Ich will, dass du jetzt gehst, Junge.« Sie müsse eine Reihe Französischstunden für die Stillwell-Mädchen vorbereiten, erklärte sie, da demnächst ihre erste Reise auf den europäischen Kontinent bevorstand, und dafür brauche sie absolute Ruhe und Frieden.
Die Glanmire-Häuschen sahen alle gleich aus. Errichtet aus Lehm-und-Stroh-Wänden, knapp fünfzig Zentimeter dick, und mit Dächern aus Kartoffelkraut ähnelten sie eher Gewächsen als Bauwerken. Zu jedem Häuschen gehörten anderthalb Morgen Land für den Anbau von Kartoffeln, jedes hatte eine Kuh, manche auch zwei, und es gab Hühnerausläufe und Schweineställe. Diese schlichten Behausungen hatten allerdings keinen Schornstein, und der Rauch von dem Torffeuer im Hausinneren musste vom Hauptraum – der auch der einzige Raum war – durch eine Tür oder ein Fenster abziehen.
Cashel näherte sich dem Häuschen der Doolins und sah zwei der kleinen Mädchen, die splitternackt und vor Vergnügen kreischend die Hennen in ihrem Auslauf vor sich herscheuchten. Er rief laut seinen Namen, und Mrs Doolin lud ihn ein, einzutreten. Sie saß auf einem Hocker am Feuer und stillte ihr Neugeborenes, ein weiteres Mädchen. Es hatte noch keinen Namen.
»Komm nur rein, Cashel, mein hübscher Junge.«
Cashel brannten bereits die Augen von dem Torfqualm, der wie eine graue Wolke unter den Dachsparren hing; der Geruch von etwas Saurem lag in der Luft, brütend. Er reichte Mrs Doolin den Flachs, den er dabeihatte, und konnte sich nicht vom Anblick des Babys losreißen, das an ihrer weißen Brust mit der dunklen Warze nuckelte.
»Dich hab ich auch an meinen Zitzen gehabt, Cashel, mein Lieber. Ich war deine Amme, als deine Tante dich aus Schottland mit herbrachte, als armes verwaistes Würmchen, das du warst.«
»Ja, ich weiß«, sagte Cashel geduldig. Er wusste, was eine Amme war. Mrs Doolin erzählte ihm diese Tatsache fast jedes Mal, wenn er zu Besuch kam, als bestünde zwischen ihnen eine tiefere, fast familiäre Bindung, weil er ihre süße Milch getrunken hatte – dass er für sie mehr war als der verwaiste Neffe der Gouvernante der Stillwells. Mrs Doolin, immer schwanger, immer gebärend (drei ihrer Kinder waren gestorben), war berühmt für ihre reichliche Muttermilch.
Sie stand auf, mit dem weiter nuckelnden Säugling an der Brust, und ging an die Tür, um Callum und Lorcan zu rufen.
Cashel sah sich um. An der Wand stand das einfache Holzbett mit der Rosshaarmatratze und der Decke, daneben ein Lager aus dichtem Stroh, auf dem die Kinder schliefen. Sie besaßen eine Truhe, von der der schwarze Lack abblätterte, einen Tisch und drei Hocker. Am Feuer stand der große Topf, in dem die Kartoffeln gekocht wurden, und daneben das Spinnrad, um Flachs für Leinen zu spinnen. Cashel dachte, wie jedes Mal, an sein Zimmer im Cottage – die bunt karierten Vorhänge am Fenster, den geknüpften Teppich, das warme Daunenbett, die Kommode mit dem Nachttopf. Die Familie hier verrichtete ihre Notdurft draußen auf dem Misthaufen, wo die Schweine herumwühlten. Auf einmal wünschte er sich, dass seine Tante ihn nicht zum Spielen mit den Doolin-Jungs hergeschickt hätte. Er hätte mit seinen Stiften und Blättern Papier am Küchentisch gesessen und sie überhaupt nicht gestört.
Dennoch lächelte er höflich, als Mrs Doolin sich wieder am Feuer niederließ und das Baby an ihre andere Brust anlegte. Ihre nackten Füße waren schwarz von Schmutz, ihm fiel auf, dass ihre Zehen wie Schildkrötenklauen aussahen, und er blickte schuldbewusst auf seine Schnallenschuhe nieder, die unter seiner Hose hervorlugten. Er knöpfte seine Jacke auf, als würde er sich dadurch in diesem Raum etwas heimischer, ungezwungener, etwas behaglicher fühlen.
Dann kamen Callum und Lorcan hereingeschlendert, grinsend, mit Hurling-Schlägern, die sie lose in der Hand pendeln ließen.
»Na, hallo, hallo, Cashel«, sagte Lorcan und setzte rätselhafterweise hinzu: »Wenn man vom Teufel spricht.«
»Lust auf eine Partie, Cashel?« Callum hielt seinen Schläger in die Höhe.
»Ich hab keinen Schläger.«
»Kein Problem, wir haben noch einen in Reserve«, sagte Callum. »Wir können Diarmuid von nebenan Bescheid sagen, dann sind wir genug für ein Spiel. Du kannst Torhüter sein.«
Eine Stunde später humpelte Cashel heimwärts, mit seinen Schuhen in der Hand. Er hasste Hurling, und Callum Doolin, davon war er überzeugt, hatte ihm mit seinem Schläger absichtlich gegen den Knöchel geschlagen, und zwar fest, obwohl der Ball längst fort war. Blutüberströmt schrie Cashel, dass sein Fußknöchel gebrochen sei.
»Dann spiel eben kein Hurling, du Baby!«, höhnte Callum. »Mit Mädchen spielen wir nicht.«
Als Cashel sich dem Cottage näherte, stieg die Straße über eine kleine Brücke an, von der aus er auf sein Zuhause und den gepflegten Garten dahinter, mit der Mauer ringsherum, hinabblicken konnte. Er blieb unvermittelt stehen. Am hinteren Gartenende sah er eine dunkle Gestalt. Einen Mann in einem langen schwarzen Mantel und mit einem hohen Hut. Dieser Mann öffnete die Tür in der hinteren Gartenmauer, schloss sie hinter sich und verschwand in den dichten Wald dahinter.
Diese Tür in der hinteren Gartenmauer, so viel wusste Cashel, war immer abgeschlossen. Der Wald dahinter durfte nicht betreten werden: »Privatbesitz«, sagte Elspeth. »Sie züchten dort Fasane und schießen sie. Es ist gefährlich.« Folglich hatte sich Cashel nie dorthin gewagt. Es war ohnehin ein feuchtklammer, düsterer Wald, eng gepflanzt, voller Eichen und Ulmen mit undurchdringlichem Unterholz, erstickt von Brombeergestrüpp und Brennnesseln.
Aber jetzt dieser Mann? War es ein Einbrecher? Ein Mörder …?
Er rannte los, durch den Vorgarten und hinauf zur Haustür. Abgeschlossen. Abgeschlossen von der anderen Seite natürlich. Verwirrt flitzte er an die Hintertür. Im Haus fehlte von seiner Tante jede Spur, sie war weder in der Küche oder Spülküche noch im Wohnzimmer. Er bekam es mit der Angst zu tun und wollte nicht nach oben zu den Schlafzimmern gehen, aus plötzlicher Furcht, was er dort vorfinden könnte.
»Tante!«, rief er laut, klagend, voller Verzweiflung.
»Cashel?«, wurde umgehend geantwortet.
Er lief zum Treppenaufgang. Seine Tante stand auf dem Absatz, wo die Treppe eine Kehre machte, in ihrem Morgenmantel. Ein zweiter Blick registrierte, dass ihr langes dunkles Haar offen war und ihr locker um die Schultern hing. Er sah sie äußerst selten mit offenem Haar und nahm selbst in diesem nervenaufreibenden Moment Notiz davon, wie anders sie auf einmal aussah – wie wunderschön, wie jung …
Aber sie war erbost, hatte die Augen zu schmalen Schlitzen verengt.
»Wieso bist du schon zurück? Ich hab doch gesagt, zum Abendessen!«
»Dieser Callum Doolin hat mich den Knöchel gebrochen.«
»Hat mir den Knöchel gebrochen.«
»Er hat mir den Knöchel beim Hurling-Spielen gebrochen. Es tut weh, Tante. Sieh nur – da ist Blut.«
Und sie ging ans Werk – setzte den Wasserkessel auf, faltete ein weiches Tuch, benetzte es mit dem heißen Wasser und tupfte behutsam das getrocknete Blut ab. Sie wickelte ihm sogar einen Mullverband um den Knöchel, mit dem er sich irgendwie vornehm und tapfer vorkam.
Elspeth küsste ihn auf die Stirn. Cashel fiel auf, dass ihre Augen ganz rot waren, als hätte sie geweint.
»Es mögen grobe Jungen sein, aber sie meinen es nicht böse.«
»Nein. Er hat es mit Absicht getan. Lorcan ist mein Freund, und Callum ist eifersüchtig.«
Sie tröstete ihn, machte ihm einen Becher süßen Tee, und dann setzte er sich, merklich beruhigt, wieder an seine Zeichnung von den wundervollen Befestigungsanlagen. Eine halbe Stunde später kam sie in ihrem blauen Kleid nach unten, das lange Haar hochgesteckt und mit Kämmchen gesichert, um ihr Abendessen aus frisch gebackenem Brot und einer Hammelsuppe vorzubereiten. Erst jetzt, als Ruhe im Haus eingekehrt war, kam Cashel wieder der Mann in den Sinn, den er an der Gartentür gesehen hatte, und auch der seltsam legere Aufzug seiner Tante. Hatte sie geschlafen? War ihr nicht wohl gewesen? War der Mann Arzt? Es war ein Rätsel, das er lösen musste, sagte er sich, und er wusste, dass die Antwort jenseits des Cottage-Gartens zu finden war – in dem dunklen Wald mit seinem Dickicht, mit dem Brombeergestrüpp und den tückischen Brennnesseln.
Der folgende Tag war ein Sonntag, und nach dem protestantischen Gottesdienst im Dienstbotenspeisesaal auf Stillwell Court (ein Gebet, ein Kirchenlied, eine Lesung) sagte Cashel seiner Tante, dass er noch einmal zu den Doolins gehen würde, um Callum seinen Knöchelverband zu zeigen und ihn mit dem Schaden zu konfrontieren, den er angerichtet hatte. Als er aber ein Stück die Straße hinaufgegangen und außer Sichtweite des Cottage war, setzte er mit einem Sprung über die Natursteinmauer und bahnte sich seinen Weg durch den Wald. Er kam nur mühsam vorwärts – das Unterholz war dicht, und die langen, stachligen Brombeertriebe waren überall und zerrten an seiner Kleidung. Schließlich kam er an der Mauer des Cottage-Gartens an. Dort war die Tür, und er versuchte sein Glück. Abgeschlossen.
Dass der Mann den Garten durch die Tür verlassen hatte und diese hinter ihm nun verschlossen war, konnte nur bedeuten, dass er einen Schlüssel gehabt haben musste …
Und dort von der Tür aus verlief ein Pfad, der in den Wald führte – eine Schneise, für die Brennnesseln abgemäht und herüberhängende Äste gestutzt worden waren. Sehr ausgetreten war er noch nicht, aber dennoch zweifelsfrei ein Pfad. Cashel zog los und folgte dem Pfad, mit, so kam es ihm vor, auf einmal hörbar pochendem Herzen, weil er sich der Gefahren bewusst wurde, die im Wald lauern konnten. Der Pfad verlief mal hierhin und mal dorthin. Einmal blieb Cashel stehen, als er vor sich auf der Erde einen Zigarrenstummel entdeckte, fünf Zentimeter lang – feucht, in Auflösung begriffen. Er hob ihn auf und schnupperte daran – jener saure, schweißige, kotige Geruch war noch wahrzunehmen. Er warf den Stummel wieder fort. Der Pfad wand sich um den Stamm einer großen Esche herum, bis er schließlich direkt vor einer weiteren Mauer stand, der Mauer des Anwesens, drei Meter hoch, mit einem hohen eisernen Tor darin.
Cashel drückte die Klinke herunter, um das Tor zu öffnen, doch es war ebenfalls verschlossen. Durch die Gitter konnte er das Wildhüter-Häuschen mit seiner achteckigen Wildkammer sehen und jenseits davon die Rückseite des großen Hauses mit seinem Pall-Mall-Hof und dem tiefen Ha-Ha-Graben. Er meinte, Hester dort zu erkennen, in einem cremefarbenen Kleid, die immer wieder bei dem Versuch scheiterte, einen Drachen in der frischen Brise steigen zu lassen.
Also, dachte Cashel, der Mann im Cottage-Garten war von Stillwell Court aus gekommen, so viel war klar. Wer aber mochte er sein? Der Wildhüter? Und was hatte er mit seiner Tante Elspeth zu tun …?
Cashel wandte sich um und kehrte auf dem Pfad wieder zum Cottage zurück. Er war zufrieden mit dem Ergebnis seiner Nachforschungen, aber den Antworten auf seine Fragen war er nicht näher gekommen. Er sprang über die Mauer und steuerte zum Cottage zurück, das er durch die vordere Tür betrat.
»Ich bin wieder da, Tante«, rief er.
Elspeth saß im Wohnzimmer und trank Tee.
»Wie ging es den Doolin-Jungen?«, fragte sie. »Hat Callum sich bei dir entschuldigt?«
»Sie waren nicht da«, log Cashel eilig. »Also habe ich mich ein Minütchen oder so mit Mrs Doolin unterhalten. Sie bedankt sich vielmals für den Flachs.«
»Arme Frau«, sagte Elspeth. »Wobei, sie hat mehr Glück als andere, nehme ich an.« Sie winkte Cashel zu sich. »Komm und setz dich her. Ich habe Neuigkeiten. Bedeutsame Neuigkeiten.«
Cashel hatte wenig Lust auf bedeutsame Neuigkeiten, doch er setzte sich ihr gegenüber auf den Pantoffelstuhl.
»Wir verlassen Stillwell Court«, verkündete Elspeth freudestrahlend.
»Was?«
»Meine Arbeit hier ist getan. Diese Mädchen haben nun alles an Bildung, was sie brauchen, und obendrein reisen sie beide nächstes Jahr nach Frankreich.«
»Wir können hier nicht fort. Was ist mit mir?«
»Ich werde nicht länger benötigt. Die Familie ist sehr großzügig gewesen.«
»Aber wir können doch sicher hier im Cottage wohnen bleiben?«
»Nein. Wir gehen fort.«
»Wohin?« Cashel spürte, wie ihm salzige Tränen in den Augen brannten. Ein Leben woanders war für ihn unvorstellbar.
»Nicht weit weg. Nicht ans Ende der Welt, Schatz.«
»Wohin gehen wir?«, fragte er nochmals, tieftraurig.
»Wir ziehen nach England«, sagte Elspeth. »In einen Ort namens Oxford.«
2
Es war ein ungewöhnlich warmer Tag für Anfang Juni, und Cashel fühlte, wie ihm die Sonne heiß auf die Schultern schien, obwohl es gerade erst kurz nach sieben Uhr morgens war. Die Schule fing um Punkt acht an, und er hatte über eine Meile Fußweg dorthin zurückzulegen. Er brach immer extra früh auf, um reichlich Zeit zu haben – wer sich verspätete, und sei es auch nur um eine Minute, wurde von Dekan Smythe versohlt. »Pünktlichkeit ist keine Angewohnheit«, pflegte der Dekan zu sagen, während er schon zum Gürtel griff, »sondern eine Tugend.«
Cashel nahm den Leinenbeutel von seiner linken Schulter und hängte ihn sich stattdessen über die rechte Schulter. In dem Beutel befand sich sein Mittagessen – ein Kanten von Tante Elspeths frisch gebackenem Brot, ein Stück Käse, eingeschlagen in ein Kohlblatt, ein Apfel und eine verkorkte Flasche mit Apfelwein, der mit Wasser verdünnt war – sowie ein Tintenfläschchen, ein Etui mit Schreibfedern, sein Federmesser und eine Bibel. An Dekan Smythes Academy musste jeder Junge seine eigene Bibel haben.
Er marschierte zügig die Botley Road entlang, die durch die ländliche Gegend nach Oxford führte, wo sich in der Ortsmitte die Schule befand. Zu seiner Rechten sah er die Kirche von Sankt Thomas dem Märtyrer inmitten ihrer ehrwürdigen Lindenbäume, und bald schon querte er die Isis-Brücke und befand sich in der eigentlichen Stadt. »Eine Kleinstadt mit vielen wunderschönen Bauwerken«, so hatte Elspeth ihm Oxford beschrieben – obwohl eigentlich eher die Bezeichnung »Stadt« angebracht war, berichtigte er sich im Stillen, da es immerhin eine richtige Kathedrale hier gab.
Über der Mautschranke hing ein staubiger Dunst, aufgewirbelt von den Rädern des erheblichen Morgenverkehrs. Die Kutsche aus Cheltenham hatte soeben den Schlagbaum passiert und ratterte nun in rücksichtslosem Tempo in die Stadt. Mit Fässern beladene Bierkutschen waren unterwegs zu den Gasthäusern und Schenken von Oxford, und Dogcarts und Kaleschen trugen ebenso zum Geklapper des endlosen Kommens und Gehens bei – selbst der Lärm war anders hier in England, dachte er, alle immer so beschäftigt, weit entfernt von der friedlichen Ruhe in Stillwell Court und der Glanmire Lane.
Beim Überqueren der Brücke über die Isis zog ihm der Gestank vom Kai des Oxford-Kanals in die Nase, und er rettete sich hastig in das Gässchen, das zur Penny Farthing Street führte, wo sich die Schule befand. Er kam in die kopfsteingepflasterte Gasse und stellte fest, dass der alte Soldat noch immer dort war, mit der Bettelschale aus Zinn, die vor ihm neben seinem Holzbein stand. Sein anderes Bein war ebenfalls weg, aber dort ließ er sein leeres Segeltuchhosenbein schlackern, um bei Passanten wirksamer Mitleid zu erregen, vermutete Cashel. Seine Krücken lehnten hinter ihm an der Hauswand aus Stuck. Er trug seinen schmutzstarrenden roten Uniformrock mit der einen noch verbliebenen fransenbesetzten Epaulette, die ganz zerfetzt war, und Cashel sah, dass er sich eine Art glänzenden Orden neu an die Brust geheftet hatte.
»Hallo, Schuljunge!«, rief er Cashel zu. »Hättest du einen Farthing für einen alten Soldaten übrig, hier in der Penny Farthing Street?«
»Ich habe keinen Farthing, Sir«, sagte Cashel, was nicht gelogen war. Einen Viertelpenny hatte er nicht, aber dafür drei Pennys, wohlverwahrt in seiner Jackentasche.
»Was hast du in dem Beutel da?«
»Mein Mittagessen, Sir.«
»Irgendwas zu trinken? Ich verschmachte hier vor Durst in der heißen Sonne. Nicht so heiß wie in Portugal wohlgemerkt, wo mir meine beiden guten Beine von den Franzmännern abgesprengt wurden.«
»Ich hab nur kalten Tee«, log Cashel und bereute sein Eingeständnis auf der Stelle.
»Ein Schluck Tee würde die Kehle schon ganz nett befeuchten, verbindlichsten Dank.«
Cashel seufzte und kramte in seinem Beutel nach der Flasche.
»Sehen Sie? Es ist nur schwacher Tee, Sir.« Er hielt die Flasche hoch, zum Beweis, dass er die Wahrheit sagte.
Der Soldat schnappte sie ihm aus der Hand, zog den Korken heraus und nahm einen großen Schluck.
»Das ist ja Apfelwein, du verfluchter Teufel!«
Er trank noch einige Schlucke mehr, ehe er Cashel die halb geleerte Flasche zurückgab, mit einem Grinsen, bei dem ein paar braune Zahnstummel zum Vorschein kamen.
»Wolltest mich wohl reinlegen, was?«
»Sie können alles austrinken.« Cashel reichte ihm die Flasche wieder. Er würde sich hüten, aus dieser Flasche zu trinken. Nicht, nachdem sie von diesen Lippen berührt worden war.
Der Soldat gluckerte den restlichen Apfelwein hinunter.
»Du bist ein guter Kerl«, sagte er. »Und sieh zu, dass du deine Schule vernünftig abschließt, Junge. Damit du nicht so endest wie ich, Gott schütze dich.«
Cashel steckte die leere Flasche in seinen Beutel und machte sich durch die Penny Farthing Street auf den Weg in Richtung Schule.
Dekan Archibald Smythes Scholarly Academy (für Knaben) war im Erdgeschoss eines etwas heruntergekommenen, pockennarbig abblätternden dreigeschossigen Stadthauses untergebracht. Das Wohnquartier des Dekans befand sich in den oberen Etagen. Auf der Hausrückseite, als eine Art Anbau, gab es einen weitläufigen Raum, fast wie eine Scheune, der als Schulzimmer diente. Er hatte eine hohe Decke mit einer Reihe schlichter Fenster direkt darunter, durch die das Tageslicht von oben herabfiel. Es war wohl eine Art Versammlungsraum oder Lagerhaus gewesen, vermutete Cashel, ehe die Räumlichkeit zu einer Schule umfunktioniert wurde.
Auf beiden Seiten des Raums standen zwei lange Refektoriumstische – lang genug, dass jeweils zwanzig Stühle daran Platz fanden. Und an der Wand über dem einen Tisch hing eine Tafel mit der Aufschrift »Gelehrte«, während auf der Tafel über dem anderen Tisch das Wort »Dummköpfe« stand. Dekan Smythes Erziehungsethos war freimütig: dies war die Kluft, die seine Schüler überwinden mussten. Dummköpfe mussten danach streben, zu Gelehrten zu werden. Gelehrte mussten sich bemühen, nicht auf das Niveau von Dummköpfen abzusinken. Beförderungen und Degradierungen waren an der Tagesordnung. Am Haupt beider Tische befand sich eine Art erhöhter Kanzel mit einem Stuhl und einem Katheder, an der die Pädagogen ihren Platz hatten: Dekan Smythe kümmerte sich um die Gelehrten, während sein Assistent, Marmaduke Seele, für die Dummköpfe zuständig war.
Cashel kam in den großen Raum und stellte fest, dass er an diesem Morgen der Erste war. Er setzte sich an seinen Platz am Gelehrtentisch – er hatte noch nie bei den Dummköpfen gesessen – und packte seine Federn und die Tinte aus. So wie die Academy ihre Schüler mittags nicht beköstigte, stellte sie ihnen auch keine Schreibmaterialien zur Verfügung.
»Morgen, Ross«, ließ sich eine dünne Stimme vernehmen. »Meine Güte, was bist du eifrig.«
Cashel reagierte nicht sofort. Auch noch nach zwei Jahren vergaß er ständig, dass sein Nachname jetzt Ross lautete und nicht mehr Greville.
Er wandte sich um und sah Marmaduke Seele, der mit einem Klassenbuch unter dem Arm durch den Raum kam und dann auf seine Kanzel stieg. Er trug einen speckigen Überzieher, und die weißen Strümpfe unter seinen Kniehosen waren grau und vielfach geflickt und gestopft. Seine Schuhe knarrten, als er die Stufen emporstieg und sich setzte.
»Oh. Ja. Morgen, Sir.«
Seele war dünn, in seinen Dreißigern, mit einem kümmerlichen, lückenhaften Schnauzbart. Dekan Smythe behandelte ihn mit unverhohlener Geringschätzung und Verachtung, was die größeren, kühneren Jungen als Ansporn auffassten, sich erbarmungslos über ihn lustig zu machen. Cashel dagegen mochte Seele eigentlich ganz gern. Da er selbst wegen seines irischen Akzents andauernd Zielscheibe des Spotts war – »Oirish« lautete deswegen sein Spitzname –, fühlte er sich Seele auf seltsame Art verbunden.
»Bald sind Sommerferien«, sagte Seele. »Freust du dich schon auf den Sommer, Ross?«
»Ja, Sir«, antwortete Cashel, ohne nachzudenken, doch er war sich nicht sicher, ob er sich dieser Tage auf überhaupt irgendetwas sonderlich freute – das Leben war so eigenartig.
Dekan Smythe kam geschäftig hereingeeilt, mit einem Blick auf seine Taschenuhr. Er war ein kleiner, fülliger Mann in den Fünfzigern, mit einem lächelnden, rosaroten, pausbackigen Gesicht. Er trug noch immer eine altmodische, kurze Perücke – die heute Morgen ein wenig schief saß. Hinter seiner pingeligen, wuseligen Art verbarg sich das brutale Temperament einer wütenden autoritären Persönlichkeit. In der Academy wurden Jungen mehrmals am Tag zur Strafe gezüchtigt, das war der normale Schulbetrieb.
Und jetzt, nach dem Dekan, kamen nacheinander die Schüler der Academy herein, verstohlen um sich blickend, allein oder zu zweit, flüsternd. Die meisten gingen zu ihren zugewiesenen Plätzen am Dummen-Tisch. An diesem Morgen saßen außer Cashel nur zwei weitere Mitschüler am Gelehrten-Tisch – der kleine Benjamin Smart (»Heißt nicht nur Smart, sondern ist auch ein smarter Kopf«, wie der Dekan regelmäßig anzumerken pflegte) und der stämmige Ned Masterson, der siebzehn war und sich bereits einen Bart wachsen ließ. In der Mittagspause rauchte er immer demonstrativ eine Pfeife, wie um seine Reife zu unterstreichen. Er sah dämlich aus, wenn er hustend daran herumpaffte, mit seinen feuchten Lippen und dem großen, runden, grobschlächtigen Gesicht, doch er war fast so schlau wie Cashel. Er wollte Priester werden und war daher ein Lieblingsschüler des Dekans.
Die drei Gelehrten erhielten ihre Aufgabe für den Vormittag – eine Seite von Ovid zu übersetzen, aus den Epistulae ex Ponto. Das Dutzend Dummköpfe nahm unterdessen mit Mr Seele die Neunerreihe durch.
Cashel starrte auf den Text, der vor ihm lag – Quod legis, o uates magnorum maxime regum, las er –, doch sein Verstand fühlte sich merkwürdig träge an. Er kannte den Grund dafür. Weil Elspeth ihm beim Frühstück eröffnet hatte, dass Mr Ross zu Besuch kommen würde, für eine ganze Woche.
Cashel war sich bewusst, dass er vor der Realität der »Oxford-Situation«, wie er es nannte, mutwillig die Augen verschloss. Er wusste ungefähr darüber Bescheid, was alles geschehen war, seit sie Stillwell Court verlassen hatten, doch es klafften Lücken in seinem Wissensstand, die ihn allerdings nicht weiter störten; aus irgendeinem Grund verspürte er nicht den Drang, diese Lücken zu füllen. Denn wie er inzwischen herausgefunden hatte, konnte man auch recht erträglich leben, ohne alles zu wissen.
Bei ihrer endgültigen Abreise weinte er, ganz ohne Scham. Auf ganz unlogische Weise war ihm zumute, als würde sein Leben enden – das Leben jedenfalls, wie er es kannte –, und nichts in der Zukunft, seiner Zukunft, erschien ihm auch nur ansatzweise verlockend. Elspeth nahm es geduldig hin, dass er den Tränen freien Lauf ließ, und es schien ihm, als hätte er den ganzen Weg bis nach Dublin geschluchzt, wo sie das Paketboot nach Bristol bestiegen. Auf den Docks in Bristol wurden sie bereits von einem Einspänner sowie einem Frachtkarren erwartet, um sie und ihre Kisten und Koffer nach Oxford zu bringen. Während dieser Reise – wegen matschiger Straßen brauchten sie für die Kutschfahrt einen ganzen Tag – setzte Elspeth ihm, ruhig und gebieterisch, die Umstände ihres neuen Lebens in England auseinander.
»Du musst tun, was ich dir sage, Cashel, mein Lieber. Ohne Wenn und Aber. Tu es für mich. Es ist nicht kompliziert, aber sehr wichtig. Wenn du mich enttäuschst, hat das für mich ernsthafte Folgen – und für dich. Man könnte mich ins Gefängnis sperren.«
Es war eine Aussicht, die ihm kalte Angstschauer über den Rücken jagte – eine wirksamere Drohung, mochte sie auch noch so vage sein, war nicht vorstellbar. Was mochte sie Schlimmes verbrochen haben, dass ihr dafür Gefängnis drohte? Er versprach ihr mit Freuden, bei seiner Seele, alles zu tun, was sie von ihm verlangte. Er hörte ihr aufmerksam zu.
Als Erstes werde er sich daran gewöhnen müssen, erklärte sie ihm, dass sie künftig andere Namen tragen würden. Aus Elspeth Soutar werde Mrs Pelham Ross. Er könne Greville gern als zweiten Namen behalten, sofern er das wünsche, für Oxford und die übrige Welt jedoch werde er fortan Cashel Ross heißen. Ferner werde er künftig nicht mehr ihr Neffe sein, sondern ihr Sohn. Mit »Tante« sei also jetzt Schluss, von nun an solle er »Mama« zu ihr sagen. Verstanden? Probier’s mal.
»Ja … Mama. Aber warum machen wir das alles?«
»Damit wir auf eine neue Weise leben können, mit neuen Freiheiten und neuen Bequemlichkeiten. Ich werde nie wieder Gouvernante sein müssen. Ich muss nicht mehr arbeiten. Wir werden ein schönes Zuhause haben. Wir werden genug Geld für alles haben.«
»Ach so.«
Sie küsste ihn auf die Wange.
»Und da ist noch etwas, das du wissen solltest.«
»Ja? Was denn?«
»Ich bin schwanger. Du weißt, was das bedeutet, ›schwanger‹?«
»Ja.« Dann setzte er noch hinzu: »Mama.«
»Braver Junge. In einigen Monaten wirst du ein neues Brüderchen oder Schwesterchen haben. Das würde dir doch gefallen, oder?«
»Ja. Das wäre nett«, sagte er pflichtschuldig, ohne die Information ganz erfasst zu haben. Was war das Gegenteil von »nett«? Es war alles zu viel auf einmal.
Elspeth nahm seine Hand und drückte sie.
»Also verstehst du nun, warum wir für uns ein neues Leben beginnen mussten – für unsere neue kleine Familie.«
»Ja, das tue ich. Das kann ich verstehen …«
»Kannst du dir das alles merken? Kannst du das für mich tun? Niemand darf je von unserem alten Leben erfahren, in Irland, auf Stillwell Court.«
»Natürlich. Das kriege ich hin.«
Sie schloss ihn fest in die Arme.
»Es kommt dir jetzt alles sehr merkwürdig vor, ich weiß«, sagte sie leise. »Aber du wirst dich bald daran gewöhnt haben – und es ist besser so, mein liebster Schatz. Du und ich, wir werden sehr glücklich sein. Sehr glücklich.«
Das Haus, das sie eine Meile außerhalb von Oxford bezogen, an der Botley Road, hieß The Glebe. Es war ein stattliches, viereckiges Haus mit weißer Stuckfassade – noch recht neu, erst vor etwa zwanzig Jahren erbaut –, ein Stück von der Straße versetzt, mit einer Auffahrt hinter einem Tor. Es gab einen Zierbrunnen, um den herum die Kiesauffahrt in elegantem Schwung links und rechts aufs Haus zu führte, und eine kleine Wagenauffahrt. Hinterm Haus erstreckte sich ein ausgedehnter Rasen, dessen Gras von Schafen kurz gehalten wurde, mit einem Walnussbaum und einem großen, drehbaren Sommerhaus. Mit ein wenig Mühe konnte der Holzbau in jede Richtung gedreht werden, aus der gerade die Sonne schien, je nach Jahreszeit.
Seitlich befanden sich, von einer Mauer umgeben, ein Obst- und Gemüsegarten, eine Obstplantage und eine Scheune, in der ihre Kalesche stand, mit Holzboxen für das Pony, das als Zugpferd diente. Sie hatten einen ältlichen Diener namens Doncaster, ein junges Hausmädchen (Daisy), eine Köchin (Mrs Pillard) sowie einen Stalljungen und Gärtner namens Albert, der draußen im Dörfchen Botley lebte, dessen ungeachtet aber immer präsent zu sein schien, von früh bis spät.
Die Dienstboten waren oben unterm Dach untergebracht. Cashel hatte sein eigenes Zimmer in der Etage darunter, und unter ihm, im ersten Stock, hatte Elspeth ihre Zimmerflucht. Das Haus war gut und mit Geschmack eingerichtet. Es gab ein Wohnzimmer, einen Salon, ein Speisezimmer sowie ein Musikzimmer mit einem rechteckigen Broadwood-Klavier. Die Küche, Spülküche, Speisekammer und Waschküche befanden sich in einem Flügel von Nebengebäuden, der an die östliche Ecke des Haupthauses angebaut war.
Cashel brauchte fast drei Tage dafür, die neue Geographie ihres Lebens zu erkunden und gedanklich zu erfassen – um zu ergründen, welches Potenzial ihm das Glebe bieten könnte. Nach dem kleinen Cottage in der Glanmire Lane war es beinahe, als wären sie in einen Palast gezogen. Wie oder warum, war ihm ein Rätsel, aber irgendwo im Hinterkopf gelangte er nach und nach zu der Erkenntnis, dass Tante Elspeth – »Mama« – offensichtlich plötzlich zu Reichtum gelangt war.
Mr Pelham Ross selbst traf etwa drei Wochen nach ihrem Einzug ein. Bis dahin hatten sich die täglichen Abläufe eingependelt, und die Dienerschaft schien ihre Pflichten gut zu erfassen und auszuführen. Cashel war in Dekan Smythes Academy angemeldet worden (zehn Guineen für ein Halbjahr), und er und Elspeth hatten in der Kalesche, sachkundig kutschiert von dem jungen Albert, Oxford und Umgebung erkundet.
Elspeth gab Cashel einen Tag vorher Bescheid.
»Wenn du ihn anredest, sagst du ›Vater‹ zu ihm«, sagte sie.
»Aber er ist nicht mein Vater. Findlay Greville war mein Vater.«
Sie schüttelte ihn unsanft an den Schultern, wie um ihm so Vernunft beizubringen.
»Denk an dein Versprechen, Cashel! Du hast es mir bei deiner Seele geschworen. Du darfst mich nicht enttäuschen.«
Er begann zu schniefen, und sie umarmte ihn.
»Vielleicht kann das helfen. Stell es dir als Spiel vor, das wir spielen«, sagte sie, schon sanfter. »Du und ich gegen den Rest der Welt, wir beschwindeln sie alle. Na, wäre das nicht herrlich? Komm, spielen wir unser Spiel zusammen. Lass uns so tun, als ob.«
Das war zumindest ein Plan, den er begreifen konnte. Lass uns so tun, als ob. Das würde er hinbekommen.
Pelham Ross stellte sich als schlanker, groß gewachsener Mann heraus, glatt rasiert, mit grau meliertem Haar und einer beginnenden Halbglatze, wie Cashel feststellte, als der Mann seinen Zylinder abnahm. Er trug teure, gut geschnittene Kleidung – einen Zweireiher aus Nanking-Kattun und sich verjüngende Beinkleider. Der hohe Stehkragen seines Hemdes reichte ihm bis an die Mundwinkel. Seine schwarze Halsbinde war aus Seide. Elspeth brachte Cashel ins Wohnzimmer, damit er ihn kennenlernte, und sie schüttelten sich die Hände.
»Guten Tag, Cashel.« Er hatte eine tiefe ernste Stimme.
»Guten Tag, Sir … Vater.«
Na also, dachte Cashel, ich habe es gesagt. Der Mann verzog keine Miene. Sah ihn reglos an. Dann setzte er ein kleines Lächeln auf.
»Wie gefällt dir dein neues Zuhause?«
»Es ist sehr schön, Sir.«
»Und deine Schule? Schlägst du dich gut dort?«
»Ich bin ein Gelehrter, Sir. Es ist nicht allzu schwer.«
Darüber lachte Ross leise und warf Elspeth einen Blick zu, deren Anspannung sichtlich nachließ.
»Kluger Junge«, sagte Ross. »Hoffentlich sehe ich dich künftig häufiger, aber ich muss regelmäßig verreisen, nach Südafrika. Ich habe Geschäfte dort.«
Cashel fragte sich, ob Südafrika die Erklärung für ihren neuen Wohlstand lieferte.
»Das klingt aufregend«, sagte er. »Eines Tages würde ich auch gern mal nach Afrika.«
»Ja, es ist aufregend – und langweilig. Dauert so lange, bis man dort ist. Ihr werdet mir fehlen, ihr beiden. Aber ich komme ja wieder.«
Elspeth schenkte ihnen beiden ein Glas Madeira ein, und Cashel fiel auf, dass Ross überaus gepflegte Hände hatte, mit kurzen, glänzenden Fingernägeln, als er die Spitze einer dünnen Zigarre abschnitt, ehe er sie sorgsam mit einem Fidibus entzündete, Rauchwolken ausstieß, auf die Glut pustete und das obere Ende mit einer Art Nadel durchbohrte, als würde er irgendein kleines Technikexperiment durchführen. Er hatte eine ruhige, würdevolle Ausstrahlung, und Cashel merkte, wie seine Ängste und Vorbehalte sich nach und nach legten. Pelham Ross schien keine Bedrohung darzustellen. Vielleicht würde ja doch alles gut. Er konnte sehen – jetzt, wo der Mann hier war –, wie glücklich Elspeth in ihrer neuen Inkarnation als seine Ehefrau war.
In diesem Augenblick kam Daisy herein, das Hausmädchen, adrett in einem neuen blauen Kleid mit einer Spitzenschürze. Sie trug ein Tablett mit Vol-au-Vents und Konfekt, das sie auf einem lackierten Beistelltisch absetzte.
»Du kannst jetzt hoch auf dein Zimmer gehen, Cashel. Wir erwarten einige Nachbarn – wir möchten uns vorstellen.« Elspeth legte ihm die Hände auf die Schultern und lotste ihn zur Tür.
»Ja, mach dich besser auf die Socken, Cashel«, sagte Ross. »Das wird öde, garantiert.«
»Auf Wiedersehen, Sir.«
»Und ich bringe dir ein Geschenk mit, aus Afrika«, sagte Ross unbestimmt, während er seine Zigarre neu entzündete.
Elspeth neigte sich an sein Ohr und flüsterte ihm etwas zu, als er aus dem Zimmer ging.
»Gut gemacht, Schatz. Kluger Junge.«
In jener Nacht lag Cashel im Bett und konnte nicht schlafen. Etwas ließ ihm keine Ruhe, irgendeine ferne Erinnerung, die ihm halb wieder zu Bewusstsein gekommen war, und auch der Versuch, mit diesem »Spiel« zurande zu kommen, das sie alle spielten: Elspeth, die so tat, als wäre sie verheiratet; Cashel, der so tat, als wäre er ihr Sohn; Mr Ross, der so tat, als wäre er ihr Mann, und Cashel, der so tat, als wäre Mr Ross sein Vater. Da hörte er Ross’ tiefe Stimme etwas murmeln, draußen auf der Treppe. Cashel schlüpfte aus dem Bett und schlich sich leise auf den Treppenabsatz, wo er durchs Geländer nach unten lugte und Elspeth und Ross erblickte, erhellt von der Kerze in Elspeths Hand, die die geschwungene Treppe heraufkamen, unterwegs in den ersten Stock waren. Ehe sie in Elspeths Schlafzimmer verschwanden, sah er noch, wie Ross mit der Hand ihren Rücken hinauffuhr und die von Locken verschattete Mulde an ihrem Nacken drückte.
Ross blieb zwei Tage und brach dann zu seinem Abenteuer in Afrika auf. Cashel fragte, was er in Südafrika genau mache, und Elspeth gab unbefriedigende Auskünfte, sagte nur, dass er dort viele Geschäftsinteressen habe, Handel, Bergbau, Bankgeschäfte. Tatsächlich war er monatelang fort, während Elspeths Schwangerschaft voranschritt und Cashels Neugier nachließ. Sie bekam einen dicken Bauch und litt unter solcher Erschöpfung, dass sie fast den ganzen Tag im Bett lag. Hin und wieder kam ein Arzt zu Besuch – ein junger Mann mit buschigem Backenbart und einer kleinen, randlosen Brille namens Dr. Jolly. Er war es, der ihr eines Tages eröffnete, dass sie Zwillinge erwartete. Ein trompetenähnliches Hörinstrument, mit dem er an ihrem Bauch horchte, hatte den Befund erbracht, dass darin zwei Herzen pochten.
Im Februar 1809 kamen die Zwillinge zur Welt. Zwei Jungen, die auf die Namen Hogan und Buckley getauft wurden. Cashel hatte nun zwei »Brüder«, was er recht erfreulich fand, obwohl er zehn Jahre älter war als sie. Ein schon älteres Kindermädchen, Miss Creevy, wurde engagiert, um sich um die Kleinen zu kümmern. Sie war in dem Raum gleich neben dem Kinderzimmer untergebracht, schien aber den Zwillingen nur flüchtige Aufmerksamkeit zu schenken. Von seinem Bett aus konnte Cashel in den meisten Nächten das endlose Wimmern eines der Babys hören – von Buckley anscheinend, der kleiner und kränklicher war als sein Bruder.
Pelham Ross kehrte schließlich heim, um seine neuen Söhne kennenzulernen, und Elspeth kam wieder zu Kräften, gewann ihren gewohnten Schwung und Elan zurück. Cashel schieße ja nur so in die Höhe, bemerkte Ross, er sei groß für einen Jungen seines Alters. In der Schule dominierte er weiterhin den Gelehrtentisch, wobei Masterson allerdings abging, um an die Universität zu wechseln. Dies nahm der Dekan zum Anlass, zu jedermanns Verblüffung ein langes Ferienwochenende zu verkünden, zur Feier von Ned Mastersons Erfolg und der Ehre, die er der Academy damit einbrachte.
Alles ist normal, wiederholte Cashel im Stillen, während er in Richtung Botley heimwärts stapfte, um den freien Tag zu genießen. Alles scheint jedenfalls »normal«, berichtigte er sich, doch tief im Inneren wusste er, dass das in Wahrheit nicht der Fall war. Ganz und gar nicht.
Cashel war dreizehn, als er seinen ersten nächtlichen Erguss erlebte. Er wusste, was geschehen war, und es bekümmerte ihn nicht weiter. Schon seit über einem Jahr hatte er vergebens an sich herumgewichst, und es freute ihn, dass dabei von nun an mit sichtbaren Ergebnissen zu rechnen war, zusammen mit dem Vergnügen.
Die Mittagspausen in der Academy verbrachten die Jungen immer nebeneinander auf einer niedrigen Mauer, die einen Hofbereich draußen vorm Schulzimmer umgrenzte. Ihr Gespräch kreiste fast immer um »Schweinkram«, insbesondere um Selbstbefriedigung und die Techniken dabei – zerren, ziehen, peitschen, wichsen, Feuer holen, reiben und zupfen, das waren ihre bevorzugten Tarnwörter.
Doch ausreichenden Schutz boten sie nicht. Einmal bekam der Dekan mit, wie zwei der Jungen – Rhodes und Bramerton – sich über »Schweinkram« unterhielten. Er versohlte sie nicht nur dafür, sondern schickte sie für eine Woche nach Hause, um ihren Eltern ihre Verfehlung zu beichten. Alsdann hielt er vor der versammelten Schülerschaft – in jenem Jahr waren es insgesamt zweiundzwanzig Jungen – einen Vortrag über die Sünde des Onan.
Dekan Smythe stand auf seiner Kanzel und beschimpfte die Jungen, die nervös vor ihm aufgereiht standen. Er sprach von den furchtbaren Gefahren der »Selbstbefleckung«, diesem »trübsinnigen und abstoßenden, einsamen Akt«. Er warnte sie, dass sie damit ihre Gesundheit zerstörten, dass sie davon erblinden könnten, unfähig würden, eigene Kinder zu zeugen, und schließlich in Schwachsinn verfallen würden, bis sie eines qualvollen, schändlichen Todes stürben. Er las aus der großen Bibel vor, die vor ihm auf dem Pult lag.
»Erstes Buch Mose, Kapitel achtunddreißig, Vers neun: ›Aber da Onan wusste‹ – da haben wir den Namen des Verworfenen, Onan – ›dass die Kinder nicht sein eigen sein sollten, ließ er’s‹ – gemeint ist sein Samen – ›auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau … Dem Herrn missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben.‹« Hier legte Dekan Smythe eine dramatische Pause ein, in der er seinen Blick über seine eingeschüchterten Zöglinge wandern ließ. »Er ließ seinen Samen auf die Erde fallen – er beging die Sünde des Onan –, und Gott der Herr ließ ihn sterben. Wie viel deutlicher soll es noch sein? Wenn ihr diese Sünde begeht, werdet ihr STERBEN!«
Der von der Predigt ausgelöste Schock und der Schrecken klangen bemerkenswert rasch wieder ab und führten stattdessen zu einer untypischen Bibelexegese, da die Gelehrten und die Dummköpfe, ausnahmsweise vereint, ihre Bibeln aufschlugen und mit forensischer Aufmerksamkeit das Kapitel achtunddreißig des ersten Buchs Mose studierten. Was Unverständnis zur Folge hatte, Missverständnis und Disput. Nirgendwo in den Schlüsselversen, das stellten sie einmütig fest, war irgendwie von Wichsen die Reden. Benjamin Smart wies darauf hin, dass die Unterlassungsanordnung eher allgemeiner Art war – Samen auf die Erde fallen zu lassen war schlecht, Unzucht an sich aber war erlaubt. Cashel war sich da nicht sicher, doch verstört war er allemal – als hätten die düsteren Warnungen des Dekans ihm ganz allein gegolten –, und eine Woche lang gelang es ihm, rein zu bleiben, bis er wieder mit dem Masturbieren anfing.
Hogan und Buckley waren keine eineiigen Zwillinge. Mit zwei Jahren sah Hogan bereits erheblich größer und kräftiger aus. Buckley war eine schmächtigere, schwächere Ausgabe seines Bruders. Sie waren beide dunkelhaarig, mit braunen Augen, doch während Hogans Energiereserven schier unerschöpflich waren, saß Buckley oft still allein für sich da, eine Stunde oder noch länger, auch ohne Spielzeug, ganz glücklich und zufrieden in seiner Reglosigkeit. Cashel fragte sich, ob er womöglich etwas einfältig war. Ihn vergötterten sie beide, ihren großen Bruder, und dackelten beharrlich hinter ihm her wie zwei Hündchen. Cashel fiel auch auf, wie sehr Pelham Ross seine Zwillingsjungen liebte. In ihrer Gegenwart fiel seine kultivierte, wachsame Zurückhaltung komplett von ihm ab, und er hob sie mit Vorliebe hoch, um sie über sich in die Luft zu werfen, dass sie nur so kreischten, und dann wieder aufzufangen, oder drehte sie auf den Rücken und kitzelte sie am Bauch durch, bis Hysterie einsetzte, oder ließ sie geduldig auf seinem Rücken reiten, während er auf allen vieren durchs Kinderzimmer kroch. Bei den Zwillingen war er wie ausgewechselt.
Seit ihrer Geburt war er weit häufiger zu Hause. Er kam mindestens einmal im Monat zu Besuch, und wenn er auch selten länger als ein paar Tage blieb, war er als Vater dennoch regelmäßig präsent. Auch Cashel schenkte er seine Aufmerksamkeit, Rumtoben aber gab es nicht bei ihnen, über ein Händeschütteln ging ihr Körperkontakt nicht hinaus. Er war höflich, er schien Anteil daran zu nehmen, dass es Cashel gut ging, aber sie unternahmen nichts gemeinsam. Cashel fiel es nicht schwer, die Anrede »Vater« bei ihm zu vermeiden, obwohl Elspeth ihn weiter zu deren Gebrauch ermunterte. Wann immer Pelham Ross sich bei ihnen im Glebe aufhielt, kam Cashel unweigerlich ihr »Spiel« in den Sinn, die Geheimnisse, die sie hüteten, und der Schein, den sie aufrechterhalten mussten, und das löste Unbehagen in ihm aus. War Ross hingegen nicht da, vergaß er das alles fast völlig.
Cashel kam in den Stimmbruch, an seinem Kinn und rings um den Mund erschienen Pusteln, und über seinem Schwanz befand sich auf einmal ein kleines Gestrüpp Schamhaare, fast so, als wäre es über Nacht gesprossen. Eines Tages merkte er, dass er sogar die große Elspeth überragte. Marmaduke Seele nahm ihn beiseite, um nach seinen Studienplänen zu fragen, und spekulierte darüber, welches der Oxford-Colleges am besten zu seinen Begabungen passen würde. Seele selbst hatte kurzzeitig am Balliol studiert (ehe er wegen Schulden relegiert wurde) und war der Ansicht, dieses College könne für Cashel ideal sein. Cashel fing erstmals an, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, darüber, was sie für ihn bereithalten mochte, was er werden sollte. Es war 1814, sagte er sich, Boney war in der Verbannung5, es herrschte endlich Frieden nach endlosem Krieg, alle Welt feierte, und es lagen auf jeden Fall interessante Veränderungen in der Luft.
Die Zwillinge waren inzwischen fünf, zwei übermütige, laute Blagen. Miss Creevy hatte längst den Dienst quittiert, zermürbt von ihren Schützlingen – selbst Buckley schien mittlerweile lebhafter –, und die einzige Möglichkeit für Cashel, ihrer ständigen Anhänglichkeit und dem häuslichen Affenspektakel zu entkommen, bestand darin, sich still und leise in das Sommerhaus am Ende des hinteren Rasens zu verdrücken. Er nahm es für sich in Besitz, richtete sich mit einem alten Teppich, einem Schreibpult, einem Stuhl und einem Bücherregal häuslich ein und improvisierte sich eine Art Diwan mit einem Kaschmirschal als Überwurf und ein paar Kissen, auf dem er sich ausstrecken und ungestört lesen konnte. Es wurde sein ureigenes Refugium.
Allerdings achtete er stets darauf, dass niemand etwas von seinem Rückzug dorthin mitbekam. Seine List bestand darin, das Haus ganz normal zu verlassen, als wolle er bloß in die Stadt, dann unbeobachtet zu den Pferdeställen abzubiegen, um ein Wort mit Albert zu wechseln, falls er dort war, und dann konnte er um die Gartenmauer herumgehen und ungesehen in das Sommerhaus huschen. Hogan und Buckley suchten ihn vergebens.
An einem Sommernachmittag begegnete er auf seinem Geheimweg zum Sommerhaus zufällig Daisy, dem Hausmädchen, die gerade mit einem schweren Korb voller Pflaumen und Reineclauden in der Hand aus dem Garten kam.
»Oh, Daisy, du bist es, hallo.«