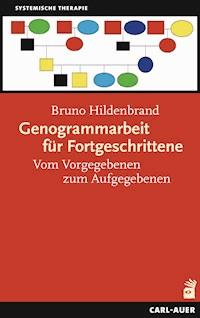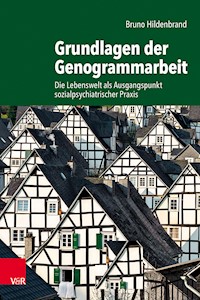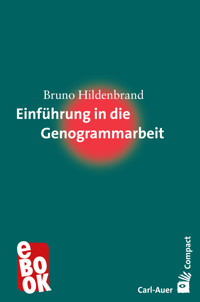
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Carl-Auer Compact
- Sprache: Deutsch
"Eine Einführung, die es in sich hat, weil sie ein theoretisch stringentes Konzept entwickelt, das die Genogrammarbeit als systematische Methodologie einerseits und als 'Kunst' der Hypothesenentwicklung andererseits herausarbeitet." Tom Levold Bruno Hildenbrand demonstriert in diesem Buch den Einsatz von Genogrammen zur Erfassung und Darstellung von Fakten, kritischen Ereignissen und Entscheidungsprozessen, die das Leben von Individuen, Paaren und Familien prägen. Der Autor zeigt, wie sich anhand von Genogrammen konkrete Entscheidungen in der Familiengeschichte rekonstruieren und analysieren lassen. Der Vergleich der getroffenen mit den denkbaren Entscheidungen macht Muster sichtbar, an denen im Beratungs- oder Therapieprozess mit dem Ziel von Veränderung gearbeitet werden kann. Das Buch vermittelt handwerkliches und theoretisches Basiswissen für die Arbeit mit Genogrammen in Beratung, Therapie, Supervision und Selbsterfahrung. Der Autor: Bruno Hildenbrand, Prof. i. R. Dr.; war bis zum Eintritt in den Ruhestand 2015 Professor für Sozialisationstheorie und Mikrosoziologie am Institut für Soziologie der Friedrich Schiller Universität Jena und bearbeitet jetzt als Gastwissenschaftler an der Universität Kassel ein Projekt über die Bewältigung von Krisen im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen in sozialen Diensten. Bis 2015 war er Dozent und Supervisor am Ausbildungsinstitut für systemische Therapie und Beratung Meilen in Zürich. Er lebt in Marburg. Veröffentlichungen u. a.: Einführung in die Genogrammarbeit (6. Aufl. 2024), Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie (zus. mit Dorett Funcke, 2009); gemeinsam mit Rosmarie Welter-Enderlin u. a. Herausgeber von Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände (5. Aufl. 2016), Gefühle und Systeme. Die emotionale Rahmung beraterischer und therapeutischer Prozesse (2. Aufl. 2011), Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie (3. Aufl. 2011); mit Ulrike Borst Herausgeber von Zeit essen Seele auf. Der Faktor Zeit in Therapie und Beratung (2012), Genogrammarbeit für Fortgeschrittene (2018).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Hildenbrand
Einführung in die Genogrammarbeit
Sechste Auflage, 2024
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Schefer (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Redaktion: Uli Wetz
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Sechste Auflage, 2024
ISBN 978-3-89670-539-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8226-9 (ePub)
© 2005, 2024 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Einleitung
Genogrammarbeit als unentbehrliche und zeitsparende Tätigkeit
Was ist das Besondere an dem hier vorgestellten Konzept der Genogrammarbeit?
Zum Gebrauch dieses Buches
1. Theoretische Grundlagen der Genogrammarbeit als Sequenzanalyse
Genogrammarbeit: Die Frage der Definition
Lebenspraxis als Prozess der Krisenbewältigung
Die Sequenzanalyse als Methode der Rekonstruktion von Krisen und ihrer Bewältigung
Genogrammarbeit in sequenzanalytischer Perspektive: Die „objektiven“ Daten
„Objektive“ Daten und „soziale Konstruktion von Wirklichkeit“
2. Genogrammarbeit als Kunstlehre: Ein Fallbeispiel
Der soziale Rahmen des Fallbeispiels
Das Fallbeispiel
Vom Nutzen der Genogrammarbeit im Fall von Dieter Kontorra
Zur Vorgehensweise bei der Genogrammarbeit als Sequenzanalyse: Eine Rückschau auf die Arbeit mit dem Genogramm der Familie Kontorra
3. Die Praxis der Genogrammarbeit I: Ein Glossar zum methodischen Vorgehen und zu den thematischen Schwerpunkten
4. Die Praxis der Genogrammarbeit II: Kontexte der Genogrammarbeit
Genogrammarbeit in Therapie und Beratung
Genogrammarbeit in der Supervision
Genogrammarbeit in der Selbsterfahrung
Grenzen der Genogrammarbeit
5. Technische Hilfsmittel bei der Genogrammarbeit
Wissen
Technik
Symbole zur Darstellung von Genogrammen
Literatur
Sachregister
Personenregister
Über den Autor
Einleitung
Genogrammarbeit als unentbehrliche und zeitsparende Tätigkeit
An einem späten Samstagnachmittag des Frühsommers 2004 fuhr ich von einem Seminar mit praktischen Ärztinnen und Ärzten einigermaßen missgelaunt nach Hause. Thema dieses Seminars war das Entdecken salutogener (die Heilung fördernder) Potenziale bei der Behandlung akuter und chronischer Krankheiten gewesen. Anhand einer Genogrammanalyse hatten wir am Vormittag die Handlungsspielräume einer ca. 35-jährigen Frau rekonstruiert, die an Typ-2-Diabetes sowie an Übergewicht leidet. Ergebnis war gewesen, dass in dem frauenzentrierten ländlichen Verwandtschaftsmilieu, in dem sie lebt und das als Grundlage eine Migrationsgeschichte hat (der Vater war aus dem Elsass in die nördliche Region Deutschlands gekommen), die Verringerung des Risikofaktors Übergewicht auf harte Widerstände stößt. Wenn ich abnehme, so hatte die Patientin erklärt, erkennen mich meine Leute nicht mehr. Das hatte sie wörtlich gemeint. Auf dieser Grundlage hatten wir dann in dem Seminar Handlungsvorschläge mit der fallvorstellenden Ärztin entwickelt, bei denen es im Wesentlichen um folgende Punkte ging: den Ehemann in die Behandlung einzubeziehen, am Beispiel des Essverhaltens Möglichkeitsräume der Individuierung des Paares und der Autonomieerweiterung der Patientin zu erkunden, um sie so mit ihrer Eigenverantwortung zu konfrontieren.
In der abschließenden Gesprächsrunde war von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tag so bewertet worden, dass die Biografiearbeit zu viel Zeit eingenommen habe und die praktischen Konsequenzen für das ärztliche Handeln zu kurz gekommen seien. Hier lag die Quelle meiner Missstimmung: Zwar hatte die Gruppe den Tag über aus den Erkenntnisquellen geschöpft, die die Genogrammarbeit ihr eröffnet hatte. Die Zeit, die dafür aufzuwenden war – anderthalb von sechs Stunden –, war ihr aber als zu viel erschienen.
Unterwegs hielt ich in einem alten, etwas verschlafenen ehemaligen Residenzstädtchen an, um in dieser Umgebung den Kopf frei zu bekommen. Im Gasthaus fiel alter Gewohnheit gemäß mein Blick in die ausliegende Tageszeitung, und er blieb an einem Foto mit der Bildunterschrift hängen: „Der Landrat überreicht Ludger Eigenbrod die Sportverdienstmedaille“. „Den kenne ich doch“, fuhr es mir durch den Kopf, und rasch war die Erinnerung wieder da: Vor etwa 20 Jahren war uns (ich leitete damals als Mitarbeiter der Psychiatrischen Klinik der Philipps-Universität Marburg eine gemeindepsychiatrische Einrichtung für psychisch Kranke im ländlichen Raum) der damals etwa 25-jährige Ludger Eigenbrod mit einem „postremissiven Erschöpfungssyndrom“ von seinem Psychiater zugewiesen worden. Ludger stand bei Eintritt der psychotischen Krise kurz vor der Verbeamtung bei einer Bundesbehörde und arbeitete etwa 200 km vom Heimatort entfernt, als er massive psychotische Symptome zeigte und in diesem Zusammenhang einen Verkehrsunfall erlitt. Wir haben seinerzeit mit ihm wie auch mit seinen Eltern die Fragen aufgeworfen: „Warum tritt diese Krankheit gerade in dieser biografischen Phase auf?“ und „Wozu wird diese Krankheit einmal gut gewesen sein?“. Diese Fragen haben wir zunächst anhand des Genogramms der Familie zu beantworten versucht. Mithilfe dieses Genogramms erschlossen wir eine Familie, in welcher der ständige Kampf darum tobte, wer die Macht haben soll und wer wem gegenüber loyal zu sein hat. Die Geschichte ist die eines Bauernpaares mit zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Der Sohn wird Gymnasiallehrer, zieht weit weg und fällt für die Hofnachfolge aus. Die Eltern halten aber an einer Kontinuität des Hofes fest, daher ist der Auftrag an die verbliebene Tochter, „einen Bauern zu bringen“. Das tut sie aber nicht. Ihre Wahl fällt auf einen Bäcker, der aus der Sicht seiner Schwiegereltern einige entscheidende Mängel hat: Erstens ist er kein Bauer, zweitens stammt er nicht aus einer Selbstständigen-, sondern aus einer Arbeiterfamilie, und drittens kommt er nicht aus der Gegend, sondern aus einer Region mit einer völlig anderen Mentalität. Damit fehlen ihm wesentliche Grundqualifikationen für die Übernahme des Hofes. Das Paar zieht in das Elternhaus der Braut, und in der Folge entbrennt der erwähnte Kampf um Macht und Loyalität. Er entzündet sich am Beruf des Eingeheirateten. Herr Eigenbrod richtet auf dem Hof eine Backstube ein, in welcher – eher ungebeten – auch die Schwiegereltern mitwirken, und seine Frau steht zwischen ihm und ihren Eltern und kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Der älteste Sohn lernt zunächst Kraftfahrzeugmechaniker, wechselt dann aber in eine Großbäckerei und hilft dem Vater in der Backstube. Die Tochter heiratet einen Griechen und zieht nach Kreta, kommt nach einem Jahr mit einem Kind zurück – und hilft dem Vater in der Backstube. Ludger, das jüngste Kind der Familie, geht in die damalige Bundeshauptstadt und macht eine Verwaltungsausbildung, und als dieser Schritt des Ausstiegs aus der Familie mit der Verbeamtung besiegelt werden soll, tritt deren Abbruch in Gestalt einer psychotischen Episode ein. Dass die Eltern angesichts der erforderlichen beruflichen Neuorientierung Ludgers planen, dem Sohn nun eine Bäckerlehre (beim Vater, versteht sich) angedeihen zu lassen, bedarf kaum noch der Erwähnung. Das Muster, das unserer Hypothese nach die Familie leitet, lautet: die totale Bäckersfamilie.
Dieses Muster war der Ausgangspunkt unserer Arbeit in besagtem Seminar, bei der es um die Entwicklung biografischer Alternativen ging. Diese Arbeit war vor allem in der Phase, in der das „postremissive Erschöpfungssyndrom“ andauerte, für alle Beteiligten teilweise sehr quälend. Wir konzentrierten uns auf die Bereiche Beruf und Wohnen (die Eltern planten nicht nur die Bäckerlehre, sondern auch, im Haus einer Tante das Dachgeschoss auszubauen, um für Ludger Wohnraum zu schaffen). Mit unseren Vorstellungen hinsichtlich anderer beruflicher Optionen fanden wir Gehör, hinsichtlich des Wohnens nicht.
Heute (2004) ist Ludger (wie das Foto und der Bericht in der Zeitung belegen) trotz seiner lebensgeschichtlichen Problematik ein angesehener Mann in der Gemeinde. Er lebt immer noch im Haus der Tante, der Sport ist sein zentraler Lebensinhalt, mit einer Freundin hat er eine krisenbelastete, aber konstante Beziehung, und im Bereich der Arbeit hat er eine Nische gefunden.
Unsere Vermutung geht dahin, dass chronische Verläufe von Erkrankungen in dem Maße einen günstigeren oder zumindest weniger katastrophalen Verlauf nehmen können, in dem frühzeitig gefragt wird: „In welchem familien- und individualgeschichtlichen Rahmen hat diese Krankheit welchen Sinn? Wozu wird, auf dieser Grundlage, diese Krankheit einmal gut gewesen sein?“ Dass das Entdecken (familien)biografischer Muster am Beginn einer therapeutischen Arbeit steht und nicht die Gesamtheit dieser Arbeit ausmacht, soll bereits hier betont werden. Wir werden darauf zurückkommen.
Hier kann bereits ein erstes Fazit zum Thema Zeit, die man in die Genogrammarbeit investiert, gezogen werden: Die Klage darüber, dass diese Arbeit Zeit benötigt, gleicht der Klage von Leuten, die ihr Haus auf einem soliden und entsprechend teuren Fundament gründen, dann aber über die Kosten dieses Fundaments jammern.
Was ist das Besondere an dem hier vorgestellten Konzept der Genogrammarbeit?
Genogrammarbeit ist in der systemischen Therapie sowie in der Familientherapie weit verbreitet. Wir schließen mit unserem Konzept an die entsprechenden Traditionen an. In drei Punkten jedoch zeigt sich die Spezifik unseres Ansatzes:
Wir betrachten die Kernfamilie, also die aus Eltern und Kindern bestehende Gruppe, als „Gruppe eigener Art“. Entsprechend behandeln wir die Beziehungsdreiecke, die zwischen diesen Personen entstehen, als zentrale Beziehungsdreiecke, die gegenüber anderen möglichen Dreiecken herausgehoben sind.
Als zentrale Strukturmerkmale der Familie (gleichgültig, ob es sich um verheiratete Paare mit Kindern oder um nichteheliche Lebensgemeinschaften handelt) sehen wir die folgenden an, beginnend mit der Ebene des Paares: (1) Die Personen betrachten sich wechselseitig als nicht austauschbar. (2) Das Paar eint eine uneingeschränkte emotionale Bindung, die den Bereich der Erotik einschließt. (3) Die Beziehung ist zeitlich nicht beschränkt, sondern wird zeitlich unbegrenzt eingegangen.
Nun zur Eltern-Kind-Beziehung: (1) Auch hier sind die Personen nicht austauschbar. (2) Es gilt auch hier die uneingeschränkte emotionale Beziehung, jedoch ist die Erotik ausgeschlossen, es gilt das Inzesttabu. (3) Auch hier ist die Beziehung zeitlich nicht beschränkt. Zwar ist die Familie eine sich selbst auflösende Gruppe, indem von den Kindern erwartet wird, dass sie sich von den Eltern ablösen. Jedoch bleiben nach der Ablösung – etwa, wenn es um soziale Unterstützung geht – Eltern Eltern und Kinder Kinder.
Demnach bestehen in der Kernfamilie mindestens drei dyadische Sozialbeziehungen, in denen die Beziehungspartner einen ungeteilten Anspruch aufeinander haben und die zusammen genommen eine Triade bilden.
Vielfach wird gegen diese Bestimmung von Familie eingewandt, sie sei überholt. Das würde man schon daran erkennen, dass die Zahl der Scheidungen und der allein Erziehenden steige. Von Nichtaustauschbarkeit der Personen und von zeitlicher Unbeschränktheit der Paarbeziehung könne keine Rede mehr sein. Schon alleine deshalb müsse man von der Mutter-Kind-Dyade ausgehen.
Dieser Einwand ist u. E. unzutreffend. Die oben beschriebenen Merkmale von Paar- und Familienbeziehungen beschreiben nämlich einen Erwartungsrahmen, an dem Paare bzw. Eltern sich orientieren, und kein tatsächliches Geschehen. Diese Merkmale haben den Stellenwert einer Landkarte, und man fährt ja auch nicht auf einer Landkarte, sondern auf den realen Straßen, die sie abbildet. Die Landkarte dient lediglich der Orientierung.
Auf unser Thema bezogen heißt das: Paare bzw. Eltern handeln so, als ob die oben aufgeführten Strukturmerkmale uneingeschränkt gültig wären. Wo sie im Verlauf einer Paar- und Eltern-Kind-Beziehung mit der Realität nicht mehr übereinstimmen, wird dies oft als Scheitern erlebt.
Dass nun in einer Familie gleichzeitig drei dyadische Sozialbeziehungen bestehen (Paarbeziehung, Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung), von denen jede durch einen ungeteilten Anspruch der Personen aufeinander gekennzeichnet ist, hat zur Folge, dass es zu Prozessen des Einschlusses und des Ausschlusses kommen muss. Dazu ein Beispiel: Wenn der achtjährige Sohn mit seinem Vater an einem verregneten Sonntag eine Fahrradtour im Wald unternimmt und beide nass und verdreckt nach Hause kommen, dann könnte es sein, dass die Mutter die beiden Männer als unvernünftig hinstellt und der Sohn sich stolz mit dem Vater gegen die besorgte Mutter verbündet weiß. Das wird den Sohn aber nicht daran hindern, gleich nach der mütterlichen Ansprache eine warme Dusche zu nehmen, sich an die Mutter zu kuscheln und den Vater aus dieser innigen Beziehung auszuschließen. Es ist dieser ständige, mit Konflikten verbundene Wechsel in der Triade, der die Persönlichkeitsbildung beim Kind voranbringt. Emotionale Basis, Dauer und Verlässlichkeit bilden die Grundlage dafür, dass das Kind diese Konflikte überhaupt aushalten kann, die notwendig dafür sind, eine Identität auszubilden. Fehlt ein Element in dieser Triade, weil es von Anfang an nicht vorhanden oder durch Trennung oder Tod ausgefallen ist, fordert dies zu Kompensationsleistungen heraus. Eine davon – aus der Sicht der betroffenen Kinder – ist die mitunter lebenslange Suche nach dem ausgefallenen Elternteil, meist dem Vater.
Damit grenzen wir uns von weithin verbreiteten Vorstellungen ab, die Kernfamilie sei eine Erfindung der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts, und im Grunde lebe die Familie in erweiterten Verwandtschaftsbeziehungen. Die Lage ist differenzierter: Wir haben es heute mit „multilokalen Mehrgenerationenfamilien“ (Hans Bertram) zu tun.
Wir benutzen ein dialektisches Konzept der Autonomie der Lebenspraxis. Selbst- und Fremdbestimmung werden in dieser Sicht nicht als wechselseitig sich ausschließende Größen behandelt. Sie sind untrennbar miteinander verschränkt. Diese Verschränkung findet ihren Ausdruck in der Frage: „Was macht der Mensch aus dem, was die Verhältnisse aus ihm gemacht haben?“
Krankheit betrachten wir folglich nicht als Störung, sondern als Versuch einer Problemlösung in Situationen der Krise. Diese Problemlösung sehen wir als Prozess. Dem hat die Genogrammarbeit methodisch zu entsprechen. Daher betreiben wir Genogrammarbeit als Sequenzanalyse.
Krankheit als Bewältigungsversuch in einer Biografie zu betrachten hat mir mein psychiatrischer Lehrer, Wolfgang Blankenburg, Marburg, in Theorie und Praxis nahe gebracht. Dies mit methodisch kontrolliertem Fallverstehen zu verbinden und dabei die sozialisatorische Triade in den Mittelpunkt zu stellen habe ich bei Ulrich Oevermann in Frankfurt gelernt. Diese Vor gehensweise bei der Genogrammarbeit als Haltung und als Technik in die systemische Beratung und Therapie einzuführen war eine Aufgabe, die wir innerhalb der Arbeitsgemeinschaft des Meilener Instituts für systemische Therapie und Beratung (Rosmarie Welter-Enderlin, Reinhard Waeber, Robert Wäschle, später kamen dann Ulrike Borst, Silvia Dinkel, Andrea Schedle und Andrea Lanfranchi hinzu) diskutieren konnten.
Ihnen allen sei an dieser Stelle gedankt.
Besonderer Dank geht an Ulrike Borst und an Oliver König, die die Mühe nicht gescheut haben, das Manuskript dieses Buches vor der Drucklegung zu lesen und so sorgfältig wie kritisch zu kommentieren. Dem Manuskript hat die sich daran anschließende Überarbeitung sehr gut getan. Für die sprachliche Überarbeitung der dritten Auflage dieses Buches danke ich meiner Frau, Astrid Hildenbrand.
Zum Gebrauch dieses Buches
Man kann zehn Bücher über Techniken des Gitarrespielens lesen und ist danach vielleicht trotzdem nicht imstande, eine flüssige Akkordfolge zu spielen. Ähnlich verhält es sich mit beraterischem und therapeutischem Handeln. Diesem Handeln liegt eine Kunstlehre zugrunde, die in jahrelanger Übung im „Fallverstehen in der Begegnung“ (Welter-Enderlin u. Hildenbrand 2004) erworben wird.
Wird die Genogrammarbeit auf eine Technik reduziert, die aus Büchern gelernt werden kann, dann kommt möglicherweise die Intuition zu kurz, die in Feldern notwendig ist, in denen es um die Bearbeitung menschlicher Probleme geht. Es bedarf des Einfalls, wenn man verstehen will, welche Muster den jeweils individuellen Fall bestimmen. Diese Fähigkeit zu erwerben braucht Zeit.
Je mehr Fälle man anhand von Genogrammen methodisch kontrolliert erschließt, je mehr Erfahrung man in kumulativem Fallverstehen sammelt, desto effizienter kann man aus einem Genogramm Muster rekonstruieren, die ein Individuum, ein Paar, eine Familie leiten und die lebenspraktischen Autonomiepotenziale von Menschen einschränken – was Grund für Beratung und Therapie sein kann.
Dieses Buch ist wie folgt aufgebaut.
Kapitel 1
Hier werden die theoretischen Grundlagen der Genogrammarbeit entwickelt. Wen Theorien eher abschrecken, kann sich zunächst durch die Falldarstellungen im weiteren Verlauf des Buches anregen lassen und das theoretische Kapitel später lesen
Kapitel 2
Mit diesem Kapitel beginnen diejenigen, die Genogrammarbeit als Kunstlehre verstehen. Hier werden anhand eines Falles die grundlegenden Operationen der Genogrammarbeit als Sequenzanalyse vorgeführt und erläutert.
Kapitel 3
Hier werden Methodenfragen und zentrale Themen der Genogrammarbeit am Leitfaden des Fallbeispiels aus Kapitel 2 besprochen.
Kapitel 4
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die Genogrammarbeit in unterschiedlichen beraterischen und therapeutischen Kontexten, in der Supervision und im Rahmen der Selbsterfahrung eingesetzt werden kann. Gegenstand dieses Kapitels ist auch die Frage, wo die Genogrammarbeit ihre Grenzen haben kann.
Kapitel 5
Hier können Sie nachlesen, welche technischen Hilfsmittel bei der Genogrammarbeit nützlich sind.
1. Theoretische Grundlagen der Genogrammarbeit als Sequenzanalyse
Genogrammarbeit: Die Frage der Definition
In dem einschlägigen Handbuch Die Sprache der Familientherapie (Simon, Clement u. Stierlin 2004) wird das Genogramm in Anlehnung an Monica McGoldricks Ansatz wie folgt definiert (S. 121):
„Die grafische Darstellung einer über mehrere Generationen reichenden Familienkonstellation. Sie zeigt die Positionen in der Geschwisterreihe, welche die Eltern in ihren eigenen Herkunftsfamilien hatten, sowie die, welche der Indexpatient in seiner Familie einnimmt. Todesfälle, Krankheiten, Symptome usw. lassen sich jeweils übersichtlich einordnen.“
Das Genogramm dient dieser Definition zufolge als Rahmen, „um Informationen zu Koalitionen, Grenzen und zum familiären Lebenszyklus zu gewinnen“ (ebd.). Üblicherweise werden mindestens drei Generationen berücksichtigt.
Dagegen dienen Genogramme unserer Auffassung nach lediglich als Grundlage für die Genogrammarbeit, die darin besteht, Schritt für Schritt Entscheidungsmöglichkeiten der infrage stehenden Akteure zu rekonstruieren und mit ihren tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu vergleichen. Auf diese Weise ist es möglich, Muster zu rekonstruieren, die die Lebenspraxis der Akteure in ihrer spezifischen Logik immer wieder hervorbringen.
Die Unterschiede zwischen beiden Definitionen sind folgende: