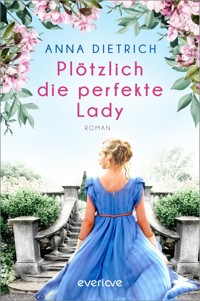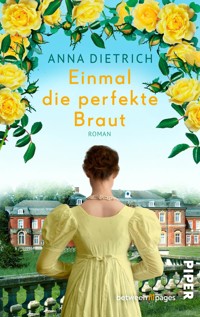
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Regency Romance mit jeder Menge Gefühle und köstlichem Humor: Taucht ein in die ländliche Idylle des schönen Süddeutschlands 1819 in dieser spicy marriage-of-convenience-Story. Für alle Fans von »Bridgerton« und den Büchern von Julia Quinn! Caspar von Landau sieht der arrangierten Ehe mit der äußerst zurückgezogen lebenden Elisabeth von Griesheim optimistisch entgegen: Denn durch ihren regen Briefwechsel haben die beiden sich bereits miteinander vertraut gemacht und erste zarte Freundschaftsbande geknüpft. Doch nicht alles wurde in ihren Briefen offenbart und die Geheimnisse, die Lissi und Caspar hüten, sind nicht die einzigen, die ihre anstehende Hochzeit gefährden könnten... Und was passiert, wenn die beiden feststellen müssen, dass ihnen und ihrem Glück sehr viel mehr im Wege steht, als jemals angenommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Einmal die perfekte Braut« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Michelle Stöger
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG
EPILOG
DANKSAGUNG
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Corinna
PROLOG
1819
Zwischen den Herzogtümern von Baden und Nassau, genauer gesagt, zwischen Worms und Oppenheim, lag immer schon eine weite Reise, abseits von großen Kaufmannsrouten und einflussreichen Handelsstädten. Kaum mehr als fünfzehn Seelen lebten in den zahlreichen, kleinen Örtchen des Wonnegau. Die meisten von ihnen umringt von Weinbergen und Weizenfeldern und Kuhweiden und blühendem Raps, der ab dem Frühsommer jeden Jahres stank wie gammeliger Kohl, dessen grauenhafter Odor vom sanften Wind über sämtliche Hügel bis in die letzten Ritzen und Winkel der Landschaft getragen wurde. Bis hin an die Säume der vielen kleinen Wäldchen, die sich verbissen, dem Abholzungseifer der Winzer und Bauern entgegenstemmten, sofern sie denn konnten. Vergeblich suchte man hier in der Region die großen, dunklen Wälder wie den Hunsrück oder den Spessart. Ebenso vergeblich suchte man auf dieser Route zwischen der Kurpfalz und den großen Städten Wiesbaden, Mainz und Frankfurt ein wahrhaft entlegenes Fleckchen Erde. Tief versteckt im Wald oder einsam in einer menschenleeren Einöde. Nein, Einöden gab es hier kaum und selbst wenn es sie gegeben hätte, man hätte sie vermutlich von jedem sanft geschwungenen Hügel aus auf Meilen hinwegsehen können.
Mit einer Ausnahme.
Tief im Dickicht der Waldungen zwischen Bechtheim und Guntersblum versteckt lag eine Klause, die nur von gewissen Personen angefahren wurde und diese einte alle eines: Das Leben und Darben im gesellschaftlichen Halbdunkel. Fernab der fröhlichen Gasthöfe entlang des Rheins, weit weg von den sonnigen Biergärtchen und gemütlichen Weinstuben, die sich kein ernst zu nehmender Reisender in der Region entgehen ließ. Außer, nun, außer jener Reisende hatte abseitige Pläne, eine Reiseagenda, die ihn zwang, unerkannt und unbemerkt zu bleiben. Diese Reisenden kehrten in der Klause ein, tief versteckt im Bauch eines Waldstücks, das sich über die Grenzen beider Herzogtümer streckte, ein finsterer Wald voller Rottannen, die alles Licht schluckten und den Waldboden öde und dörr zurückließen.
Verschwiegen war man in der Klause, der Wirt höchstselbst ein Mann von zweifelhaftem Ruf. Die Speisen der Küche waren allesamt mehr als reizlos und das Bier stets auffällig wässrig. Der schwarzgebrannte Schnaps, den man gleich becherweise vorgesetzt bekam, war würzig und mit Vorsicht zu genießen, wenn man vorhatte, sein Augenlicht unbedingt behalten zu wollen.
Die zwielichtigen Gestalten, die hier einkehrten, zahlten dennoch für alles auf der Karte einen hohen Preis. Denn selbst das wässrigste Bier konnte man für acht Schilling verkaufen, wenn der Käufer keine Alternative hatte.
Die beiden Herren, die sich gerade im Séparée trafen, weit entfernt von jedem übereifrigen Ohr im Schankraum, hätten in jedem Fall einen Haufen Alternativen, das hatte der Wirt auf Anhieb gesehen. Gleich beim ersten Mal, als sie sich hier vor einem guten Monat trafen, mit einem Dritten im Bunde, der heute fehlte. Der anders war als die anderen beiden, die so gepflegt und auffällig aufrecht unter ihren dreckigen Umhängen gewesen sind. Der Wirt war schließlich nicht dumm. Ungebildet ja, aber man brauchte schon eine gewisse Bauernschläue, um selbst den niedersten Halunken der Gesellschaft das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und der Wirt hatte sich nicht einen Moment von der alten Pferdedecke täuschen lassen, die der Erste, der eingetroffen war, als Umhang trug, sein Haupt tief unter der behelfsmäßigen Kapuze verborgen. Nein, der Wirt hatte die Stiefel gesehen und trotz ihrer dicken Matschkruste erkannt, dass es teure, lederne Reitstiefel waren, die sich kein Wegelagerer, der eine Decke als Mantel trug, jemals würde leisten können. Und die Hand, die dem Wirt den Silberkronen zugeworfen hatte, die es kostete, das Séparée zu mieten, die hatte nicht eine einzige Schwiele, nicht einmal eine Narbe oder einen Kratzer gehabt. Und der zweite Herr, der diesem ominösen Ersten nachfolgte und direkt auf die Tür des Séparées zuhielt, ganz offensichtlich mit dem Ersten verabredet, der hatte sich nicht die Mühe gemacht, so wie der Erste, ein unscheinbares Leihpferd aus einem der umliegenden Dörfer zu mieten. Der kam auf einem dunklen Warmblut angeritten und selbst der größte Dummkopf aller Zeiten hätte erkannt, was für ein edles, teures Geschöpf es war. Er hatte sich ebenfalls eine Pferdedecke übergeworfen, aber diese war weder alt noch fleckig und sein Schritt war stolz und majestätisch, statt leise und unauffällig. Bei diesem ersten Treffen war schließlich ein Dritter dazugestoßen, eine wahrhaft scheußliche Kreatur, gebückt und vermeintlich schon mit einem Bein im Grab, konnte sich der Mann schneller bewegen, als selbst scharfe Augen zu beobachten im Stande waren. Und er war durch den halb vollen Schankraum geglitten, ohne dass eine einzige Person – vom Wirt abgesehen – ihm Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
Bei diesem ersten Treffen hatte der Wirt verpasst, was da im Nebenzimmer vor sich ging, musste bedauerlicherweise eine spontane Schlägerei zwischen ein paar Gästen schlichten und ein halbes Dutzend Streitlustige an die Luft setzen. Verpasste, was die drei Gestalten besprachen und als er endlich fertig war, da waren sie bereits verschwunden.
Aber heute nicht. Heute wartete er ab, bis auch der zweite Herr hinter der Tür in den Nebenraum verschwunden war, gab seinem Schankmädchen einen Klaps, schickte sie los ins Séparée, um anzufragen, ob die Herren nicht etwas trinken oder essen wollten, und er nutzte ihre laute, ruppige Geschäftigkeit in den Raum zu pflügen, um vorsichtig und leise den kleinen Holzriegel an der Wand hinter der Theke aufzuschieben und dadurch mit angehaltenem Atem dem Gespräch im Nebenraum lauschen zu können.
Ärgerlicherweise hatten die beiden unbekannten Gäste die Stühle weit weg von der Tür bis ans andere Ende des Raumes geschoben und dem Wirt fiel es einigermaßen schwer, ihr Gespräch mitzuhören, genau genommen hörte er immer nur den einen von beiden, der laut und unbekümmert sprach, während der andere nur heiser zu flüstern schien.
»… genau so viel bezahlt wie vereinbart. Und sind einen Tag davor abgereist. Wie abgesprochen.«
»…«
»Nein! Natürlich nicht! Ich habe zugesichert, ich werde sie nicht einweihen und ich habe es auch nicht getan. Überhaupt, es ist ihr egal, was mit Elisabeth wird. Sie hat sich noch nie etwas aus dem Kind gemacht.«
»…«
Der Wirt konnte nicht ausmachen, was die zweite Stimme sagte, aber es klang wie eine zischende Ermahnung und das war es vermutlich auch, denn der laute Mann wurde merklich leiser. Leiser, aber immer noch passabel zu verstehen:
»Um meine Tochter musst du dich sicherlich nicht sorgen. Sie tut, was ich ihr sage.«
»…«
Eine längere Pause folgte. Und dann – der Wirt hatte schon die Hoffnung aufgegeben, sich einen Reim auf das Gespräch machen zu können – sagte die laute Stimme:
»Uns wird die Kunde sowieso erst spät erreichen. Vermutlich durch Tratsch. Wir lesen keine Zeitung.«
»…«
»Ja, so wird es kommen. Wenn es erst mal offiziell verkündet ist, wird es so einige auf den Plan rufen. Die danach gieren. Dem Geld und dem Titel und …«
Die Stimme des leisen Mannes unterbrach ihn wispernd – unverständlich seine Worte, aber fuchsteufelswild sein Unterton.
»Ach wo! Wer soll uns hier schon hören!«
»…«
»Außerdem … nein, nein, ganz im Ernst. Bis die Nachricht seines Todes bis hierhin vorgedrungen ist, vergehen Wochen, wenn nicht gar Monate. Bis dahin erinnert sich nicht mal dein eigener Stallbursche an diesen Ausflug hier.«
Doch darin würde der laute Mann sich täuschen.
Denn der Wirt vergaß nicht, und er erinnerte sich auch sofort an die beiden Herren im Séparée, als vierzehn Tage später ein fränkischer Hehler mit gestohlenem Krimskrams bei ihm einkehrte und lautstark verkündete:
»Der letzte Graf von Pernstein ist tot! Das Erbe der Böhmischen Krone ist weiterhin ungeklärt!«
KAPITEL EINS
Schloss Landau, Frühjahr 1819
»…und deswegen denken wir, es ist das Beste, wenn du bald heiratest.«
Caspar zwinkerte. Mehrfach. Ein festes Augen-auf-und-zu-pressen, ganz so, als könne er damit das Bild seiner Mutter, die auf dem kleinen Sofa sitzend ordentlich die Falten ihrer Röcke glattstrich, irgendwie fortblinzeln. Was, trotz aller Anstrengung, einfach nicht gelingen wollte.
»Sehr bald«, fügte sein Vater hinzu, der sich neben der kleinen Anrichte postiert hatte. Bekanntermaßen sein Lieblingsplatz im Familiensalon, immerhin stand er damit stets in Griffweite des nächstbesten Weinbrands.
Caspars ratloser Blick pendelte von einem Elternteil zum anderen und sein Mund öffnete sich, als würden bei Bedarf doch noch Worte aus seiner Kehle kommen, was allerdings nicht den Tatsachen entsprach und dementsprechend schloss sich der Mund nach einer Weile wieder, hilflos und stumm.
Nicht so der Mund von Caspars ältestem Bruder.
»Wird auch Zeit!«, dröhnte Georgs Stimme durch den Raum wie immer zu laut und zu barsch, ganz seinem Charakter entsprechend und schob etwas von Lotterleben und auf Vaters Tasche liegen hinterher.
Die Mühe, auf diese Anschuldigungen einzugehen, machte sich Caspar schon lange nicht mehr. Die Anerkennung seines großen Bruders zu erringen, das war etwas, was Caspar in seinem Leben noch nicht erreicht hatte – und er versuchte es auch nicht mehr. Seit jenem folgenschweren Sonnabend im Mai vor beinahe exakt neun Jahren gab Caspar nichts mehr auf Georgs Meinung, Georgs Anerkennung oder einfacher ausgedrückt: Auf Georg, ganz im Allgemeinen.
Aus diesem Grund überging Caspar dessen Einwurf geflissentlich und wandte sich stattdessen demonstrativ seiner Mutter zu.
»Ich bin aber nicht der einzige Sohn dieser Familie, der dir Enkelkinder schuldet«, nahm er den Faden von vorhin wieder auf und sah aus den Augenwinkeln mit einer gewissen Genugtuung, wie Georg ertappt zusammenzuckte und sein Kopf hochrot wurde. Doch bevor er explodieren konnte, intervenierte ihr Vater und forderte mit stählerner Souveränität in der Stimme:
»Sechsundzwanzig ist sehr wohl alt genug, um sesshaft zu werden und Kinder in die Welt zu setzen. Erst recht, wenn man als Drittgeborener ein gewisses Auskommen hat und nur durch Heirat an Vermögen kommt.«
Vaters Zurechtweisung traf Caspar bis ins Mark. Heiße Wut strömte durch ihn hindurch und es fühlte sich an, als würde jeder einzelne Muskel in seinem Körper zu Stein werden.
»Und es ist ja nicht so, als dürfte ich mir große Hoffnungen darauf machen, dass Martin mir Enkelkinder schenken wird«, warf seine Mutter mit versöhnlichem Witz in den Raum und ein klein wenig löste das Caspars Anspannung. Seine Mundwinkel umspielte ein amüsiertes Lächeln, als er ihren Blick erwiderte und leise antwortete:
»Ich bin sicher, Martin wäre nicht der erste Novize im Priesterseminar, dem man ein Malheur nachsehen würde.«
Sein mokanter Unterton ließ seine Mutter ablehnend schnaufen, aber sie blieb stumm. Ihr oft artikulierter Wunsch nach Enkelkindern ließ Caspar zweifelnd darüber zurück, ob sie sich nicht heimlich wünschte, ihr Zweitgeborener würde seinem Ruf in den Schoß der heilig-römisch katholischen Kirche entsagen und stattdessen einfacher protestantischer Geistlicher auf dem Land werden und irgendein Pfarrhaus mit einem halben Dutzend Kindern füllen.
»Tatsächlich habe ich bereits eine aussichtsreiche Kandidatin für dich im Sinn«, durchbrach Vaters Stimme Caspars wandernde Gedanken und ließ alle Anwesenden im Raum überrascht verstummen. Caspars Zunge fühlte sich plötzlich zu groß für seinen Mund an, sein Hals mit einem Mal schrecklich trocken und dennoch versuchte er, Worte zu finden. Eine Erwiderung.
Verdammt wollte er sein, wenn er seinen Schwur darüber brach, dass sein Vater niemals wieder das letzte Wort haben sollte.
»Wunderbar. Ich nehme an, Sie ist reich, von blauem Geblüt und hochgradig verzweifelt?«
»Warum, bei aller Liebe, sollte sie …?«, wisperte seine Mutter, doch Caspar unterbrach sie sogleich.
»Ich bin der drittgeborene Sohn eines Landbarons. Ohne, wie Vater es so schön ausgedrückt hat, nennenswertes Auskommen. Ich verfüge über kaum beachtenswerte Verbindungen und ich bin nicht einmal sonderlich belesen.« Er feixte ein Grinsen und wandte sich wieder seinem Vater zu, dessen wütender Blick Bände darüber sprach, was er von Caspars Zusammenfassung hielt.
»Das Haus Landau genießt höchste …«, platzte Georg wütend dazwischen, doch ihr Vater setzte bereits an, ein dröhnender Bariton, der selbst Georgs Stimme abrupt untergehen ließ.
»Du wirst dich dem fügen, Caspar Gustav Felix von Landau!« Der Herr des Hauses hatte gesprochen und einen Moment herrschte lähmende Stille im Salon, zumindest bis sich der Angesprochene berappelt hatte. Mit einem betont lässigen Schulterzucken versuchte Caspar, das unangenehme Gefühl abzuschütteln, das sein Vater in ihm hervorgerufen hatte.
»Gleich alle drei Vornamen, es scheint also wirklich ernst.« Er versuchte sich an einem Witz, doch seine eigene Stimme klang ebenfalls gepresst, ganz so, als versagte er sich die eigentliche Antwort, die er auf diesen Befehl gerne gegeben hätte.
Und als hätte sie erkannt, dass dies ihr Stichwort wäre, sprang seine Mutter wieder ein, ihre Stimme nun noch weicher und diplomatischer als sonst.
»Oh, ich brenne darauf, zu erfahren, wen du für Caspar ausgesucht hast.«
Oh, ich auch, dachte dieser und die Stimme in seinem Kopf klang zwar überaus sarkastisch, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass er insgeheim seiner Mutter beipflichten musste. Er wollte unbedingt wissen, an wen sein Vater dachte.
Um den Vorschlag sofort zu vernichten. Mit validen Gegenargumenten.
Denn er kannte jede verfügbare Debütantin im Umkreis von … Caspar unterdrückte ein lautes Seufzen. Sehr weit, dieser Umkreis, in jedem Fall.
»Fräulein Elisabeth von Griesheim.«
Moment.
»Der Name ist mir gar nicht bekannt.« Seine Mutter klang erstaunt und sprach damit exakt das aus, was auch Caspar sich dachte.
»Ist sie eine der Debütantinnen, die während der Saison in Heidelberg residieren?« Da klang beinahe so etwas wie vorfreudige Hoffnung in der Stimme seiner Mutter mit, ganz so, als wüsste sie klammheimlich um Caspars Unwillen, in eine der bekannten Familien des ansässigen Landadels rund um die Landauer Besitztümer einzuheiraten.
»Nein.« Vaters Antwort war sowohl kurz als auch barsch. Eine imposante Zurschaustellung, von wem Georg seine schnörkellosen rhetorischen Fähigkeiten geerbt hatte.
»Oh.« Mutter blickte betreten auf die Hände in ihrem Schoß und Caspar wollte sich bereits aufschwingen, so wie er es stets tat, wenn sein Vater seine Mutter verbal zurechtstutzte, doch dieses Mal war dieser schneller, fügte mit einem scharfen Seitenblick auf seinen jüngsten Sohn hinzu:
»Sie ist die Tochter von Freiherr Karl-Konstantin von Griesheim.«
»Ich wusste gar nicht, dass dieser eine Tochter hat«, flüsterte seine Mutter halb zu sich selbst, aber sie richtete unverzüglich ihren Blick wieder brav in Richtung ihres Gatten, als dieser, nach einem großzügigen Schluck Cognac, ungerührt weiter fortfuhr:
»Sie bewohnt gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, der vormaligen Gräfin von Traun, den Landsitz der von Traun. Bei Wiesbaden.«
Dem allgemeinen Schweigen, das dieser Aussage nachfolgte, war unschwer zu entnehmen, dass keine der anwesenden Personen mit so etwas gerechnet hatte. Immerhin, nach Wiesbaden waren es mehrere Tagesreisen und in der Regel – einer Regel, von der Caspar bis dato glaubte, unumstößlich festzustehen – verheiratete man keine drittgeborenen Söhne ohne Auskommen in andere Grafschaften. Oder gar in andere Herzogtümer. Die Mühen einer Eheschließung über Landesgrenzen hinweg war etwas, was man höchstens für die aufsehenerregendsten Verbindungen, für zukünftige Würdenträger und Titelerben reservierte.
Dementsprechend fehlten ihm die Worte, als sein Vater mit einem gönnerhaften Unterton empfahl:
»Es ist wohl ein wenig zu weit für einen spontanen Besuch, aber du könntest einen Brief schreiben.«
Das entrüstete Schnauben, das Caspars erste Reaktion auf diesen lächerlichen Vorschlag war, ließ sich leider nicht mehr aufhalten und die Mundwinkel seines Vaters zogen sich missbilligend nach unten.
»Das war kein Scherz, Caspar. Schreibe diesen Brief.« Und dann, mit einem Kopfnicken in Georgs Richtung marschierte sein Vater zur Tür. Warf keinen einzigen Blick mehr auf seinen jüngsten Sohn oder seine Gattin, kein Wort des Abschieds, nicht einmal ein Murmeln auf seinen Lippen, als er den Raum verließ, ein Diener mit dem Glas Cognac dicht auf seinen Fersen und brav folgend auch Georg, der seiner Mutter zumindest ein halbes Kopfnicken zum Abschied schenkte.
Als hinter der kleinen Karawane die Tür final ins Schloss fiel, blieben Mutter und Sohn einsam im Salon zurück und einen kurzen Moment lang herrschte bleiernes Schweigen, als wüssten beide nicht so recht, was sie sagen sollten. Irgendwann wagte seine Mutter jedoch den ersten Vorstoß, und ihre Finger nestelten hektisch an den Rüschen ihrer Röcke und fleckige Röte zierte ihre Wangen, als sie leise sprach:
»Weißt du, vielleicht hat es auch sein Gutes. Immerhin …«, doch sie sprach nicht weiter, führte nicht aus, was gut an dieser ganzen Situation sein sollte. Immerhin, dachte Caspar, durchaus in einem Anfall von Galgenhumor, kannte er Wiesbaden nicht einmal. Aber es sollte besser eine wirklich schöne Stadt sein, wenn er dahinziehen sollte. Himmel, fort von Heidelberg. Das würde er in jedem Fall vermissen. Noch dazu all seine Bekanntschaften, seine Freunde und die vertrauten Orte und …
»Vielleicht ist es das Beste, wir zerbrechen uns erst später den Kopf.« Ein versöhnlich optimistisches Lächeln auf den Lippen beugte sich seine Mutter zu ihm und tätschelte liebevoll seine Hand. Und jedem anderen Menschen auf dieser Erde hätte Caspar ordentlich die Meinung darüber gegeigt, wie sehr er selbst und ganz alleine in der Lage wäre, zu ermessen, ab wann man sich den Kopf zerbrechen soll, aber immerhin, das hier war seine Mutter. Und daher nickte er nur, zähneknirschend, sich ein erschöpftes Lächeln abringend, welches seine Augen nie erreichte und meinte dann, betont gelassen und bemüht freundlich:
»Dann schreibe ich wohl jetzt diesen Brief.«
*
Der Tag, an dem Caspars Brief bei Elisabeth im Trauner Schloss eintraf, stand bereits kurz nach Morgengrauen unter keinem guten Stern. Wer auch immer ihr das Frühstückstablett vor die Kammer gestellt haben mochte, die Person hatte es mit sehr viel Nachlässigkeit getan und das Kännchen mit der Milch war umgefallen, hatte das Brot, den Käse und den Apfel ertränkt. Wobei der Apfel glücklicherweise von seinem unfreiwilligen Bad unbeeindruckt und essbar blieb, etwas, was man vom Brot und dem Stückchen Käse leider nicht sagen konnte und um den Großteil ihres Frühstücks beraubt, tigerte Elisabeth später mehr als hungrig durch die Dienstbotengänge Richtung Orangerie. Sie wusste es besser als in der Küche ein zweites Frühstück zu erbitten, das letzte Mal, als sie unangekündigt in die Küchenräume gekommen war, hatte eine der älteren Mägde sie erblickt und war dermaßen erschrocken, dass sie einen schweren Tontopf voller Mehl fallen ließ und damit die gesamte Küche lahmlegte. Nein, da war ein wenig Hunger bis zur Mittagszeit eindeutig die bessere Alternative und sehnsüchtig dachte Elisabeth daran, dass es noch mehr als sechs Monate dauern würde – sieben, wenn es ein verregneter Sommer werden würde –, bevor sie sich den lieben langen Tag am Obst des Gartens erfreuen könnte, an den Birnen, Äpfeln und den Johannisbeersträuchern und den gesamten Spätsommer und Frühherbst nie in die Verlegenheit kam, bei der Dienstbotenschaft um Mahlzeiten zu bitten.
Vielleicht war es der Hunger, vielleicht war es eine merkwürdige Form der Vorahnung, aber Elisabeth fand an diesem Tag nicht wirklich in ihre gewohnte Routine. Das Umtopfen der Zöglinge ihrer Rosen dauerte heute enervierend lange, gleich dreimal ertappte sie sich selbst bei einem Schreibfehler, während sie in ihrem Notizbüchlein ihren Fortschritt festhielt. Als sie gegen Mittag zurück in ihre Kammer stieg, stolperte sie zweimal beinahe über ihre beschmutzten Rocksäume (das Umtopfen hatte leider heute durchaus seine erdigen Spuren hinterlassen) und erstaunt sah sie, dass neben dem Teller mit ihrem Lunch (es gab schon wieder arme Ritter) ein Brief lehnte und mit mulmigem Gefühl nahm sie das Tablett mit, beäugte das Briefkuvert sorgenvoll, bevor sie sich dazu durchringen konnte, es zu öffnen. Und während sie auf einem sehr harten und kalten Stück armer Ritter herumkaute, las sie zu ihrem Erstaunen, dass der Brief eine Einladung war. Oder, besser ausgedrückt, war er weniger eine Einladung als eine Vorladung, befahl er ihr doch, sie solle sich zum Diner heute Abend förmlich kleiden, da sie mit ihrem Vater und der Gräfin speisen sollte.
Das harte Stück Brot steckte augenblicklich wie ein ganzer Felskoloss in ihrer Kehle fest und sie brauchte zwei große Schlucke Wasser, um ihn hinab zu zwingen.
Das letzte Mal, dass sie außer der Reihe – also außerhalb der Weihnachtsabende und ihres Geburtstags – mit ihrem Vater und dessen Gattin hatte speisen dürfen, war über fünf Jahre her. Und dennoch erinnerte sich Elisabeth mit brennender Intensität an diesen Abend, an dem sie zu viert am Tisch saßen, ein unbekannter Herr Elisabeth gegenüber, der sich als Doktor der Dermatologie vorgestellt hatte, ihr seinen Namen allerdings den gesamten Abend über schuldig geblieben war. Unangenehm aufdringlich hatte er ihr ins Gesicht gestarrt, obwohl sie sich nach Kräften bemüht hatte, die Haare so zu drapieren, dass ihre linke Gesichtshälfte unter dem Schleier dunkler Locken versteckt blieb. Das Gespräch zwischen den einzelnen Gängen drehte sich ausschließlich um seine fachliche Einschätzung zu Elisabeths Haut und gekrönt wurde es schlussendlich von einem Monolog des Arztes, in dem er allerhand unbekannte, lateinisch klingende Worte benutzte und final mit dem Fazit schloss: »Gegen solche Narben sind die gängigen Tinkturen wirkungslos.«
Wie versteinert hatte Elisabeth dagesessen, mit aller Macht versucht, heiße Tränen zurückzuhalten, die ihre Sicht verschwimmen ließen, hörte die Stimmen der anderen am Tisch nur seltsam blechern an ihre Ohren dringen. Ihr Vater, wie er verstimmt etwas von Zeitverschwendung murmelte und ihre Stiefmutter, die Gräfin, die über verschreckte Gäste und ein zu wahrendes Bild in der Öffentlichkeit klagte. Am Ende jenes grauenhaften Diners empfahl sich der Doktor mit wortreichen Entschuldigungen und ihr Vater sprach mit leiser, belehrender Stimme zu ihr. Darüber, dass man ihm und der Gräfin wahrlich nicht vorwerfen konnte, nicht alles für Elisabeth versucht zu haben. Das selbst die Dienerschaft unter der Bürde ihres Anblicks zu leiden hätte. Das vermutlich nicht einmal die Klöster rund um Schloss Traun bereit wären, sie aufzunehmen.
Und irgendwo zwischen all diesen Sätzen, die in ihr Herz gestochen hatten wie spitze Nadeln, hatte Elisabeth aufgehört, die Tränen mit aller Macht zurückzuhalten, da waren sie heiß und zahlreich über ihre Wangen gelaufen, über die gute, schöne Rechte mit ihrer makellosen Blässe und auch die verhasste Linke mit ihren Narbenwülsten, den Kratern und den weiß-rötlichen Verfärbungen. Da flossen die Tränen weiter hinab, über ihr Kinn den Hals hinunter, den guten, rechten Teil, der aussah, wie ein Hals auszusehen hatte und den schlimmen, versehrten linken Teil, der faltig und vernarbt und hässlich war. Hätte sie ein Kleid mit Dekolleté besessen, dann hätten sich die Tränen vielleicht sogar ihren Weg weiter nach unten bahnen können, dorthin, wo bei gesunden Frauen zwei gleichgroße Brüste warteten. Doch nicht so bei Elisabeth. Bei Elisabeth war nur die rechte eine wohlgeformte, handgroße, perfekte Kugel. Die linke Brust hingegen war gegen die Narben gewachsen, hatte sich unter der versehrten und verrunzelten Haut niemals so entwickeln können wie ihr rechtes Pendant. Stattdessen war sie kleiner, nicht rund, eher oval und die wenigen Male, die es Elisabeth in ihrer Pubertät ertragen hatte, sich selbst nackt im Spiegel zu betrachten, hatte sie voll Abscheu auf die Brust geblickt, sich gefragt, wie diese Brust jemals ihrem Zwecke nachkommen sollte, wenn sie doch so missgestaltet war, dass selbst ein neugeborenes Kind es intuitiv ablehnen musste, von einer solchen Monstrosität genährt zu werden.
Doch dieser Gedanke war ein müßiger, immerhin war sich Elisabeth im Klaren darüber, dass sie niemals das Wunder der Mutterschaft erleben würde. Niemals würde sie das irdische Glück erfahren, von einem Mann geliebt und geheiratet zu werden, Kinder in diese Welt zu setzen und sie mit derselben bedingungslosen Liebe zu versorgen, die auch sie selbst von ihrer Mutter erfahren hatte. Einer Liebe, die sich niemals von Narben hätte abschrecken lassen, einer Liebe, die nur ihr Innerstes gesehen hätte: Ihren Charakter und Ihr Wesen. Einer Liebe, die für immer und für alle Zeiten angedauert hätte, davon war Elisabeth überzeugt, wäre die Mutter ihr nicht entrissen worden, damals vor über sechzehn Jahren, als Elisabeth noch klein, kaum neun Jahre alt gewesen ist und das wütende Feuer, das sich schneller durch die Räume des Griesheimer Landhauses gefressen hatte, als man rennen konnte, ihr das Kostbarste stahl, was sie besaß: Ihre heiß geliebte Frau Mama, die sich selbst opfernd, ihren Körper schützend um ihr kleines Töchterlein gekrümmt, durch die schrecklichen Flammen gestiegen war, Elisabeth vor dem sicheren Tod gerettet hatte, auch wenn dies bedeutete, dass sie selbst dabei ihr Leben gab. Und ja, das feuchte Tuch, das sie schützend um ihre Tochter gewickelt hatte, war auch das schlussendlich feuerfangende Stück Stoff, das die schweren Brandnarben in Elisabeths Haut fraß. Der erste Arzt, der jemals mit ihr über ihre Verletzungen sprach, war auch gleichzeitig der Einzige, der ihr jene Wahrheit offenbarte, über die später niemals wieder gesprochen werden sollte:
Ihre Narben waren ein Segen, ein Beweis ihres Überlebens, denn ohne jenes Tuch, jenes fürchterliche, an ihrer Haut klebende Stück Stoff, dass diese Narben verursacht hatte, hätte sie ebenso wie ihre Mutter zu viel Rauch eingeatmet. Wäre ebenso wie ihre Mutter am erstickenden Qualm gestorben. Das Tuch, obgleich es sie in ein hässliches Monster verwandelt hatte, hatte ihr gleichzeitig das Leben gerettet und auch wenn es sie über allen Maßen geschmerzt hatte, so teilte sie Vaters Ansicht nicht. Er hatte jenen Arzt damals aufs Übelste verflucht, hatte im Nebenzimmer gewütet, war in seiner Rage so laut geworden, dass selbst Elisabeth in ihrem Krankenbett ihn grausamerweise perfekt hören könnte. Hörte, wie er den Arzt verfluchte, der ihm bestätigte, dass die Narben im Gesicht seiner Tochter für ewig wären. Hörte, wie ihr Vater unumwunden kundtat, dass es vielleicht ein besseres Schicksal gewesen wäre, zu sterben.
Da hatte sich ihr kleines, neunjähriges Herz vor Schmerz zusammengekrümmt und nur ein einziger Gedanke hatte sie am Leben gehalten, ein Gedanke, der sie bis heute am Leben hielt: Ihre Mutter hätte nicht so gedacht. Ihre Mutter hatte sie in das nasse Tuch gehüllt, wohl wissend, dass dies ihre beste Überlebenschance war. Ihre Mutter hätte immer gewollt, dass sie am Leben blieb. Ihre Mutter hatte dies so sehr gewollt, dass sie ihr eigenes Leben dafür gegeben hat, und Elisabeth schwor sich damals, gefesselt an ihr Krankenbett, der Kopf merkwürdig leicht, beinahe schwerelos, von den fürchterlich bitteren Tränken des Arztes, dass dieses Opfer ihrer Mutter nicht umsonst gewesen wäre.
Dass sie ihr Leben darauf verwenden würde, ihre Mutter mit Stolz zu erfüllen.
Dies bedeutete leider auch, sich immer und stets ihrem Vater zu fügen, ganz so, wie ihre Mutter dies getan hatte. Sie hatte sich ihrem angetrauten Gemahl in allem gefügt: In Elisabeths Erinnerung hatte ihre Mutter stets Ja, mein Herr und Sehr wohl, mein Herr gesagt und das einzige Mal, dass sich Elisabeth an Widerworte ihrer Mutter erinnern konnte, war, wenn es um ihre Rosen ging. Diese hatte sie verteidigt und im treuen Andenken an sie tat Elisabeth es ihr nach.
Die Rosen waren Mutters Erbe und Elisabeth nahm die Verantwortung für ihre kleinen Zöglinge sehr ernst. Bedauerlicherweise bedeutete dies auch, dass Elisabeth jedes Mal, wenn sie um ihre Rosen kämpfte, damit den Zorn ihres Vaters auf sich zog. Gleichgültig, ob sie von der Dienstbotenschaft dabei beobachtet wurde, wie sie einen der Gärtnergehilfen bat, mehr Mulch in ihre Umtopferde zu geben (obgleich sie strengste Anweisungen hatte, mit niemandem außerhalb der engen Mauern des Schlosses zu sprechen) oder sie – aus Versehen, das sei unbedingt dazugesagt! – nicht mitbekommen hatte, dass sich Besuch bei der Gräfin angekündigt hatte (Besuch, der bei schönem Wetter vielleicht über die Kieswege des Barockgartens flanieren wollte und keinesfalls aus der Ferne Elisabeth am alten Geräteschuppen sehen sollte, den sie als Notlösung für ihr fehlendes Gewächshaus benutzte). Ja, solche verflixten Momente waren es, die Vaters Zorn erweckten und Elisabeth zerbrach sich sorgenvoll den Kopf über die Einladung für das heutige Diner, denn normalerweise stürmte Vater nur ihre Kammer, hochrot und schnaufend, weil es immerhin drei hohe Treppenfluchten bis zu ihr nach oben waren. Vielleicht war es das. Vielleicht war es ihm einfach zu anstrengend geworden, sie direkt aufzusuchen, versuchte sie sich selbst einen Reim auf alles zu machen, während sie in das einzige Kleid schlüpfte, dass sie in ihrem Schrank beherbergte und das dem väterlichen Wunsch nach förmlicher Kleidung gerecht wurde. Es war ein abgelegtes Kleid aus Mutters Reisegarderobe. Die Koffertruhe, die nur wenige Stücke barg – unter anderem einen Mantel mit Filzkragen, ein Tageskleid, eine Abendrobe, Wäsche, Strümpfe und ein Reisekleid mit Jäckchen – war eines der wenigen irdischen Dinge, die Elisabeth von ihrer Mutter geblieben war. Die Truhe und die Rosen im Garten und ein schmuckloses Grab auf dem Friedhof von Schloss Griesheim. Sonst leider nichts.
Das Abendkleid war eine nun beinahe dreißig Jahre alte, vollkommen aus der Mode gekommene, elfenbeinfarbene Alabasterrobe, die einen Cul de Paris als Reifrock benötigte, um unterhalb der Taille korrekt zu sitzen. Da Elisabeth aber keinen hatte, trug sie das Kleid – ihr immerwährend treuer Begleiter für die Weihnachts- und Geburtstagsdinner, die sie mit Vater und der Gräfin vollzog – mit zwei behelfsmäßig gerafften Schleifen an ihren Hüften, damit der überschüssige Stoff nicht auf dem Boden schleifte. Sie ertrug stoisch und mit stiller Größe das erstickte Glucksen und amüsierte Flüstern, das die Gräfin jedes Mal ausstieß, wenn sie Elisabeth in ihrem Abendkleid sah. Worte wie lächerlich und geradezu komödiantisch waberten dann durch den Raum und Elisabeth versteckte in diesen Momenten nicht nur ihre grässlichen Narben hinter ihrem Vorhang aus dunklen Locken, sondern ebenso das grimmige Verziehen ihres Mundes und die feststeckenden kleinen Tränchen, die ihre Augen glasig schwimmen ließen. Dazu durchringen, ihren Vater um neue Garderobe zu bitten, konnte sie sich jedoch nicht. Es hätte ein weiteres Gespräch mit ihm erzwungen – ihm, der jedes Mal, wenn sie, aktiv von sich aus, das Gespräch mit ihm suchte, aussah wie ein Mann, der mit den ärgsten Übeln der Welt zu ringen hatte. Nein, wenn sie sich überhaupt dazu durchrang, so war es stets für ihre Rosen und dabei würde es bleiben.
Eine gewisse Beklommenheit und vage Vorahnungen verknoteten ihren Magen, als Elisabeth die breiten Stufen der Herrschaftstreppe hinunterstieg, denn das alte Abendkleid war zu opulent, um es damit die schmale Wendeltreppe im Dienstbotengang hinunterzuschaffen. Vor wenigen Wochen, als sie gemeinsam Weihnachten feierten, hatte Elisabeth vorsichtig angefragt, ob Vaters vor Jahren bereits gegebenes Zugeständnis, den alten Geräteschuppen zumindest notdürftig reparieren zu lassen (das zerbrochene Rückfenster austauschen und das Dach neu decken), dieses Jahr wohl endlich Wirklichkeit würde, immerhin: Es war der einzige Weihnachts- und Geburtstagswunsch, den sie seit Jahren aussprach. Seit vier Jahren, um genau zu sein, seit jenem Geburtstag, an dem sie sich überwunden hatte, ihren Vater und die Gräfin um den Bau eines Gewächshauses zu bitten. Diesem Wunsch war damals nicht stattgegeben worden, aber Vater hatte zumindest zugesichert, dass der Schuppen gerichtet wurde. Seither wartete sie auf die Umsetzung dieses Versprechens und dieses Weihnachten hatte sie sich erneut erdreistet (die Wortwahl der Gräfin war, wie sonst auch, gewohnt dramatisch, wenn es um Elisabeth ging) anzufragen, wann wenigstens das Dach gemacht werden würde, denn Elisabeth gingen langsam die Gefäße aus, um den durch die Löcher des Daches tropfenden Regen aufzufangen.
Bei diesem Diner, dachte sie mit pochenden Herzen, kurz bevor sie sich mit gesenktem Kopf an den Dienern vorbeistahl, um selbst die Türen zum Salon zu öffnen, wäre vielleicht der Moment gekommen, in dem ihr Vater ihr mitteilte, dass der Schuppen niemals repariert werden würde. Vielleicht erfolgte heute das Gespräch, vor dem sich Elisabeth am allermeisten fürchtete:
Wenn Vater ihr die Rosen ganz verbieten würde.
Doch es kam völlig anders.
Kaum hatte sie den Salon betreten und eilig in Richtung Sitzgruppe geknickst, den Blick noch nicht einmal vorsichtig gehoben, um auszumachen, wo genau sich ihr Vater und die Gräfin im Raum befanden, da ertönte bereits der stählerne Bariton des Freiherrn. Er klang heute viel heller und lauter als sonst, ja, beinahe gut gelaunt, als er sprach:
»Elisabeth! Du bist pünktlich, das ist gut. Ich habe großartige Neuigkeiten.«
Und nur einen Atemzug später fügte er hinzu: »Ich habe einen Gatten für dich gefunden. Du wirst heiraten.«
KAPITEL ZWEI
Das Leben einer Einsiedlerin brachte so manchen Vorteil mit sich. Man musste sich nicht täglich Gedanken darum machen, ob man etwas Erhellendes von sich gab, wenn man nach dem eigenen Wohlbefinden gefragt wurde. Man musste weder Eloquenz noch Wissen vortäuschen, um Gespräche zu bewältigen. Genaugenommen benötigte man die eigene Stimme kaum, manches Mal sprach Elisabeth eine volle Woche mit keiner Seele.
Der Nachteil daran war selbstverständlich, dass diese Stimme dann außer Übung war. Und die Gedanken, die man zuvor formen musste, bevor man sprach, die sollte man im besten Falle zuvor ordnen, sich klare Sätze zurechtlegen, prägnante Fragen formulieren.
All das versuchte Elisabeth nach Kräften, während sie mit zitternden Knien am Esstisch saß, mittig an der langen Tafel platziert, gut acht Fuß entfernt von ihrem Vater und der Gräfin an den beiden Stirnseiten des Tisches. Sie versuchte Worte finden, das wirre Unverständnis in ihrem Kopf in klare Fragen, in strukturierte Sätze zu bringen, doch es wollte ihr einfach nicht gelingen. Hinzukam, dass ihr Vater, seit sie Platz genommen hatten, nicht wirklich eine Redepause eingelegt hatte. Und sie versuchte, ihm zuzuhören, sie versuchte es wirklich, denn Himmel, hier ging es schließlich um ihre gesamte Zukunft, aber Vater erzählte so viel, so schnell, ihr armer Kopf kam einfach nicht hinterher. Fetzen nahm sie auf, kleine Satzteile und einzelne Worte, auf die sie versuchte, sich einen Reim zu machen, das große Ganze zu verstehen. Ihr Vater sprach von gesellschaftlichen Verbindungen. Tausend verschiedene Namen wurden genannt, die Elisabeth allesamt nicht kannte. Er redete über Pflichten und Aussteuer, über Vermählung und Kosten, über doppelt gelegte Schleier, über seine eigene Schulzeit, über das Palais Traun in Wiesbaden, über die Gräfin und die Pflege von wichtigen Freundschaften und sogar über das Theater. Und Elisabeth versuchte wirklich, wirklich, alles, was er erzählte, zu verstehen, doch er redete ohne Punkt und Komma und sie war überzeugt, er hatte in ihrem ganzen Leben noch nie so viel mit ihr gesprochen.
Und dann, so abrupt, dass Elisabeth erschrocken zusammenzuckte, erhob er sich von seinem Stuhl und trat auf sie zu, so nah, dass sie einen Moment fürchtete, er würde sie berühren, etwas, dass er nicht mehr getan hatte, seit …
»Hier.« Keine Hand berührte ihre zitternde Schulter, keine väterliche Bewegung ermutigte sie, den Blick zu heben. Stattdessen landete ein blütenweißes Briefkuvert auf ihrem Platzteller, genau in ihrem Blickfeld und einen Moment brauchte Elisabeths Verstand, um zu begreifen, dass dieser Brief direkt an sie adressiert war. An sie, mit ihrem vollen Namen und das war … nun, sie hatte keine Worte dafür.
Noch nie. Noch nie hatte sie ihren eigenen Namen ausgeschrieben auf einem Stück Papier gesehen. Geschrieben von einer unbekannten Person mit fremder Handschrift, ein wenig größer und eckiger als ihre Eigene, aber sehr viel eleganter und ordentlicher, als die wenigen Zeilen, die ihr Vater ihr manches Mal schrieb, wenn er es vermeiden wollte, ihr gewisse Dinge direkt von Angesicht zu Angesicht sagen zu müssen.
An Fräulein Elisabeth von Griesheim.
Und ihr Herz flatterte mit einem Male ganz wild in ihrer Brust, das Zittern ihrer Knie befiel plötzlich selbst ihre Hände, die Finger kribbelten, als wollten sie gerne nach dem Brief greifen, herausfinden, was wohl darin stand.
»Vielleicht möchte sich Elisabeth zurückziehen, um dies alles auf sich wirken zu lassen.« Ertönte die Stimme der Gräfin von der Seite und Elisabeth war einen Moment so voll sprachloser Fassungslosigkeit, dass sie unbedacht den Kopf hob, ihr Blick den der Gräfin fand. Denn diese hatte weder für Elisabeths Sache jemals Partei ergriffen noch je ein einziges liebevolles Wort an ihre Ziehtochter verschwendet. Die Gräfin sprach über sie, nicht mit ihr, aber ihr Vorschlag war so dermaßen freundlich, so bedacht und empathisch.
Mit einem spontan würgenden Geräusch reinsten Ekels zuckte die Gräfin zusammen, als Elisabeth spontan den Blick hob, ließ diese sofort und auf der Stelle bereuen, was sie getan hatte. Den Blick starr ins Nichts gerichtet, den Hals möglichst weit von Elisabeth fortgedreht, sprach sie weiter:
»Dann dürften auch wir in Ruhe dinieren. Ich denke, das haben wir alle verdient.« Und Elisabeth versuchte beim wehklagenden Unterton der Gräfin nicht zusammenzuzucken, während sie ihren Blick zurück Richtung Teller zwang, den Vorhang aus dunklen Locken zurück über ihre Züge fallen ließ.
»Ein sehr guter Plan, meine Teuerste!«, lobte ihr Vater lautstark und dann, ein wenig leiser, wandte er sich an seine Tochter:
»Wir lassen dir ein Tablett nach oben bringen. Bitte schreibe bis morgen früh eine Antwort. Das gebietet die Höflichkeit.«
Und dann, noch leiser, sodass es nur Elisabeth, aber kein anderer im Raum zu hören vermochte, fügte er noch hinzu:
»Ich denke, ich muss nicht erwähnen, was für eine großartige Chance das ist. Ich erwarte eine perfekte Antwort.«
Durch den Schleier ihrer Haare sah sie die wedelnde Handbewegung ihres Vaters, der Wink, der ihr befahl, zu verschwinden.
Abrupt kam Elisabeth auf die Füße, knickste hastig und floh.
Floh vor den beiden Menschen, die nicht einmal ein einziges Diner zwischen Weihnachten und Geburtstag mit ihr ertrugen. Floh vor der Herablassung ihrer Stiefmutter und dem Diktat ihres Vaters. Floh mit weiterhin ungeklärten Fragen, dutzenden, die in ihrem Kopf schwirrten wie ein Schwarm wilder Bienen.
Aber an ihre Brust gedrückt hielt sie einen Brief.
Einen Brief von einem Mann. Von dem Mann. Dem einen Mann, der bereit schien, sie vielleicht zu ehelichen. Und flink eilte sie die Unzahl von Stufen hinauf, weil sie es kaum mehr abwarten konnte, seine Zeilen an sie zu lesen.
Bitte sei ein freundlicher Mann, beschwor sie inbrünstig.
Bitte sei ein guter Mensch mit ehrlichem Charakter und ohne viele Wünsche an die Schönheit und Wohlgestalt einer Gattin.
*
Caspar wäre am liebsten zurück in seine kleine Junggesellenbehausung in Heidelbergs Innenstadt geflüchtet. Drei Tage unter einem Dach mit seinem Vater waren das Äußerste, was man ihm abverlangen konnte und drei Tage mit Vater und Georg – nun, das kam einem Kriegsverbrechen gleich. Caspar hatte zwar in keinem Krieg gedient, aber so in etwa stellte er sich Kriegsverbrechen vor: Unerträgliche Qual, gepaart mit einem frischen Reigen von wortreichen Erniedrigungen und der immerwährenden Unfreiheit, seine eigene Meinung kundtun zu dürfen.
Doch eine Sache hielt ihn festgekettet an Schloss Landau und das war der Brief. Jener Antwortbrief, der bald eintreffen würde. Musste, wenn Caspar richtig zählte. Fünfzehn Tage war es her, dass er seinen eigenen Brief an die unbekannte Elisabeth von Griesheim gesendet hatte, in dem er – ziemlich unverblümt – geschrieben hatte:
Schloss Landau, 1819
Holdes Fräulein von Griesheim,
was habe ich geschwankt, zwischen ›hold‹ und ›teuer‹ und auch zwischen ›wertes‹ und ›hochgeachtetes‹ Fräulein. Schon die Anrede des Briefes bringt mich um den Schlaf und dabei habe ich noch so viel Aufsehenerregendes hineinzuschreiben. Fallt bloß nicht in Ohnmacht! Zumindest noch nicht, denn ich bin sehr weit entfernt und kann euch nur schwer auffangen. Wir müssen diesen Teil des Werbens auf den Zeitpunkt verschieben, an dem wir einander gegenüberstehen. Aber seid versichert: Ich bin von einigermaßen robuster Statur, daher sollte es mir möglich sein, euch in jedem Fall vor einer Begegnung mit dem Fußboden zu erretten. Seid so gnädig und fallt dann bitte in meine Richtung.
Nun, genug der Scherze: Ich schreibe euch, um euch mit den unglaublichen Neuigkeiten vertraut zu machen, dass ich es bin, der auf Wunsch meiner Familie, euch den Hof machen soll. Es mag für den Erfolg dieses Werbens hinderlich sein, dass dies per Brief geschieht, aber schon der ein oder andere Freund hat mich vom Irrglauben befreit, ich sei eine Wohltat für die Augen, daher ist dies hier vielleicht sogar der allerbeste Ansatz.
Mein Name ist Caspar Felix Gustav von Landau und ich bin dritter Sohn des Landbarons von Landau, pendle zwischen Schloss Landau und Heidelberg hin und her und war – es sei gleich dazu gesagt! – noch niemals in Wiesbaden. Es bleibt also an Euch, mir über die Schönheit eurer Heimat zu berichten. Und falls Ihr das ein oder andere gedenkt, großzügig auszuschmücken, um Wiesbaden attraktiver klingen zu lassen, so wisset: Ich bin ebenso vergesslich wie verzeihend. Doch seid gewarnt: Ich mag vielleicht durchweg äußerst schlechte Schulnoten in Geographie erhalten haben, aber selbst ich weiß, dass Wiesbaden unmöglich an einem weißen Sandstrand liegen kann und auch bei Euch müssen Palmen und Südfrüchte importiert werden! Falls ihr übrigens Sehnsucht nach Palmen, Südfrüchten oder einem Sandstrand habt, so zögert nicht, mir dies zu schreiben. Ich persönlich finde, es muss in jedem Fall die frischgebackene Braut sein, die das Ziel einer Hochzeitsreise festlegt.
Doch bis wir diese Entscheidung zu fällen hätten, gäbe es noch einige andere, die zuvor entschiedenen werden müssen. Und dafür empfiehlt es sich wohl, sich ein wenig besser kennenzulernen. Und weil es mehrere Tagesreisen sind, die ich von Wiesbaden entfernt bin, so denke ich, ist ein erster Briefwechsel vermutlich das Taktvollste, was ich Ihnen (holdes, teures, wertes, hochachtungsvolles) Fräulein von Griesheim anbieten kann.
Sollten meine Zeilen Euer Wohlwollen finden, so schreibt mir bitte folgendes: Wie dürfte ich euch nennen? Mich, das würde mich am meisten erfreuen, nennt bitte einfach
Euer Caspar
Er hatte die Zeilen aus einer Laune heraus verfasst, wenig bis gar nicht darüber nachgedacht, sondern einfach los geschrieben, im Hinterkopf eine leise Stimme ignorierend, die hohl anfragte, ob das lapidare Herunterschreiben wohl ein Versuch war, Vaters Wunsch nach dieser Verbindung zu torpedieren. Die unbekannte Elisabeth – Caspar wusste weder ihr genaues Alter noch sonst etwas über ihr Gemüt und ihre Reife – könnte vielleicht auch ein wohlbehütetes kleines Lämmchen sein und beim Lesen seiner unverblümten Worte in Ohnmacht fallen.
Oder sie war eine graziöse Debütantin voller exakter Vorstellungen an einen formvollendeten Bewunderer. Dann würde sie seinen Versuch, locker und geistreich zu sein, vermutlich zu Tode beleidigt und aufs Tiefste getroffen, vollumfänglich abweisen.
Und Caspar war sich immer noch nicht sicher, ob er nicht genau darauf angespielt hatte. Ob sein beinahe schon obszön lapidar formulierter Brief nichts weiter als eine Probe war, ein Versuch, von Ferne zu erfahren, ob es sich bei der unbekannten Dame um jemanden handelte, den er unmöglich für längere Zeit ertragen konnte, geschweige denn für immer.
Nein, sie musste seinem Humor mit Nachsicht begegnen und seine offenen Worte schätzen, statt diese zu verurteilen, nur dann gäbe es eine Möglichkeit, eine Aussicht auf eine mögliche Verbindung zwischen ihnen beiden. Und um das zu erfahren, brauchte Caspar endlich Antwort von ihr, brauchte diese so dringend, er konnte sich beinahe auf nichts anderes mehr konzentrieren.
Und heute war der fünfzehnte Tag des Wartens angebrochen und als schließlich Roland, Vaters oberster Butler, mit der Tagespost auf einem Silbertablett im Türrahmen des Salons erschien, eilte Caspar ihm entgegen, wie sonst nur junge Hunde auf Futter und davonlaufende Hasen zustürmten, und er pflückte in einer einzigen schwungvollen Handbewegung den gesamten Stapel Post vom Tablett, fleißige Finger blätterten geschwind durch ein halbes Dutzend Briefe und dann – einen vollen Herzschlag tat Caspar nichts weiter als erleichtert auszuatmen – hielt er ihn in Händen:
An Caspar F. G. von Landau persönlich
Und es war ein denkwürdiger Moment, in dem Caspar nicht einen winzigen Deut auf Georgs beißenden Kommentar gab, die brüderliche Beleidigung mit keinerlei Reaktion, nicht einmal mit einem Schulterzucken würdigte, sondern einfach nur aus dem Salon stapfte, eilig und schnell, während seine Finger bereits das Siegel brachen und den Brief auffalteten:
Schloss von Traun, 1819
Werter Caspar,
ich weiß nicht, wie viele Versionen Eures Briefes Ihr schreiben musstet, bevor Ihr mit Eurer finalen Version zufrieden wart, aber ich möchte Eurer Ehrlichkeit mit noch mehr Ehrlichkeit von meiner Seite begegnen und gestehe: Fünf.
Fünf makellose Bögen Büttenpapier sind meinen ersten Gedanken zum Opfer gefallen, bevor dies hier nun, mein sechster Versuch, hoffentlich der Brief sein wird, der Euch erreicht.
Und ohne Euch auch nur im Entferntesten auf die Folter spannen zu wollen, komme ich Eurer Bitte sofort und unverzüglich nach: Ihr fragtet, wie Ihr mich nennen dürft und nun, ich hatte fünf Ansätze Zeit, die allesamt versuchten zu erklären, warum ich es mir wünsche, so genannt zu werden, aber alle davon waren nur die Halbwahrheit und, wie oben geschworen: Ich möchte stets und immer ehrlich zu Euch sein!
Bitte nennt mich Lissi. Ich habe keine lustige Anekdote oder ähnliches, mit der ich diese Bitte ausschmücken könnte, aber meine Mutter nannte mich Lissi, bis zu ihrem viel zu frühen Tod und seither nennt mich niemand so. Zu wissen, es gäbe nun doch eine Person auf dieser Erde, die meinen Spitznamen benutzt, ist ein wundervolles Gefühl und die Formlosigkeit Eures Briefes (verzeiht meine Verwegenheit!) lässt mich hoffen, Ihr seid einer formlosen Anrede nicht abgeneigt.
Und des Weiteren kann ich sagen: Ich mag weder Sandstrände, noch Palmen, noch Südfrüchte übermäßig. Allerdings spreche ich hier nicht aus Erfahrung, sondern gebe eine reine Vermutung ab. Ich war noch niemals an einem Sandstrand und ich aß auch noch keine Südfrucht. Palmen (in Kübeln) säumen zwar die Terrassen von Schloss Traun, aber sie sind, wie ihr richtig vermutet habt, alle importiert.
Über Wiesbaden weiß ich selbst vermutlich nicht mehr als ihr. Aber wenn ich die Gäste der Gräfin von Traun manches Mal über die Stadt sprechen höre, dann sind die meisten voller Lob. Ich gestehe es gleich: Ich lebe äußerst zurückgezogen. Wenn Ihr also große Hoffnungen auf eine weltgewandte Gattin voller gesellschaftlicher Raffinesse habt, werde ich Euch bitter enttäuschen. Wenn Ihr aber zufällig Interesse an der Botanik habt, besonders an heimischer Flora und Fauna, ganz besonders an Rosen, so wäre ich eine ideale Gesprächspartnerin. Ich weiß sehr viel über Zucht und Pflege der kleinen dornigen Geschöpfe, ein Wissen, das ich meiner verstorbenen Mutter verdanke und ich versuche stets, jeden Tag noch mehr zu erfahren.
Ein wichtiger Punkt aus eurem Brief ist noch offen und ich möchte dazu Folgendes schreiben:
zwischen hold und wert und hochgeachtet und teuer habt Ihr geschwankt und ich teile eure Ansicht, dass es schwer sein mag, sich zu entscheiden, wenn man die adressierte Person nicht kennt. Ich persönlich finde, hold und hochgeachtet sind Zuschreibungen, die nur für Personen gelten, die außerordentlich mächtig sind. Dazu zähle ich ganz bestimmt nicht. Und teuer kann man dem Verfasser des Briefes auch nur dann sein, wenn dieser die Person bereits kennt. Aber wert … nun, ich denke, jeder Mensch ist etwas wert. Gleichgültig, ob er einen Titel trägt oder ein einfacher Bürger ist. Gleichgültig, ob man schön anzusehen ist oder nicht. Und daher möchte ich meinen Brief mit folgender Frage schließen:
Seht Ihr das genauso?
Eure Lissi
In Caspars Brust nistete plötzlich ein merkwürdig schweres Gefühl und um sich abzulenken, las er den Brief noch einmal und noch einmal und erst, als sein Verstand die Zeilen bereits voraussagen konnte, erst als er Wort für Wort dieses Briefes so in sich aufgesogen hatte, dass er jedes davon auswendig kannte, erst da erkannte er das leichte, beinahe schwindelige Gefühl in seinem Kopf als Erleichterung.
Elisabeth von Griesheim war ein feiner Mensch. Mit Humor und einem liebevollen Charakter, voller spannender Aspekte, die Caspar plötzlich alle kennenlernen wollte. Sofort und unverzüglich. Und deswegen setzte er sich auch direkt an den nächstbesten Sekretär und verfasste eine Antwort.
*
Grundsätzlich erforderten die Aufzucht und Pflege von kapriziösen Geschöpfen wie Rosen vor allem eines: Geduld. Man durfte nicht ungeduldig werden, wenn es um den richtigen Zeitpunkt des Umtopfens ging, den richtigen Zeitpunkt, Ableger zu ziehen, den richtigen Zeitpunkt, um zu gießen. Tatsächlich hätte Lissi beschworen, dass sie eine überaus geduldige Person war.
Leider jedoch war sie in den letzten Tagen eines Besseren belehrt worden. Acht Tage war es her, dass sie den kleinen Brief auf das Posttablett im Foyer gelegt und – gut versteckt hinter den gedrechselten Streben der im Halbdunkel liegenden Galerie – heimlich beobachtet hatte, wie der oberste Diener der Gräfin höchstselbst den gesamten Schwung gepackt und dem Laufburschen der Post überreicht hatte. Sie hatte wirklich keine Vorstellung davon, wie lange so ein Brief unterwegs war, sie war nicht einmal sicher, wie weit Schloss Landau von Schloss Traun entfernt sein mochte. Sie wusste nur eines: Jeder Tag, der verstrich, ohne dass ein weiteres Kuvert auf ihrem Frühstücks- oder Dinertablett lag, war ein Tag, der an ihr nagte und sie zerbrach sich den Kopf über die müßigsten Kleinigkeiten. Warum hatte sie ihn direkt gebeten, sie mit einem Kosenamen anzusprechen? Das war viel zu viel verlangt, zu vertraut und übergriffig! Außerdem, wieso nur hatte sie ihn (indirekt zwar, aber dennoch) mit einem Bürgerlichen gleichgesetzt? Er war immerhin Sohn eines Barons und damit auf jeden Fall von adeligem Geschlecht.
Und hatte sie zu viel von sich preisgegeben, als sie schrieb, auch Menschen ohne ein hübsches Äußeres wären etwas wert? Hatte er herausgelesen, dass sie hässlich war? Dass sie jeden Spiegel mied, ja selbst bei Fensterglas sicherheitshalber den Blick senkte?
Vielleicht würde er ihr niemals antworten, vielleicht waren die wenigen Zeilen ihres Briefes an ihn genug, um ihn davon zu überzeugen, dass sie keinesfalls die richtige Kandidatin für ihn wäre und das wäre schlimm, Lissi verstand sich selbst gar nicht so richtig, aber es steckte ihr wie ein spitzer Stein in der Kehle, wenn sie an seine ersten Zeilen an sie dachte. Welche ungläubige Freude sie beim Lesen seiner erfrischend ehrlichen Worte empfunden hatte. Wie oft hatte sie in den letzten Tagen geschmunzelt, beim Gedanken daran, dass Sie ihm eines Tages gegenüberstehen würde, die ersten Worte von ihren Lippen wären ein ›Ich verspreche, wenn ich falle, falle ich in Eure Richtung!‹. In diesem Gedankenspiel war sie eine andere Frau. Eine Frau ohne Narben – innerlich wie äußerlich. Sie wäre schön anzusehen gewesen und auf ihren Witz hin, hätten sich seine Gesichtszüge zu einem Lächeln, einem vergnügten Grinsen hin verzogen und sie hätten diesen gemeinsamen Scherz geteilt und später ein Gelübde und dann ein Bett und … »Autsch.«
Hastig drückte sie den verletzten Daumen in die Falten ihrer Gärtnerschürze, presste fest, dort, wo sie mit der Rosenschere abgerutscht war und sich geschnitten hatte. Normalerweise passierte das nicht. Normalerweise schnitt sie sich nicht, denn normalerweise war sie nicht so gedankenversunken bei der Arbeit, dass sie sogar vergaß, ihre Handschuhe anzuziehen. Das hatte sie nun davon!
Während sie sich den schmutzigen, blutigen Daumen in den Mund steckte, wanderte ihr Blick flink von rechts nach links, aber hier war einfach nichts, was sich als Pflaster oder Verband nutzen ließ und obgleich sie mit ihrer Arbeit noch nicht fertig war, eilte sie schließlich – wie immer vorsichtig darauf bedacht, außerhalb des Blickfelds der Terrassen zu bleiben – und huschte durch die Dienstbotengänge zurück in ihre Kammer, in Gedanken bereits bei dem bunten Haufen Stoffreste, den sie in einem alten Obstkorb hortete und der ihr sowohl beim Stopfen der zahlreichen Löcher ihrer Kleider, als auch beim Verarzten der vielen kleinen Verletzungen von tausend blutrünstigen Dornen schon die besten Dienste erwiesen hatte.