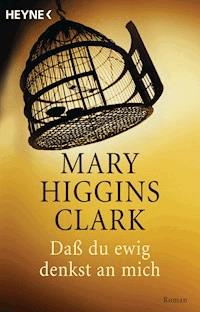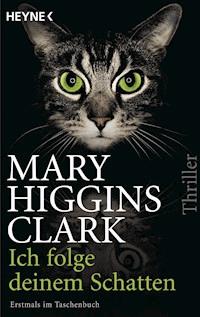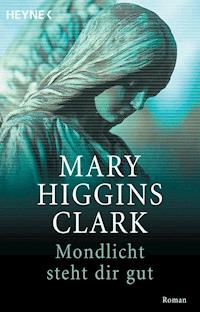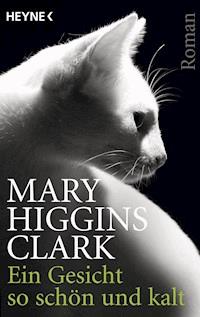9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach einem privaten Drama braucht die Edelsteinexpertin Celia dringend eine Auszeit. Erleichtert nimmt sie die Einladung an, auf einem Kreuzfahrtschiff Vorträge zu halten. Dort freundet sie sich mit Lady Em an, einer reichen alten Dame, die eine unschätzbar wertvolle Smaragdkette besitzt. Drei Tage später, mitten auf hoher See, wird Lady Em ermordet aufgefunden – und die Kette ist verschwunden. Celia ist entschlossen, die Tat aufzuklären. Auch wenn die Liste der Verdächtigen immer länger wird. Und auch wenn sie sich ihres eigenen Lebens an Bord bald nicht mehr sicher sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Die Edelsteinexpertin Celia Kilbride ist am Boden zerstört: Ihr Verlobter hat sich als Finanzbetrüger entpuppt, der selbst ihre besten Freunde um ihr Erspartes gebracht hat. Auch Celia wird verdächtigt, mit ihm unter einer Decke zu stecken. Da erhält sie ein rettendes Angebot: Sie soll auf einer luxuriösen Kreuzfahrt Vorträge halten. An Bord lernt sie eine 86-jährige Dame kennen, Lady Em, die ein sagenumwoben wertvolles und angeblich fluchbeladenes Smaragdcollier besitzt. Und der Fluch scheint sich zu erfüllen: Nach drei Tagen wird Lady Em ermordet aufgefunden, die Kette ist verschwunden. Der Täter muss noch an Bord sein. Aber wer war es? Die scheinbar so treu ergebene Assistentin der Lady? Ihr etwas zwielichtiger Vermögensverwalter? Der vergeistigte Shakespeare-Experte? Es kommt zu weiteren Zwischenfällen, auch Celia selbst gerät in Gefahr. Und während das Schiff auf einen Sturm zusteuert, spitzt sich die Lage immer mehr zu …
Zum Autor
Mary Higgins Clark, geboren in New York, lebt und arbeitet in Saddle River, New Jersey. Sie zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautoren weltweit. Ihre große Stärke sind ausgefeilte und raffinierte Plots und die stimmige Psychologie ihrer Heldinnen. Mit ihren Büchern führt Mary Higgins Clark regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an. Sie hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. den begehrten Edgar Award. Zuletzt bei Heyne erschienen: Und niemand soll dich finden.
MARY
HIGGINS
CLARK
EINSAM BIST DU
UND ALLEIN
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karl-Heinz Ebnet
In Erinnerung an meine Mutter und meinen Vater,
Luke und Nora Higgins
und meine Brüder
Joseph und John,
in Liebe
ERSTER TAG
1
Das Kreuzfahrtschiff Queen Charlotte lag kurz vor seiner Jungfernfahrt an der Anlegestelle im Hudson River. Das herrliche Schiff, der Inbegriff von Luxus, wurde bereits mit der ersten Queen Mary und sogar mit der an Prunk kaum zu überbietenden Titanic verglichen.
Die Passagiere gingen an Bord, checkten ein und wurden im Anschluss daran in die Grand Lounge gebeten, wo ihnen von weiß behandschuhten Kellnern Champagner serviert wurde. Nachdem der letzte Gast an Bord war, bat Kapitän Fairfax um Aufmerksamkeit für seine Willkommensrede.
»Wir versprechen Ihnen auf dieser Reise ein Maß an Luxus und Komfort, wie Sie es noch nie erlebt haben und nie mehr erleben werden«, verkündete er in seinem makellosen britischen Akzent, der seinen Worten gleich noch mehr Glanz verlieh. »Die Ausstattung der Kabinen steht ganz in der Tradition der wunderbaren Linienschiffe vergangener Zeiten. Die Queen Charlotte bietet Platz für exakt einhundert Gäste. Unsere fünfundachtzigköpfige Crew steht Ihnen rund um die Uhr und in jeder Hinsicht zu Diensten. Das Unterhaltungsprogramm ist eines Broadways, einer Carnegie Hall und einer Metropolitan Opera würdig. Daneben bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Vorträgen, und zu unseren Dozenten gehören berühmte Autoren, ehemalige Diplomaten und Experten zu Themen wie Literatur oder Edelsteinkunde. Herausragende Köche, die Meister ihrer Zunft, bereiten Ihnen aus den frischesten Zutaten die himmlischsten Gerichte zu, die auf Rezepten der besten Küchenchefs der Welt beruhen. Natürlich wissen wir, dass Kreuzfahrten den Durst anregen. Deshalb dürfen wir Sie zu mehreren Weinverkostungen einladen, die von anerkannten Weinkennern geleitet werden. Im Einklang mit dem Charakter dieser Kreuzfahrt – und zur Illustration der reizenden Umgangsformen, derer man sich in der Vergangenheit bediente – wird es eine Lesung aus einem der Werke von Emily Post geben, der berühmten Autorin mit ihrem untrüglichen Gespür für die gesellschaftliche Etikette ihrer Zeit.
Jetzt aber heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen auf unserem Schiff, das für die folgenden sechs Tage Ihr Zuhause sein wird.
Und abschließend möchte ich Sie noch mit Gregory Morrison bekannt machen, dem Eigner der Queen Charlotte. Ihm ist es zu verdanken, dass auf diesem Schiff alles bis hin zum kleinsten Detail in Perfektion geplant wurde und Sie deshalb die exklusivste Kreuzfahrt genießen dürfen, die Sie jemals erleben werden.«
Gregory Morrison, ein stämmiger, rotgesichtiger Mann mit silbergrauem Haar und durchdringenden braunen Augen, trat vor.
»Ich möchte Sie herzlich an Bord begrüßen. Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung – ein Traum, den ich seit über fünfzig Jahren habe, seitdem ich ein kleiner Junge war. Damals stand ich neben meinem Vater, einem Schlepperkapitän, der die wunderbarsten Kreuzfahrtschiffe in und aus dem New Yorker Hafen bugsierte, aber während mein Vater den Blick immer nach vorn gerichtet hielt, richtete ich ihn voller Ehrfurcht nach hinten zu den großartigen und eleganten Schiffen, die den grauen Hudson River durchschnitten. Damals wusste ich: Eines Tages möchte ich ein Schiff auf Kiel legen, das noch Ehrfurcht gebietender sein soll als jene Schiffe, die ich damals so sehr bewunderte. Die Queen Charlotte ist die Verwirklichung dieses Traums, den ich zu träumen gewagt habe. Ganz egal, ob Sie sechs Tage bis Southampton an Bord bleiben oder uns neunzig Tage lang auf unserer Weltreise begleiten, in jedem Fall hoffe ich, dass der heutige Tag am Beginn eines Erlebnisses steht, das Sie niemals vergessen werden.« Er hob sein Glas: »Die Leinen los!«
Donnernder Applaus setzte ein, dann wandten sich die Passagiere ihren jeweiligen Nachbarn zu, um sich einander vorzustellen. Alvirah und Willy Meehan, die ihren fünfundvierzigsten Hochzeitstag feierten, genossen ihr großes Glück. Vor ihrem Lottogewinn hatte sie als Putzfrau gearbeitet, während er sich als Klempner mit Rohrbrüchen und verstopften Toiletten herumgeschlagen hatte.
Ted Cavanaugh nahm ein Glas Champagner in Empfang und sah sich um. Er erkannte einige Gäste an Bord, unter anderem die Vorstandsvorsitzenden von General Electric und Goldman Sachs sowie mehrere Pärchen aus Hollywoods erster Schauspielerriege.
Jemand sprach ihn an. »Kann es sein, dass Sie mit dem Botschafter Mark Cavanaugh verwandt sind? Sie sehen ihm nämlich verblüffend ähnlich.«
»Ja.« Ted lächelte. »Ich bin sein Sohn.«
»Wusste ich’s doch, dass ich mich nicht getäuscht habe. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Charles Chillingsworth.«
Ted kannte den Namen. Es handelte sich um den ehemaligen, mittlerweile in den Ruhestand versetzten Botschafter in Frankreich.
»Ihr Vater und ich waren junge Attachés«, erzählte Chillingsworth. »Alle jungen Frauen in der Botschaft haben Ihrem Vater damals schöne Augen gemacht. Ich sagte ihm immer, keiner habe es verdient, so gut auszusehen. Er hat, soweit ich mich erinnere, unter zwei Präsidenten in Ägypten gedient und dann in Großbritannien.«
»Ja«, bestätigte Ted. »Mein Vater war von Ägypten fasziniert, und ich teile seine Leidenschaft. Ich bin dort aufgewachsen, vor unserem Umzug nach London, bevor er dort Botschafter wurde.«
»Und Sie sind in seine Fußstapfen getreten?«
»Nein, ich bin Anwalt. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist dem Aufspüren von alten Kunstwerken gewidmet, die in ihren Ursprungsländern gestohlen wurden.« Den wahren Grund für seine Reise behielt er allerdings für sich. Er wollte nämlich bei Lady Emily Haywood vorstellig werden und sie davon überzeugen, ihre berühmte Smaragdhalskette der Kleopatra dem rechtmäßigen Eigentümer, dem ägyptischen Volk, zurückzugeben.
Professor Henry Longworth, der das Gespräch zufällig mitanhörte, trat interessiert näher. Er galt als renommierter Shakespeare-Kenner, der mit seinen Vorträgen und Rezitationen aus den Werken des großen Dichters das Publikum zu begeistern wusste. Er war von mittlerer Größe, in den Sechzigern und ein gesuchter Redner auf solchen Kreuzfahrten sowie an Colleges.
Devon Michaelson hielt sich etwas abseits von den übrigen Gästen. Er hatte keine Lust auf den Small Talk, wie er sich unweigerlich ergab, wenn sich Menschen zum ersten Mal begegneten. Wie Professor Longworth war er Anfang sechzig, von durchschnittlicher Größe und ohne besondere äußere Merkmale.
Ebenfalls abseits stand die achtundzwanzigjährige Celia Kilbride. Sie war groß, hatte schwarze Haare und saphirblaue Augen. Weder bemerkte sie die bewundernden Blicke, die ihr zugeworfen wurden, noch hätte sie sich darauf etwas eingebildet, wenn sie ihr aufgefallen wären.
Der erste Zwischenstopp auf der Reise um die Welt würde Southampton in England sein. Dort würde sie von Bord gehen. Wie Professor Longworth war sie als Vortragende eingeladen und würde als Gemmologin von der mitunter jahrhundertealten Geschichte berühmter Edelsteine erzählen.
Am aufgeregtesten aber war die geschiedene sechsundfünfzigjährige Anna DeMille aus Kansas, die die Kreuzfahrt als ersten Preis in einer Kirchentombola gewonnen hatte. Ihre schwarz gefärbten Haare und Augenbrauen bildeten einen starken Kontrast zu ihrem sonst blassen, hageren Gesicht und schmalen Körper. Sie hoffte, auf dieser Reise endlich ihren Traumprinzen kennenzulernen. Warum nicht?, sagte sie sich. Ich hab die Tombola gewonnen. Vielleicht wird das ja mein Glücksjahr!
Die sechsundachtzigjährige, für ihren Reichtum und ihre philanthropischen Neigungen bekannte Lady Emily Haywood war von jenen Gästen umgeben, die sie zu dieser Seereise eingeladen hatte: Brenda Martin, seit zwanzig Jahren ihre persönliche Assistentin und Begleiterin, Roger Pearson, ihrem Investmentberater und Erbschaftsverwalter, sowie Rogers Ehefrau Yvonne.
In einem Interview zu dieser Kreuzfahrt hatte Lady Emily bekannt gegeben, dass sie ihre legendäre Kleopatra-Smaragdhalskette mitnehmen und zum ersten Mal in der Öffentlichkeit tragen wolle.
Während sich die Passagiere zerstreuten und sich gegenseitig eine gute Reise wünschten, konnten sie natürlich nicht wissen, dass mindestens einer von ihnen Southampton nicht mehr lebend erreichen würde.
2
Statt ihre Kabine aufzusuchen, trat Celia Kilbride an die Reling und sah zu, wie das Schiff langsam an der Freiheitsstatue vorbeiglitt. Sie würde noch nicht einmal eine Woche an Bord sein, aber das sollte reichen, um etwas Abstand zu gewinnen von der sensationslüsternen Medienberichterstattung über Steven, ihren Exverlobten, der keine vierundzwanzig Stunden vor ihrer Hochzeit verhaftet worden war. War das wirklich alles erst vier Wochen her?
Sie hatten sich beim Probedinner zugeprostet, als plötzlich FBI-Beamte im Speisesaal des 21 Club auftauchten. Der Fotograf hatte gerade einen Schnappschuss von ihnen allen zusammen gemacht sowie weitere Nahaufnahmen des fünfkarätigen Verlobungsrings an ihrem Finger.
Der attraktive, charmante, geistreiche Steven Thorne – er hatte ihre Freunde dazu überredet, in seinen Hedgefonds zu investieren, der jedoch vor allem dazu diente, seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Gott sei Dank ist er noch vor der Hochzeit verhaftet worden, dachte Celia. Zumindest das ist mir also erspart geblieben.
So vieles im Leben hängt vom Zufall ab, dachte sie. Zwei Jahre zuvor, kurz nach dem Tod ihres Vaters, hatte sie in London an einem gemmologischen Seminar teilgenommen. Da ihr Arbeitgeber, Carruthers Jewelers, ihr ein Ticket in der Businessclass besorgt hatte, war sie zum ersten Mal nicht in der Holzklasse geflogen.
Auf dem Rückflug nach New York – sie hatte gerade ihren Platz eingenommen und an ihrem zur Begrüßung gereichten Glas Wein genippt – verstaute ein tadellos gekleideter Mann seinen Aktenkoffer im oberen Gepäckfach und ließ sich auf den Sitz neben ihr fallen. »Steven Thorne«, stellte er sich mit einem einnehmenden Lächeln vor und streckte ihr die Hand hin. Er erklärte, dass er eine Investment-Konferenz besucht habe, und als sie in New York landeten, hatte sie sich einverstanden erklärt, mit ihm essen zu gehen.
Celia schüttelte den Kopf. Wie konnte sie bei einem Menschen bloß so falschliegen, sie, die Gemmologin, die bei einem Edelstein noch den geringsten Makel entdecken würde? Tief atmete sie die wunderbare Meeresluft ein. Ich will nicht mehr an Steven denken, nahm sie sich vor. Aber sie würde nur schwer vergessen können, dass viele ihrer Freunde Geld in den Fonds investiert hatten, weil sie sie mit Steven bekannt gemacht hatte – Geld, auf das sie angewiesen waren. Sie war vom FBI verhört worden. Natürlich musste die Polizei annehmen, dass sie an der Hochstapelei beteiligt gewesen war, obwohl sie selbst ebenfalls Geld in den betrügerischen Fonds gesteckt hatte.
Sie hatte gehofft, niemanden unter ihren Mitreisenden zu kennen, aber es war in allen Medien verkündet worden, dass Lady Emily Haywood mit an Bord sein würde. Regelmäßig brachte die alte Dame Stücke aus ihrer umfangreichen Schmucksammlung zur Reinigung oder zur Reparatur zu Carruthers in der Fifth Avenue, und jedes Mal bestand sie darauf, dass Celia sie auf Kratzer oder abgebrochene Splitter untersuchte. Begleitet wurde sie dabei stets von ihrer persönlichen Assistentin Brenda Martin. Dann kannte sie auch noch Willy Meehan. Der hatte bei Carruthers seiner Frau Alvirah das Geschenk zu ihrem fünfundvierzigsten Hochzeitstag besorgt und ihr von ihrem Lottogewinn über vierzig Millionen Dollar erzählt. Er war ihr sofort sympathisch gewesen.
Abgesehen von den beiden Vorträgen und der Fragestunde, die sie geben sollte, würde ihr an Bord viel Zeit für sich selbst bleiben. Sie war bereits mehrmals auf Schiffen der Castle Line als Gastrednerin aufgetreten, und jedes Mal hatte ihr der für das Unterhaltungsprogramm zuständige Kreuzfahrtdirektor mitgeteilt, dass sie von den Passagieren zur interessantesten Rednerin gekürt worden war. Erst letzte Woche hatte er sie angerufen und zu dieser Schiffspassage eingeladen, nachdem ein Vortragender in letzter Minute erkrankt war.
Für sie war es ein Geschenk des Himmels. Die Reise bot ihr die Möglichkeit, dem Mitleid mancher ihrer Freunde und dem Groll derer zu entkommen, die ihretwegen Geld verloren hatten. Bin ich froh, hier sein zu können, dachte sie sich, bevor sie sich umdrehte und den Weg in ihre Kabine antrat.
Wie jeder Quadratzentimeter auf der Queen Charlotte war auch ihre exquisit eingerichtete Suite bis ins Detail mit großer Sorgfalt konzipiert worden. Sie war Salon, Schlafzimmer und Badezimmer in einem. Anders als auf den älteren Schiffen, auf denen sie bislang gefahren und auf denen die Concierge-Suite nur halb so groß gewesen war wie hier, verfügte ihre Kabine über geräumige Schränke. Die Tür öffnete sich zu einem Balkon, auf dem sie im Freien sein konnte, wenn ihr zwar nach Meeresluft war, aber nicht nach der Gesellschaft der anderen.
Sie wollte schon auf den Balkon hinaustreten, beschloss dann aber, erst ihre Sachen auszupacken und sich einzurichten. Ihr erster Vortrag würde morgen Nachmittag stattfinden, und sie wollte noch ihre Aufzeichnungen durchgehen. Thema war die Geschichte seltener Edelsteine, beginnend mit den alten Hochkulturen.
Ihr Handy klingelte. Sie hob ab und hörte eine vertraute Stimme. Steven. Er war vor dem Prozess auf Kaution freigelassen worden. »Celia, ich kann alles erklären«, begann er. Sofort beendete sie das Gespräch und schleuderte das Handy aufs Bett. Sie musste nur seine Stimme hören, und schon wand sie sich innerlich vor Scham. Ich kann den kleinsten Fehler in jedem Edelstein entdecken, dachte sie erneut verbittert.
Dann schluckte sie den Kloß im Hals hinunter und wischte sich zornig die Tränen aus den Augen.
3
Lady Emily Haywood, allen nur als »Lady Em« bekannt, saß in der teuersten Suite auf dem Schiff in kerzengerader Haltung in einem hübschen Ohrensessel. Sie war schlank und zart wie ein Vögelchen, hatte volle weiße Haare und ein runzliges Gesicht, dem ihre einstige Schönheit immer noch anzusehen war. Leicht konnte man sie sich als bezaubernde amerikanische Primaballerina vorstellen, die im Alter von zweiundzwanzig Jahren das Herz von Sir Richard Haywood im Sturm erobert hatte, des damals sechsundvierzigjährigen berühmten und wohlhabenden britischen Forschungsreisenden.
Lady Em sah sich um. Man bekommt hier schon was für sein Geld, dachte sie. Sie befand sich im Hauptraum ihrer Suite. Über dem Kamin war ein großer Fernseher angebracht, den Boden bedeckten antike Perserteppiche, an beiden Seiten des Raums standen blassgold bezogene Sofas, daneben Stühle mit dazu kontrastierenden Bezügen, antiquarische Beistelltische und eine Bar. Zur Suite gehörte darüber hinaus ein großes Schlafzimmer und ein Badezimmer, das mit einer Dampfdusche und einem Jacuzzi sowie einer Bodenheizung ausgestattet war, die Wände wiederum schmückten beeindruckende Marmormosaike. Vom Schlafzimmer und dem Hauptraum führten jeweils Türen hinaus zum privaten Balkon. Der Kühlschrank war voll mit den von ihr vorab erbetenen Snacks.
Lady Em lächelte. Sie hatte einige ihrer wertvollsten Geschmeide mit aufs Schiff genommen. Es würden bei dieser Jungfernfahrt einige Berühmtheiten an Bord sein, und wie immer hatte sie vor, sie alle in den Schatten zu stellen. Mit ihrer Zusage zur Reise hatte sie verkündet, dass sie angesichts des luxuriösen Ambientes die sagenhafte Smaragdhalskette, die angeblich einst Kleopatra gehört hatte, mitbringen und auch tragen wolle. Nach der Kreuzfahrt wollte sie sie der Smithsonian Institution vermachen. Die Kette war von unschätzbarem Wert, und da Lady Em keine Verwandten hatte, mit denen sie sich herumschlagen musste, stellte sich natürlich die Frage, wem sie die Kette hinterlassen sollte. Denn auch die ägyptische Regierung hatte Ansprüche angemeldet, da das Kunstwerk, wie behauptet wurde, aus einem geplünderten Grab stamme und deshalb zurückgegeben werden müsse. Sollen doch sie und das Smithsonian sich darum streiten, dachte Lady Em. Es wird mein erster und meiner letzter großer Auftritt mit der Kette sein.
Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spaltbreit offen, und sie konnte ihre Assistentin hören, Brenda, die drinnen den Überseekoffer und das übrige Gepäck auspackte. Brenda war die einzige unter ihren Angestellten, die Lady Ems persönliche Besitztümer anrühren durfte. Allen anderen war dies strikt untersagt.
Was würde ich ohne sie bloß machen?, fragte sich Lady Em. Sie weiß immer schon im Voraus, was ich haben möchte oder brauche – oft, bevor ich es selbst weiß! Seit zwanzig Jahren kümmert sie sich mit großer Hingabe um mich, ich hoffe nur, ihr eigenes Leben ist dabei nicht zu kurz gekommen.
Bei ihrem Finanzberater und Erbschaftsverwalter Roger Pearson lag die Sache anders. Sie hatte Roger und seine Frau zu der Reise eingeladen und freute sich wie immer auf Rogers Gesellschaft. Sie kannte ihn, seitdem er ein kleiner Junge war, und schon sein Großvater und sein Vater hatten sie in allen finanziellen Angelegenheiten beraten.
Eine Woche zuvor aber hatte sie einen alten Freund getroffen, Winthrop Hollows, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Wie sie gehörte er ebenfalls zu Pearsons Mandanten. Er hatte sie gefragt, ob sie immer noch Rogers Dienste in Anspruch nehme, und ihr daraufhin zugeraunt: »Nimm dich in Acht, er ist nicht wie sein Großvater oder Vater. Ich würde dir raten, lass deine Finanzen von einer zweiten Kanzlei gegenprüfen.« Als sie von Winthrop eine Erklärung verlangte, weigerte er sich, ihr mehr mitzuteilen.
Sie hörte Schritte, gleich darauf ging die Tür zum Schlafzimmer auf. Brenda Martin kam ins Zimmer. Sie war eine große Frau, eher muskulös als übergewichtig, und sah mit ihrer wenig schmeichelhaften Kurzhaarfrisur älter aus, als ihre sechzig Jahre vermuten ließen. Ihrem runden Gesicht hätte ein wenig Make-up gutgetan. Jetzt aber brachte es Besorgnis zum Ausdruck.
»Lady Em …«, begann sie zurückhaltend. »Sie sehen beunruhigt aus. Stimmt etwas nicht?«
Vorsicht, ermahnte sich Lady Em. Ich möchte nicht, dass sie von meinen Bedenken wegen Roger erfährt.
»Ich sehe beunruhigt aus? Ich wüsste nicht, warum.«
Brenda wirkte sofort erleichtert. »Gut. Dann freue ich mich, dass nichts Ihre gute Laune trübt. Sie sollen doch jeden Augenblick auf diesem wunderbaren Schiff genießen. Soll ich Tee kommen lassen?«
»Das wäre sehr nett, Brenda. Celia Kilbrides Vortrag morgen verspricht äußerst interessant zu werden. Schon erstaunlich, dass eine noch so junge Frau schon so viel über Edelsteine weiß. Ich glaube, ich weihe sie in den Fluch ein, der auf der Kleopatra-Halskette lastet.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie mir schon mal davon erzählt haben.«
Lady Em lachte in sich hinein. »Kleopatra wurde von Cäsars Adoptivsohn und Erben Octavian gefangen genommen. Sie wusste, dass er sie als seine Gefangene mit nach Rom nehmen wollte, und dazu hatte er ihr befohlen, die Smaragdhalskette während der Überfahrt zu tragen. Vor ihrem Selbstmord ließ sie sich daher die Halskette bringen und belegte sie mit einem Fluch: ›Wer immer diese Halskette mit aufs Meer hinausnimmt, wird die Küste lebend nicht erreichen‹.«
»O Lady Em!«, seufzte Brenda. »Was für eine schreckliche Geschichte. Vielleicht sollten Sie die Kette lieber im Safe lassen.«
»Kommt gar nicht infrage«, beschied Lady Em knapp. »Und jetzt bestellen Sie Tee.«
4
Roger Pearson und seine Frau Yvonne nahmen den Nachmittagstee in ihrer Suite auf dem Concierge-Deck der Queen Charlotte zu sich. Roger, von stämmiger Statur, mit schütter werdenden hellbraunen Haaren und Lachfältchen um die Augen, war ein geselliger, offener Zeitgenosse, in dessen Gegenwart sich jeder sofort wohlfühlte.
Er war auch der Einzige, der es wagte, in nicht ganz ernstem Ton mit Lady Em über politische Fragen zu debattieren. Immerhin war sie eine glühende Anhängerin der Republikaner, während sein Herz ebenso leidenschaftlich für die Demokraten schlug.
Er und Yvonne gingen das Veranstaltungsprogramm für den nächsten Tag durch. Als sie den für 15.30 Uhr angekündigten Vortrag von Celia Kilbride entdeckten, runzelte Yvonne die Stirn. »Arbeitet sie nicht für Carruthers Jewelers, und ist sie nicht auch in diesen betrügerischen Hedgefonds verwickelt?«
»Dieser Thorne versucht, sie mit reinzuziehen«, antwortete Roger eher gleichgültig.
Yvonne war skeptisch. »Das hab ich auch gehört. Aber wenn Lady Em dort ihren Schmuck zur Reparatur hinbringt, verlangt sie immer nach Celia Kilbride. Das hat mir Brenda erzählt.«
Roger drehte sich zu ihr hin. »Dann gehört Kilbride zum Verkaufspersonal?«
»Sie ist wesentlich mehr. Ich habe einiges über sie gelesen. Sie ist eine erstklassige Gemmologin und kauft weltweit für Carruthers Edelsteine ein. Ihre Vorträge auf solchen Schiffen sollen Wohlhabende dazu animieren, in Edelsteine zu investieren.«
»Sie scheint eine kluge Frau zu sein«, bemerkte Roger und wandte sich dem Fernseher zu.
Yvonne betrachtete ihn. Wie immer war von Rogers Umgänglichkeit nicht viel zu spüren, sobald sie allein waren. Meistens ignorierte er sie dann komplett.
Sie nahm einen Schluck von ihrem Tee und griff nach einem der kleinen Gurken-Sandwiches. In Gedanken war sie bei der Garderobe, die sie am Abend tragen wollte, ihrem neuen schwarz-weiß karierten Kaschmirblazer und der einfarbig schwarzen Freizeithose von Escada. Die Lederaufsätze an den Ellbogen verliehen der Jacke genau den zwanglosen Touch, den der Dresscode für den heutigen Abend an Bord verlangte.
Yvonne, dreiundvierzig Jahre alt, war sich bewusst, dass sie sehr viel jünger aussah. Sie wünschte sich nur, sie wäre etwas größer, aber sie war schlank, und ihre Friseurin hatte exakt den von ihr gewünschten Blondton getroffen. Beim letzten Mal hatte sie es mit dem Goldanteil doch etwas übertrieben.
Ihr Aussehen war Yvonne ebenso wichtig wie ihr gesellschaftlicher Status, nicht zu vergessen die Wohnung in der Park Avenue und das Haus in den Hamptons. Roger selbst langweilte sie eigentlich schon lange, aber sie liebte ihren Lebensstil.
Sie hatten keine Kinder, und es gab keinen echten Grund, warum er die College-Gebühren für die drei Söhne seiner verwitweten Schwester übernehmen sollte. Yvonne lag seit Jahren mit ihrer Schwägerin über Kreuz, dennoch argwöhnte sie, dass Roger die Rechnungen zahlte.
Aber das ist schon in Ordnung, dachte sie und spülte das Sandwich mit einem letzten Schluck Tee hinunter. Solange ich deswegen nicht zurückstecken muss.
5
Das ist doch alles viel zu teuer, Willy. Auch wenn es unser fünfundvierzigster Hochzeitstag ist«, seufzte Alvirah und sah sich in der Suite um, die Willy zur Feier des Ereignisses gebucht hatte.
Trotz ihres Protestes hörte Willy aber auch, wie aufgeregt sie klang. Er war im Wohnbereich und öffnete die Flasche Champagner, die in einem silbernen Eiskühler kalt gestellt worden war. Während er sich am Korken zu schaffen machte, ließ er den Blick zu den deckenhohen Spiegeln schweifen und von dort hinaus auf den dunkelblauen Atlantik.
»Willy, wir brauchen doch keine Kabine mit eigenem Balkon. Wir können doch an Deck gehen, wenn wir aufs Wasser sehen und uns den Wind um die Nase wehen lassen wollen.«
Willy lächelte. »Liebste, auf diesem Schiff hat jede Kabine ihren eigenen Balkon.«
Alvirah war jetzt im Badezimmer neben dem Schlafzimmer. »Willy!«, rief sie aufgeregt. »Das ist unglaublich! Im Schminkspiegel ist ein Fernseher eingebaut. Das muss doch alles ein Vermögen kosten.«
Willy lächelte nachsichtig. »Liebling, wir bekommen zwei Millionen im Jahr vor Steuern, und das seit mittlerweile fünf Jahren. Noch dazu verdienst du durch deine Artikel für den Globe.«
»Ich weiß.« Alvirah seufzte. »Aber ich würde das Geld lieber für einen guten Zweck ausgeben. Du weißt doch, Willy: Viel wird von jenen erwartet, denen viel gegeben wurde.«
O Mann, dachte Willy. Was wird sie erst sagen, wenn ich ihr heute Abend den Ring schenke? Er beschloss, ihr einen sachten Hinweis zukommen zu lassen. »Liebling, sei bitte nicht so voreilig. Nichts macht mich glücklicher, als mit dir diesen Jahrestag feiern zu dürfen. Es schmerzt mich schon ein wenig, wenn ich dir nicht zeigen darf, wie glücklich ich über unsere fünfundvierzig Jahre Ehe bin. Außerdem habe ich noch etwas, was ich dir heute Abend schenken möchte. Wenn du es nicht annehmen willst, dann, na ja, wäre das ein wirklich herber Schlag für mich.« Na, das habe ich doch sehr diplomatisch rübergebracht, dachte er.
Alvirah sah ihn betroffen an. »Oh, Willy, verzeih mir. Natürlich freut es mich, dass ich mit dir hier sein kann. Und du weißt ja, du warst doch derjenige, der gesagt hat, lass uns dieses Lotterielos kaufen. Ich hab gesagt, den Dollar könnten wir uns sparen. Ich bin überglücklich, und genauso freue ich mich über alles, was du mir schenken willst.«
Sie standen an der Balkontür und bewunderten den Blick aufs Meer. Willy legte ihr den Arm um die Schulter. »Das klingt schon eher nach dir, meine Liebe. Also, in der kommenden Woche werden wir jede einzelne Minute genießen.«
»Ja, das werden wir«, stimmte Alvirah zu.
»Und du siehst wunderschön aus.«
Auch das, dachte Alvirah, hatte eine gute Stange Geld gekostet. Ihre übliche Friseurin war im Urlaub, also hatte sie sich die Haare in einem superteuren Salon tönen lassen. Die Empfehlung stammte von ihrer Freundin, der Baroness von Schreiber, der das Cypress Point Spa gehörte, das Alvirah gleich nach dem Lottogewinn besucht hatte. Ich hätte es wissen müssen. Min schlägt nie was anderes vor, dachte sie. Aber sie musste auch zugeben, ihre Haare hatten exakt den samtigen Rotton, den sie sich immer wünschte, und Monsieur Leopoldo hatte ihr einen ganz wunderbaren Schnitt verpasst. Zudem hatte sie seit Weihnachten sieben Kilo abgenommen und konnte wieder die herrlichen Sachen tragen, die Min ihr vor zwei Jahren ausgesucht hatte.
Willy drückte sie an sich. »Liebling, schön zu wissen, dass du auf einem Schiff wie diesem für deine nächste Kolumne von nichts anderem schreiben musst als von deinem sorglosen Aufenthalt hier.«
Aber noch im selben Moment beschlich ihn das untrügliche Gefühl, dass es so nicht laufen würde. Denn so lief es nie.
6
Raymond Broad, der Lady Ems Suite zugewiesene Steward, erschien mit einem Tablett, um den Nachmittagstee abzuräumen. Er hatte Lady Em zusammen mit ihrer Assistentin fortgehen sehen, wahrscheinlich suchten sie die Queen’s Cocktail Lounge auf dem siebten Deck auf.
Nur die mit den allerdicksten Brieftaschen konnten sich den Aufenthalt dort leisten, dachte er. Leute, wie er sie mochte. Mit geübter Hand stellte er das Teeservice und die noch übrigen Sandwiches und süßen Gebäckteile auf das Tablett.
Dann trat er ins Schlafzimmer und sah sich um. Er zog die Schubladen der Nachttische zu beiden Seiten des Bettes auf. Oft gaben die Reichen ihren Schmuck einfach nur in die Schubladen, statt ihn im Schranksafe zu verschließen. Deshalb warf er immer einen Blick hinein.
Und die Leute gingen auch sehr unachtsam mit ihrem Geld um. Wenn jemand am Ende der Reise eine überquellende Brieftasche in der Schublade liegen ließ, würde er ein paar hundert Dollar kaum vermissen, weil er das Geld vermutlich sowieso nicht gezählt hatte.
Raymond ging immer sehr vorsichtig vor, weshalb er in den zehn Jahren, in denen er mittlerweile für Castle Line arbeitete, nie des Diebstahls bezichtigt worden war. Außerdem, was schadete es schon, wenn er sich noch ein kleines Zubrot verdiente, indem er der Klatschpresse pikante Geschichten über die eine oder andere Berühmtheit an Bord verhökerte? Er wusste ja, er galt als ein ausgezeichneter Steward.
Er kehrte in den Hauptraum zurück, nahm das Tablett und verließ die Suite. Das zufriedene Lächeln, mit dem er üblicherweise das Terrain sondierte, verschwand, sobald er die Kabinentür öffnete. Jetzt war er wieder der gestrenge, in eine makellose Uniform gekleidete Steward mit den dünnen, ordentlich über die kahle Stelle am Hinterkopf gekämmten Haaren und der dienstbaren Miene, falls ihm ein Gast im Gang begegnen sollte.
7
Professor Henry Longworth überprüfte den Sitz seiner Fliege. Obwohl für den Abend zwanglose Garderobe angesagt war, hatte er nicht vor, das Hemd offen zu tragen. Er mochte so etwas einfach nicht. Es erinnerte ihn an die schäbigen Sachen seiner Kindheit in den Slums von Liverpool. Im Alter von acht Jahren war er allerdings schon schlau genug gewesen, um zu kapieren, dass nur Bildung ihn von dort wegbrachte. Nach dem Unterricht, wenn die anderen Jungs zum Fußballspielen abzogen, hatte er sich daher hingesetzt und gebüffelt.
Mit achtzehn bekam er ein Stipendium in Cambridge, wo sich jedoch alle über seinen Liverpooler Dialekt lustig machten. Er kostete ihn einige Mühen, um ihn bis zum Abschluss seines Studiums loszuwerden.
Im Lauf der Jahre hatte er eine große Leidenschaft für Shakespeare entwickelt. Schließlich wurde ihm eine Professur in Oxford angeboten, wo er sich mit diesem Thema sein Leben lang bis zu seiner Emeritierung beschäftigen konnte. Wie er sehr wohl wusste, witzelten seine Kollegen in Oxford, dass man ihn nach seinem Tod mit Frack und Fliege in den Sarg legen würde. Aber das war ihm egal.
Die Fliege saß perfekt.
Er zog das Jackett aus leichtem Karostoff an, genau richtig für das Wetter Mitte September, und sah auf die Uhr. Zehn Minuten vor sieben. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, dachte er.
Seine Suite lag auf dem Concierge-Deck, und er hatte festgestellt, dass dieses neue Kreuzfahrtschiff doch wesentlich mehr Luxus bot als ältere Schiffe. Natürlich konnte man es schwerlich ernst nehmen, wenn das Wort »Suite« für eine Kabine benutzt wurde, in der Wohn- und Schlafzimmer in ein und demselben Raum lagen, aber so sollte es nun mal sein. Er trat vor den hohen Spiegel an der Badezimmertür und vergewisserte sich, dass sein Äußeres tadellos war. Das Spiegelbild zeigte einen schlanken Sechzigjährigen mittlerer Größe mit kahlem Schädel, grauem Haarkranz und durchdringenden Augen hinter randlosen Brillengläsern. Er nickte wohlwollend und ging zur Ankleide, um erneut einen Blick auf die Passagierliste zu werfen. Wie nicht anders zu erwarten, waren Berühmtheiten aus diversen gesellschaftlichen Bereichen mit an Bord. Wie viele von ihnen waren wohl von Castle Line eingeladen worden? Nicht wenige, vermutete er.
Seit seiner Emeritierung hielt er regelmäßig Vorträge auf Schiffen der Linie und verstand sich gut mit dem Kreuzfahrtdirektor. Ein halbes Jahr zuvor, als er die PR-Ankündigung zur Jungfernfahrt der Queen Charlotte gelesen hatte, hatte er im Buchungsbüro angerufen und anklingen lassen, dass es ihm eine Freude wäre, als Gastredner auf dieser Reise mit dabei zu sein.
Und hier war er nun. Hochzufrieden verließ Professor Henry Longworth seine Kabine und ging zur Queen’s Cocktail Lounge, um sich unter die wichtigsten Passagiere zu mischen.
8
Ted Cavanaugh warf nur einen sehr flüchtigen Blick auf seine Suite. Als Sohn eines Botschafters war er so ein luxuriöses Ambiente gewohnt. Auch wenn ihm die Einrichtung außergewöhnlich kostspielig erschien, achtete er nicht weiter darauf. Ted, vierunddreißig Jahre alt, hatte bis zum Beginn seines Studiums mit seinen Eltern im Ausland gelebt und in den Ländern, in die sein Vater abberufen worden war, die jeweiligen internationalen Schulen besucht. Er sprach fließend Französisch, Spanisch und ägyptisches Arabisch. Er war in Harvard gewesen, dann an der juristischen Fakultät in Stanford, aber seine Begeisterung für antike Kunst rührte von seiner Jugend in Ägypten her.
Acht Monate zuvor hatte er gelesen, dass Lady Emily Haywood die Jungfernfahrt auf der Queen Charlotte gebucht hatte. Für ihn könnte das die Gelegenheit sein, sie als Mitreisender anzusprechen und ihr sein Anliegen vorzutragen. Er wollte ihr klarmachen, dass ihr Schwiegervater vor hundert Jahren die Halskette zwar zweifellos erworben hatte, eindeutige Indizien aber dafür sprachen, dass es sich bei dem Schmuckstück um ein gestohlenes Artefakt handelte. Falls sie es der Smithsonian Institution vermachen und seine Kanzlei dagegen Klage einreichen sollte, würde das unschöne Publicity für Lady Haywood sowie ihren verstorbenen Ehemann und ihren Schwiegervater nach sich ziehen. Beide waren berühmte Forschungsreisende, seinen Recherchen zufolge aber hatten sich beide in mehreren Fällen der Plünderung antiker Grabstätten schuldig gemacht.
Das war sein Ansatzpunkt. Es war weithin bekannt, dass Lady Haywood ungemein stolz war auf das Vermächtnis ihres Mannes. Vielleicht war sie vernünftigen Argumenten zugänglich, wenn sich dadurch vermeiden ließ, dass der Ruf ihres Mannes und dessen Vaters durch einen unschönen Prozess in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Damit beschloss Ted, sich in der Zeit bis zum Cocktail einen äußerst seltenen Luxus zu gönnen, nämlich endlich das Buch anzufangen, das er schon seit Monaten lesen wollte.
9
Devon Michaelson interessierte sich kaum für seine Umgebung. Sein Gepäck enthielt bloß das Allernötigste für eine solche Reise. Seine Miene war teilnahmslos, seine haselnussbraunen Augen aber waren hellwach. Er sah und hörte alles, nichts entging ihm.
Mit einiger Enttäuschung hatte er erfahren, dass der Kapitän des Schiffes sowie der Sicherheitschef über seine Anwesenheit in Kenntnis gesetzt worden waren. Je weniger Personen von ihm wussten, desto besser wäre es, dachte er. Wenn er seinen Auftrag erfüllen sollte, war er allerdings auf die Kooperation von Castle Line angewiesen. Er musste an Lady Emily Haywoods Tisch platziert werden, damit er sie und ihre Umgebung im Auge behalten konnte.
Der »Mann mit den tausend Gesichtern« war Interpol bestens bekannt. Seine in insgesamt sieben Ländern verübten Diebstähle waren an Unverfrorenheit kaum zu überbieten. Der letzte Raub, zwei frühe Henri-Matisse-Gemälde aus dem Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, lag erst zehn Monate zurück.
In den Wochen nach dem Raub hatte der dreiste Dieb Interpol verspottet und sich mit Einzelheiten seiner Taten gebrüstet. Diesmal war er anscheinend anders vorgegangen. Mittels eines nicht nachverfolgbaren E-Mail-Kontos hatte jemand, der sich selbst als der Mann mit den tausend Gesichtern bezeichnete, seinen Wunsch kundgetan, die Halskette der Kleopatra in seinen Besitz zu bringen. Die Mail erschien kurz, nachdem Lady Emily Haywood unklugerweise öffentlich bekannt gegeben hatte, das Geschmeide mit auf die Reise zu nehmen.
Castle Line wusste von der Drohung, als Michaelson Kontakt mit dem Unternehmen aufnahm, und erklärte sich schnell bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Devon, alles andere als ein geselliger Mensch, freute sich nicht unbedingt darauf, einem Tisch zugewiesen zu werden, an dem er mit Fremden Konversation machen musste – mit Leuten, die er ganz bestimmt langweilig finden würde. Aber da Lady Haywood nur bis Southampton reiste, war der Zeitraum überschaubar; diese Unannehmlichkeit musste er eben in Kauf nehmen.
Er hatte schon so viel über die Halskette der Kleopatra gehört – wie perfekt die Smaragde aufeinander abgestimmt waren, welch atemberaubenden Anblick sie boten – und freute sich schon darauf, sie endlich aus nächster Nähe betrachten zu können.
Als offiziellen Vorwand für die Reise würde er gegenüber seinen Mitpassagieren angeben, dass er die Asche seiner Frau im Meer verstreuen wollte. Eine gute Tarngeschichte, dachte er, und eine, die dafür sorgen würde, dass er sich die meiste Zeit zurückziehen und für sich bleiben konnte.
Es war fast neunzehn Uhr, der Zeitpunkt, zu dem in der exklusiven, für die Passagiere des Privatdecks reservierten Queen’s Lounge Cocktails serviert würden.
10
Anna DeMille schnappte aufgeregt nach Luft, als sie die Tür zu ihrer Suite öffnete. Bislang war sie nur ein Mal auf dem Meer gewesen, bei einer Disney-Kreuzfahrt, bei der die einzigen Berühmtheiten an Bord Mickey, Minnie und Goofy gewesen waren. Spaß hatte die Reise auch nicht gemacht, weil sonst nur Familien mit kleinen Kindern teilnahmen. Einmal hatte sie sich auf einen Clubsessel gesetzt, danach hatte sie einen ekligen Kaugummi an ihrer neuen Hose kleben.
Aber das hier? Einfach himmlisch!
Ihr Gepäck war verstaut. Die Kleidung hing bereits im Schrank oder war ordentlich in Schubladen geräumt, die Toilettenartikel lagen im Badezimmer ausgebreitet. Begeistert sah sie, dass die Dusche auch ein Dampfbad war, was sie gleich am nächsten Morgen ausprobieren wollte.
Sie ging durch die Kabine und musterte jeden einzelnen Gegenstand. Das Kopfbrett des Bettes war mit einem bedruckten Stoff bezogen, dessen Blumenmuster der Besatz der weißen Tagesdecke wieder aufnahm.
Sie setzte sich aufs Bett und wippte auf und ab. Die mittelharte Matratze war genau, wie sie es mochte. Sie sah, dass sie auch hochgestellt werden konnte, damit sie im Sitzen fernsehen konnte.
Sie öffnete die Tür, trat hinaus auf den Balkon und war enttäuscht, dass er durch einen Sichtschutz von den Nachbarbalkonen getrennt war. Sie hatte gehofft, sich mit den Passagieren nebenan unterhalten und vielleicht anfreunden zu können.
Sei’s drum, es würde genug Zeit bleiben, sich während des Essens und der anderen Veranstaltungen unter die anderen Gäste zu mischen. Sie hatte das ganz starke Gefühl, dass sie einen neuen Mann kennenlernen würde.