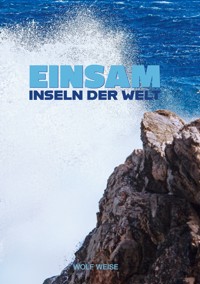
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Holzbeinige Piraten, einsame Strände, paradiesbunte Papageien, versteckte Schatzkisten im Dschungellabyrinth solche Bilder schwirrten mir, dem Zehnjährigen, bunt und verlockend durch den Kopf. Schon früh war mir klar: Ich will die Welt sehen, ich will sie mit allen Sinnen begreifen, ich will reisen am liebsten auf ferne Inseln. Ich stellte sie mir vor wie geheimnisvolle Schatzkammern, spannender als Mond und Sterne. Heute, Jahrzehnte später, blicke ich auf ein langes Reiseleben zurück. Mein großes Glück ist, in meiner englischen Frau Vivien eine Gefährtin gefunden zu haben, die meine Reisebegeisterung teilt. Alle Länder der Welt außer einem haben wir miteinander bereist und dabei einen unglaublichen Schatz an Erinnerungen gesammelt. Und natürlich haben wir auch die Sehnsuchtsorte meiner Kindheit besucht die Inseln!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caelum non animum mutant qui trans mare currunt Wer über See fährt, wechselt den Himmel, nicht den Charakter (Horatius)
Für Emmy
Über den Autor
Wolf Weise und seine britische Frau Vivien reisen, seitdem sie sich in Israel an einem Ansichtskartenstand begegnet sind, gemeinsam um die Welt. Als meistgereistes Ehepaar erfuhren sie alle Kontinente, meist mit einem klapprigen VW-Bus, oft per Autostopp, auf Schiffen, per Eisenbahn, zu Fuß, mit Pferd oder Kajak …
Als Freiberufler verdienten sie sich ihr Reisebudget zu Hause und in anderen Ländern. Sie sind Autoren zahlreicher Bücher und waren unter anderem als Reporter, Gärtner, DJ, Judotrainer, Vertreter, Fotomodell, Kräuterexperten, Obstpflücker, Schauspieler, LKW-Fahrer, Messebauer, Lehrer und Security Guard tätig. Ihre Arbeits- und Jobpalette ist eine eigene Biographie wert.
Inseln sind in ihren Reisereportagen, in Journalen, im Radio und Diashows ihre Spezialität. „Einsam“ ist nun ein Auszug aus ihrem Reise– repertoire.
Weitere erschienene Bücher sind:
LKW-Abenteuer Westafrika
Köln-Kapstadt
Panamericana – Von Alaska bis Feuerland
Köstlichkeiten aus der Natur – Wildkräuterrezepte
1000 Tage Freiheit – Weltreise
The Gourmet Weed Cook Book – Vegetarian Recipes
Cooking Weeds - Vegetarian Recipes
Gedichte – Eine Seelenbiographie
und andere ausverkaufte Bücher (Antiquariat).
Die Fortsetzung von „Einsam“ ist in Bearbeitung, sowie eine Reisebiographie in Anekdoten und „Einmal um die Welt und zurück“.
Vorbemerkung
Viele unserer Fotos stammen aus vordigitaler Zeit und entsprechen daher nicht immer den heutigen Standards und Erwartungen.
Da unser Reisefundus nicht in ein einziges Buch passt, habe ich eine Auswahl von 17 Inseln getroffen. In einem zweiten Buch werde ich weitere entlegene Inseln beschreiben.
Für jedes verkaufte Buch spenden wir einen Euro an Greenpeace.
Kursiv gedruckt sind fremdsprachliche Worte und Ausdrücke. Ausnahmen: Orts- und Eigennamen sowie Dialoge in wörtlicher Rede.
Inhalt
Vorwort
1 Ayiti -
Gefangen im Bürgerkrieg
2 Komodo -
Drachen ohne Flügel
3 St. Kilda -
Häuser ohne Menschen
4 Nan Madol -
Steinernes Rätsel
5 Kihnu -
Insel der Stille
6 Dilmun -
Der verlorene Garten Eden
7 Deception Island -
Auf den Spuren einer wahren Heldenreise
8 South Georgia -
Shackletons Triumph
9 Futuna -
Kleine Königreiche im Pazifik
10 Tuvalu -
Knapp über der Wasserlinie
11 Ul-laun -
Das Meer gibt’s, das Meer nimmt’s
12 Athos -
Heiligtum der Muttergottes – für Frauen Zutritt verboten
13 Himmafushi -
Knapp am Paradies vorbei
14 Rapa Nui -
Stumme Zeugen der Vergangenheit
15 Tristan da Cunha -
Am entlegensten Wohnort der Welt
16 Beechey -
Eismumien
17 Ra‘ivavae -
Dem Himmel so nah
Nachwort
Danksagung
Vorwort
Holzbeinige Piraten, einsame Strände, paradiesbunte Papageien, versteckte Schatzkisten im Dschungellabyrinth – solche Bilder schwirrten mir, dem Zehnjährigen, bunt und verlockend durch den Kopf. Schon früh war mir klar: Ich will die Welt sehen, ich will sie mit allen Sinnen begreifen, ich will reisen - am liebsten auf ferne Inseln. Ich stellte sie mir vor wie geheimnisvolle Schatzkammern, spannender als Mond und Sterne.
Heute, Jahrzehnte später, blicke ich auf ein langes Reiseleben zurück. Mein großes Glück ist, in meiner englischen Frau Vivien eine Gefährtin gefunden zu haben, die meine Reisebegeisterung teilt. Alle Länder der Welt außer einem haben wir miteinander bereist und dabei einen unglaublichen Schatz an Erinnerungen gesammelt. Und natürlich haben wir auch die Sehnsuchtsorte meiner Kindheit besucht – die Inseln!
Was ich als Kind ahnte, hat sich dabei bestätigt: Jede Insel ist eine Schatzkammer, ein eigenes kleines Universum. Zwar nicht reich an Gold und Edelsteinen, aber an Einzigartigkeit. Tier- und Pflanzenwelt, Himmel und Erde, die Menschen, die hier leben, und ihre Geschichte: Alles kombiniert sich auf faszinierende Weise zu Orten, wie es sie nur hier und nirgends sonst auf der Welt gibt.
Inseln sind nicht immer Paradiese! Auch wenn eine von ihnen einst Pate stand für die Vorstellungen der Menschen vom biblischen Paradies. Jede hat ihren eigenen Charakter. Manche geben sich bezaubernd, andere abweisend. Um einige ranken sich Mysterien, andere erscheinen nüchtern. Manche liegen fast vor der Haustür, andere als einsamer Außenposten weit draußen im Ozean. Auf einigen Inseln ist der Aufenthalt sogar gefährlich – alle aber sind sie gefährdet.
Mit diesem Buch möchte ich mit stellvertretend ausgewählten Inseln allen Eilanden unserer Erde ein Denkmal setzen. Es ist kein Reiseführer, kein Geschichtsbuch, kein Erdkundebuch und auch kein fortlaufend zu lesender Reisebericht, sondern eine Mischung von allem. Eine Hommage an die Inseln der Welt: an diese achtens-, bewunderns- und schützenswerten Protagonisten der Erd- und Menschheitsgeschichte. Für jede Insel gibt es ein eigenes Kapitel. Jedes Inselkapitel steht „isoliert“ für sich, und doch zeigt sich Verbindendes, ein subtiles Netz von Gemeinsamkeiten, die diese Juwelen der Weltmeere mit anderen Orten teilen.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise, erkunden Sie zusammen mit uns die Vielfalt der Inselwelten unserer Erde!
1 Ayiti
Gefangen im Bürgerkrieg
Port-au-Prince, Hauptstadt der Repiblik Dayiti. Auf dem Zentralplatz Champs de Mars. Es fallen Schüsse. Ein Volksauflauf. Demonstrationen in der ganzen Stadt. Eine Handvoll Reis, die einzige Tagesration, können sich viele jetzt nicht mehr leisten. Die Reispreise haben um das Doppelte angezogen, im sowieso schon ärmsten Land der nördlichen Hemisphäre mit dem niedrigsten Lebensstandard. Die Armen gehen auf die Barrikaden und rufen, von Gewehrsalven begleitet, in Sprechchören, dass sie schon vorher nicht genug Gourdes hatten, um Reis zu kaufen, und jetzt reicht es nicht mehr zum Leben, nur noch zum Sterben. Bürgerkrieg!
Haiti, ohnehin kein Reiseland, jetzt im Bürgerkrieg, das konnten wir nicht ahnen, als wir vor einer Woche hier eintrafen. Wir kommen direkt aus El Salvador, das nach jahrzehntedauerndem Terror endlich zur Ruhe gekommen ist.
Bei unserer Ankunft in Haiti ist noch nichts von Aufruhr zu spüren, außer dass die Menschen nicht die Ausgelassenheit und laissez-faire-Stimmung des fröhlichen Karibik-Flairs anderer Inseln ausstrahlen. Viv und ich fühlen zwar etwas von knisternder Stimmung und blicken oft in ausdruckslose Gesichter, geprägt von Hunger, aber wir nehmen die Not nicht wirklich bewusst wahr. Hinter die Masken der Menschen können wir nicht schauen. Wir fragen uns zum Hotel Oloffson durch, einen Kilometer vom Champs de Mars entfernt. Es ist noch früh am Morgen. Am Ende der Rue Capois liegt auf einer Anhöhe das aus Holz erbaute Hotel Oloffson, mit seinen Türmchen und Balkonen. Von Weitem schimmert uns sein Blechdach entgegen. Aus der Ferne wirkt es wie ein Märchenpalast, aber längst hat es seinen Glorienschein verloren, auch die umgebenden Steingärten wirken ungepflegt und verwildert. Heute liegt sein Zauber nur noch in der nostalgischen Vergangenheit des Anwesens, als die Damen und Herren der Hautevolee damals in der Abenddämmerung auf den Balkonen ihren Rum Punch schlürften, und als Graham Greene in den 1960er Jahren hier seinen berühmten Roman „The Comedians“ schrieb. Das Hotel Oloffson war seine Zentrale. Von hier aus betrieb Greene seine umfangreichen Recherchen über das Terror-Regime von „Papa Doc“ und seinen Henkersknechten für sein Buch.
Voller Erwartung betreten wir den schattigen Garten. Etwas abseits sitzen zwei alte Damen mit scharlachrot gefärbten Haaren. Ihre Köpfe hängen über die Brust und sie schnarchen ganz entspannt in der Morgenluft.
Der Hoteleingang ist weit geöffnet, der Wind fächelt kühle Luft durch die Flure. Vor dem Rezeptionspult rufen, klopfen und trommeln wir, um uns bemerkbar zu machen. Totenstille. Kein Mensch da. Keine Antwort.
Ein heruntergekommenes Hotel ohne Personal. Plötzlich hören wir ein Schlurfen. Aus dem Halbdunkel nähert sich ein verschlafener Mann in wenig repräsentativem Dress, Jacke halb aufgeknöpft, mit Schweißrändern an den Stulpen. Der Portier. Kein würdiges Aushängeschild für so ein geschichtsträchtiges Hotel. Er murmelt etwas von „trop tôt“ – zu früh, „les femmes de chambre se reposent“ – die Zimmermädchen ruhen sich aus. Was er meint ist, sie schlafen noch oder sind gar nicht da, und das um zehn Uhr morgens. Und was das Dümmste ist, sie hätten die Schlüssel und so könne er uns kein Zimmer zeigen, wir sollen morgen wiederkommen.
Der Mann spricht‘s, gähnt, macht kehrt und taucht wieder ab im Zwielicht des Flurs. Wir sind sehr enttäuscht. Später werden wir feststellen, dass das Schicksal für uns die richtige Entscheidung getroffen, uns vielleicht sogar das Leben gerettet hat.
Gegen Mittag beziehen wir ein Zimmer im Hotel Plaza am Champs de Mars, unweit des Präsidentenpalastes. Das Hotel erinnert an eine Burg, umschlossen von soliden Steinmauern mit einem schweren, schmiedeeisernen Gitterportal. Der Portier öffnet, und das quietschende Tor fällt mit einem dumpfen Schlag hinter uns ins Schloss. Wir fühlen uns wie in einem Gefängnis. Durch den Garten, vorbei an einem überdachten Pavillon und einem leeren, mit bröckelnden Steinen eingefassten Swimmingpool, führt der Weg zur Rezeption. Unser Zimmer liegt im Erdgeschoss. Hier ist es düster wie in einer Gefängniszelle. Hohe Mauern vor dem Fenster versperren jeglichen Ausblick und lassen, wie in einer Festung, nur wenig Licht herein.
Mit dem Bau einer Festung, einer Garnison, begann auch die spanische Besiedlung der gesamten Insel, eingeleitet durch Christoph Kolumbus (Cristoforo Colombo in Italien, seinem vermutlichen Herkunftsland, und Cristobal Colon in Spanien, seiner Wahlheimat). Auf seiner ersten Reise nach Westen, gesponsert vom spanischen Königspaar Isabella und Ferdinand II, hatte er nach seiner Überzeugung den Seeweg nach Indien entdeckt, aber in Wirklichkeit Amerika als Erster für die Europäer gefunden. So jedenfalls steht es in den meisten Geschichtsbüchern.
Sorry Kolumbus, 500 Jahre vor dir waren schon Wikinger unter Leif Eriksson auf Neufundland und hatten schon an der L’Anse aux Meadows eine Siedlung gegründet.
Sehr stark zu vermuten ist auch, dass die Phönizier schon wesentlich früher mit Amerika Handel trieben, als sie von ihrem westlichen Handelsposten vom spanischen Atlantikhafen Cadiz, ehemals Gadir, in See stachen.
Und im 6. Jahrhundert scheint es der Heilige Brendan aus Irland sogar von Island in einem Lederboot bis nach Amerika geschafft zu haben.
Du, Kolumbus, hast nur einmal deinen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt – und das war nicht Indien, wie du dachtest, es war Mexiko in Mittelamerika.
„Er wusste nicht, wohin die Reise ging. Er wusste nicht, wo er war, als er dort war. Und als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war.“
Der unbekannte Verfasser dieses Spruchs wusste, wovon er sprach.
Aber die Begriffe Indianer, Indios, Westindien sind dennoch bis heute erhalten geblieben, seit Kolumbus am 6. Dezember 1492 im heutigen Môle-Saint-Nicolas im Südwesten Haitis landete. Er nannte die Insel La Isla Española – die spanische Insel, später lateinisiert zu Hispaniola.
Nicht lange danach sollte ihn ein schwerer Schicksalsschlag treffen. Am Weihnachtsabend havarierte Kolumbus mit seinem Flaggschiff Santa Maria auf einem Korallenriff vor Ayiti, „Bergiges Land“, wie die Einheimischen Taino ihre Insel nannten, das heutige Haiti. Aus den Wrackteilen ließ Kolumbus das Fort La Navidad, Weihnachten, zurechtzimmern, die erste Befestigung in der Neuen Welt.
Die Entdeckung Haitis bereitete den Weg für den Aufstieg der gierigen europäischen Kolonisatoren in der amerikanischen Welt und damit der Abstieg der indigenen Bevölkerung bis fast zu ihrer Ausrottung. Es begann eines der schwärzesten Kapitel der europäischen Geschichte – der Sklavenhandel.
Kolumbus selbst bemerkte einmal zu den Ureinwohnern: „Die Arawaks sind gütige, freundliche, großzügige und ehrliche Menschen, die ein friedvolles Leben führen.“ Wenn sie gewusst hätten, welche Verknechtung ihnen bevorstand, hätten sie sich sicher anders verhalten.
Vom Leben der Arawaks, die in prähistorischer Zeit aus dem Orinocobecken des heutigen Venezuelas eingewandert waren, ist bruchstückhaft einiges überliefert. Sie fingen Wasserschildkröten mit Hilfe von mit Saugplatten ausgestatteten Putzerfischen, die an die Schildkröten andocken.
Mit Hilfe einer Schnur, am Fischschwanz angebunden, zogen sie die Fische samt Schildkröten rückwärts bis an den Strand. Eine Methode, die sich bis heute erhalten hat. Sie aßen Sirenen, Leguane, Früchte, bauten Mais und Kassawa an. Die Arawaks verbrachten viel Zeit in ihren Hängematten und konsumierten cohiba, Tabak, der aus einer Röhre, tabaco genannt, in die Nasenlöcher geblasen wurde. Daher rührt auch unser Tabakgenuss. Diebstahl war das schwerste Verbrechen und wurde mit Schmoren am Spieß geahndet.
Unter den Spaniern arbeitete sich die Inselbevölkerung in den Minen zu Tode, oder erlag den von Europäern eingeschleppten Krankheiten.
Innerhalb von 50 Jahren war somit fast die gesamte Urbevölkerung ausgerottet. Sie wurden auch Opfer der encomienda, eines in Spanien bereits im Mittelalter üblichen Bewirtschaftungssystems. In den Kolonien räumte das System den Eroberern nicht nur das Recht zur Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung ein, sondern berechtigte sie sogar, über Leben und Tod der Ureinwohner zu bestimmen.
Die tap tap, bunt lackierte, wie Pfingstochsen wild dekorierte Kleinbusse, schaukeln die Einwohner und Reisenden auf halsbrecherischen Feldwegen durchs Land. Einfallsreiche Slogans über den Windschutzscheiben zieren die Minibusse, Christ Roi – Christ ist König, oder Marie, Aide-moi – Maria, Hilf. Wir sind unterwegs zum Étang Soumâtre im Massif De La Selle, dem größten See Haitis. Ein Bad in dessen blauen, salzhaltigen Wassern bietet eine echte Erfrischung.
Unweit des Pic La Selle, dem mit 2.674 Metern höchsten Berg Haitis, liegt die Grenzstation Malpas zur Dominikanischen Republik. Malpas, was „schlechter Weg“ bedeutet, macht seinem Namen alle Ehre. Barré, die Straße ist gesperrt! Alle Grenzübergänge sind geschlossen, die Dominikanische Republik lässt niemanden durch. Noch wissen wir nicht, warum.
An den Hängen der Montagnes Noires ist nur noch spärlicher Baumbewuchs übriggeblieben. Der kostbare Mahagoniwald ist längst nach Übersee verkauft. Der Restwald ist der Brandrodung für Farmen, meist Kaffeeplantagen, zum Opfer gefallen. Bodenerosion und Verkarstung machen den Bäumen ebenfalls das Leben schwer. Den meisten von ihnen droht ein Ende als Feuerholz, denn die 12 Millionen Menschen im am dichtesten besiedelten Karibikstaat haben unstillbaren Bedarf nach Brennmaterial. Die breite Masse der Haitianer ist so arm, dass sie sich keinen anderen Brennstoff als Holz zum Kochen leisten kann. Die Menschen kämpfen ums nackte Überleben.
Die Bevölkerung Haitis wurde gebeutelt, ausgenommen, politisch vergewaltigt; schon seit der Sklavenzeit unter den Kolonialisten und bis ins 20. Jahrhundert, als ein dreißigjähriges Terrorregime die Haitianer unterjochte.
Der ehemalige, so philanthropisch anmutende Landarzt Dr. François Duvalier, mit Schimpfnamen Papa Doc genannt, entpuppte sich 1957 als einer der rücksichtslosesten Diktatoren der Neuzeit. Nachfolger wurde sein Sohn Jean Claude Duvalier, alias Baby Doc. Ihre Privatmiliz, die Tonton Macoutes, so trefflich in Graham Greenes Buch „The Comedians“ beschrieben, war ein Mordkommando, welches alle nicht konformen Haitianer gnadenlos beseitigte. Dieses grausame Regime begann einen Genozid, der schließlich über 30.000 Menschen das Leben kosten sollte.
Verfallene Zuckerrohrpressen, die wenigsten funktionieren noch, sind Zeitzeugen der Sklavenära, als es tausende Zuckerrohrplantagen auf Haiti gab. Wir beobachten eine dieser Zuckerrohrpressen bei der Arbeit.
Quietschend und eiernd tut sie noch ihren Dienst zur Verarbeitung dieser mehrjährigen Grasart. Ein Rind trottet angebunden im Kreis, den Pressbalken drehend – früher waren es Sklaven, die diese Arbeit verrichteten.
Ein Mann schiebt die bis fünf Zentimeter dicken Zuckerrohrhalme in die eiserne Walzpresse, die in einer Wanne den süßen Saft aufnimmt. Ein Nebenprodukt bei der nachfolgenden Zuckerherstellung ist die Melasse, die Grundsubstanz für die Rumproduktion. Rum ist einer der wenigen Exportartikel Haitis wie auch anderer Karibikinseln.
Als die Zuckerrohrplantagen begannen, den enormen Hunger nach Zucker in Europa zu stillen, fehlte es an Landarbeitern. Die Urbevölkerung hatte man ja „erfolgreich“ eliminiert. Eine Lösung war schnell gefunden:
Import von Sklaven aus Afrika. Hier in Haiti war es, dass der weltgrößte Sklavenhandel begann. Bereits zwölf Jahre nach Kolumbus‘ Ankunft auf der Insel waren an der gesamten Westküste Afrikas Sklavenhändler aktiv.
Das bedeutendste Kontingent an „Ebenholz“, wie die Menschen zynisch genannt wurden, kam aus Dahomey, heute Republik Benin. Der Sklavenhandel war für den König und die Häuptlinge dort ein erfolgreiches Geschäft und zur nationalen „Industrie“ geworden. Alljährliche Raubzüge zu anderen Volksstämmen brachten tausende von Gefangenen, neue „Ware“. Der eingetauschte Erlös waren Metall, Perlen, Waffen und Schnaps.
Sklavenhändler transportierten die Afrikaner wie Vieh, nur unmenschlicher. Die mit shebah, hölzernen Gabeln, mit Vorder- und Hintermann am Hals verbundenen und mit Fußfesseln traktierten Menschen stolperten in Kolonnen zu den wartenden Kerkerschiffen.
Unter großen Verlusten wurden sie auf Hispaniola „angeliefert“. Sie starben auf den Schiffen wie die Fliegen, an Seekrankheit, Unterernährung und ausbrechenden Epidemien. Sklavenhändler sowie Plantagenbesitzer machten hohe Profite mit ihren grausamen Geschäften. Der Verschleiß an Sklaven war so groß, dass sie alle fünf Jahre ersetzt werden mussten, da sie sich bis dahin zu Tode gearbeitet hatten. Aber der Nachschub war ja gesichert, ein rentables Geschäft.
Bald mischten auch „Bukaniere“ in der Region mit. Sie waren die Seeräuber, Freibeuter, Piraten Westindiens. Der unbarmherzigste Menschenschlag in der Geschichte der Seefahrt. Sie agierten zunächst von ihrem Versteck, dem notorischen Piratennest auf der Isla Tortuga, Île de la Tortue, der Schildkröteninsel im Nordwesten Haitis.
Einer der berüchtigtsten Bukaniere, Henry Morgan aus Wales, wurde im 17. Jahrhundert von seinen Piraten-Kumpanen als Kommandant und Admiral gewählt und wurde sogar für seine „Verdienste“, seine Kaperfahrten und Überfälle auf französische und spanische Besitzungen, von Charles II in England zum Ritter geschlagen.
Nirgendwo sonst sind afrikanische Traditionen und Glaubensvorstellungen außerhalb des Schwarzen Kontinents so verwurzelt wie hier in Haiti.
95 Prozent der Bevölkerung sind afrikanischer Abstammung, davon sind 80 Prozent Katholiken und 20 Prozent Protestanten, aber 100 Prozent sind Voudou.
Da die meisten Sklaven aus der Bucht von Benin stammten, gehörten sie alle zur gleichen Religion: Voudou. Sie war das Einzige, was sie in die Fremde mitnehmen konnten. Der Begriff „Voudou“ geht zurück auf die Stämme der Fon und bedeutet in der Ewe-Sprache einfach „Gott“ oder „Geist“. Voudou ist eine bei uns konstant böswillig missverstandene und falsch interpretierte Religion. Sie wird schlechthin als Aberglaube abgestempelt, der Angst und Schrecken verbreiten soll. Schuld daran sind düstere, auf unheimlich getrimmte Gespensterfilme aus Hollywood sowie unqualifizierte Presseberichte. Tatsache ist, dass es einen Hochgott, papa maître gibt und loas, die ähnliche Positionen bekleiden wie die Heiligen im Katholizismus.
Die missionarischen Tätigkeiten der christlichen Kirchen haben zwar bewirkt, dass die Menschen diesen Glauben angenommen haben, daraus ist jedoch in Haiti ein Zwitter entstanden, eine synkretische Glaubensrichtung, eine Mischung aus verschiedenen Religionen.
Port-au-Prince steht für uns in einem solch starken Kontrast zu anderen Orten der Karibik, dass es uns beim Gang durch die Straßen immer wieder den Atem verschlägt und ein Gefühl der Beklemmung hinterlässt.
Von unserem Hotel Plaza, neben einem kleinen Reisebüro, überqueren wir den Champs de Mars zum Marché de Fer, der zum Seehafen führt. Bunte, marode Fischerkähne aus Holz liegen dümpelnd, nicht wirklich seetüchtig, an der Mole.
Die Wohnhäuser in den Slums sind aus Holz, windschief und kurz vor dem Kollaps. Wohnen darin ist kaum möglich. Aber wo sonst? Müll überall, Abfall liegt auf den Gassen, zwischen den Häusern. Es gibt keine Müllabfuhr.
In der Basilique Notre Dame findet gerade eine Messe statt. An den Mauern kriecht Schimmel über den Putz und bringt ihn zum Abbröckeln. Ein alter Priester liest mit monotoner Stimme. Wenige Menschen, meist ältere, knien ehrfurchtsvoll nieder. Fast nur Frauen in abgewetzter Kleidung.
Sie erscheinen niedergeschlagen. Angelehnt an das mit rotem Blechdach gedeckte Gotteshaus kleben armselige, winzige Marktstände, Holzverschläge von einem Quadratmeter Grundfläche. Sie sind aus Treibholz schiefwinklig zusammengezimmert und mit Pappe, alten Kartons und Plastikfetzen verkleidet. Der Markt scheint wie ausgestorben. Ein paar Leute trotten ärmlich gekleidet durch die Gassen. Niedergedrückt. Kein sonst so typisch karibisches, unbeschwertes Lachen. Keine Fröhlichkeit, keine Musik. Tristesse!
Viele der Stände sind verlassen, leer. An einem hockt eine alte Frau hinter einem Dutzend schwarzer, matschiger Bananen, das ist alles, was sie zum Verkauf anzubieten hat. Sie braucht sicher nötig ein paar Gourdes.
„Bonswa, konbyen?“, wieviel kosten die, fragen wir sie. Wir kaufen ihr die Früchte ab. „Mesi anpil“, danke schön, sagen wir auf Kreolisch, in unserem Wörterbuch nachblätternd. Haitisch-kreolisch ist eine aus spanischen, französischen und englischen Worten zusammenfigurierte Sprache, deren Struktur jedoch westafrikanischen Sprachen entnommen ist. Wir können leider mit der Bananenverkäuferin nicht weiter kommunizieren, denn nur 15 Prozent der Bevölkerung sprechen Französisch, und das nur die gehobene Klasse, über 80 Prozent sind Analphabeten.
Ein paar Stände weiter liegen Schuhe vor einem Stand, ungeordnet, abgelatscht, mit abblätternden Sohlen, dazu einige Sandalen aus sonnengebleichtem Plastik. Ein Markt in völlig desolatem Zustand.
An der gegenüberliegenden Seite des dreikuppeligen Palais National, der Residenz des Präsidenten, steht die bronzene Freiheitsstatue des Marron Inconnu, des entlaufenen unbekannten Sklaven. In der einen Hand hält er eine große Seemuschel, die er zum Kampf gegen die Unterdrücker bläst, in der anderen eine Machete als Waffe. Symbol der résistence gegen die Unterdrücker. Erinnerung an die Befreiung der Sklaven, als sich Toussaint Louverture, ein ehemaliger Sklave, an die Spitze der Sklavenbewegung stellte. Als Katalysator hatte die Erstürmung der Bastille 1789 in Frankreich gewirkt. Die Sklaven Haitis befreiten sich und zwangen damit Frankreich zur Abschaffung der Sklaverei während der napoleonischen Ära.
Toussaint handelte sich dadurch den Beinamen „der schwarze Napoleon Haitis“ ein. Sein General Jean-Jaques Dessalines führte nach Toussaints Tod Haiti zur Unabhängigkeit. Er riss aus der französischen Tricolore den weißen Streifen heraus, als Symbol des weißen Mannes, und nähte Blau und Rot wieder zusammen. So entstand die bis heute wehende Flagge Haitis, mit ihrem Motto „Liberté ou la Mort“, Freiheit oder Tod.
Am 1. Januar 1804 wurde hier die erste schwarze Republik der Welt geboren. Damit nicht genug. Dessalines war dem Größenwahnsinn erlegen. Er krönte sich zum Kaiser Haitis, um die absolute Macht an sich zu reißen. Der Anfang einer Epoche von sich häufig wiederholenden, gewalttätigen politischen Umstürzen, die Haiti noch weitere 200 Jahre plagen sollte.
1807 wurde die Insel Hispaniola geteilt: in Haiti, den westlichen Teil und Saint-Domingue, den östlichen Teil.
Heute Abend wollen wir einen Rum Punch im Hotel Oloffson genießen.
Aber eine Demonstration auf dem Champs de Mars verhindert unsere Exkursion. Menschenansammlungen. Die Straße der Rue Capois ist blockiert. Wir spüren, dass es vernünftiger ist, zurück zum Plaza Hotel zu gehen. Der Pförtner lässt uns schnell hinein und schließt eilig das Tor.
Das Abendessen lässt keinen Spielraum für Auswahl. Die paar Gäste müssen sich mit dem begnügen, was aus der Küche kommt. Und das sind lauwarme Spaghetti, mit Ketchup serviert, und danach bannan peze, gebratene Kochbananen. Dazu ein „Presidente“, ein in der benachbarten Dominikanischen Republik gebrautes Bier.
Das Ende unserer Reise – aus unserem Tagebuch:
Tag 1
Schüsse! Wir stürmen in Unterwäsche zur Rezeption – keiner da! Der Morgen dämmert. Wir laufen zum Ausgang. Der Nachtwächter sitzt hinter einem Betonpfeiler und winkt uns vehement zurück. Zwei, drei Männer mit Gewehren versuchen das schwere, schmiedeeiserne Tor von außen zu stürmen. Sie klettern immer höher, aber vergeblich, das Tor reicht bis zur Decke. Was ist los? Weitere Gewehrsalven. Schreie. Um die Ecke blicken wir auf den Champs de Mars, Menschenmassen. Ein paar Milizen, Gewehr im Anschlag, huschen an den Häuserwänden als Rückendeckung entlang. Sie haben keine Chance die aufgebrachte Menge auseinanderzutreiben. „Allez! Zeigt euch nicht, geht zurück!“, schreit der Nachtwächter uns zu. In Sprechchören rufen die Menschen auf dem Champs de Mars: „Tuez-nous, de toute façon, nous allons mourir!“ – erschießt uns nur, wir sterben sowieso.
Plötzlich kommt eine Frau zum Hotel gehastet. Der Portier öffnet, lässt sie durchs Tor und sperrt es eilends wieder ab. Offensichtlich kennt er die Frau. Es ist Janique, Besitzerin des kleinen Reisebüros nebenan. Ganz außer Atem berichtet sie, warum sie fliehen musste. Ein Haufen aufgebrachter Männer hatte mit Steinen ihre Schaufensterscheibe zertrümmert, drang ins Kontor, begann zu plündern und nach Geld zu suchen.
Voller Angst ist Janique in unser Hotel geflüchtet, denn der Weg zu ihrer Wohnung im 10 Kilometer entfernten Pétion-Ville ist durch Straßensperren blockiert. Hier ist sie vorerst sicher. Sie spricht endlos lang mit ihrem Mann am zitternden Handy. „Bleib, wo du bist“, sagt er. „Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Ich kann hier nicht weg, um dich zu holen, Schießereien, Volksansammlungen überall.“ Wir sind jetzt gefangen in einem Hotel, Janique sogar im eigenen Land.
Tag 2
An der Rezeption, noch immer kein Mensch. Wenn es lange dauert in unserem Hotelgefängnis, wird das Trinkwasser zur Neige gehen. Es stehen nur noch wenige Wasserflaschen im Abstellraum hinter der Rezeptionstheke. Leitungswasser ist nicht potable, nicht trinkbar. Wie lange halten die Essensvorräte noch? Unser Zimmerklo ist verstopft. Bald sind alle außer Betrieb. Vieles geht uns durch den Kopf, während wir hilflos unter Freiheitsentzug leiden.
Janique legt ihr Tablet nicht mehr aus der Hand. Der Grund der ganzen Misere, belehrt sie uns, ist, dass die Politiker den Reispreis verdoppelt haben, und die Armen, die sich sowieso nur eine Tagesmahlzeit Reis leisten konnten, jetzt nur noch alle zwei Tage etwas essen können. Der Präsident René Préval will gegen Abend eine Ansprache zur Ausnahmesituation halten, informiert uns Janique. Aber weder im Radio noch auf ihrem Tablet erscheint eine Mitteilung von ihm. Dann im Radio eine knisternde knackende, kaum zu verstehende Neuigkeit der UN-Truppe, die am Flughafen stationiert ist:
„Der Präsident ist heute Abend mit einem Hubschrauber ausgeflogen worden.“ Er hat sich seiner Pflicht entzogen, kurz, er ist einfach geflüchtet und hat sein verzweifelt hungerndes Volk seinem Schicksal überlassen.
Tag 3
Die Nacht über wieder Schreie, Parolen, Gewehrsalven. Glas splittert, das Eisentor rappelt. Steine schlagen über der Mauer in die Fenster der oberen Etagen des Hotels ein. Viv liegt angekuschelt, aber nicht kuschelig neben mir im Bett. Es ist heiß und stickig in unserem Zimmer. An Schlaf ist nicht zu denken. Wir klammern uns fest aneinander. Ist das vielleicht unsere letzte Nacht auf dieser Erde? Wir sind noch mehr in Gefahr, weil wir die einzigen Weißen im Hotel sind, und weil Weiße häufig Ziele von Ausschreitungen sind, als Verantwortliche für die Misere, die sie den ehemaligen Sklaven beschert haben. Bei solchen Aufständen, wo die Stimmung sich aufheizt und hochschaukelt, kann es zu ungesteuerten Hassausschreitungen kommen. Mit diesen Gedanken im Kopf können wir nicht einschlafen.
Unser Zimmer ist voller Moskitos, Dengue Fieber ist eine Bedrohung. Bei Taschenlampenlicht hängen wir mitten in der Nacht unser Reisemoskitonetz auf. Die Beleuchtung streikt, der Strom ist ausgefallen.
Tag 4
Früher Morgen, an der Rezeption sitzt ein Mann. „Der Eigentümer ist weg!“, sagt er, er sei der einzig verbliebene Bedienstete. Alle anderen sind mitten in der Nacht geflohen. Er selbst könne nicht weg, weil seine Familie im fernen Gonaïves wohnt, und das seien 160 Straßenkilometer oft übelster Art. Straßensperren verhindern jegliche Flucht, „malheureusement“, leider, „c’est dommage“, sehr schade, klagt er.
So dommage ist es für uns jedoch nicht, wenigstens einer ist als Ansprechpartner noch da.
Die Frage nach einem Taxi zum Flughafen hat sich schnell erledigt, denn der Flughafen sei angeblich geschlossen, informiert uns der Rezeptionist.
Außerdem hätten die Taxifahrer zu viel Angst um ihre Autos, die gerne als Attackenziele von der aufgebrachten Menge umgeworfen und angezündet würden. Die ganze Stadt sei im Aufruhr verzweifelnder Menschen, die ums nackte Überleben kämpften. Kein Durchkommen mehr.
Wir fühlen uns wie betäubt. Wir müssen an die frische Luft, wenigstens bis in den Garten. Neben dem Pool gibt es eine Toilette, die noch funktioniert. Klopapier ist schon rar. Unter dem Dach des Pavillons steht eine Gruppe von vier menschlichen Baumstämmen, die aussehen wie Bodyguards. Sie logieren ebenfalls im Hotel. Viv spricht mit ihnen und fragt, ob und wie man zum Flughafen käme. Wir hätten aber keine Flugtickets.
„Talk to the boss“, sprich mit dem Boss, sagt einer der Männer und nickt mit seinem Kinn links über die Schulter. „There, that’s him, Kes.“ Da steht er, das ist er, Kes. Der breitschultrige, schwarze Zweimetermann im Pavillon ist nicht zu übersehen. Auf Vivs Frage antwortet er ruhig und überzeugend: „Yes, we want to get out as well. If you want to, we’ll take you with us.“ Ja wir wollen auch hier raus, wenn ihr wollt, nehmen wir euch mit.
„Tomorrow then, very early in the morning, be prepared before the sun rises! See you here at the pool.” Bis morgen dann, früh morgens, bevor die Sonne aufgeht. Seid bereit. Bis dann, hier am Pool.
Er sagt noch, er sei Haitianer, wohne aber in Florida und wolle seine Familie auch irgendwie hier rausbringen.
Tag 5
Eine weitere Nacht der Unruhe erwartet uns. Aber wir trösten uns damit, dass wir hier untergekommen sind und nicht im Hotel Oloffson. Das Holzhaus hätte uns keinen Schutz gegen plündernde und aufgebrachte Menschenmassen geboten. Wir wollen um fünf Uhr raus. Hoffentlich rappelt der Reisewecker. Unsere kleinen Kabinenrucksäcke sind gepackt und verschnürt. Wir liegen fertig angezogen in Reisekleidung im Bett. Das ist unsere letzte Chance dem Bürgerkrieg zu entkommen. Können wir dem Boss vertrauen? Ein Mann, der uns nicht kennt, den wir nicht kennen?
Unser mechanischer Wecker klingelt pünktlich, wir waren sowieso schon wach. Wir sind sofort bereit. Zähneputzen abgesagt. Minuten später stehen wir am Pool. Drei Bodyguards gesellen sich zu uns, noch ohne Sonnenbrillen. „Der Boss kommt gleich“, sagt einer, er muss nur noch seine Familie zusammentrommeln. Dann kommt Kes mit seiner Frau Cindy und zwei kleinen Töchtern. Im fahlen Morgenlicht schreitet er vorweg, wir dicht hinter ihm, bis zur hinteren Ecke des umzäunten Hotelgrundstücks.
Hinter dem Zaun steht versteckt ein dunkler, großer Pick-Up mit Doppelkabine. Kes nickt uns zu. Wir steigen im Fond mit Cindy und den zwei Mädchen ein. Ich habe ein Kind auf dem Schoß, Cindy das andere, Viv umklammert unsere zwei kleinen Rucksäcke. Kes sitzt vorne neben dem Fahrer und dirigiert uns hinaus, durch kleine Nebensträßchen. Er scheint die Stadt bestens zu kennen. Dann beginnt die Hindernisfahrt. Viv und ich sollen uns ducken, damit wir nicht als Weiße erkannt werden. Durch Gassen, mit Steinen und Autoreifen verbarrikadiert, jongliert der Fahrer, einer der brothers, wie sie sich alle nennen, geschickt und konzentriert.
Er fährt vorsichtig an herumstreunenden Menschen mit Steinen in den Händen vorbei, immer seinen Fuß bereit am Gaspedal, um im Notfall durchzustarten.
Die Kleine auf meinem Schoß wird unruhig, rutscht hin und her und will aussteigen zum Pinkeln. Kes ermahnt sie: „Das geht jetzt nicht, mach ins Höschen“, sagt er in einem Ton, der keine Widerrede zulässt. Nur, was ist dann mit meiner Hose? Besser mit einer nassen Hose raus als mit einer trockenen hiergeblieben, denke ich mir.
Brennende Autoreifen, umgestürzte Autos. Wir kommen an einer gefährlich lodernden Tankstelle vorbei – eine potentielle Megabombe. Der Fahrer ist genial. Er umfährt die Hindernisse in Schlangenlinien, als wäre er auf einem Autoparcours. Er nimmt die Schikanen durch das qualmende Chaos, als hätte er es vorher geübt.
Die Demonstranten versuchen, allen den Weg zu verlegen, die die Stadt verlassen wollen. Noch acht Kilometer bis zum Flughafen. Aber ist er überhaupt noch geöffnet?
Die Straße wird freier, und endlich, endlich biegen wir auf einen Parkplatz direkt vor dem Terminal ein. Zwei Panzerspähwagen einer Blauhelmtruppe sichern den Eingang. Menschenschlangen.
Kes bringt seine Familie in einer der Warteschlangen unter. Sie haben Tickets für einen Flug. Woher? Welchen Flug?
Es soll noch eine andere US-Maschine kommen, zur Evakuierung. Kes schleust uns bis ganz nach vorne zum Ticketschalter. Dann verlässt er uns: „Adieu“, „Good-bye“ und „Merci“, keine Zeit für große Dankesreden.
Kes verschwindet im Gewühl angstvoller, verzweifelter Menschen. Kinder schreien.
Die renommierte American Airlines soll noch kommen, munkelt man, aber das ist nicht sicher. So reihen wir uns also ein in die Schlange einer „gemunkelten“ Airline.
Ich sichte in einer Ecke ein kleines Schild, Spirit Airlines steht drauf und sprinte zum Schalter. Viv bleibt in der Schlange für AA. Die Dame am Check-In Counter der Spirit Airlines versichert mir, dass die Maschine schon unterwegs zur Evakuierung sei. Nur wann sie ankommt, weiß sie nicht. Egal, ich will zwei Tickets kaufen, nach Fort Lauderdale in Florida.
Aber, sagt sie, alles ausgebucht, nur noch ein einziger freier Platz. Ich renne zurück zu Viv, sage ihr, dass sie den letzten Platz hat und fliegen soll. Vehement lehnt sie ab: „Both of us or none of us“, entweder wir beide oder keiner, dann bleiben wir eben hier, zusammen, sagt meine tapfere englische Frau.
Ich bin überhaupt nicht einverstanden und hetze zurück zum Spirit Counter. Menschenmassen im Terminal, Chaos überall. Die ground hostess ist völlig überfordert. Ich versuche Ruhe zu bewahren. Meine Hände schwitzen. Ich bitte sie, noch einmal die Passagierliste durchzuchecken. Und da, auf einmal: „Doch!“, sagt sie, „ich habe noch einen zweiten Platz.“ 550 US-Dollar pro Person soll es kosten. Ich bin erleichtert. Ich gebe ihr meine Visa-Karte. „Akzeptieren wir nicht, nur Cash!“, sagt sie. Aber wir haben nur noch 700 US-Dollar Bargeld in der Tasche!
Verhandlung. Ich lege unsere restlichen Dollars auf die Theke und versuche es nochmals mit der Visa-Karte, die ich ihr entgegenstrecke. Sie ist gnädig, schiebt die Kreditkarte in die Kassiermaschine. Sie kommt wieder raus, nicht angenommen, funktioniert nicht! Sie hat sie falsch herum eingesteckt.
Ich drehe sie um. Jetzt klappt’s. Die restlichen 400 Dollar sind abgebucht.
Ich habe zwei Tickets in den Händen. Ich eile zu Viv. Sie löst sich aus der Schlange und wir steigen die Treppe hoch in die Wartelounge, etwas entspannter.
Das Flugzeug ist noch nicht in Sicht. Wird es überhaupt kommen? Es ist jetzt 11:30 Uhr. Ungeduldige, verängstigte Menschen um uns herum. Dann ein Aufschrei. Um kurz nach 12 Uhr setzt eine Maschine auf dem Rollfeld auf, es ist die Spirit Airlines Maschine. Sie rollt aus und dreht zum Terminal.
Der Pilot lässt die Triebwerke laufen. Blaubehelmte UN-Soldaten bilden ein Spalier bis zur Gangway. Keiner steigt aus, wer will auch jetzt schon nach Haiti?
„Vite, vite!“, schnell, schnell. Wir eilen aufs Rollfeld und die Gangway hinauf.
Freie Platzwahl. Keiner kontrolliert die Tickets. Der Pilot fährt die Turbinen auf Hochtouren, rollt das Flugzeug auf Position und startet durch. In einer Schleife sehen wir die Häuser von Port-au-Prince unter uns kleiner werden.
Wie eine Legostadt, als sei das alles nicht wahr gewesen. Eine brennende, qualmende, bedrückende Stadt. Rauchschwaden steigen auf. Unwirklich.
Jetzt schweben wir bald über dem karibischen Meer, über den Wolken, als hätte unsere Odyssee nie stattgefunden.
Als wir uns im Flieger umschauen, sind wir etwas verwirrt – er ist nur halb voll. Warum hat man nicht mehr Menschen mitgenommen, evakuiert? Was ist schiefgelaufen? Hat das digitale Buchungssystem versagt?
Kein Bordservice wird uns geboten. Den brauchen wir auch nicht. Ein Planter’s Punch, eine Piña Colada oder auch ein einfacher Rum aus Haiti sind uns nichts wert. Wir sind einfach nur dankbar, mit trockener Kehle der Bedrohung entronnen zu sein. Kes, Kesnel Theus aus Florida, hat uns jedenfalls uneigennützig geholfen – wahrscheinlich sogar das Leben gerettet!
Doch wie übersteht Janique diese Tage? Und Kes und seine Familie?
Werden sie ausgeflogen? Und wie werden die Haitianer diese schwere Zeit überleben? Was steht ihnen nach jahrhundertelangem Leiden noch bevor? Diesen Menschen, die keinen anderen Ort haben, zu dem sie entkommen könnten?
Bei aller eigenen Erleichterung – das Herz bleibt uns schwer.
2 Komodo
Drachen ohne Flügel
Warum läuft jemand mit Rucksack und einem zwei Meter langen Holzknüppel in der Hand über eine feuchtheiße Pazifikinsel, ein paar Grad südlich des Äquators?
Der Stock läuft vorne zu einer Astgabel aus. Eine echte Waffe ist er nicht, aber ein höchst wirksames Abwehrutensil gegen Drachenangriffe. Auf keinen Fall werde ich dieses Gerät bei unseren Wanderungen durch die hügelige Landschaft Komodos aus den Händen lassen! Näher als sonst ist Viv an meiner Seite.
Davon ahnten wir noch nichts, als wir im staubigen Straßengraben östlich der Hauptstadt Dili in Ost-Timor, dem Land der vielen Namen, saßen und warteten. Ost-Timor ist eine Tautologie, so wie Timor-Leste auf Portugiesisch, denn timor bedeutet übersetzt einfach Osten – somit heißt das ehemals portugiesische Land Ost-Ost. Der volle politische Name des Landes lautet auf Tetum, der austronesischen Lingua Franca neben Portugiesisch: Republika Demokratika Timor Loro Sa’e, wobei Loro Sa’e „wo die Sonne aufgeht“ bedeutet. Hier liegt Timor, ganz im letzten östlichen Zipfel von Nusa Tenggara, den kleinen Sundainseln. Das Wort Sunda geht zurück auf das Hindu-Sunda-Königreich (669-1573) der Ureinwohner West-Javas. Von Ost-Timor über Flores wollten wir weiterreisen auf die Insel Komodo.
Mehr oder weniger geduldig warten wir unter der aus dem Zenit brennenden Sonne. Neben uns ein halb-havarierter PKW. Unser jugendlicher Taxifahrer wendet alle Tricks und Kräfte auf, um die Radmuttern, von denen nur noch je zwei von fünf übrig sind, festzuziehen. Es nützt aber alles nichts: Nach zwei, drei, Kilometern beginnt der klapprige australische Holden wieder zu eiern. Erst schlenkert das Lenkrad, dann vibriert das Fahrzeug dermaßen, dass das Prozedere von Neuem beginnt – anhalten, aussteigen und im Straßengraben warten, bis die Muttern wieder notdürftig sitzen.
Obwohl unser junger Lenkradpilot mestiço, also portugiesisch-timoresischer Abstammung ist, spricht Dionísio nur Tetum. Das Ländchen ist zwar nur halb so groß wie Belgien, aber hier leben 15 ethnische Gruppen, die alle ihre eigene Sprache pflegen.
Der Zustand oder besser Nicht-Zustand des Fahrzeugs ist leider die Norm in diesem Land. Vielen Autos fehlen Türen, und die Windschutzscheiben bestehen aus Rissen, Löchern, Klebeband und Splitterwerk. Es verwundert nicht, dass das Land am Boden liegt, denn der Kampf um die Unabhängigkeit von Indonesien hat seine fürchterlichen Spuren hinterlassen. Dazu kommen noch die innenpolitischen Machtkämpfe der beiden Fraktionen Fretilin und UDT. Bis heute attackieren sie sich im Guerillakrieg in immer wieder aufflackernden Bürgerkriegen; über 100.000 Menschen mussten bisher ihr Leben lassen. UNO-Truppen patrouillieren an den Hotspots auf dem Land und in der Hauptstadt Dili, um das Schlimmste im Keim zu ersticken und die Bevölkerung zu schützen. Am 20. Mai 2002 erreichte Timor-Leste seine Unabhängigkeit – aber ein Ende der Spannungen ist nicht in Sicht.
Dionísio setzt uns an einem schattenlosen Strand ab. Nicht weit entfernt schimmern Korallen verheißungsvoll unter der Wasseroberfläche.
Remuneração (Bezahlung) und gorjeta (Trinkgeld) wandern in den staubigen Aschenbecher des Taxis. Adeus! und muito obrigado! (Vielen Dank) versteht Dionísio und lächelt. Während wir unsere Schnorchelausrüstung aus dem Rucksack ziehen, werkelt er an seinen Radmuttern, hupt, winkt noch einmal, und aufgewirbelter Staub zeigt an, wo der Holden uns abgesetzt hatte.
Bei 30 °C Wassertemperatur halten wir es sehr lange im Meer aus.
Schnorchelnd schweben wir auf der Wasseroberfläche und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Korallen und Fächerpflanzen bieten eine Heimat für blau-violette Papageienfische, Anemonenfische, Rotkopf-Zwerglippfische und so viele farbenprächtige Riffbewohner, dass wir uns nicht sattsehen können. Die ganze Regenbogenpalette ist vertreten. Die hin- und hereilenden Fische in der Korallenlandschaft stehen der Vogelwelt der Insel in ihrer morphologischen Vielfalt in nichts nach. Zurück am Strand kommt Vivs „Fischbibel“, ihr Bestimmungsbuch, ausgiebig zum Einsatz. Wir haben lange zu tun, bis alle gesichteten Arten abgehakt sind, und die Fischlektüre wellt sich nun unter Wasserrändern und Salzflecken.
Die ruhige Banda-See hier im Norden, von den Timoresen Tace-Teto, Frauenmeer, genannt, ist ein idealer Tauch- und Schnorchelgrund. Im Gegensatz dazu steht im Süden der Insel die raue Timor-See, Taci-Mane, die Männersee. Sie wird häufiger von Seebeben und den darauffolgenden Tsunamis heimgesucht, denn genau hier in der Subduktionszone des pazifischen Feuerrings finden plattentektonische Verschiebungen statt.
Australischer und asiatischer Schild bilden Verwerfungen, die die Ursache für den geballten Vulkanismus in dieser Erdzone sind.
Trotz der unsicheren politischen Lage entschließen wir uns nach Dili zurückzutrampen. Blauhelme patrouillieren die Straßen in unregelmäßigen Abständen, dürfen uns aber nicht mitnehmen. Also nehmen wir oft Taxis zu unseren Zielen auf Timor, aber das Abholen zu einer vereinbarten Uhrzeit hat nie geklappt. Viel zu viele Ablenkungen lauern den Fahrern auf dem Weg zu uns auf und lassen unsere Abholung in Vergessenheit geraten: Ein tebe-dai, ein Tanzfest irgendwo am Wegesrand, eine koremetan, eine Folkloreveranstaltung, oder ein grausames Hahnenkampfspektakel.
Bei diesem „Sport“ zerfetzen sich die beiden Kampfhähne mit einem rasiermesserscharfen Sporn am Bein bis aufs Blut. Die Wettbegeisterung der Zuschauer heizt die grausame Atmosphäre zusätzlich an. Aber meistens ist es wohl einfach uma avaria, eine Autopanne, die den Taxifahrer aufhält. Da bleibt uns nur der Autostopp, den wir schon oft, besonders in infrastrukturarmen Weltregionen, als Alternative genutzt haben.
Schon von ferne sehen wir die 27 Meter hohe Jesusstatue, die Dili überblickt, als wolle sie Timor-Leste endlich von den Bürgerkriegen, der Knute der Indonesier und den Folgen der 500jährigen portugiesischen Kolonialzeit erlösen. Ein Wahrzeichen, nachempfunden dem „Cristo Redentor“ in Rio de Janeiro.
Der Wink der Minibus-Fahrer nach oben zum Gepäckträger überzeugt uns nicht. Dort klammern sich schon andere Fahrgäste fest; eine Mitfahrposition, auf die wir lieber verzichten.
Sandelholz, seit alters her begehrtes Räuchermittel und bei Kunsttischlern auf der ganzen Welt gefragt, ist von Timor fast ganz verschwunden.
Stattdessen hat der Anbau von Kaffee Arabica den Sandelholzexport überholt – sogar Starbucks kauft hier große Mengen an Bio-Kaffee billig ein. In manchen Inselregionen wachsen noch ein paar Rest-Sandelholzbestände sowie Eukalyptus- und Tamarindenwälder. Auch der endemische Timor-Netzpython (Python reticulatus) ist an manchen Orten anzutreffen, die mit bis zu neun Metern längste Schlange der Welt. Ein weiterer Überlebenskünstler ist das Leistenkrokodil, vor dem man sich bei Wanderungen hüten muss, denn es ist im Süßwasser, also in Flüssen und Seen, ebenso zu Hause wie im Salzwasser. Krokodile haben auf Timor mythische wie auch kulturelle Bedeutung, ihnen sind häufig Totem-Häuser, uma lulik, gewidmet.
Eine austronesische Legende erklärt, wie es zur Gestalt und Form Timors kam: In grauer Vorzeit rettete ein kleiner Junge ein schwaches Krokodilbaby, indem er es ins schützende Meer hineintrug. Als viele Jahre später das alte Krokodil seinen nahenden Tod spürte, legte es sich zum Dank ins Meer, um mit seinem Körper dem Jungen und seinen Nachkommen – den nativen Timoresen – als Inselheimat zu dienen. „Wir verlassen unser Krokodil“, das sagen die Insulaner bis heute wehmütig, wenn sie ihre Heimat für länger oder für immer verlassen.
Direkt am Meer lehnen Viv und ich an einer portugiesischen Kanone.
Salzluft und Feuchtigkeit nagen an ihrer Oberfläche und haben Rostrosen auf dem jahrhundertealten Kriegsgerät zum Blühen gebracht. Über uns, in gewaltigen Baumkronen, finden gurrende Tauben und schrille Kakadus im letzten Abendrot ein Nachtquartier. Junge Leute in europäischer Kleidung und mit Kofferradios unterm Arm ziehen an uns vorbei, moderne Rhythmen dröhnen aus den Lautsprechern. Die traditionelle Kleidung ist in der Stadt fast aus der Mode gekommen. Diese tais, Webstoffe, werden von den Männern als mane tais wie Sarongs gewickelt getragen, die feta tais der Frauen sind schlauchförmig enganliegend genäht. Nur auf dem Land hat die mit speziellen Mustern der Region getragene Kleidung noch ihre Bedeutung. Lebensfroh bunt, rot, blau und gelb, wie die Farben der schottischen Clans, wird sie dort bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Beerdigungen und traditionellen Festen angelegt.
Die Grenze zum indonesischen Teil Timors ist unsicher, häufig geschlossen. In Grenznähe sind Überfälle nicht auszuschließen. Wir entschließen uns daher zu einem Direktflug auf die Insel Flores, das Sprungbrett nach Komodo. Ein Taxi ohne Heckscheibe und Handbremshebel bringt uns – hoffentlich, es sind nur sieben Kilometer – zum Flughafen. Es herrscht Linksverkehr, aber keiner hält sich wirklich dran. Man fährt einfach da, wo Platz ist.
Nicolau Lobato Airport hat kein Radar, also operiert er nur bei Tageslicht.
Unser Flug geht um sieben Uhr morgens, so ist es angesagt. Um zehn Uhr sitzen wir angeschnallt neben dem Propeller und fliegen endlich ab.
Die Flugbegleiterin trägt ein westliches Kostüm, aber ihr salendang, eine gewebte bunte Schärpe aus tais, erinnert an ihre Tradition.
Das schmale Band der Ost-West-Verbindungsstraße auf der Blumeninsel Flores windet sich doppelt so weit wie die Luftliniendistanz. Eine teuflische Strecke durch eine vulkanzerklüftete Bergwelt. Bemos und mikrolets, überfüllte Kleinbusse schaukeln uns in engen Serpentinen bergauf und wieder hinunter, wie auf einer Achterbahn.
Flores, im Westen der indonesischen Sundainselkette West-Nusa-Tenggara gelegen, wird von 14 aktiven Vulkanen gekrönt. Die über 13.000
Inseln Indonesiens beherbergen 129 tätige Vulkane. Eine ständige seismische Überwachung ist dringend erforderlich. Immer wieder führen tektonische Verschiebungen zu verheerenden Beben und Eruptionen.
Die schwerste noch in der Erinnerung der Menschen haftende Vulkanexplosion geschah 1883. Eine ganze Insel schoss wie der Korken einer warmen, geschüttelten Sektflasche in die Stratosphäre, hinaufkatapultiert bis in eine Höhe von 70 Kilometern. Die Schockwelle umrundete den Erdball sieben Mal und die sterbenden Ausläufer der Flutwellen waren sogar kräuselnd bis in die Nordsee wahrzunehmen.
Es war die Insel Krakatao in der Straße von Malakka, die am 26. August 1883 in dieser gewaltigen Explosion zersprengt wurde. Der anschließende Einsturz der Caldera rief eine bis 30 Meter hohe Flutwelle hervor, kostete 36.000 Menschen das Leben und vernichtete ungezählte Tiere und Pflanzen. Im Kern dieser Caldera wuchs ein „Kind“ heran, ein neuer kleiner Inselvulkan, der Anak Krakatao, Sohn seiner Krakatao-Mutter.
Warnend steht er da, höchst aktiv, drohend und qualmend, bereit zu weiteren Schandtaten; geboren 1930.
Unglaubliche Ereignisse reihten sich um diese Katastrophe: Auf Sumatra beobachteten Einheimische, dass Tiere sich – vor dem Ausbruch! – ungewöhnlich verhielten, ihre angestammten Plätze verließen und in die Berge flohen. Die Ureinwohner, geübt im aufmerksamen Beobachten der sie umgebenden Natur, folgten ihnen in höhere Regionen und entgingen somit der Gefahr. Der Dampfer Berouw wurde durch die Flutwelle zwei Kilometer bis ins Innere Sumatras befördert. Ein Fischer, der an der Mündung des Lampong-Flusses in den wütenden, verheerenden Wogen herumzappelte, klammerte sich an einen vermeintlichen Baumstamm und wurde meilenweit ins Inland gewaschen. Als er losließ, entpuppte sich der Baumstamm als ein gleichermaßen verängstigtes Krokodil.
In Flores auf dem Lande verläuft unsere Verständigung schmählich stockend, denn leider sind uns nur wenige Vokabeln geläufig. Eine der wichtigsten ist air minum – Trinkwasser, aber wenn die Antwort nicht eindeutig ist oder es keins gibt, reicht „Bintang Bir, silahkan“, Bintang-Bier, bitte. Das ist eine eindeutig keimfreie Sache.
Im Verwaltungsbezirk Manggarai im Westen von Flores, wo das Volk der Manggarai lebt, herrscht eine andere, eigenständige Sprache. Eine von 300 aktiven Sprachen und 600 Dialekten in Indonesien. Nationale Amtssprache ist die Bahasa Indonesia, eine moderne Form des Austronesisch-Malaiischen, die malaiische Händler mitgebracht hatten. Früher wurde sie mit arabischen Schriftzeichen geschrieben, heute in lateinischen Buchstaben, von niederländischen Missionaren importiert. Präsident Soekarno führte die Bahasa Indonesia 1945 als Lingua Franca zur übergreifenden Verständigung ein. Interessant ist die oft einfache Grammatik des Indonesischen, so heißt desa Dorf und desa desa Dörfer. Eine Art der Pluralbildung, wie man sie auch von afrikanischen Sprachen her kennt.
Besonders in den überall präsenten warungs, kleinen, verlockend duftenden Garküchen, kann man sich mit wenigen Indonesisch-Brocken beliebt machen. Zum Beispiel, wenn man auf gado gado, gekochtes Gemüse in Erdnusssoße mit nasi – Reis – zeigt und nur ini silahkan – dies bitte – und terima kasih – dankeschön – stottert.
Wem ein feuerscharfes Chiligericht die Eingeweide zu verbrennen droht, der deutet am warung schnellstmöglich auf geraspelte, gedämpfte Kokosnuss oder gebackene Ananas, die bald die Schärfe neutralisieren und den anschließenden Schluckauf besiegen. Ein bewährtes Mittel.
Zu unserer Freude gibt es überall Stände, die uns mit einer ganzen Palette exotischer Früchte versorgen. Unter anderem werden feilgeboten: Rambutan, kastaniengroße, haarige Früchte mit hochroter Schale (von den Indonesiern „Affeneier“ genannt): Der süße Geschmack des weißen Fleisches gleicht dem einer großen Traube. Oder Durian, die vielgeschmähte Stinkfrucht: kopfgroße, stachelige Früchte, die unter ihrem übelriechenden Samenmantel einen wohlschmeckenden, kastaniengroßen Samen verbergen. Das Gerücht geht um, dass, wenn die Durian von den Bäumen fallen, diese Früchte die Leidenschaft von Tigern, Elefanten und Menschen wie ein Feuer steigern und infolgedessen während der Reifesaison die Sarongs sich heben.
Die Fensterscheibe des Kleinbusses vibriert, von den vielen Kurven wird mir fast übel. Um mich zu stabilisieren, fixiere ich mit dem Blick standfeste Bäume und Sträucher am Straßenrand. Die auffälligsten sind die Frangipani. Ihre weiß-gelb-rosafarbenen Blüten zieren das Haar vieler Mädchen und Frauen. Die Blumenkelche verströmen einen verführerischen Wohlgeruch. Ein Parfüm, das nur die Natur hervorbringen kann und vergessen lässt, dass die Zweige des Baumes einen giftigen Milchsaft führen. Flores verdankt seinen Namen den zahlreichen Orchideen, deren Vielfalt die Portugiesen überwältigte, als sie Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals ihren Fuß auf die Insel setzten.
Nur knapp entgeht unser Buspilot bei seinen haarsträubenden Manövern anderen Fahrzeugen, die uns in unübersichtlichen Kurven entgegenkommen. Selbst kurz vor Haarnadelbiegungen schlängelt er den Bus noch schnell um ein Pferdefuhrwerk oder einen Ochsenkarren herum. Dabei knattert sein knalpot (= Auspuff, aus dem Niederländischen entlehntes Wort) aus allen Rostlöchern. Die Mitfahrer sehen das alles sehr locker. Sie unterhalten sich unbeeindruckt weiter und scheinen völlig entspannt, während wir unruhig auf den durchgesessenen Sitzen des mikrolets herumrutschen.
Die Menschen auf Flores leben gemäß dem Landesmotto: „Bhinneka Tunggal Ika“ – Einigkeit in der Vielfalt. Sie leben miteinander in selam, in Frieden, egal welcher Religion oder ethnischen Gruppe sie angehören. Das Christentum ist auf dieser Insel Hauptreligion, ein Legat der holländischen Kolonialzeit. Hochzeiten sind zentrale kulturelle Veranstaltungen, an denen alte Sitten wachgehalten werden, zum Beispiel der althergebrachte, rituelle caci, Peitschenkampf. Zwei Männer, je einer aus der Sippe der Braut und des Bräutigams, bekämpfen sich mit Riemenpeitschen, die tiefe, offene Wunden auf ihren nackten Oberkörpern hinterlassen.
Auch das tägliche Leben der Manggarai ist von tradierten Gesetzen und Gebräuchen durchwebt, beispielsweise der bis heute gebräuchlichen, genialen Landaufteilung innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Sie entspricht der Aufteilung des Dorfgemeinschaftshauses mharu gendang. Dieses „Trommelhaus“ ist ein konisch geformtes, strohgedecktes Gebäude mit kreisförmigem Grundriss, eingeteilt in „Kuchenstück“segmente. Jeder angestammten Familie gehört eins der „Kuchenstücke“. Die Einteilung des lingko, des Rundfeldes in Dorfnähe, ist ein Spiegelbild des mharu gendang. Es ist ebenfalls rund mit speichenförmig unterteilten Segmenten angelegt. Jeder Familie gehört hier das respektive Teilstück. Die Radachse bildet den sakralen Ort, wo „Vater oben im Himmel und Mutter unten in der Erde“ verehrt und mit Opfergaben bedacht werden.
Von Labuan Bajo, dem westlichen Hafen von Flores, sticht unser Motorboot in See. Als ein prahu, ein umgebautes hölzernes Fischerboot, wagt es sich in den Sog der Strömungen, die hier bei Flores aus dem Pazifischen und dem Indischen Ozean ineinanderfließen und sich zügellos bekämpfen. Da beide Meere unterschiedliche Höhen haben und die Meerestiefe zwischen den drei Inseln Flores, Rinca und Komodo mit 30 bis 70 Metern sehr gering ist, entstehen bei jedem Gezeitenwechsel gewaltige Strudel und Meeresdriften, die zu den stärksten der Welt zählen.
Wir kreuzen in Wallacea. Ein imaginäres Land in der biogeographischen Übergangszone zwischen Orientalis und Australis, an der Naht der beiden Kontinentalplatten Sunda und Sahu. Der viktorianische Naturforscher und Biologe Alfred Russel Wallace (1823-1913) erforschte und entdeckte hier, in den kleinen Sundainseln, die Übergangszone Asiens zu Australien. Beides tektonische Platten, die in dieser Region aufeinandertreffen. Die Wallace-Linie, die Trennungslinie zwischen den Platten des alten südostasiatischen Kontinents Sunda und des australischen Kontinents Sahul, führt durch die





























