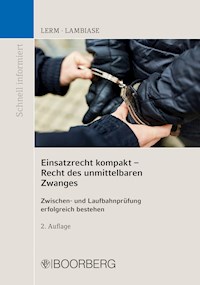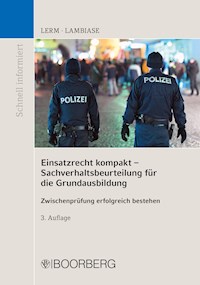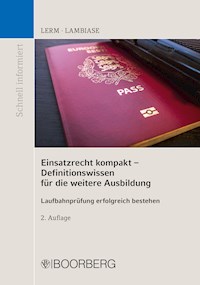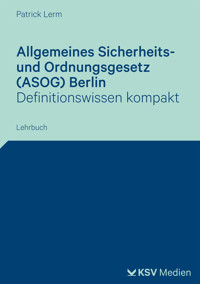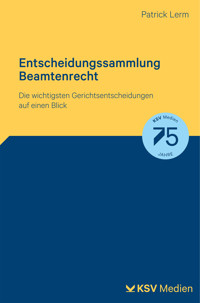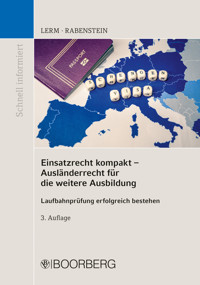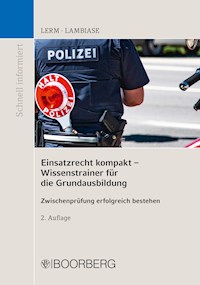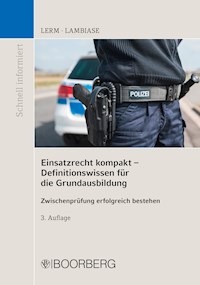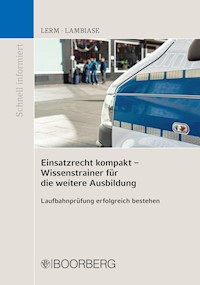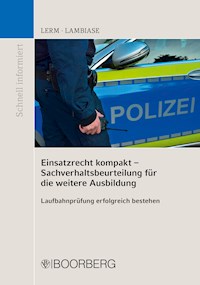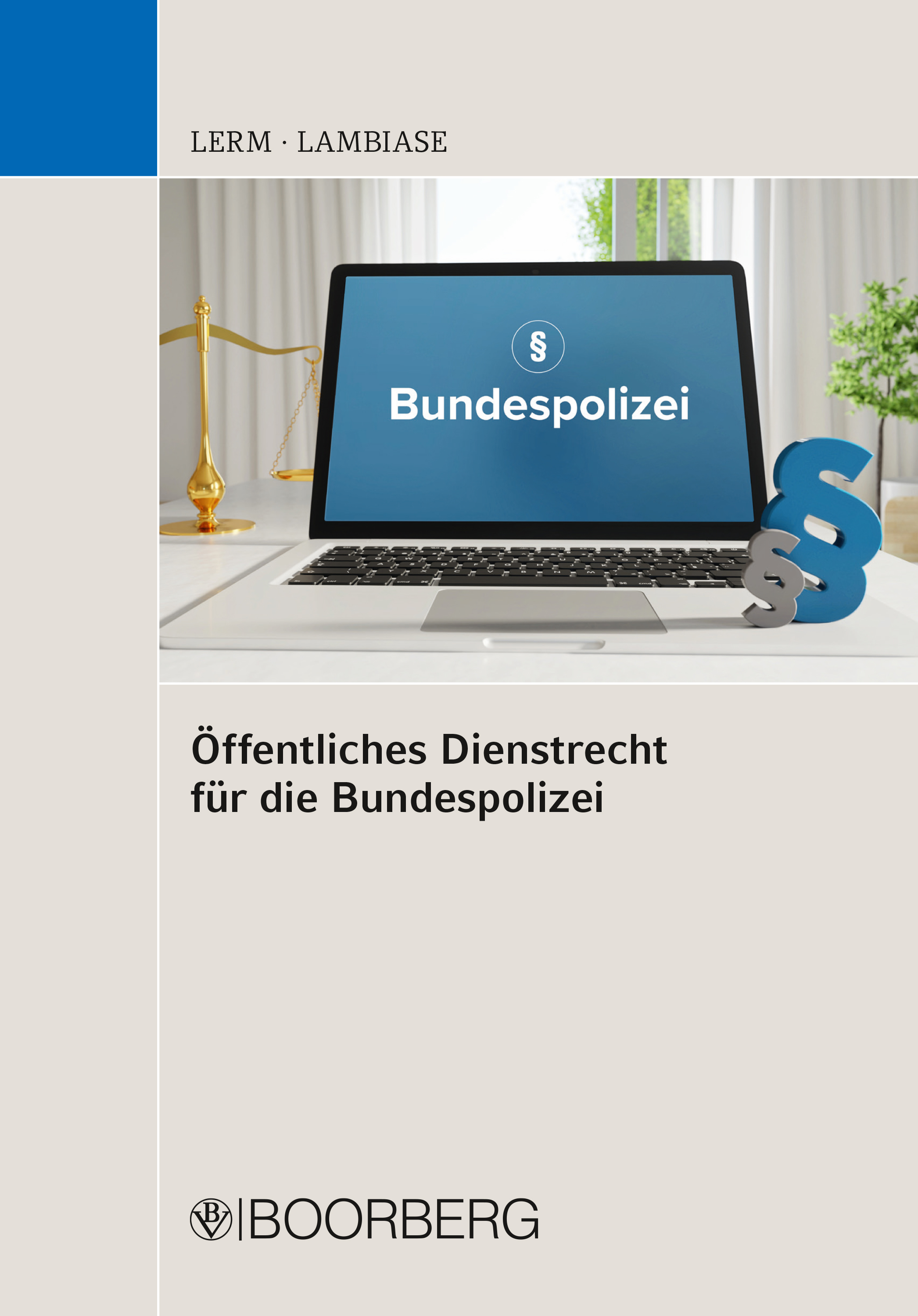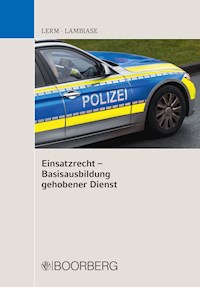
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bestens vorbereitet auf die Prüfung Das Lernbuch hilft den schriftlichen Leistungstest (am Ende der Basisausbildung) mit Erfolg zu bestehen. Die Autoren erläutern die polizeilichen Befugnisse und Straftaten, die Thema des Rechtsunterrichts der Basisausbildung sind. Grundlegendes Definitionswissen Aufbauend auf den rechtlichen Grundbegriffen (u.a. Gefahrenbegriffe, Entscheidung) stellen die Verfasser zunächst die erforderlichen Definitionen der Befugnisse und Straftaten dar, ohne die die spätere, erfolgreiche Sachverhaltsbeurteilung nicht denkbar ist. Zur Verdeutlichung sind stets der einschlägige Gesetzestext und ein kurzes Fallbeispiel beigefügt. Sachverhaltsbeurteilung leicht gemacht Mittels vorformulierter Hilfsfragen zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen bzw. Tatbestandsvoraussetzungen gelingt es den Anwärterinnen und Anwärtern, Sachverhalte rasch, umfänglich und damit erfolgreich zu bearbeiten. Das Buch enthält außerdem ausformulierte Mustersachverhalte zu den einzelnen Befugnissen und Straftaten. Ein separates Kapitel widmet sich dem Öffentlichen Dienstrecht, da dieses Fach oft Bestandteil des schriftlichen Leistungstests ist. Eine Musterklausur mit Lösungsvorschlag ergänzt dieses wertvolle Arbeitsmittel. Maßgeschneidert für: Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter des gehobenen Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei (BPOL), bereits ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte, die den Ausbildungsaufstieg absolvieren, und sog. Praxisaufsteigerinnen und -aufsteiger, die den verkürzten Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst anstreben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einsatzrecht – Basisausbildung gehobener Dienst
Lernbuch für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei
Patrick Lerm
Polizeioberkommissar Fachlehrer am Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg für Einsatzrecht und Öffentliches Dienstrecht Lehrbeauftragter der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung
Dominik Lambiase, M. A.
Polizeioberkommissar Fachlehrer am Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg für Einsatzrecht und Öffentliches Dienstrecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Print ISBN 978-3-415-06873-5 E-ISBN 978-3-415-06875-9
© 2020 Richard Boorberg Verlag
E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Titelfoto: © Tobias Arhelger – stock.adobe.com
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresdenwww.boorberg.de
Einführung
Dieses Lernbuch hat das primäre Ziel, den Polizeikommissaranwärter1 des gehobenen Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei (BPOL) in die Lage zu versetzen, die im Rechtsunterricht der Basisausbildung2 dargebotenen Befugnisse und Straftaten nachzuvollziehen und den schriftlichen Leistungstest (am Ende der Basisausbildung) mit Erfolg zu bestehen. Darüber hinaus ist dieses Buch geeignet für bereits ausgebildete Polizeibeamte, die den Ausbildungsaufstieg absolvieren, als auch für sog. Praxisaufsteiger, die den verkürzten Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst anstreben.
Die Anregung zur Erstellung dieses Lernbuches lieferten diverse Gespräche mit Polizeikommissaranwärtern und -anwärterinnen im Rahmen der Unterrichtungen in der Basisausbildung der vergangenen Studienjahrgänge am bislang größten Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrum in Bamberg. In Anlehnung an die ebenfalls im RICHARD BOORBERG VERLAG erschienenen Werke für die Auszubildenden des mittleren Polizeivollzugsdienstes (u.a. Einsatzrecht kompakt – Definitionswissen für die Grundausbildung, Zwischenprüfung erfolgreich bestehen) wurde versucht, den spezifischen Anforderungen an das Studium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes Rechnung zu tragen.
Aufbauend auf den rechtlichen Grundbegriffen (u.a. Gefahrenbegriffe, Entscheidung) werden zunächst die erforderlichen Definitionen der Befugnisse und Straftaten dargestellt, ohne die die spätere, erfolgreiche Sachverhaltsbeurteilung nicht denkbar ist. Stets dabei abgedruckt sind der jeweilige Gesetzesauszug und ein kurzes Fallbeispiel.
Auch wurde das im mittleren Polizeivollzugdienst bewährte Konzept der Hilfsfragen bei den einzelnen Tatbestandsmerkmalen bzw. Voraussetzungen aufgegriffen, durch die die Anwärter in die Lage versetzt werden sollen, Sachverhalte rasch, umfänglich und damit erfolgreich zu bearbeiten. Im Anschluss daran werden Mustersachverhalte zu den einzelnen Befugnissen und Straftaten ausformuliert. Ein separates Kapitel widmet sich dem öffentlichen Dienstrecht, da dieses Fach zumeist auch Bestandteil des schriftlichen Leistungstestes ist. Zum Schluss wird noch eine Musterklausur mit Lösungsvorschlag präsentiert.
Wir hoffen, dass dieses Werk auch über die eigentliche Basisausbildung hinaus an Strahlkraft gewinnt, da die hier dargestellten Inhalte im Laufe des Grund- und Hauptstudiums wiederholt und vertieft werden und somit weiterhin von Relevanz sind.
Bamberg, Juli 2020
Die Verfasser
Inhalt
Einführung
Kapitel 1 Begriffliche und schematische Grundlagen
1.1 Prüfungsschemata
1.1.1 Befugnisse
1.1.2 Straftaten
1.2 Prävention/Repression (Entscheidung)
1.3 Gefahrenlehre
1.4 Grundlagen des StGB
1.4.1 Grundlagen
1.4.2 Handlung und Kausalität
1.4.3 Elemente der Straftat
Kapitel 2 Definitionswissen
2.1 Präventive Standardbefugnisse
2.1.1 Generalklausel
2.1.2 Platzverweis
2.1.3 Datenerhebungsgeneralklausel
2.1.4 Befragung
2.1.5 Identitätsfeststellung
2.1.5.1 IDF nach § 23 I Nr. 1 BPolG – zur Abwehr einer konkreten Gefahr
2.1.5.2 IDF nach § 23 I Nr. 2 BPolG – bei der Grenzübertrittskontrolle
2.1.5.3 IDF nach § 23 I Nr. 3 BPolG – im Grenzgebiet (30-km-Bereich)
2.1.5.4 IDF nach § 23 I Nr. 4 BPolG – an gefährdeten Orten
2.1.5.5 IDF nach § 23 I Nr. 5 BPolG – zum Schutz privater Rechte
2.1.6 Datenabgleich
2.1.6.1 Datenabgleich nach § 34 I S. 1 BPolG
2.1.6.2 Datenabgleich nach § 34 I S. 2 BPolG
2.1.7 Durchsuchung von Personen
2.1.7.1 Durchsuchung nach § 43 I Nr. 1 BPolG
2.1.7.2 Durchsuchung nach § 43 I Nr. 2 BPolG
2.1.7.3 Durchsuchung nach § 43 I Nr. 3 BPolG
2.1.7.4 Durchsuchung nach § 43 III BPolG
2.1.8 Durchsuchung von Sachen
2.1.8.1 Durchsuchung nach § 44 I Nr. 1 BPolG – anlässlich einer Personendurchsuchung
2.1.8.2 Durchsuchung nach § 44 II BPolG – im Grenzgebiet
2.1.9 Sicherstellung
2.1.9.1 Sicherstellung nach § 47 Nr. 1 BPolG – zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr
2.1.9.2 Sicherstellung nach § 47 Nr. 2 BPolG – zum Schutz des Berechtigten
2.1.9.3 Sicherstellung nach § 47 Nr. 3 BPolG – bei Freiheitsentziehungen
2.2 Repressive Standardbefugnisse
2.2.1 Identitätsfeststellung
2.2.1.1 Identitätsfeststellung beim Verdächtigen, § 163b I StPO
2.2.1.1 Identitätsfeststellung beim Unverdächtigen, § 163b II StPO
2.2.2 Durchsuchung
2.2.3 Sicherstellung und Beschlagnahme
2.2.3.1 Sicherstellung nach § 94 I StPO
2.2.3.2 Beschlagnahme nach §§ 94 I, II, 98 StPO
2.3 Straftaten
2.3.1 Sachbeschädigung
2.3.1.1 Einfache Sachbeschädigung
2.3.1.2 Sachbeschädigung („Graffiti“)
2.3.1.3 Gemeinschädliche Sachbeschädigung
2.3.2 Diebstahl
2.3.3 Körperverletzung
2.3.3.1 Einfache Körperverletzung
2.3.3.2 Gefährliche Körperverletzung
2.3.4 Widerstandsdelikte
2.3.4.1 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
2.3.4.2 Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
2.4 Zwangsrecht
2.4.1 Allgemeines
2.4.2 Präventiver Zwang
2.4.3 Repressiver Zwang
2.4.4 Zwangsmittel
2.4.5 Weitere Vorschriften
2.4.6 Merkregeln und Definitionen zum unmittelbaren Zwang
Kapitel 3 Sachverhaltsbeurteilung
3.1 Präventive Standardbefugnisse
3.1.1 Generalklausel
3.1.2 Befragung
3.1.3 Identitätsfeststellung zur Abwehr einer Gefahr
3.1.4 Sicherstellung
3.2 Repressive Standardbefugnisse
3.2.1 Identitätsfeststellung
3.2.2 Durchsuchung
3.2.3 Beschlagnahme
3.3 Straftaten
3.3.1 Sachbeschädigung
3.3.2 Diebstahl
3.3.3 (Einfache) Körperverletzung
3.3.4 Gefährliche Körperverletzung
3.3.5 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
3.3.6 Tätlicher Angriff
Kapitel 4 Öffentliches Dienstrecht
4.1 Grundbegriffe und verfassungsrechtliche Grundlagen
4.1.1 Grundbegriffe
4.1.1.1 Beamtenarten in der Bundespolizei
4.1.1.2 Dienstherr und dessen Organe
4.1.1.3 Sonstige Beschäftigungsverhältnisse
4.1.2 Verfassungsrechtliche Grundlagen
4.1.2.1 Art. 33 II GG (Leistungsprinzip)
4.1.2.2 Art. 33 II GG (Gleichheitsprinzip)
4.1.2.3 Art. 33 IV GG (Funktionsvorbehalt)
4.1.2.4 Art. 33 V GG (Hergebrachte Grundsätze)
4.2 Grundzüge des Ernennungsrechts
4.2.1 Begriff der Ernennung und Ernennungsanlässe
4.2.2 Fehlerhafte Ernennung und Rechtsfolgen
4.2.2.1 Nichternennung
4.2.2.2 Nichtigkeit
4.2.2.3 Rücknahme
4.2.3 Beendigung des Beamtenverhältnisses
4.2.3.1 Entlassungsgründe für alle Beamten
4.2.3.2 Entlassung von Beamten auf Probe
4.2.3.3 Entlassung von Beamten auf Widerruf
4.3 Beamtenpflichten (Auswahl)
4.3.1 Verfassungstreuepflicht (§ 60 I S. 3 BBG)
4.3.2 Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz (§ 61 I S. 1 BBG)
4.3.3 Folgepflicht (§ 62 I S. 2 BBG)
4.3.3.1 Beratungs- und Unterstützungspflicht (§ 62 I S. 1 BBG)
4.3.3.2 Gehorsamspflicht (§ 62 I S. 2 BBG)
4.3.4 Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten (§ 61 I S. 3 BBG)
Kapitel 5 Übungsklausur
Lösungsvorschlag
Anlage 1 – Beschuldigtenbelehrung
Anlage 2 – Zeugenbelehrung
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.Franz Kafka
Kapitel 1Begriffliche und schematische Grundlagen
1.1 Prüfungsschemata
1.1.1 Befugnisse
Das nachfolgende Schema zur Prüfung von Eingriffsmaßnahmen im gehobenen Polizeivollzugsdienst dient (lediglich) zur Orientierung für die Basisausbildung. Das Schema wird im Grund- und Hauptstudium noch weiter ausgebaut und verfeinert. Gleichwohl ist es aus didaktischen Gründen erforderlich, das Schema (zumindest in den Grundzügen) kurz vorzustellen, so dass der im Unterricht dargelegte Inhalt besser eingeordnet werden kann.
Entscheidung für präventives oder repressives Einschreiten?
Bevorstehende RGV → Anhaltende RGV → Abgeschlossene RGV
A.Mögliche Ermächtigungsgrundlage
Grundsatz des Vorbehaltes des Gesetzes (Art. 20 III GG)
Nennung der in Betracht kommenden Rechtsgrundlage
B.Formelle Rechtmäßigkeit
I.Zuständigkeit der Bundespolizei
II.…
C.MaterielleRechtmäßigkeit
I.Ermächtigungsgrundlage(Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Befugnis → Subsumtion!)
II.Richtiger Adressat/Adressatenregelung
III.Allgemeine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
Die Kernelemente der Basisausbildung sind der Punkt B, Zuständigkeit3 (sachlich und örtlich), als auch der Punkt C, Ermächtigungsgrundlage und Verhältnismäßigkeit als Bestandteil der allgemeinen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen. Das Schema kann zum einen in Gänze Bestandteil des Leistungstestes sein. Es ist jedoch auch möglich, dass nur einzelne Teile daraus Bestandteil der Fragestellung sind.
Bevor man mit der Prüfung der genauen Ermächtigungsgrundlage (= Eingriff) beginnt, muss stets eine Entscheidung (präventiv/repressiv) getroffen werden, damit klar ist, welches Gesetz zur Anwendung kommt. In der Basisausbildung spielen, was die Befugnisse (= Ermächtigungsgrundlagen) betrifft, das Bundespolizeigesetz (BPolG) und die Strafprozessordnung (StPO) eine herausragende Rolle.
Befugnisse / Ermächtigungsgrundlagen
Präventiv (d. h. zur Gefahrenabwehr)
Repressiv (d. h. zur Strafverfolgung)
Maßnahme aus dem BPolG
Maßnahme aus der StPO
1.1.2 Straftaten
Wenn es um Straftaten geht, kommt häufig die typische Fallfrage auf Sie zu: Hat sich die Person strafbar gemacht?
Das Schema zur Prüfung von Straftaten ist etwas übersichtlicher als das zur Prüfung von Eingriffsmaßnahmen. Des Weiteren muss keine Entscheidung getroffen werden, welches Gesetz zur Anwendung kommt. Denn: Die in der Basisausbildung relevanten Straftaten finden sich alle im Strafgesetzbuch (StGB).
Schema zur Prüfung von Straftaten
Typische Fallfrage in der Klausur: Hat sich die Person strafbar gemacht?
1.Tatbestand
a)objektiver Tatbestand → Schwerpunkt Subsumtion (3er-Schritt)
b)subjektiver Tatbestand → Vorsatz und ggf. besondere Absichten
2.Rechtswidrigkeit
Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert die Rechtswidrigkeit. → ggf. Prüfung von Rechtfertigungsgründen
3.Schuld
→ Ggf. Prüfung von Schuldausschließungsgründen
Für den schriftlichen Leistungstest gilt auch hier, dass entweder das ganze Schema geprüft werden muss oder auch nur einzelne Teile davon, z. B. nur der Tatbestand.
Für alle Aufsteiger/Umsteiger aus dem mittleren Polizeivollzugsdienst ist es wichtig zu wissen, dass der Vorsatz des Täters im Studium des gehobenen Polizeivollzugsdienstes nicht beim Punkt Schuld zu prüfen ist, sondern im sog. subjektiven Tatbestand.
Zu den einzelnen Prüfungspunkten wie folgt:
1. Tatbestandsmäßigkeit (des Täterverhaltens)
1.1 Objektiver Tatbestand
►Beispiel: § 223 StGB Körperverletzung
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. […]
Der objektive Tatbestand des § 223 StGB ist:
■Andere Person
■Körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung
1.2 Subjektiver Tatbestand
a) Vorsatz: Wissen + Wollen der Tatbestandsverwirklichung
(für die meisten Delikte reicht bedingter Vorsatz aus)
b) Ggf. besondere Absichten, z. B.
■Absicht der rechtswidrigen Zueignung, § 242 I StGB (Diebstahl)
■Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr, § 267 I StGB (Urkundenfälschung)
2. Rechtswidrigkeit (der Tat)
Es gilt der (grundsätzliche) Merksatz: Die Tatbestandsmäßigkeit indiziert die Rechtswidrigkeit.
Was bedeutet dieser Satz genau?
Es darf im Regelfall vermutet werden, dass aufgrund der Tatbestandsmäßigkeit des Täterverhaltens die Tat auch rechtswidrig geschah.
Ausnahmen von der Rechtswidrigkeit:
■Vorliegen von Rechtfertigungsgründen, z. B. Notwehr gem. § 32 StGB
■Rechtfertigender Notstand gem. § 34 StGB
■Rechtmäßige Dienst- bzw. Amtsausübung
3. Schuld (des Täters)
Berücksichtigung von:
■individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten sowie
■Beweggründen, Zielen und dem Vorleben des Täters (s. auch § 46 StGB).
Ausnahmen von der Schuld:
■Sog. Schuldausschließungsgründe (z. B. § 19 StGB, unter 14 J.)
■Entschuldigender Notstand, § 35 StGB
1.2 Prävention/Repression (Entscheidung)
Dreh- und Angelpunkt (fast) jeder Sachverhaltsbeurteilung ist die Entscheidung. Gedanklicher Ausgangspunkt der Entscheidung sind die drei Hauptaufgaben der Polizei:
Gefahrenabwehr (Prävention)
Bei der Prävention handelt die Bundespolizei nach dem sog. Opportunitätsprinzip, d. h. die jeweilige Bundespolizeibehörde hat bei ihren Maßnahmen einen Handlungsspielraum. Die Behörde kann eingreifen, muss aber nicht. Man spricht hier auch vom pflichtgemäßen Ermessen (§ 16 BPolG).
Strafverfolgung (Repression)
Im Rahmen der Strafverfolgung handelt die Bundespolizei nach dem Legalitätsprinzip. Dieses ist die gesetzlich normierte Verpflichtung der Strafverfolgungsorgane, erkannte bzw. mögliche Straftaten von Amts wegen zu erforschen und zu verfolgen (s. auch § 163 StPO).
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Dieses Teilgebiet gehört zwar zur Repression, aber das Einschreiten der Behörden erfolgt nach dem Opportunitätsprinzip (s. auch § 53 Ordnungswidrigkeitengesetz – OWiG). Demnach haben die Behörden und Beamten des Polizeidienstes nach pflichtgemäßen Ermessen Ordnungswidrigkeiten zu erforschen und dabei alle unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten.
Anhand eines Beispiels aus dem bundespolizeilichen Aufgabenbereich soll die Entscheidung dargestellt werden:
►BPOLI Hamburg – Sie sehen am Bahnsteig eine Person, die eine Spraydose in der Hand hält und zielgerichtet auf einen Fahrausweisautomaten (FAA) zugeht.
Wie schreiten Sie hier ein? Wie lautet Ihre Entscheidung? (präventiv oder repressiv)?
Lösung
Der Schaden am Rechtsgut Eigentum der DB AG ist hier noch nicht eingetreten. Daher versuchen Sie hier, den Schadenseintritt zu verhindern und fordern die Person auf, die Spraydose auf den Boden zu legen. Man spricht hier von einer bevorstehenden Rechtsgutverletzung (in diesem Fall für das Eigentum).
Beachten Sie, dass polizeiliche Situationen dynamisch sind. Situationen können sich rasch ändern. Deshalb ist die Frage nach der Entscheidung stets eine Momentaufnahme. Die Situation wird für einen kurzen Moment eingefroren und Sie müssen sich entscheiden.
Sobald der Schaden am Rechtsgut eingetreten ist, spricht man von einem Schadenseintritt, siehe Übersicht. Dies wäre dann der Fall, wenn die Person bereits begonnen hat, den Automaten zu besprühen bzw. sie immer noch dabei ist, ihn zu besprühen. Das Verhalten stellt (zumindest) den Verdacht einer Straftat nach § 303 II StGB (Sachbeschädigung) dar. Die Polizeibeamten müssen demnach (auch) zwingend das Legalitätsprinzip beachten.
Sprüht die Person schon bzw. sprüht sie weiter, wird das Eigentum der DB AG immer weiter verletzt. Daher fordern Sie die Peron auf, unverzüglich mit dem Sprühen aufzuhören und die Dose auf den Boden zu stellen. Sie müssen demnach zunächst eine weitere Schadensvertiefung verhindern. Sie schreiten zuerst präventiv ein.
Kommt die Person der Aufforderung nach (also ist die Gefahr der Schadensvertiefung abgewehrt), werden im Anschluss repressive Maßnahmen eingeleitet wie z. B. eine IDF gem. § 163b I StPO. Sie schreiten demnach im Anschluss repressiv ein. Dies bezeichnet man auch als anhaltende Rechtsgutverletzung.
Nun zur dritten Rechtsgutverletzung:
Diese liegt dann vor, wenn es keine Gefahr mehr abzuwehren gilt. Der Schaden ist bereits eingetreten und eine Schadensvertiefung ist nicht mehr möglich.
Im Fall mit dem Sprayer würde das bedeuten, die Person hat gerade mit dem Sprühen aufgehört und beginnt, sich vom Tatort zu entfernen. Gerade in diesem Moment kommen Sie als Streife zum Ereignisort.
Es handelt sich demnach um eine abgeschlossene Rechtsgutverletzung. Sie schreiten (nur noch) repressiv ein.
Zusammenfassung am o. g. Beispiel
Sie sehen am Bahnsteig eine Person, die eine Spraydose in der Hand hält und zielgerichtet auf einen Fahrausweisautomaten zugeht.
Sie sehen die Person, wie diese gerade den Automaten besprüht.
Sie sehen, dass die Person gerade mit dem Sprühen aufgehört hat und sich vom Tatort entfernt.
Noch kein Schaden eingetreten
Schaden ist bereits eingetreten
Schaden ist bereits eingetreten
Schadenseintritt steht unmittelbar bevor
Schadensvertiefung ist möglich
Schadensvertiefung ist nicht möglich
Bevorstehende RGV
Anhaltende RGV
Abgeschlossene RGV
Präventives Einschreiten
Erst präventives, dann repressives Einschreiten
Repressives Einschreiten
Soweit zu den theoretischen Grundlagen der Entscheidung.
Für die Ausformulierung der Entscheidung gibt es ein kleines Schema, welches die Abarbeitung vereinfacht:
1.Kurzwiedergabe des Sachverhaltes
2.Benennung des beeinträchtigten Rechtsgutes
3.Feststellung, ob bereits ein Schaden eingetreten ist / ggf. Benennung der Straftat
4.Repressives Einschreiten möglich / nicht möglich
5.Schadensprognose (ist ein Schadenseintritt / Schadensvertiefung möglich)
6.Präventives Einschreiten möglich / nicht möglich
7.Feststellung der Art der Rechtsgutverletzung
8.Entscheidung zu repressiven / präventiven Einschreiten
Anhand der drei Sachverhaltskonstellationen und des Schemas finden sie auf den folgenden Seiten die entsprechenden Ausformulierungen:
Fall 1
Sie sehen am Bahnsteig eine Person, die eine Spraydose in der Hand hält und zielgerichtet auf einen Fahrausweisautomaten zugeht.
Fall 2
Sie sehen die Person, wie diese gerade den Automaten besprüht.
Fall 3
Sie sehen, dass die Person gerade mit dem Sprühen aufgehört hat und sich vom Tatort entfernt.
Fall 1
1.Die Person hat eine Spraydose in der Hand und läuft zielgerichtet auf einen Fahrausweisautomaten zu.
2.Durch dieses Verhalten ist das Rechtsgut Eigentum der DB AG beeinträchtigt.
3.Ein Schaden ist noch nicht eingetreten.
4.Repressives Einschreiten ist nicht möglich.
5.Die Person könnte mit dem Besprühen beginnen. Der Schadenseintritt steht unmittelbar bevor.
6.Präventives Einschreiten ist möglich.
7.Es handelt sich um eine bevorstehende RGV.
8.Ich schreite präventiv ein.
Fall 2
1.Ich sehe gerade die Person, wie diese gerade den Fahrausweisautomaten besprüht.
2.Durch dieses Verhalten ist das Rechtsgut Eigentum der DB AG beeinträchtigt.
3.Ein Schaden ist bereits eingetreten. Es kommt hier eine Straftat gem. § 303 II StGB (Sachbeschädigung) in Betracht.
4.Repressives Einschreiten ist möglich.
5.Die Person könnte immer weiter sprühen. Daher ist eine Schadensvertiefung möglich.
6.Präventives Einschreiten ist möglich.
7.Es handelt sich um eine anhaltende RGV.
8.Ich schreite zunächst präventiv ein (um die Schadensvertiefung zu verhindern), anschließend repressiv.
Fall 3
1.Ich sehe, wie die Person gerade mit dem Sprühen aufgehört hat und sich anschließend vom Tatort entfernt.
2.Durch dieses Verhalten ist das Rechtsgut Eigentum der DB AG beeinträchtigt.
3.Ein Schaden ist bereits eingetreten. Es kommt hier eine Straftat gem. § 303 II StGB (Sachbeschädigung) in Betracht.
4.Repressives Einschreiten ist möglich.
5.Eine Schadensvertiefung ist nicht möglich. Die Person entfernt sich vom Tatort.
6.Es handelt sich um eine abgeschlossene RGV.
7.Ich schreite repressiv ein.
Eine Empfehlung
Unabhängig davon, ob die Aufgabenstellung eine Entscheidung fordert, ist es ratsam, ständig eine kurze Entscheidungsprüfung im Kopf zu machen. Denn: Polizeiliche Situationen sind dynamisch. Je nachdem, wie das polizeiliche Gegenüber reagiert und je nach Fortschritt der Tathandlung(en) kann sich Ihr Einschreiten verändern.
1.3 Gefahrenlehre
Der Begriff der Gefahr taucht im BPolG mehrfach auf:
§ 3 Bahnpolizei
(1) Die Bundespolizei hat die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, [...]
§ 14 Allgemeine Befugnisse
(1) Die Bundespolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 1 bis 7 die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren [...]
§ 23 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen
(1) Die Bundespolizei kann die Identität einer Person feststellen 1. zur Abwehr einer Gefahr,[...]
§ 20 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen
(1) Die Bundespolizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach § 17 oder § 18 Verantwortlichen richten, wenn 1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, [...]
§ 47 Sicherstellung
Die Bundespolizei kann eine Sache sicherstellen,
1.um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, [...]
Gefahren lassen sich grundsätzlich durch die zeitliche Nähe des möglichen Schadenseintrittes und Intensität, d. h. das mögliche Schadensausmaß, unterscheiden.
Abgrenzung abstrakte Gefahr von der konkreten Gefahr
Man spricht auch von der generellen Möglichkeit, dass ein Schaden eintritt.
►Beispiel: Wenn sich Personen im Gleisbereich aufhalten, bestünde (ganz allgemein) eine Gefahr für Leib und Leben.
Diese ist definiert in § 14 II S. 1 BPolG: Gefahr im Sinne dieses Abschnitts ist eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Bereich der Aufgaben, die der Bundespolizei nach den §§ 1 bis 7 obliegen.
Aus dieser Definition leiten sich drei Tatbestandsmerkmale4 ab:
1. TBM
2. TBM
3. TBM
Gefahr im Einzelfall (konkret)
Öffentliche Sicherheit oder Ordnung
Aufgabenbereich der BPOL §§ 1–7 BPolG
►Beispiel: Wenn sich jetzt gerade (konkrete Zeit und Ort) Personen im Gleisbereich aufhalten, besteht eine konkrete Gefahr (für Leib und Leben).
Gegenwärtige Gefahr
Die gegenwärtige Gefahr ist eine 3-stufige Polizeigefahr, bei der das schädigende Ereignis bereits begonnen hat oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorsteht.
Hier die Kurzformel:
►Beispiel: Wenn sich jetzt gerade (konkrete Zeit und Ort) Personen im Gleisbereich aufhalten und ein Zug in wenigen Minuten diese Strecke passieren wird, besteht eine gegenwärtige Gefahr (für Leib und Leben).
Erhebliche Gefahr
Eine erhebliche Gefahr ist eine 3-stufige Polizeigefahr für ein bedeutsames Rechtsgut, wie Bestand des Staates, Leben, Gesundheit, Freiheit, wesentliche Vermögenswerte oder andere strafrechtlich geschützte Güter von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit. Die Legaldefinition der erheblichen Gefahr findet sich in § 14 II S. 2 BPolG.
Hier die Kurzformel:
►Beispiel: Wenn sich gerade (konkrete Zeit und Ort) Personen im Gleisbereich aufhalten, besteht eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter Leben und Gesundheit.
Gegenwärtige erhebliche Gefahr
Eine gegenwärtige erhebliche Gefahr ist eine 3-stufige Polizeigefahr, bei der das schädigende Ereignis für ein bedeutsames Rechtsgut bereits begonnen hat oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorsteht.
Hier die Kurzformel:
►Beispiel: Wenn sich jetzt gerade (konkrete Zeit und Ort) Personen im Gleisbereich aufhalten und ein Zug in wenigen Minuten diese Strecke passieren wird, besteht eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter Leben und Gesundheit.
1.4 Grundlagen des StGB
1.4.1 Grundlagen
In diesem Kapitel erfolgt eine einführende Darstellung in das Strafrecht. Grundsätzlich wird zwischen formellen und materiellem Strafrecht unterschieden.
Das formelle Strafrecht wird hauptsächlich durch die Strafprozessordnung (StPO) abgebildet. Das Strafgesetzbuch (StGB) und die Strafnebengesetze (BtmG, WaffG, AuslR, etc.). bilden das materielle Strafrecht ab.
Abbildung zur Einteilung des StGB
Das materielle Strafrecht beschreibt die Voraussetzungen der Strafbarkeit von bestimmten menschlichen Verhaltensweisen, die als sozialschädlich angesehen werden und deren Rechtsfolgen. Das StGB wird in einen Allgemeinen Teil (Voraussetzungen der Strafbarkeit) und einen Besonderen Teil (strafbare Handlungen und deren Rechtsfolgen) unterteilt.
Die Strafgesetze in der Übersicht
Im Strafrecht gibt es verschiedene Prinzipien, die zu beachten sind:
■Analogieverbot: Keine Strafe bei straffreien Verhaltensweisen, die Straftaten ähnlich sind.
■Bestimmtheitsgebot: Der Bürger muss erkennen können, was verboten ist.
■Verbot der Doppelbestrafung: Niemand darf wegen derselben Tat zweimal bestraft werden.
■Rückwirkungsverbot: Für Handlungen in der Vergangenheit dürfen nur die damals geltenden Gesetze angewendet werden.
■Keine Strafe ohne Gesetz: Man darf nur für durch das Gesetz verbotene Handlungen bestraft werden.
Weitere Prinzipien des deutschen Strafrechts sind:
■§ 3 StGB: Tatortprinzip
■§ 4 StGB: Flaggenprinzip
■§ 5 StGB: Schutzprinzip
■§ 6 StGB: Weltrechtsprinzip
■§ 7 StGB: Weitere Auslandstaten
■§ 8 StGB: Zeit der Tat
■§ 9 StGB: Ort der Tat
Das Strafgesetzbuch unterscheidet zwei Deliktsarten i. S. d. § 12 StGB:
Deliktsarten gemäß § 12 StGB
Maßgebend für die Einstufung ist die im Gesetz angedrohte abstrakte Freiheitsstrafe, nicht die in der Verurteilung festgesetzte Freiheitsstrafe.
1.4.2 Handlung und Kausalität
Eine Straftat kann durch Tun oder Unterlassen erfolgen. Um eine Straftat zu begehen ist also eine Handlung oder eine Nicht-Handlung erforderlich.
Eine Handlung im strafrechtlichen Sinne ist ein vom Willen getragenes menschliches Verhalten. Verhalten kann durch Tun oder Unterlassen erfolgen.
Wann handelt also jemand im strafrechtlichen Sinne?
Strafrechtliches Handeln liegt vor, wenn jemand seinen Willen einsetzt. Ohne Willen liegt keine Handlung vor. Nur bei völligem Ausschluss des geistigen Steuerungsapparats liegt keine Handlung vor.
Tun
Unterlassen
Das Entfalten von – wenn auch nur geringer – Kraft oder körperlicher Aktivität, die in irgendeiner Weise verändernd in die Außenwelt eingreift.
Das Nicht-Entfalten von Aktivität und Nicht-Eingreifen in ablaufende Kausalprozesse.
Vom Willen getragenes menschliches Verhalten kann folgendermaßen charakterisiert werden:
Übersicht: Vom Willen getragenes menschliches Verhalten
■Offensichtliche Handlung
—Das Schlagen eines anderen Menschen.
—Das Einschlagen einer Scheibe im Zug.
■Bewegungen im Zustand bloßer Bewusstseinsstörung
Verhalten im Rauschzustand (Alkohol, Drogen, etc.).
■Impulsive Handlungen
Taten im Affekt.
■Automatisierte Handlungen
Überreaktion einer eingeübten Handlung.
■Mit willensbeugender Gewalt
Eine andere Person zu einem Verhalten zwingen.
Diese o. g. Handlungen sind strafbar.
Weiterhin gibt es Handlungen, die nicht vom menschlichen Willen getragen werden.
Übersicht: Vom Willen nicht getragenes menschliches Verhalten
■Bloße Körperreflexe
Das Schlagen nach einer Wespe und dabei eine andere Person treffen
■Bewegungen im Zustand der Bewusstlosigkeit
Im Rausch krampft der A und tritt dabei aus und trifft den P am Knie.
■Bewegungen im Schlaf oder Krampf
Während eines Albtraums schlägt der Ehemann im Bett um sich und trifft die Ehefrau.
■Mit willensausschließender Gewalt
A schubst B auf eine andere Person. B verletzt beim Anrempeln die andere Person.
Bei diesen Handlungen ist eine Strafbarkeit ausgeschlossen, da keine Handlung im eigentlichen Sinne fehlt, da der Wille hierzu nicht vorhanden ist.
Ein weiteres Element im Strafrecht ist die sogenannte Kausalität. Kausalität bedeutet, dass zwischen der Handlung und dem Erfolg der Tat ein kausaler Zusammenhang bestehen muss.
Dies bedeutet, dass ein Ursachenzusammenhang zwischen einer bestimmten Bedingung und einer dadurch – unmittelbar oder mittelbar – bewirkten Folge bestehen muss.
Im Weiteren wird die Äquivalenztheorie betrachtet, obwohl es noch weitere Kausalitätstheorien gibt. Die Äquivalenztheorie meint, dass jede Ursache kausal ist, die den tatbestandlichen Erfolg herbeiführt. Also jeder Vorgang oder jede Handlung, die kausal für einen Sachverhalt ist, so dass der Sachverhalt nicht zustande gekommen wäre, wenn der Vorgang oder die Handlung hinweggedacht werden würde. Verkürzt lässt sich dies auf die Formel „Conditio sine qua non“ herunterbrechen.
►Beispiel: A schlägt den B mit der Faust ins Gesicht. B hat durch den Schlag in das Gesicht ein blaues Auge erhalten. A hat somit eine Körperverletzung gem. § 223 StGB begangen. Denkt man sich den Schlag des A weg (Ursache), so hätte der B auch keine Verletzung (Folge).
Diese Theorie birgt ein Problem in sich:
►Beispiel: Der Vater V schenkt seinen Sohn S ein Cabrio auf den Geburtstag. S gerät bei der ersten Fahrt ins Schleudern und fährt gegen einen Baum. S verstirbt noch am Unfallort.
Folgt man nun strikt der Äquivalenztheorie, so hätte der V tatbestandlich i. S. d. Totschlages gem. § 212 StGB gehandelt. Dieses Problem wird auch „uferlose Weite“ genannt. Dies würde in der Praxis zu absurden Ergebnissen führen. Dieses Problem wird über die objektive Zurechnung des Handlungserfolgs gelöst. Im Rahmen der objektiven Zurechnung muss geprüft werden, ob es sich hierbei um ein allgemeines, vertretbares Lebensrisiko handelt. Als Hilfe dient hier die Frage, ob der Täter eine rechtlich missbilligende Gefahr geschaffen hat.
Im vorliegenden Fall muss dies offensichtlich verneint werden, da ein Geburtstagsgeschenk eines Vaters an seinen Sohn eine sozial-adäquate Handlung darstellt.
1.4.3 Elemente der Straftat
Elemente der Straftat
Tatbestand
Der Tatbestand ist die Beschreibung der mit Strafe bewährten Handlung, also das äußere Erscheinungsbild einer Straftat.
Im Gesetz werden teilweise allgemeine Verbrechensmerkmale beschrieben („rechtswidrig“). Diese allgemeinen Verbrechensmerkmale sind keine Tatbestandsmerkmale.
Der Tatbestand einer Straftat
Eine Tatbestandsmäßigkeit liegt vor, wenn der Straftatbestand und Sachverhalt deckungsgleich sind. Es gibt objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale. Objektive Tatbestandsmerkmale beschreiben das äußere Erscheinungsbild, also Tatobjekt, Tatsubjekt (Opferkreis), Tathandlung, besondere Tatmodalitäten, usw.
Die subjektiven Tatbestandsmerkmale sind die inneren Merkmale, also Absichten, Motive und Gesinnungsmerkmale einer Straftat. Prägend für den subjektiven Tatbestand ist der Vorsatz. Im Rahmen des Vorsatzes können verschiedene Stufen unterschieden werden:
Vorsatzstufen
Bedingter Vorsatz
Merksatz: „Na wenn schon?“
Eventualvorsatz/ dolus eventualis
Unbedingter Vorsatz
Merksatz: „Wissen dominiert!“
Direkter Vorsatz/ dolus directus 2. Grades
Absicht
Merksatz: „Wollen dominiert!“
dolus direcuts 1. Grades
Falls in der jeweiligen Norm kein Vorsatz beschrieben ist, reicht der bedingte Vorsatz als Vorsatzform aus (§ 15 StGB: „Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.“
Abgrenzung Fahrlässigkeit und Vorsatz
Rechtswidrigkeit
Die Rechtswidrigkeit stellt die allgemeine Bezeichnung für den Widerspruch der Tat zur Rechtsordnung dar. Die Verwirklichung eines von der Rechtsordnung grundsätzlich verbotenen Verhaltens lässt den Schluss auf die Rechtswidrigkeit des in Rede stehenden Verhaltens zu (§ 11 I Nr. 5 StGB). Die Tatbestandsmäßigkeit der Handlung zeigt deren Rechtswidrigkeit an.5
Eine Handlung, die zwar tatbestandsmäßig ist, aber hierfür ein Rechtfertigungsgrund vorliegt, ist nicht strafbar.
Rechtfertigungsgründe
Rechtfertigungsgründe sind Umstände, welche eine Strafbarkeit ausschließen. Rechtfertigungsgründe beseitigen also das Unrecht der strafbaren Handlung, obwohl der Täter tatbestandlich gehandelt hat.
Rechtfertigungsgründe
Für die Polizei kommen regelmäßige folgende Rechtfertigungsgründe in Betracht.
Wichtige Rechtfertigungsgründe für Polizeivollzugsbeamte
■§ 32 StGB: Notwehr
■§ 34 StGB: Rechtfertigender Notstand
■§ 228 StGB: Einwilligung des Verletzten
■§ 127 I StPO: Jedermannsrecht
■§ 228 BGB: Defensivnotstand
■§ 904 BGB: Aggresivnotstand
■Mutmaßliche Einwilligung
■Rechtmäßige Dienstausübung
Schuld
Die Schuld ist Ausdruck der seelischen Beziehung des Täters zu seiner Tat und die Wertung dieser Beziehung als persönlich vorwerfbar.
Der strafrechtliche Schuldbegriff umfasst:
■die Schuldfähigkeit des Täters,
■das Unrechtsbewusstsein des Täters,
■Entschuldigungsgründe.
Die persönliche Verantwortlichkeit des Täters für sein Verhalten manifestiert sich in der Schuld. Die Verhängung einer Kriminalstrafe setzt stets ein schuldhaftes Handeln des Täters voraus, d. h. keine Strafe ohne Schuld.
Der Grundsatz „Keine Strafe ohne Schuld“ ergibt sich aus der Verfassung und hat Verfassungsrang. Eine explizite Regelung des Schuldgrundsatzes gibt es im StGB nicht. Jedoch gibt es in einigen Normen Hinweise auf diesen Grundsatz:
■§ 29 StGB –
Jeder wird nach seiner Schuld bestraft.
■§ 46 StGB –
Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe.
Liegen nicht alle Elemente der Schuld vor, so hat der Täter nicht schuldhaft gehandelt. Ohne ein schuldhaftes Handeln erfolgt keine Bestrafung (Geld- oder Freiheitsstrafe) des Täters. Dennoch können andere Maßnahmen in Betracht kommen, wie zum Beispiel §§ 63, 64 StGB.
Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt.
§ 16 I StGB bildet die Grundlage für die Schuld und bringt zum Ausdruck, dass der Täter alle Umstände der Tat kennen muss, es wird aber nicht verlangt, dass der Täter alle Tatbestände bis ins kleinste Detail kennt. Es genügt, dass der Täter eine ungefähre Vorstellung über ein verbotenes Handeln hat.
Die Schuldfähigkeit einer Person liegt vor, wenn der Täter fähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und auch fähig ist, in dieser Einsicht zu handeln. Schuldausschließungsgründe finden ihre Grundlage in den §§ 19 ff. StGB. Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist (§ 19 StGB). § 21 StGB regelt den Tatbestand der verminderten Schuldfähigkeit.
Wenn der Irrtum über das Verbot unvermeidbar war, besteht ein Schuldausschließungsgrund.