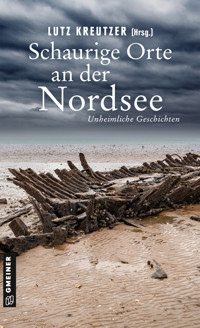9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Theo Krumme
- Sprache: Deutsch
Mit dem Eisnebel kommt der Tod – ein neuer Fall für Kommissar Theo Krumme.
Über die Küste Nordfrieslands bricht eine Kältewelle herein – und sie bringt Schlimmeres als Schnee und Eis. Im Husumer Hafen wird die übel zugerichtete Leiche eines Unbekannten aus dem Wasser gefischt. Kommissar Theo Krumme nimmt mit seiner Kollegin Pat die Ermittlungen auf. Die Spur führt sie in einen kleinen Ort auf der Halbinsel Eiderstedt, dessen Einwohner eng zusammenhalten. Und als ein Eisnebel über dem Deich heraufzieht, müssen Krumme und Pat die Dorfgemeinschaft vor einem skrupellosen Mörder schützen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Über die Küste Nordfrieslands bricht eine Kältewelle herein, Vorbotin düsterer Ereignisse. Denn kurz darauf wird aus dem Wasser des Husumer Hafens die übel zugerichtete Leiche eines Unbekannten gefischt. Kommissar Theo Krumme nimmt mit seiner Kollegin Pat die Ermittlungen auf. Die Spur führt sie in einen kleinen Ort auf der Halbinsel Eiderstedt, dessen Bewohner eng zusammenhalten. Und als ein Eisnebel über dem Deich heraufzieht, müssen Krumme und Pat die Dorfgemeinschaft vor einem skrupellosen Mörder schützen.
Weitere Informationen zu Hendrik Berg
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Hendrik Berg
Eisiger Nebel
Ein Nordsee-Krimi
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe März 2020 Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: FinePic®, München; mauritius images/Ingo Boelter Redaktion: Heiko ArntzKS · Herstellung: ik Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-25760-6V001 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1
Nur der eisige Wind wehte leise über das Feld, sonst war kein Laut zu hören. Die Morgensonne versteckte sich hinter grauen Wolken.
Er atmete die kalte Luft ein, schloss dabei für einen Moment die Augen, um eins mit der Natur und diesem jungen Tag zu sein. Er roch, schmeckte das Salz in der Luft, schließlich war die zum Meer führende Eider nur ein paar Kilometer entfernt. Er seufzte, strich sich mit der flachen Hand über das müde Gesicht. Griff in die tiefe Tasche seiner Jacke, holte ein Metallfläschchen heraus und drehte den Verschluss auf. Tee mit Rum. Er trank einen kleinen Schluck, lächelte, als er spürte, wie die warme Flüssigkeit durch seine Kehle rann.
Der Mann schaute nach oben in den Himmel. Es würde bald wieder schneien. Zeit, der Fährte weiter zu folgen. Noch war sie in der dünnen Schneedecke deutlich zu sehen. In Schlangenlinien führte sie über den Acker bis hin zu einem Knick, hinter dem der Mann im Morgendunst den Schatten eines kleinen Wäldchens ausmachen konnte.
Er steckte den Flachmann weg, richtete den dicken Schal und zog den Gurt stramm, an dem das Gewehr über seiner Schulter hing.
Also weiter. Kleine Atemwolken ausstoßend stapfte er über das Feld. Trotz seiner festen Stiefel musste er bei den gefrorenen Ackerfurchen aufpassen, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Bei einem anderen Ausflug vor einem Jahr hatte er sich dabei den Knöchel verrenkt und lange Zeit nicht laufen können. Das durfte ihm heute Morgen auf keinen Fall passieren.
Nach ein paar Minuten erreichte er den Knick. Während auf dem Acker nur ein dünner Schneeteppich lag, hatte der scharfe Ostwind hier einen hohen weißen Wall gegen das Gehölz gedrückt. Die deutlich zu erkennende Fährte führte eine Weile parallel zu dem Gestrüpp. Dann hatte sich das Tier durch eine kleine Lücke gezwängt und war auf die andere Seite gelangt. Zu eng für den kräftig gebauten Förster, der einen weiten Bogen machen musste, um wieder zu der Spur hinter dem Knick zu gelangen.
Trotz der Kälte war er ins Schwitzen geraten. Mit einem Taschentuch wischte er sich über die Stirn und sah sich um. Auf dem Feld konnte er fast hundert Meter weit sehen. Hier dagegen war die Lage unübersichtlich. Im Dickicht des Wäldchens erkannte er keinen Pfad. Die Birken, Eichen, Linden und Buchen standen wie erstarrte Riesen vor ihm. Ihre Äste waren wie das Gehölz am Boden von Eis überzogen. Schade, dass die Sonne sich nicht blicken ließ. Etwas Licht und die gefrorene Natur würden das Wäldchen wie ein Märchenschloss funkeln lassen.
Ein leises Knacken, ganz in der Nähe. Reflexartig streifte er den Gewehrgurt über den Kopf. Er wandte sich langsam in alle Richtungen, lauschte mit zusammengekniffenen Augen. Seit über zwanzig Jahren ging er auf Jagd, er wusste, wie er sich blitzschnell im Schutz der Bäume unsichtbar machen konnte. Doch hier, zwischen Knick und Wald, war das nicht möglich. Im Falle eines Angriffs gab es keine Deckung.
Wieder das Knacken, jetzt lauter. Mit einem Ruck fuhr er herum, das Gewehr im Anschlag.
Bloß eine Krähe. Der Vogel sprang durch das gefrorene Unterholz. Überrascht von seiner Gegenwart ruckte der Kopf nach oben, die dunklen Augen auf ihn gerichtet. Einen kurzen Augenblick starrten sich die beiden an, dann flatterte der Vogel mit einem verärgerten Krächzen davon.
Der Förster atmete aus und schüttelte lächelnd über seine Schreckhaftigkeit den Kopf. Seltsam, was für Streiche Schnee und Eis einem spielen konnten. Nur ein Vogel. Dem Geräusch nach hatte er mindestens mit einem Reh gerechnet. Vor allem, da er wusste, dass sich ein Sprung Rehe hier in der Gegend herumtrieb.
Jetzt begann es tatsächlich wieder zu schneien. Er musste sich beeilen. Wenn der Schneefall heftiger wurde, verschwand die Spur bald unter einer weißen Decke.
Bemüht, jeden Schritt so vorsichtig und leise wie möglich zu setzen, folgte er der Fährte und betrat das Wäldchen. Immer wieder musste er sich an dichten Büschen vorbeizwängen. Der Ast eines Haselnussstrauchs blieb in seinem Bart hängen. Er schlug ihn mit einer fahrigen Handbewegung fort. Dabei übersah er ein Erdloch und sackte mit seinem rechten Bein bis zum Knie im Schnee ein.
Der Förster fluchte leise. Ein Elefant im Porzellanladen könnte nicht mehr Unruhe verbreiten. Wenn es in diesem Wald tatsächlich Wild gab, hatte er es mit dem Lärm längst vertrieben. Hatte es überhaupt noch Sinn weiterzusuchen? Er hörte ein leises Knurren. Kein Tier. Nur sein Magen, der ihn daran erinnerte, dass er noch nicht gefrühstückt hatte, und Proviant hatte er auch keinen dabei. Er kam sich vor wie ein blutiger Anfänger. Am besten, er brach die Suche ab. Trotz der Wollsocken und dem extradicken Pullover fror er, und die Augen tränten.
Dabei hatte die Sonne mittlerweile eine Lücke zwischen den Wolken gefunden. Weiter im Norden berührte ein leuchtender Finger die Erde. In Friedrichstadt schien jetzt die Sonne. Doch hier wurde der Schneefall eher stärker. Schon war die Spur auf dem Boden nicht mehr zu erkennen. Nur einzelne abgeknickte dünne Zweige verrieten ihm, dass er noch der richtigen Fährte folgte.
Eine Ladung Schnee auf einem Eichenast löste sich im Wind und landete mit einem dumpfen Laut auf dem Boden. Er zuckte zusammen, blieb stehen. Er hatte hier nichts zu suchen. Mit seiner Körperfülle fühlte er sich in einem Hochsitz am wohlsten, sollten sich doch die jüngeren Jäger durch das Unterholz quälen.
Doch was war das? Dort hinten, verborgen im Schatten einer alten Eiche, bereits am anderen Ende des Wäldchens. Für einen Moment meinte er, im Schneegestöber etwas gesehen zu haben. Ein braun-graues Fell? Eine Bewegung?
Alarmiert umfasste er wieder das Gewehr mit beiden Händen. Dann stapfte er weiter. Langsam. Zweimal ging er hinter einem Baum in Deckung, um das Wild nicht aufzuschrecken. Oder was auch immer da hinten auf ihn wartete.
Endlich erreichte er die kleine Lichtung. Er hatte sich nicht getäuscht – zwei Rehe. Mit verrenkten Gliedern lagen sie in ihrem Blut. Ein Bock. Sein Bauch war aufgerissen, die Gedärme waren auf den Waldboden gequollen und in der Eiseskälte bereits gefroren. Ein Bein fehlte, war direkt am Unterleib abgetrennt worden. Der Hals zerfetzt, der Kopf baumelte nur noch an ein paar blutigen Sehnen.
Daneben eine Ricke. Auch bei ihr war der Bauch aufgerissen. Überall Blut. Ein Schlachtfeld. Dafür war ein Wolf verantwortlich, kein Zweifel. Jetzt konnte der Förster die Fährte auch wieder deutlich erkennen. Sie führte aus dem Wäldchen hinaus und weiter über die Felder. Richtung Westen, nach Nordfriesland.
Der Förster ließ den Blick in die Ferne schweifen, als ein Rascheln bei den Tierkadavern ihn zusammenzucken ließ. Er verzog das Gesicht. Es war nicht zu fassen. Die Ricke lebte noch, trotz ihrer schweren Verletzungen. Sie versuchte, sich zu erheben, setzte die Vorderläufe auf, aber die Hinterläufe wollten ihr nicht gehorchen. Sie reckte den Kopf, sah sich voller Panik um.
Der Förster seufzte und legte auf das Tier an.
Der Schuss zerriss die Winterstille und war noch viele Kilometer weit bis nach Friedrichstadt zu hören.
2
Der eisige Wind blies auf dem Deich heftiger als gedacht. Die Sonne hatte sich den ganzen Tag nicht sehen lassen. Jetzt, am späten Nachmittag, war die Temperatur noch einmal um ein paar Grad gefallen. Minus zehn Grad! Und in drei Wochen war Ostern!
Vom Meer sprühten immer wieder frostige Gischttropfen herüber und trafen Krumme wie kleine Nadelstiche im Gesicht. Aber er liebte es. Aus dem Grund war er vor ein paar Jahren von Berlin an die Nordsee gezogen.
Hier am Meer war Wetter noch Wetter. Er mochte Sonnenschein, aber ebenso gut gefielen ihm Sturm und Regen. Zu Hause, beim Essen oder vorm Fernseher, hatte er seine tägliche Routine, von der er nur ungern abwich. Aber beim Wetter war er ein Rebell. Es war eine Leidenschaft, die er erst nach dem Umzug nach Nordfriesland entwickelt hatte. Damals, als er noch in einer kleinen Wohnung in Neukölln gehaust hatte, war er vor jedem Schauer in die U-Bahn geflüchtet. Er hatte nie ein Fahrrad benutzt. Mit fünfundfünfzig Jahren hatte er sich darauf eingestellt, dass nichts mehr kam außer Alter, Rente und Tod.
Doch jetzt ging er über den Deich an Eiderstedts nördlicher Küste, blickte mit vor Kälte glühendem Gesicht über die aufgewühlten Wellen des Heverstroms hinüber nach Pellworm. In die andere Richtung bot sich ihm das wunderbare Panorama des winterlichen Eiderstedt. Einsame Höfe, Birkenreihen neben langen Wassergräben, weite Felder. In der Ferne ragte ein Kirchturm aus dem blassen Nebel. Was für ein Anblick!
»Wollen wir nicht endlich nach Hause?« Marianne scheuchte ihn aus den Gedanken. »Ich spür meine Füße kaum noch.«
Krumme sah seine Freundin überrascht an. Wie er trug sie einen dicken Mantel, Schal und Handschuhe. Aber anders als er wirkte sie gar nicht glücklich.
»Wir sind doch erst eine Stunde unterwegs«, erwiderte er.
»Eben. Eine Stunde in der Eiseskälte.«
»Du bist doch die Nordfriesin? Ich dachte, euch macht das Wetter nichts aus?«
Sie hustete. »Von wegen. Wenn jemand bei dieser Kälte unterwegs ist, dann nur Touristen. Wir Einheimischen bleiben schön zu Hause. Und machen es uns mit Kaffee und leckerem Kuchen gemütlich. Oder mit einem heißen Grog«, fügte sie mit sehnsüchtigem Lächeln hinzu und wischte sich mit dem Handrücken über die Nase.
Krumme musterte sie. Auch sie hatte von der Kälte gerötete Wangen. Ihre Wollmütze saß schief auf dem Kopf und konnte ihre strubbeligen blonden Haare im stürmischen Wind kaum bändigen. Marianne war nur ein paar Jahre jünger als er. Aber in Momenten wie diesen sah sie aus wie ein Teenager. Krumme lächelte.
Er zeigte zu dem riesigen Mischlingshund, den sie an der Leine hielt. »Was ist mit Watson? Ihm scheint’s zu gefallen.«
Tatsächlich schaute der Hund freundlich hechelnd Richtung Meer. Die Windböen schienen ihm nicht das Geringste auszumachen.
»Der hat ein dickes Fell. Ich nicht«, sagte sie trotzig mit zitternder Stimme.
Krumme nahm sie in den Arm und drückte sie an sich. »Schon gut. Ist wirklich kalt. Gehen wir nach Hause.«
Marianne lächelte erleichtert und gab ihm dankbar einen Kuss auf die Wange. Dann hielt sie ihm Watsons Leine hin. »Hältst du ihn mal kurz?«
Sie kramte nach einem Taschentuch. »Schon verrückt, dieser Kälteeinbruch. Und Weihnachten haben wir noch draußen auf dem Balkon in der Sonne gesessen.«
Krumme nickte. »Mit dir, mein Freund.« Er klopfte Watson auf die mächtige Flanke.
Doch der Hund hatte nur Augen für die kleine Herde Schafe, die, ein paar Meter vom Meer entfernt, mit den Köpfen vorweg hinter einigen Heuballen Schutz vor dem stürmischen Wind gesucht hatte.
»Meinst du, er will eins fressen?«, fragte Krumme.
»Sehr witzig.« Marianne verdrehte die Augen. Er grinste. Natürlich wusste er, dass Watson absolut harmlos war und keinem Schaf etwas antun würde.
Oder doch? Plötzlich spürte Krumme einen heftigen Ruck im Arm. Der riesige Hund riss sich los und sprang mit langen Schritten davon. Krumme konnte die Leine mit seinen dicken Fäustlingen nicht halten.
»Watson!«, rief er erschrocken. »Bleib hier!«
Aber der Hund beachtete ihn nicht. Stattdessen lief er den Deich hinab Richtung Schafe und der tosenden Nordsee.
»O Gott, nein!«, stammelte Krumme in Erwartung eines Massakers. Aber Watson wollte gar nichts von den Tieren. Laut bellend sprang er mit hin und her schwingendem Schwanz und weit heraushängender Zunge um die Tiere herum. Die rannten aufgeregt blökend davon, blieben aber schon nach ein paar Metern wieder stehen, schauten irritiert zu Watson und versuchten bei der Gelegenheit, etwas von dem vereisten Deichgras zu futtern.
Krumme jagte Watson hinterher, rutschte auf dem gefrorenen Boden aus und landete auf dem Hintern. Fluchend rappelte er sich wieder auf. »Watson, verdammt! Bei Fuß, kommst du wohl her!« Er versuchte, nach der Leine zu greifen, die der Hund hinter sich herumwirbelte. Ohne Erfolg. Von seinen Fesseln befreit war Watson viel zu aufgeregt, um sich von ihm einfangen zu lassen. Oder war für ihn alles nur ein Spiel?
Doch auf einmal schien sich der Hund nicht mehr für ihn oder die Schafe zu interessieren. Er blieb stehen, schnüffelte in der kalten Seeluft und lief dann den Deich hinauf. Krumme versuchte, sich im Hechtsprung auf ihn oder wenigstens die Leine zu werfen. Aber wieder landete er nur im Schnee. Er stöhnte und sah dem Hund hinterher.
Watson verschwand bereits über der Deichkrone. Schimpfend nahm Krumme die Verfolgung auf, hielt sich das Knie, das er sich beim Sturz gestoßen hatte. Dieser verdammte Hund! Er hatte ihn wirklich gern. Aber warum hörte er nicht auf ihn? Bei Marianne reichte ein kurzer Pfiff, und er stand stramm.
Aber dieses Mal klappte es selbst bei ihr nicht. Krumme beobachtete, wie sie ebenfalls den Deich hochlief.
Oben angekommen sah Krumme, dass Watson stehen geblieben war und mit angelegten Ohren in die verschneite Marsch hinabblickte. Selbst bei dem lauten Wind konnte er hören, wie der Hund zu knurren begann.
»Alles in Ordnung, Kumpel?«, erkundigte er sich besorgt, als er endlich neben ihm stand. Speichel troff aus Watsons gewaltigem Maul, die Augen funkelten. Er sah aus wie ein scharfer Wachhund, der sich jeden Moment auf einen Einbrecher stürzen wollte. Krumme konnte sich nicht erinnern, ihn je so furchterregend gesehen zu haben.
»Scheint was gewittert zu haben«, meinte Marianne.
»Aber was?« Krumme schaute hinunter auf die von Gräben durchzogenen winterlichen Wiesen. Er konnte nichts Bedrohliches erkennen. Watson schon. Plötzlich ließ er ein wütendes Bellen hören. Krumme zuckte erschrocken zusammen und trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
Marianne hatte keine Angst. Besorgt ging sie neben dem Hund in die Knie. »Was ist denn da?«, fragte sie und tätschelte ihm den Kopf.
Es war kaum zu glauben. Von einem Moment zum anderen war Watson wieder ganz der Alte. Mit braunen Teddybäraugen schaute er Marianne überrascht an – und leckte ihr dann mit seiner handtuchgroßen Zunge über das Gesicht.
»Wie machst du das nur?« Krumme schüttelte den Kopf.
Marianne richtete sich auf und zuckte mit den Schultern. »Vielleicht hat er ein Kaninchen gesehen?«
»Kaninchen? Er sah aus, als wenn er den Teufel persönlich gewittert hätte!«
Marianne lächelte und begann, den Schnee von seinem Mantel und seiner Hose zu klopfen. Auch Watson wollte mit seiner langen Zunge helfen, aber Krumme schob ihn verärgert zur Seite. »Jetzt komm mir nicht so, ich bin sehr böse auf dich! Läufst einfach davon!«
Marianne lachte. »Du vergisst immer, dass er ein Hund ist. Du kannst ja gerne mit ihm plaudern und Quatsch machen …«
»Quatsch?«, unterbrach Krumme sie und zeigte auf seine verdreckte Kleidung. »Sehe ich aus, als wenn ich gerne Quatsch mache?«
»… aber wenn du was von ihm willst, braucht er klare Kommandos.«
»Du meinst pfeifen? Kein Problem!« Krumme zog seinen Fäustling aus und versuchte, auf zwei Fingern zu pfeifen, brachte aber nur ein leises Fiepen hervor. Watson bemerkte es gar nicht, sondern beobachtete stattdessen hechelnd die Schafe, die zu dem Heuballen zurückgekehrt waren.
»Liegt an der verdammten Kälte«, brummte Krumme. »Eigentlich kann ich das.«
Marianne lächelte und streichelte ihm zärtlich über die Wange. »Komm, lass uns nach Hause fahren.«
Krumme gab seinen Widerstand auf. Arm in Arm und mit Watson an der Leine stemmten sie sich gegen den Ostwind an, als sie zurück zu Mariannes Golf gingen. Es kostete sie einige Mühe, den großen Hund in den kleinen Wagen zu schieben.
Schließlich fuhren sie los, am Deich entlang, dann vorbei am südlichen Husumer Hafen mit den großen Speicherhäusern und weiter in die Innenstadt. Bevor sie wieder in ihr Haus in der nördlichen Altstadt zurückkehrten, mussten sie Watson noch bei seiner Besitzerin Anette abgeben. Die junge Schauspielerin bereitete sich gerade wieder einmal auf ein Vorsprechen vor und war dankbar, dass Marianne und Krumme sich um Watsons Auslauf kümmerten. Kein Problem für die beiden. Der Hund war ihnen mittlerweile so ans Herz gewachsen, dass sie sich freuten, wenn sie ihn mit auf ihre Spaziergänge nehmen konnten.
Als sie ihr gemütliches Haus betraten, seufzte Marianne erleichtert auf. Endlich die eiskalten Füße aufwärmen! Sie waren noch ganz taub. Die Winterschuhe, die sie im Schlussverkauf erstanden hatte, taugten nichts. Krumme bot an, ihr eine Wanne mit warmem Wasser zu holen.
»Du bist ja süß«, sagte sie gerührt. »Was ist mit Essen? Soll ich uns nicht erst einen kleinen Happen machen?«
Aber auch darum kümmerte sich Krumme, holte Brot und Käse aus der Küche und sorgte sogar für den heißen Grog. Kurz darauf saßen sie nebeneinander auf Mariannes altem Sofa – Marianne mit den Füßen in einer Plastikwanne.
»Tut mir leid«, sagte Krumme, »wir hätten früher zurückkommen sollen.«
»Quatsch. Ist doch meine Schuld, wenn ich die falschen Schuhe anziehe«, erwiderte Marianne, nippte an dem Grog und lehnte ihren Kopf an Krummes Schulter.
Er lächelte. Für einen Augenblick schwiegen sie einträchtig. Nur die leise Musik aus dem Radio war zu hören. NDR Kultur, Mariannes Lieblingssender. Krumme mochte ja lieber Countrymusik. Aber an so einem entspannten Abend konnte er auch mit Mozart leben.
Eine Weile hing jeder seinen Gedanken nach. Schließlich fragte Krumme: »Was Watson da wohl gewittert hat?«
Marianne überlegte. »Vielleicht den Wolf, von dem sie in der Zeitung schreiben?«
»Der ist doch weit weg. Bei Itzehoe, haben sie gesagt.«
»Wer weiß, wo er sich bei der Kälte sein Fressen sucht. Wölfe sind viel unterwegs.«
»Du meinst, er kommt rauf bis nach Nordfriesland?«
Marianne zuckte mit den Schultern.
Krumme trank einen Schluck von seinem Grog. Er schaute zum Wohnzimmerfenster. Draußen war es mittlerweile dunkel geworden. »Ein Wolf an der Nordseeküste«, sagte er nachdenklich. »Das wäre ein Albtraum. Bei den vielen Schafen.«
Sie nickte betroffen. »Ich habe gehört, sie sollen manchmal sogar bis in die Städte kommen.«
»Aber doch nur in einsame Siedlungen. Bestimmt nicht nach Husum.« Er lächelte und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Aber wenn einer kommt, werde ich mich natürlich zwischen dich und die Bestie werfen.«
»Du?« Sie sah ihn spöttisch an.
»Ja, hallo? Ich bin Kriminalkommissar. Ich habe es schon mit ganz anderen Ungeheuern aufgenommen.«
»Aber vorhin hattest du sogar Angst vor Watson.«
»Stimmt ja gar nicht.«
»O doch.«
Krumme seufzte, dachte an ihr Erlebnis auf dem Deich. »Er hat aber auch furchterregend ausgesehen. Ich habe den Burschen gar nicht wiedererkannt.«
Marianne nickte. »Ich würde mich in so einem Moment nicht mit ihm anlegen.«
Krumme nahm erneut einen Schluck von seinem Grog. »Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich und Watson auf dich aufpassen. Dann brauchst du vor einem Wolf absolut keine Angst mehr zu haben.«
»Mein Held«, hauchte Marianne und gab ihm einen Kuss.
Krumme schloss die Augen. Er liebte es, wie sie roch, auch ohne jedes Parfüm. Ein leichter, sanfter Duft nach Zitrone und Lavendel, nach Geborgenheit, nach dem Menschen, mit dem er den Rest seines Lebens verbringen wollte. Er atmete tief durch, drückte sie zärtlich an sich. Wenn die Kälte dazu führte, dass sie öfter so gemütlich auf ihrem Sofa saßen, konnte der Winter gern noch länger bleiben.
Im Flur klingelte sein Handy.
Krumme stöhnte. »Bitte nicht.«
Es war Sonntag. Wer störte ihn da?
»Willst du nicht rangehen?«, fragte Marianne.
»Soll er doch auf die Mailbox sprechen.«
»Und wenn es das Präsidium ist?«
Krumme seufzte. Sie hatte ja recht. Er wusste auch, dass eigentlich nur die Kollegen der Kripo auf diesem Telefon anriefen.
»Wird schon nichts Schlimmes sein. Auch Bösewichte haben keine Lust, bei dieser Kälte aus dem Haus zu gehen.«
Das Handy klingelte noch. Ächzend stemmte Krumme sich aus dem Sofa hoch. »Na schön. Aber du bleibst hier. Rühr dich nicht vom Fleck.«
Sie nickte, warf ihm eine Kusshand zu, als er den Raum verließ und hinaus in den Flur ging, wo das Handy auf der Kommode lag. Er nahm ab.
»Hier Krumme, was gibt’s denn?«, brummte er.
»Hallo, Theo.«
Krumme stutzte. Das war kein Kollege. Aber er kannte die Stimme nur zu gut. Und spürte, wie ihm auf einmal eine Gänsehaut über den Nacken kroch.
3
Als Castor aus dem warmen Haus hinaus in den Garten stürmte, hatte er das Gefühl, in einen Kühlschrank zu steigen, so frostig war die Nacht hier draußen in der Marsch.
Schwer atmend, die Pistole im Anschlag, schaute er sich um. Die Auffahrt wurde links von einem Wall aus Pappeln und Birken gesäumt. Am Ende des Walls stand eine baufällige Scheune. Rechts begrenzte eine niedrige Steinmauer das Grundstück. Er lauschte. Nichts. Kein Laut war zu hören.
Er rieb sich das schmerzende Kinn. Der Angriff hatte ihn unvorbereitet getroffen. Ein Anfängerfehler, er hatte den Schlag nicht kommen sehen, obwohl er in der Situation auf alles gefasst hätte sein müssen. Er war so dicht vor dem Ziel gewesen! Kohnen hatte ihm diesen Auftrag gegeben, weil er ihm vertraute. Weil er wusste, dass er nie versagte. Und Castor wusste genau, wie wichtig Kohnen die Sache war. Hier ging es nicht darum, irgendeinen kleinen Gauner aus dem Weg zu räumen. Es ging auch nicht um Geld oder Geschäftliches. Das hier war etwas Persönliches. Niemals würde Kohnen ein Versagen akzeptieren. Deshalb hatte er ihn, seinen besten Mann und einzigen Vertrauten, geschickt. Und was tat er? Ließ sich wie ein Tölpel überraschen und überwältigen.
Er tastete nach dem Handy in der Hosentasche. Sollte er den Chef anrufen? Ihm erzählen, was los war? Dass er Verstärkung brauchte?
Nein, verdammt. Das hier würde er wohl noch allein hinbekommen! Kohnen hatte ihn nicht hierher – an das Ende der Welt geschickt, damit er beim ersten Problem den Schwanz einzog.
Er holte tief Luft, ließ den Kopf kreisen, um die Verspannung im Nacken zu lösen. Schluss mit der Grübelei! Zeit, aufs Ganze zu gehen. Wenn er Glück hatte, saß er morgen früh im Zug und war auf dem Weg nach Hause. Er hatte genug von dieser Einöde. Er vermisste die Stadt, wo man nicht stundenlang suchen musste, um ein anständiges Restaurant oder eine Bar zu finden.
Ein leises Knirschen holte ihn aus den Gedanken. Schritte auf dem gefrorenen Boden. Bei der Scheune. Im schwachen Licht, das hinter ihm aus einem Fenster fiel, sah Castor, dass das Tor der Scheune nur angelehnt war. Er hob den Lauf des Revolvers und lächelte. Na also, ihm entkam keiner. Schon bald würde er die Information erhalten, die er brauchte. Er wusste, dass er sehr überzeugend sein konnte, wenn es darauf ankam. Er vergewisserte sich, dass die Waffe entsichert war. Dann schlich er zu der Scheune und ging neben dem Tor in Stellung.
»He, ich will nur reden!«, rief er, die Pistole im Anschlag. »Kein Grund, nervös zu werden.«
Stille. Nur der Wind blies von der nahen Nordsee herüber.
»Sag mir, was ich wissen will, dann bin ich sofort weg. In Ordnung?«
Keine Antwort. Aber jetzt hörte er ein leises Rascheln. Kein Zweifel, jemand war in der Scheune und bestimmt nicht nur eine Ratte. Castor holte tief Luft. Langsam hatte er genug von dem Quatsch. Er musste das jetzt zu Ende bringen. Vielleicht half ja ein Schuss ins Knie, um die Angelegenheit zu beschleunigen.
Er räusperte sich. »Na schön«, sagte er so freundlich, wie es ihm möglich war. »Ich komme jetzt rein, entspann dich, wir wollen doch beide keinen Ärger.«
Er wartete noch einen Moment, dann stieß er das Tor auf. Im Innern war alles dunkel. Es roch nach Heu und Pferdemist. Aber Tiere waren nicht zu sehen. Am hinteren Ende der Scheune erkannte Castor die Umrisse eines großen Treckers.
»So, da bin ich. Komm einfach aus deinem Versteck. Ich tue dir nichts, versprochen.« Ihm war klar, dass das nicht sehr glaubwürdig klang, aber das war jetzt auch egal. Als Zeichen seines guten Willens hielt er die Pistole mit einer Hand nach oben in die Luft – natürlich ohne den Finger vom Abzug zu nehmen.
Ein Knarren ließ ihn zusammenzucken. Es kam von oben auf dem Heuboden, direkt über ihm. Er schaute hoch, musste den Blick aber wieder abwenden, als ihm Staub in die Augen rieselte. Ein Schatten, nein, zwei liefen oben über den Holzboden.
Er riss die Pistole hoch, schoss sofort. Einmal, zweimal. Er hörte Fluchen, einen Aufschrei. Hatte er getroffen? Nein, die Schatten rannten weiter, zur anderen Seite der Scheune.
Schluss mit dem Spiel!
Er schoss weiter, immer wieder. Holzsplitter spritzten. Funken blitzten durch die Dunkelheit, irgendwo hatte er Metall getroffen, der Querschläger zischte durch die Luft.
Er hielt inne, blickte an der Waffe vorbei nach oben. Hörte ein zähes Knirschen, dann das Bersten eines Pfostens, Holz, das langsam nachgab. Und sah viel zu spät, wie aus dem Dunkel der Öffnung etwas Großes auftauchte. Für den Bruchteil einer Sekunde glänzte Metall im spärlichen Licht. Dann schwang ein großer Gegenstand wie ein Pendel auf ihn zu – und traf ihn mit ungeheurer Wucht mitten ins Gesicht. Das laute Knacken seines Schädels war das Letzte, was er in diesem Leben wahrnahm. Dann wurde er in ein schwarzes Nichts geschleudert.
4
»Theo? Alles in Ordnung?«
Krumme drehte sich überrascht um. »Was?«
Pat, seine junge Kollegin, schaute ihn irritiert an.
»Du stehst seit fünf Minuten da am Fenster und starrst raus.«
»Ist das verboten?«
»Nein, aber außer dem Bahndamm und der Straße gibt’s da wirklich nicht viel zu sehen.«
»Also, ich finde, an so einem Wintertag sieht alles irgendwie reizvoll aus.«
»Machst du Witze? Wir haben den hässlichsten Ausblick von ganz Husum.«
Krumme wandte den Blick wieder aus dem Fenster. Pat hatte recht. Draußen gab es nur den Verkehr auf der Poggenburgstraße. Daneben einen Parkplatz, wo verdreckte Autos neben schmutzigen Schneehaufen standen. Dahinter die Gleise des Bahnhofs. Gerade donnerte dort ein endlos langer Güterzug durch die Stadt. Krumme seufzte. Pat hatte recht. In Husum gab es wunderschöne Orte, den Hafen, die Altstadt, den Schlosspark. Die Gegend rund um den unscheinbaren Siebzigerjahrebau der Polizei gehörte auf jeden Fall nicht dazu.
Krumme gab sich einen Ruck und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Er begann, einige Unterlagen zu sortieren. Krumme und Pat hatten bis auf ein paar Bagatelldelikte zurzeit keine akuten Fälle. Umso besser. Denn ihm fiel es heute schwer, sich zu konzentrieren. Immer wieder ging ihm der Anruf von gestern Abend durch den Kopf. Allein bei dem Gedanken bekam er Herzklopfen und ein mulmiges Gefühl im Bauch.
»Hast du nichts zu tun?«
Krumme sah seine Kollegin an. Pat war fast zwei Meter groß. Wenn sie sich aufrichtete, konnte sie ohne Probleme über ihren Computerbildschirm auf seinen Schreibtisch blicken.
»Erst siehst du eine Ewigkeit regungslos aus dem Fenster. Und jetzt schiebst du dieselbe Anzeige immer wieder von einer Seite des Schreibtisches auf die andere.«
Krumme blickte schuldbewusst vor sich auf den Tisch. Pat hatte recht!
»Beobachtest du mich?«
»Es ist mein Job, Leute zu beobachten. Außerdem seufzt du ständig so laut, dass ich mich kaum konzentrieren kann.«
Tat er das? Wie peinlich! Vielleicht wurde er langsam doch alt. Er blickte verlegen in Pats rundes Gesicht. Seit drei Jahren saßen sie jetzt schon zusammen in diesem kleinen Büro. Damals war er von der Berliner Kripo hierher nach Husum gewechselt. Die neuen Kollegen hatten ihm Pat an die Seite gestellt, eine völlig unerfahrene Kommissarin, direkt von der Polizeischule. Ein schüchternes großes Mädchen im schlabbrigen schwarzen T-Shirt und in Jeans, ständig mit dem Handy in der Hand. Er dagegen war ein Mann im fortgeschrittenen Alter, mit lichtem Haar und Rückenproblemen. Noch immer sorgten sie beide für Aufsehen und auch Spott, wenn sie irgendwo als Team auftauchten. Doch längst hatte Krumme die ruhige, gewissenhafte Pat als kompetente Partnerin schätzen gelernt. Und mit ihrer Begeisterung für neue Medien und Technik war sie ihm bereits mehrfach eine wertvolle Hilfe gewesen. Jetzt, wo er darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass Pat heute Morgen noch nicht einmal auf ihr Handy geschaut hatte.
»Ich war nur in Gedanken«, beantwortete er ihre Frage.
»Gedanken dienstlicher Natur?«
»Ist das hier ein Verhör?«
Sie musterte ihn mit nachdenklicher Miene. Dann blickte sie wieder auf ihren Bildschirm und tippte auf ihrer Tastatur herum. Krumme fiel ein gerahmtes Foto auf, das mit dem Bild nach unten auf ihrer Tischplatte lag.
»Ärger mit Mike?« Ihr Freund, ein Rettungssanitäter.
Pat sagte nichts, sondern hämmerte nur umso lauter auf ihrer Tastatur herum.
Er zeigte auf ihr stummes Handy. »Normalerweise schickt ihr euch jeden Morgen mindestens zehn Nachrichten hin und her.«
Sie atmete tief durch. »Wenn du mir nichts erzählst, muss ich dir auch nichts erzählen«, sagte sie, ohne vom Computer aufzusehen.
Na schön, dachte Krumme, dann wird eben geschwiegen. Er begann erneut, die Unterlagen zu sortieren. In der Stille hörte man das leise Pfeifen der Heizung. Ihr Heizkörper war kaputt und ließ sich nicht herunterstellen. Krumme saß nur im Hemd an seinem Schreibtisch, und ihm war trotzdem noch zu warm. Der Installateur sollte es längst repariert haben, hatte sich bisher aber nicht blicken lassen.
Krumme überlegte, ob er Pat nicht um Rat fragen sollte. Er redete höchst ungern mit anderen über private Probleme. Aber Pat hatte immer wieder Geduld mit derlei Dingen bewiesen, und trotz ihres jungen Alters verfügte sie über ein erstaunliches Feingefühl und viel Empathie. Und überhaupt, so viel Zeit wie mit ihr verbrachte er mit keinem anderen Menschen. Mehr noch als mit Marianne hatte er bei Pat das Gefühl, dass sie beide sich manchmal bereits wie ein altes Ehepaar benahmen.
Also gut, vielleicht sollte er über seinen Schatten springen und sie um Rat fragen. Er hüstelte, wollte gerade ansetzen, als sie ihm zuvorkam.
»Wir haben uns getrennt«, sagte sie – erneut ohne aufzublicken.
»Du und Mike? Getrennt? Aber wieso …?« Ihm fehlten die Worte. Er betrachtete die Rückseite ihres Computerbildschirms, konnte ihr schweres Atmen hören. Weinte sie etwa?
»Habt ihr euch gestritten?«, fragte er. Krumme mochte Mike – ein echter Nordfriese, genauso groß wie Pat und mit dem gleichen zweifelhaften Modegeschmack für schlabbrige schwarze Kleidung.
»Ich habe Schluss gemacht«, sagte Pat leise.
»Aber wieso?«
»Weil …« Sie überlegte. Endlich konnte er ihr Gesicht sehen. Sie schaute traurig aus dem Fenster. »Ich mag ihn ja. Aber in letzter Zeit hat mir irgendwie die … Romantik gefehlt.«
»Romantik?«, echote Krumme.
»Na ja, Mike ist nett und so, aber … weißt du, wann er mir das letzte Mal Blumen geschenkt hat?«
Das wusste Krumme nicht. Aber er erinnerte sich, dass er Marianne vor drei Monaten auf dem Wochenmarkt in der Altstadt den Vorschlag gemacht hatte, sich doch selbst ein paar Blumen auszusuchen. Sie hatte es getan, aber ihre Begeisterung hatte sich in Grenzen gehalten.
»Vielleicht war er mit seinen Gedanken woanders? Schließlich ist er Rettungssanitäter.«
Pat wirkte nicht überzeugt. »Es sind die kleinen Dinge. Ein bisschen Aufmerksamkeit …«
»Hm«, machte Krumme nur.
»Aber weißt du, was das Schlimmste ist?«
Krumme schüttelte den Kopf.
»Er will nie mit mir shoppen gehen«, stöhnte Pat.
Dieses Mal konnte Krumme seine Verständnislosigkeit nicht verbergen. »Shoppen?«, wiederholte er. Er hasste Shoppen!
Pat nickte, den Tränen nah. »Schon vor Ewigkeiten hat er mir versprochen, zum Outlet nach Neumünster zu fahren.«
»Und?«
»Und? Nichts! Er hat mich angelogen. In Wirklichkeit wollte er niemals mit mir dahin.«
Krumme verzog das Gesicht und schwieg. Er fragte sich, was Pat da hatte kaufen wollen. In seiner Wahrnehmung hatte sie immer das gleiche schwarze T-Shirt an.
»Jedenfalls …«, fuhr Pat fort und wischte sich mit der Hand über die verschwitzte Stirn, »glaube ich, dass eine kleine Pause im Moment das Beste für uns ist.«
»Vielleicht.« Krumme nickte und beschloss, Mike mal zu fragen, ob er Lust auf ein Bier unter Männern hatte.
»Und? Jetzt raus mit der Sprache!«, nahm Pat einen neuen Anlauf. »Was ist mit dir und Marianne?«
Er sah sie überrascht an. »Mit Marianne? Nichts, alles wunderbar, was soll denn sein?«, fragte er verwundert.
Pat sah ihn enttäuscht an. »Na toll, ich verrate dir mein Innerstes. Und du kriegst den Mund nicht auf.«
»Stimmt doch gar nicht.«
Aber Pat seufzte nur enttäuscht und hämmerte wieder auf die Tasten.
Krumme sah sie an. Es stimmte, er musste ihr ebenfalls die Wahrheit sagen. Schlimm genug, dass er Marianne nichts verraten hatte. Er überlegte, wie er anfangen sollte, hüstelte verlegen und holte Luft – als das Telefon klingelte.
Pat ging sofort ran. Schweigend hörte sie zu, was der Anrufer ihr zu sagen hatte, nickte nur bedächtig und machte sich ein paar Notizen.
»O nein, wie schrecklich«, sagte sie schließlich.
Krumme verzog das Gesicht, immer das Gleiche, wenn Pat abnahm. Wieso spannte sie ihn auf die Folter? Es wäre ein Leichtes, ihm mit ein paar Worten schon während des Gesprächs zu verraten, worum es ging. Oder wollte sie ihm nichts sagen, weil sie eingeschnappt war?
Schließlich legte sie auf und sah ihn mit ernster Miene an.
»Und?«, fragte er ungeduldig.
Pat stand auf, griff nach ihrer schwarzen Daunenjacke. »Schluss mit dem Papierkram. Wir haben einen neuen Fall.«
5
Sie mussten nicht weit fahren. Ihr Ziel war ein verlassenes Werksgelände am Nordufer des Husumer Außenhafens. Das Gelände bot einen traurigen Anblick. Kein Mensch zu sehen. Nur ein paar einsame Container und zwei LKW-Anhänger standen neben einer abbruchreifen Halle. Auf einer Mole erhob sich ein großer Haufen Schrott. Der heftige Wind, der über den Heverstrom von der Nordsee in den Hafen blies, hatte den löchrigen Asphalt vom Schnee befreit und ihn stattdessen in hohen Wehen an die Mauer der Halle gedrückt.
Sie stellten ihren Dienstpassat neben drei Streifenwagen, die als Einzige für ein bisschen Farbe in dieser trüben Welt aus Schwarz und Weiß und Rostbraun sorgten. Als Krumme mit Pat aus dem Wagen stieg, wurden sie sofort von einer eisigen Böe erfasst, so heftig, dass Krumme sich kurz an seiner Kollegin festhalten musste.
Verlegen ließ er ihren Arm los, als er sich gefangen hatte. »Tschuldigung«, sagte er. Pat nickte gnädig und schwieg. Mit seinen dicken Fäustlingen fummelte er ungelenk den Reißverschluss der Winterjacke hoch und zog sich die Kapuze über den Kopf.
Pat wies zu einem mit Flatterband abgesperrten Bereich am Ende der Mole direkt an der Hafenmauer. »Da hinten ist es.«
Schweigend stapften sie am Wasser entlang. Immer wieder mussten sie sich gegen einzelne Böen stemmen. Bei der Mole duckten sie sich unter dem im Wind knatternden Flatterband hindurch und gingen zu zwei Kollegen, die sich in den Windschatten eines Mauervorsprungs geflüchtet hatten, während zwei Männer der Spurensicherung den Boden absuchten. Neben den Polizisten bei der Mauer stand ein Hafenarbeiter mit Vollbart.
»Moin«, sagte Krumme.
»Was für ein Gepuste«, erwiderte einer der beiden uniformierten Beamten von der Schutzpolizei und verschränkte die Arme fröstelnd vor der Brust. Polizeihauptkommissar Kurt Breuer. Krumme wusste, dass seine knollenartige Nase nicht nur von der Kälte, sondern vor allem von den regelmäßigen abendlichen Bierchen gerötet war. Er nickte dem anderen Kollegen zu, Polizeihauptwachtmeister Lothar Petersen, einem kräftigen Mann mit gegelten blonden Haaren. Ihm schien die Kälte wenig auszumachen. Er trug seine Jacke offen, hatte keine Mütze auf und hielt in der einen Hand eine Zigarette, während die andere lässig in der Hose steckte. Mit abschätziger Miene betrachtete er Pat. Nicht ganz unbegründet, denn die sah in ihrer dicken Wolljacke, mit dem schwarzen Strickbeanie und den dunklen Chucks aus wie ein überdimensionaler Teletubby auf dem Weg zu einer Beerdigung.
»Also, was ist passiert?«, fragte Krumme.
Petersen forderte den Hafenarbeiter mit einer Handbewegung zum Reden auf. Der kräftige Mann mit dem Vollbart trat einen Schritt vor und stellte sich als Hinnerk Kattelsen vor. »Ich sollte heute Morgen eine von den Schuten abholen«, fing er im breiten Norddeutsch an. »Gar nich’ so einfach. Is’ ja alles zugefroren. Der Chef hat gesagt, ich soll die Paula 4 nehmen. Is’ gerade letzte Woche überholt worden. Der Schlepper hat lange gebockt, aber jetzt läuft er wieder wie geschmiert.«
»Sie haben also das Ding da rausgezogen?«, unterbrach Krumme den aufgeregten Redefluss des Hafenarbeiters und zeigte auf einen Lastkahn, der an der anderen Seite des Hafenbeckens festgemacht war.
»Jo. Hat ganz schön gekracht wegen dem Eis. War heute Morgen ja praktisch alles dicht. Und ein büschen eng is’ es hier ja auch. Ich mach und tu also, als auf einmal so ein grauer Sack wie ein Flummi nach oben aus dem Wasser springt.«
»Ein grauer Plastiksack«, ergänzte Breuer und zeigte zu einer Palette etwas weiter entfernt am Kai, auf der ein mit einer Polizeidecke abgedecktes Bündel lag.
»Müll, hab ich zuerst gedacht«, fuhr Hinnerk fort. »Aber dann hab ich da eine Hand gesehen. Als wenn die mir zuwinken wollte.« Der Hafenarbeiter schüttelte sich. »Hab dann natürlich bei euch Jungs im Revier angerufen.«
»Und da sind wir dann also«, beendete Breuer den Vortrag.
Krumme seufzte. »Dann schauen wir uns den Toten mal an.«
Gemeinsam gingen sie zu der Palette hinüber.
»Ziemlich ekelig«, sagte Petersen mit breitem Grinsen zu Pat. Die nickte nur. Soweit Krumme das beurteilen konnte, verzog sie unter ihrem Schal keine Miene. Das war nicht immer so gewesen. Vor drei Jahren, als sie gerade frisch von der Ausbildung nach Husum gekommen war, hatte sie sich stets bemüht, dem Anblick von Toten aus dem Weg zu gehen. Zum Glück kamen solche Fälle hier oben in Nordfriesland nur selten vor.
Bei der Palette angekommen bemerkte Krumme die teigig weiße Hand, die an der Seite herunterhing.
»Wirklich schlimm«, sagte Breuer, anders als sein Kollege ernsthaft um Pats Gemütszustand besorgt. »Wir können auch auf den Gerichtsmediziner warten. Müsste jeden Moment da sein.«
»Nun mach schon«, brummte Krumme, worauf Breuer die Decke zur Seite warf.
Pat stöhnte leise, und auch Krumme verzog das Gesicht. Wasserleichen waren nie schön anzusehen, aber Breuer hatte recht gehabt, diese sah besonders hässlich aus. Es handelte sich um einen Mann. Er trug eine dicke Winterjacke, und an den Füßen steckten teure Winterstiefel.
Wie alt der Mann sein mochte, war nur schwer zu sagen, denn dort, wo früher wohl mal das Gesicht gewesen war, sahen sie jetzt nur einen blutigen, im kalten Wasser gefrorenen Klumpen Fleisch.
Krumme zog ein Paar Gummihandschuhe aus der Jackentasche. Während die anderen ihm wortlos zusahen, begann er, die Leiche abzutasten.
»Was wohl mit ihm passiert ist?«, fragte Breuer.
»Sieht aus, als wäre er mit der Birne unter eine Dampfwalze geraten«, meinte sein Kollege.
Die Kleidung des Toten war bretthart. Der ganze Körper wirkte wie tiefgefroren.
»Keine Papiere? Oder ein Handy?«, fragte Krumme, als er nichts dergleichen ertasten konnte.
Breuer schüttelte den Kopf. »In der Jacke jedenfalls nicht. Darunter ist noch alles zu stark gefroren.«
Krumme tauschte einen nachdenklichen Blick mit Pat, die unter ihrer Wollmütze die Stirn runzelte. Sie deutete auf ein abgerissenes dickes Seil, das am Fuß des Toten befestigt war. »War er daran irgendwo angebunden?«, fragte sie Hinnerk.
»Keine Ahnung. Der Sack trieb auf einmal in meinem Kielwasser, mehr weiß ich nicht.«
»Vielleicht war daran ein Gewicht befestigt? Damit er am Grund blieb«, überlegte Krumme.
»Aus Beton? Wie bei der Mafia?« Petersen grinste.
Krumme grinste nicht. Erst vor drei Jahren hatte er tatsächlich hier in Husum mit einem nördlichen Zweig der ’Ndrangheta zu tun gehabt.
»Ein Italiener?«, fragte Breuer.