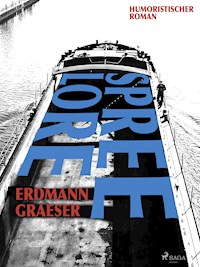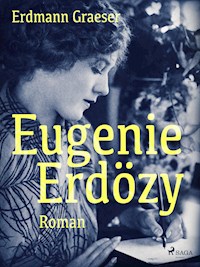Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Gewiss bedauerlich, dieses Schicksal! Man hat sie in eine Anstalt bringen müssen, weil sie geisteskrank wurde. Und gesund ist sie nicht mehr geworden, sie hofft noch heute, daß Herbert wiederkommen werde. Wenn Eisbahn ist, taucht sie auf – in ihrem verrückten Aufputz und belästigt die Offiziere. Traurig, traurig ist das alles!" Die Rede ist von Friederike Sandbohm, deren hoffnungsvolle Liebe zum adligen Offizier Herbert in ihrer Jugend durch die Schuld der Umwelt zerstört wurde. Als stadtbekanntes Original sorgt die "Eisrieke" nun Jahr um Jahr im Winter für Aufsehen, wenn sie auf der Schlittschuhbahn nach dem verschollenen Geliebten Ausschau hält. Diesen glaubt sie nun endlich wiedergefunden zu haben: in der Person des jungen Walter von Eschwege, der, wie er nun erfährt, auch in der Tat eine verblüffende Ähnlichkeit zu seinem Onkel Herbert aufweist, der vor langen Jahren seine Geliebte sitzengelassen hat und nach Amerika ausgewandert ist. Auch wenn sie ihren Herbert also nicht wirklich wiedergefunden hat, beginnt für die gütige alte Eisrieke nun doch ein Weg zurück in die Welt, auf dem sie, die zeitlebens so Unglückliche, nun einem jungen Paar zu seinem Glück verhelfen kann ... Erdmann Graeser wirft in seinem berührenden, erfrischend frech und realistisch erzählten tragisch-komischen Roman einen aufschlussreichen Blick in das Berliner Leben um die Wende zum 20. Jahrhundert und entfaltet so ein buntes Gesellschaftspanorama, das auch heute noch äußerst lesenswert ist.Erdmann Graeser (1870–1937) war ein deutscher Schriftsteller. Als Sohn eines Geheimen Kanzleirats im Finanzministerium in Berlin geboren, ist Graeser zwischen Nollendorfplatz und Bülowbogen im Berliner Westen aufgewachsen. Graeser studierte Naturwissenschaften, brach jedoch das Studium ab und arbeitete zunächst als Redakteur für die "Berliner Morgenpost" und später als freier Schriftsteller. Er wohnte viele Jahre in Berlin-Schöneberg und zog nach seinem literarischen Erfolg nach Berlin-Schlachtensee im Bezirk Zehlendorf. 1937 starb er an einem Herzleiden. Sein Grab liegt auf dem Gemeindefriedhof an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf. In seinen Unterhaltungsromanen thematisierte Graeser die Lebenswelt der kleinen Leute im Berlin seiner Zeit und legte dabei auch großen Wert auf den Berliner Dialekt. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Lemkes sel. Witwe", "Koblanks", "Koblanks Kinder" und "Spreelore". Einige seiner Romane wurden später auch für Hörfunk und Fernsehen bearbeitet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Eisrieke
Roman
Saga
Eisrieke
© 1970 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592489
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erster Teil
Über Nacht war der Wind umgeschlagen, kam nun vom Westen, brachte Tauluft. Die Schneeflächen der Schöneberger Wiesen nahmen im Laufe des trüben Tages eine blaugraue Färbung an. In den heftig schwankenden Zweigen der alten, ausgehöhlten Weiden, die jetzt, durch ihre Doppelreihen, unfahrbar gewordene Feldwege erkennen ließen, krächzten die Krähen, halbverhungert und verzweifelt nach der langen Winterszeit. Warteten nun gierig, daß dort, wo trotz der Warnungstafeln und des wachsamen Gendarmen von wagemutigen Fuhrleuten Müllabladeplätze angelegt worden waren, ja – warteten, daß dort nun wieder die verschneite Herrlichkeit aus den reichen Küchen des Kielganviertels zum Vorschein käme.
So ließ sich also mit Nachhilfe von Krallen und scharfen Schnabelhieben der Sache auf den Grund kommen und noch ein köstliches Mahl erhoffen.
Wenn der Tauwind nur anhielt! Die klugen Augen der alten, erfahrenen Vögel richteten sich besorgt auf den fahlen Westhimmel hinter dem gelben Riesenbau des Joachimsthalschen Gymnasiums in der Ferne. Entstand, um diese Stunden, dort ein roter Streifen, kamen neuer Frost, neuer Schnee, neue Hungerszeit ...
Wie die Krähen blickten auch die Jungen aus der Potsdamer Vorstadt nach dem Westhimmel, aber immer in der Erwartung, daß er sich blutrot färben möge. Denn dann bestand die gute Hoffnung für sie, daß über Nacht wieder durch scharfen Frost die morsch und körnig gewordene Eisbahn am Anfang des Wiesengeländes spiegelglatt würde.
Die hatte der „olle Busch“ auf dem im Herbst regelmäßig überschwemmten Gebiet in kluger Voraussicht angelegt. Hier entstand ja, ohne jedes Zutun, bei Frostwetter ganz von selbst eine gewaltige Eisfläche, während der Weißbierwirt Fiedler jedesmal neu gießen mußte, wenn durch Tauluft die dünne Eisschicht auf dem sandigen Bauplatz nahe der Winterfeldstraße jäh zerstört worden war.
Diesmal aber schienen beide Konkurrenten mit dem Geschäft zufrieden zu sein. Kurz vor Weihnachten hatte der Frost eingesetzt und bis jetzt – Mitte März – angehalten. Die Kosten für die Grogbude auf Buschs Bahn waren längst eingebracht, auch für das mit roter Leinwand beschlagene Lattengerüst, auf dem jetzt die vier Mann starke Kapelle saß und mit vereisten Trompeten gegen den Wind ankämpfte.
Ja, der „olle Busch“ – wie immer mit einer gelben, mottenzerfressenen Pelzmütze und an der roten Nasenspitze einen hellen Tropfen – konnte sich vergnügt die Hände reiben, als er nun nach dem schwarzen Gewimmel auf der Eisbahn blickte. Der Mann von der Kasse hatte sich eben einen neuen Billettblock holen müssen, denn die anderen hatten nicht ausgereicht, weil immer noch neue Schlittschuhläufer kamen.
„Eisrieke ist auch wieder da“, hatte er gesagt, „warum die nicht mehr nach die Rousseau-Insel geht!“
„Weil sie ihren Leutnant dort nie gefunden hat!“ Ein Läufer – jung, blond, groß – bastelte in der Nähe an seinem Halifax. Jetzt hob er den Kopf und fragte: „Eisrieke?“
„Na ja doch, Eisrieke“, sagte der Pächter. „Stand doch neulich erst wieder in der Zeitung von sie! Ein Original – verrückt geworden – unglückliche Liebe. Denkt immer, der Piepmatz kommt noch wieder, doch der Piepmatz kommt nicht mehr.“
Der Kassierer war im Galopp nach dem Eingang der Bahn zurückgelaufen. Natürlich! Einige Jungen, denen der Groschen Eintrittsgeld zu hoch war, weil sie ihn nicht hatten, waren inzwischen über die von einem Schneewall und ausgedienten Weihnachtsbäumen gebildete Umfassung geklettert und verschwanden eben in der Menge. Gedeckt von ihren Freunden, die durch das an die Mütze gesteckte Eintrittsbillet ihren berechtigten Aufenthalt auf der Bahn nachweisen konnten, obwohl es nur Karten waren, die sie sich vorher draußen von Fortgehenden erbettelt hatten. Hinten, am Ende der Bahn, beim Faulen Graben, waren sie dann über die Schneemauer gestiegen – mit ihrem Billet konnte sie jetzt niemand verjagen.
„Eisrieke – hä!“ Der olle Busch spuckte vergnügt seitwärts und spähte wieder über die Bahn. Was er erwartet, war eingetreten – alles in Aufregung. Dort, wo man die Schlittschuhe anschnallte und Stuhlschlitten mieten konnte, staute sich die Menge.
Und dort stand Eisrieke, mit frischem, rotem Gesicht, schlohweißem Haar. Trotz der Winterzeit einen Strohhut mit roten Rosen, an der einen Hand einen weißen, an der anderen Hand einen schwarzen Handschuh. Sie lächelte die Umstehenden an, beachtete die spottenden Zurufe „Eisrieke“ gar nicht. Doch – da war noch eine andere merkwürdige Person – ein älterer Mann, der sich mit dem Anschnallen seiner Schlittschuhe beschäftigte, sonderbaren Dingern aus Holz mit eisernen Laufschienen, die vorn, an der Spitze, zu Spiralen geformt waren. Er trug hohe Schaftstiefel, einen Schafspelz und auf dem Hinterkopf eine Bibermütze mit rundem, grünem Samtdeckel.
Jetzt war er fertig, Eisrieke stieg in den Stuhlschlitten, bekam eine Decke. Gleich darauf durchbrach der Mann mit dem Schlitten die Kette der Neugierigen, jagte davon, gefolgt von der Menge, die wie ein Kometenschweif nun hinterhersauste.
„Eisrieke, Eisrieke!“ gellten die Rufe.
Die Kapelle hatte, mitten in einem flotten Militärmarsch, jäh abgebrochen und versuchte jetzt, so gut es bei dem Winde und mit den vereisten Instrumenten gehen wollte:
„Du bist verrrückt, mein Kind ...“
zu blasen. Der olle Busch hatte es so angeordnet – zur Erhöhung der allgemeinen Stimmung. Der hintere Teil der Bahn, plötzlich ganz leer geworden, weil vorher alle Schlittschuhläufer nach dem Eingang, zu Eisrieke gestürmt – war jetzt, nach einigen Kreuz- und Querfahrten des Schlittens, das Ziel des wilden Zuges.
Und dort, unbekümmert um die Vorgänge auf der Bahn, holländerte jener schlanke, junge Läufer, froh, daß er für seine Kunstübungen genügend Bewegungsfreiheit bekommen hatte. Doch nun, stutzig geworden, schlug er die Hackenspitze des einen Schlittschuhs ins Eis und sah verwundert den Anstürmenden entgegen.
Gerade wollte der Schlitten an ihm vorübersausen, da gellte, von Eisrieke ausgestoßen, ein markerschütternder Aufschrei:
„Her-bert!“
Ein Schrei, daß der pelzbemützte Mann plötzlich innehielt. Der ganze Zug ballte sich, viele rannten aufeinander auf, stolperten.
Eisrieke fuchtelte wild mit den Armen, riß die Decke ab, sprang aus dem Schlitten, eilte rufend auf den einsamen Läufer zu: „Herbert, endlich, endlich!“
Doch, ehe sie ihn noch erreicht, glitt sie aus, fiel hin. Und blieb wie tot liegen, trotzdem sich ihr Begleiter und der Eisläufer sofort um sie bemühten. Endlich gelang es ihnen, sie wieder in den Schlitten zu setzen, den sie nun zusammen dem Ausgang der Bahn zuschoben.
Erschrocken war die Läuferschar zurückgewichen, ein weiter Kreis hatte sich gebildet, nun folgte die Menge in einiger Entfernung. Das Ganze glich einem Trauerzug, die Kapelle war verstummt.
„Ist sie tot, was ist denn los?“ Niemand beantwortete die Frage des Pächters, der aus der Grogbude herbeieilte.
„Sollen wir einen Doktor holen?“ boten sich ein paar hilfsbereite Jungen an. Doch der pelzbemützte Mann machte eine abwehrende Bewegung. Mit dem Taschenmesser, das er schon hervorgeholt, durchschnitt er, einen Augenblick stehenbleibend, eilig die Riemen und steckte die Schlittschuhe in die Seitentaschen des Pelzes. „Sicher man bloß wieder ein Anfall, den kriegt sie immer, wenn sie sich aufregt“, sagte er dann, sich zu seinem Helfer wendend. Aber als er ihn nun, zum erstenmal, wirklich ansah, fuhr er betroffen zurück. „Donnerwettstein, ist das eine Ähnlichkeit! Da kann man ja wirklich lang hinschlagen, ich möchte wahrhaftig fragen: Mit wem hab’ ich denn eigentlich das Vergnügen?“
„Walter von Eschwege!“
„Was? von Eschwege? Am Ende jar ooch Leutnant?“
„Gewesen, jetzt studiere ich!“
Sie waren am Ausgang angelangt. „Draußen wartet unser Wagen“, schrie Eisriekes Begleiter den Neugierigen zu – „der Kutscher soll helfen, sie reintragen – hol mal einer Jochen!“ Während sie warteten, sagte der Mann, die Pelzmütze berührend: „Mein Name ist Sandbohm – Albert Sandbohm. Wir wohnen in die einsame rote Villa hinters Joachimsthalsche Jymnasium. Ich würde mir freuen, Sie wiederzusehen, vielleicht ist das jut für meine arme Schwester, sie ist nämlich ein bißchen“ – er tippte sich auf die Stirn. Dann wandte er sich an Jochen, der sich eben durch die Neugierigen gedrängt hatte. „Nimm ihr an die Beine, ich werde ihr an ’n Kopp nehmen. Bahne frei ...“, kommandierte er.
Der olle Busch und ein hinzugekommener Gendarm sorgten dafür, daß man ungehindert zu der altmodischen Kalesche kam, die vor der Eisbahn hielt. Die Leblose wurde hineingehoben, Herr Sandbohm setzte sich daneben und stützte sie und Jochen kletterte auf den Bock. „Hüh!“ Die beiden schweren Gäule zogen an, der Wagen rollte davon.
Die Neugierigen zerstreuten sich und die Kapelle begann zu spielen:
„Freut euch des Lebens –
Weil noch das Lämpchen glüht ...“
Während die Kalesche der einsamen Villa zustrebte, Walter sich wieder auf die Eisbahn begab, saß seine Mutter, die verwitwete Frau Hauptmann Henriette von Eschwege, in ihrer Sonnabendnachmittagsstimmung am Nähtischchen beim Fenster. Sie war eine Dame mit schlohweißem Haar, blassem, feingeschnittenem Gesicht, das noch nicht alt, nur frühzeitig welk geworden war. Immer trug sie ein schwarzes Kleid mit einer weißen Halskrause, man hätte sich ihre schmalschultrige, gebrechlich anmutende Erscheinung in einem farbigen Kleid gar nicht vorstellen können.
Auf dem Fensterbrett lagen Gerocks „Palmblätter“ und Julius Sturms „Fromme Gedichte“, in denen sie, als Vorbereitung zum morgigen Gottesdienst, gelesen hatte. Die Wohnung in der Bülowstraße, gegenüber dem Omnibusdepot, gehörte zur Zwölf-Apostelkirche, aber trotzdem ging die Frau Hauptmann immer in die viel weiter gelegene Matthäi-Kirche, zum „alten Büchsel“ – er sprach mehr zu ihrem Herzen, wie sie sagte.
Jetzt, da es dunkel geworden war, klingelte sie dem Mädchen, der Tochter des Portiers, die tagsüber die Aufwartung besorgte. Marie hatte in der Küche nur auf dieses Zeichen gewartet, denn nun kam nur noch die Abrechnung, dann konnte sie endlich hinunter in die elterliche Wohnung. Vater hatte schon das Gas auf der Treppe angesteckt und ihr durch Anschlag mit dem Anzünder gegen die Hintertür das Zeichen gegeben, daß sie erwartet werde.
„Für die paar Kröten, die du bei die Adlige kriegst, brauchst du dir kein Bein ausreißen, die soll froh sein, daß sie dir hat“, sagte er jedesmal, wenn die Tochter verspätet in der Kellerwohnung erschien.
Marie hatte jetzt die große Petroleumlampe angesteckt, aber der Schirm saß wieder schief.
„Erst geraderücken“, sagte Frau von Eschwege, „und dann bringen Sie den Einkauf herein – das Ausgabenbuch aber gleich mit!“
Das junge Ding mit der schwarzen Ponnyfrisur schnalzte verächtlich durch die Zähne – die Frau Hauptmann überhörte es geflissentlich. Die Lebensmittel für den nächsten Tag wurden stets in den Abendstunden eingekauft, weil dann alle leicht verderblichen Waren beim Schlächter oder im Grünkramkeller billiger abgegeben wurden. So war auch die Abrechnung über das mitgegebene Geld stets der Abschluß der Tagesbeschäftigung.
Frau von Eschwege sagte an, was im Buch verzeichnet war, und Marie zeigte die Ware vor.
„Das soll für einen Groschen Suppengrün sein?“
„Is doch ’ne Selleriescheibe bei, im Sommer gibt’s mehr fürs Geld!“
„Und dann ist wieder mal falsch zusammengerechnet, ich bekomme noch zwanzig Pfennige mehr zurück.“
„Ich hab’ nicht mehr, jnädige Frau können mir alle Taschen durchsuchen.“
Ein unterdrückter Seufzer der Entmutigung. „Tun Sie den Kaffee in die Büchse und mahlen Sie ein halbes Lot für morgen früh, schütten Sie es aber noch nicht in den Beutel, das werde ich selbst machen!“
Marie ging hinaus, öffnete die Kaffeetüte, zählte zehn Bohnen ab, von denen sie sieben in den Strumpf, drei in den Mund steckte und knirschend zerbiß. Sie war bleichsüchtig und litt in diesem Zustand an einem Heißhunger nach Kaffeebohnen – wenn sie keine hatte, kratzte sie den Mörtel von der Küchenwand und zerknirschte ihn.
Die Mühle quietschte, verstummte endlich. So, und nun war Marie endlich fertig.
„Morgen früh also wie jewöhnlich“, sagte sie zur Tür hinein – „dann jeh ich jetzt – ju’n Nacht!“
„Gute Nacht – bitte, die Hintertür gut abschließen!“
„Hab’ ich das schon mal verjessen?“
Frau von Eschwege winkte ab, gab keine Antwort, setzte sich mit dem Rücken gegen den lauwarmen Kachelofen und überließ sich ihrem trübseligen Sinnen, das sie nach diesem täglichen Kleinkampf mit dem Mädchen stets überfiel. Das glänzende Elend eines armen Offiziers – ach, sie hatte es, in der Liebe zu dem bewunderten Mann, gern mitertragen. Und sie allein hätte jetzt, nach seinem Tode, mit der Pension und den Zinsen ihres kleinen Vermögens eine sorgenlose, bescheidene Existenz führen können. Aber, da war doch nun der Sohn – dieses Sorgenkind! Dicht vor dem Avancement zum Premierleutnant hatte er den Dienst quittieren müssen, noch heute unfaßbar für die Frau Hauptmann. War in einer Versammlung der Sozialdemokraten gesehen worden, hatte sich, zur Rede gestellt, höchst ungeschickt verteidigt. Hätte der Vater, der Herr Hauptmann Erster Klasse, noch gelebt, wäre die unglückliche Geschichte vielleicht noch glimpflich abgelaufen, aber so!
Ein tiefer Seufzer. Nein, nein, nur nicht zurückdenken! Nun studierte er ja, konnte sich als Jurist, vielleicht im Gerichtsdienst, eine auskömmliche Stellung erringen, freilich, das kleine Kapital würde dann, wenn es endlich soweit war, bis auf den letzten Pfennig aufgezehrt sein.
Nach dem Abendessen saßen Mutter und Sohn wie gewöhnlich noch ein Weilchen zusammen. Walter hatte das merkwürdige Erlebnis auf der Eisbahn erzählt. Die Frau Hauptmann, zuerst sehr überrascht, hatte nachher nur noch ein nachdenkliches „Ja – ja!“ gesagt, war sehr schweigsam geblieben.
„Nanu – Mama – warum denn so einsilbig heute? Wieder Ärger mit der Marie? Gott, wenn du dir doch ein ordentliches Mädchen nehmen könntest! Kennst du eigentlich die traurige Geschichte dieser armen Person, dieser Eisrieke, soll ich sie dir mal erzählen?“
„Nein – kenne sie! Aber was die Leute da reden und auch das, was in der Zeitung gestanden hat, stimmt ja gar nicht! Was las ich denn da – ja, daß das bedauernswerte Geschöpf die Tochter des reichen Kommissionsrates Lietzmann aus der Breitenstraße sein soll ... daß sie einen Potsdamer Gardeoffizier geliebt, der sich das Genick gebrochen, als er nach Berlin galoppierte, weil der alte Lietzmann endlich seine Einwilligung zur Heirat gegeben ... daß sie deswegen geisteskrank geworden sei – ach, das ist ja alles romantischer Unsinn! Nicht mal den richtigen Namen wissen sie, Sandbohm ist er, wie ihn der Mann dir auf der Eisbahn angegeben hat – und sie heißt Friederike Sandbohm ...“
Ein flackerndes Rot starker, innerer Erregung hatte das sonst so blasse Gesicht der Frau Hauptmann gefärbt.
„Aber, Mama, ich bin ja ganz baff! Wieso, ja wieso weißt du denn da besser Bescheid? Du kümmerst dich doch sonst nicht um Klatschgeschichten! Kennst du denn die Leute selbst?“
Die Mutter kämpfte offenbar mit einem Entschluß. „Wenn es nun der Zufall gewollt hat –“ begann sie.
Und plötzlich stand sie auf, ging nach dem Schreibtisch ihres Mannes, zog ein Geheimfach auf, kramte zwischen Briefen und Andenken. Kam dann mit einer Schnellphotographie, wie sie auf Ausflügen nach dem Grunewald gemacht werden, hielt sie dem Sohne hin. „Erinnerung an Schildhorn“ stand mit Goldschrift auf dem papiernen Schutzrahmen.
„Weißt du, wer das ist?“
Unwillkürlich blickte Walter von dem Bildchen in den Wandspiegel, sah dann betroffen die Mutter an. „Das könnte ich sein – in Uniform. Und das Mädchen ... Herrgott, wer ist das?“
„Der Leutnant ist Onkel Herbert – und sie – ja, sie ist es, Eisrieke!“
„Den Namen rief sie ja auch auf der Eisbahn, als sie mich sah, Herrgott, was ist das? Was ist das für Romantik in unserer hausbackenen Familie?“
„Was hast du gegen unsere Familie? Der einzige, der die Tradition nicht in Ehren gehalten, war Papas Bruder – aber er hat es bitter, bitter büßen müssen!“
Die im Herzen der Frau Hauptmann gärende Erregung brach plötzlich durch. „Und du, der du ihm so ähnlich bist, auch in der Charakterveranlagung – ach, die Angst um deine Zukunft zermartert mir die Seele. Eines Tages wirst du dich auch ’reingeritten haben, wie Onkel Herbert, wegen irgendeiner dummen Liebschaft – ach, sei still, ich kenne ja dein leicht entzündliches Herz ...“
„Nicht, Mama, nicht wieder weinen! Ich hab’ dir doch mein Ehrenwort gegeben, daß jetzt nichts mehr vorkommt! Ich weiß doch selbst, was auf dem Spiele steht ...“
Er hatte die Mutter umfaßt. „Setz dich, Mama – komm! Und was ist das mit Eisrieke und Onkel Herbert?“
„Schande hat er über uns gebracht, Schande! Noch heute laufen genug Menschen herum, die die peinliche Geschichte kennen. Ein Wunder eigentlich, daß du sie nicht längst schon von anderen gehört hast. Solange Papa lebte, durfte ja seines Bruders Namen überhaupt nicht genannt werden ...“
Die Mutter wurde ruhiger. Als sie zu erzählen begann, sprach sie in leisem, resigniertem Ton:
„Er ist ja, wie du weißt, tot – irgendwo in Amerika gestorben – vielleicht ganz verdorben. Das einzige Gute, was man ihm nachsagen kann, daß er keine Bettelbriefe geschrieben, überhaupt niemals mehr etwas von sich hat hören lassen. Aber sonst! Schulden bis über die Ohren – und Liebschaften, manchmal drei zu gleicher Zeit! Und das als blutjunger Leutnant. Um sich zu retten, wollte er den Dienst quittieren, eine reiche Heirat machen – Mesalliance! Weiß ich, wo er diese Friederike dann kennengelernt, ich glaube auf der Rousseau-Insel beim Eislaufen. Damals, wie die Photographie ja zeigt, war sie ein hübsches Mädchen, aber sehr derb! Eine Schöneberger Bauerntochter! Man sagt, ihr Vater habe auf seinen Wiesen – wie soll ich dir das erklären – damals gab es doch noch keine Wasserspülungen in den Häusern –, also habe alles aus dem Westen auf seine Wiesen abfahren lassen und dann, als auch da die Bebauung kam, das Terrain teuer verkauft. Über Nacht, sozusagen, war er Millionär geworden, dieser Bauer ...“
Sie hob den Kopf und sah den Sohn forschend an. „Immer, wenn du Schlittschuhlaufen gehst, ja, ich werde die Angst nicht los, daß du da auch einmal – –“
„Eine Schöneberger Millionärstochter – –“
„Nein, aber irgend so ein armes Ding unter deinem Stande für immer auf dem Halse hast. Ich hab’ doch auch Augen im Kopfe, sehe, wenn ich mit dir aus der Kirche komme, wie dir die Blicke zufliegen. Und du, in dir zuckt’s ja immer, dich von meinem Arm loszureißen, hinterherzulaufen, und so war er auch!“
„Du übertreibst, Mama! Dann hättest du mir die Halifax zu Weihnachten nicht schenken sollen, mit den alten rostigen Dingern wäre ich nicht mehr gelaufen. Aber erzähle doch weiter, ich bin ja so gespannt wie ein Flitzbogen. Warum ist denn nun ...“
„Ja – also die Tochter dieses Kerls wollte Herbert heiraten, aber stell’ dir das vor, der Mistbauer, wie ihn Papa immer genannt hat, war dagegen, beschimpfte den adligen Offizier als Mitgiftjäger, und dabei hat Onkel die Person doch geliebt, wenn ihm auch ihre Exaltiertheit auf die Nerven gegangen ist, denn ihre Überschwenglichkeit in der Liebe machte auf andere einen lächerlichen Eindruck. Deswegen hat er dann wohl auch nicht standgehalten, als die Geschichte zum Klappen kam. Wenn eine Liebschaft komisch wird, ist die Sache aus! Eines Tages war Onkel verschwunden, zuerst glaubte auch Papa, daß er sich erschossen habe, aber dann stellte es sich heraus, daß er sich die Papiere besorgt und nach Amerika ausgewandert war, die Blutsauger hatten das Nachsehen.“
„Und sie?“
„Nun ja – sie! Gewiß bedauerlich, dieses Schicksal! Man hat sie in eine Anstalt bringen müssen, weil sie geisteskrank wurde. Und gesund ist sie nicht mehr geworden, sie hofft noch heute, daß Herbert wiederkommen werde. Wenn Eisbahn ist, taucht sie auf – in ihrem verrückten Aufputz und belästigt die Offiziere. Nach der Rousseau-Insel darf sie nicht mehr kommen, es hat zuviel Skandal gegeben. Die verschuldeten jungen Leutnants machten sich ihre Verrücktheit zu Nutze, fuhren sie aus Jux manchmal im Stuhlschlitten um die Bahn, als Belohnung steckte sie ihnen dann ihr Portemonnaie zu – traurig, traurig ist das alles!“
Die Mutter erhob sich. „Jetzt will ich sehen, ob ich schlafen kann nach diesen Erinnerungen. Wo ist die Photographie?“
„Laß sie mir Mama, sie kommt in die Familiensammlung –“
„Ich warne dich, Junge! Dieser Onkel Herbert hat über alle Menschen nur Unglück gebracht.“
„Aber sein Bild kann mir doch nichts schaden, und vom Onkel habe ich nichts in meiner Mappe.“
In jenem Teil der Brandenburgischen Straße, damals nichts weiter als ein einsamer Feldweg von Schöneberg nach Charlottenburg, stand die „einsame Villa“, wie sie genannt wurde, inmitten eines großen Gartens. Im März waren dort schon stets gelbe und blaue Krokusse in voller Blüte – im Mai aber verschwand hinter hohen süßduftenden Fliederbüschen das Haus den Blicken der Vorübergehenden.
Und hier, in diesem Hause, lag in einem mit schönen alten Mahagoni-Möbeln ausgestatteten Zimmer Fräulein Friederike Sandbohm auf dem grünen Ripssofa und schluchzte jämmerlich in ihr Taschentuch.
Bruder Albert stand am Kachelofen, nuppelte an einer halbzerblätterten Zigarre. Auf seiner Schulter hockte eine Dohle, äugte aus ihren wasserblauen Augen von einem zum anderen und plusterte jedesmal entsetzt ihr Gefieder, wenn ihr der Zigarrenqualm zu nahe kam.
Plötzlich hob Rieke den Kopf: „Was war denn eigentlich mit mir los?“
„Krank gewesen biste! Hinjefallen auf die Eisbahn, bloß jut, daß du dir nischt jebrochen hast!“
„Wie lange ist denn das schon her?“
„Na, morjen werden es jrade acht Tage!“
„Und ist er denn nicht hier jewesen?“
„Wer denn?“
„Herbert!“
„Ist ja nicht Herbert, der junge Mann war wahrscheinlich noch jarnicht auf der Welt, als du mit deinem Herbert gingst!“
Sie lachte seltsam, es klang wie das Gurren einer Taube. „Du bist ja verrückt“, sagte sie.
„Einer von uns beiden ist es bestimmt! Aber wollen wir nun nicht Kaffee trinken?“
Sie antwortete nicht, lauschte auf das dumpfe Geräusch der vom schrägen Dach abrutschenden Schneemassen.
„So war’s damals auch – Tauwetter, mit der Eisbahn plötzlich aus und vorbei! Grade am letzten Tage noch hatte ich ihn kennengelernt – und nu ist er endlich wiedergekommen, na, die Aussteuer ist ja nu fertig, alle Monojramms sind jestickt.“ Sie lachte wieder ihr gurrendes Lachen.
Die Tür wurde mit dem Fuß aufgestoßen, ein ältliches, hageres Mädchen kam mit dem Kaffeegeschirr herein, blieb mit dem Ärmel an der Türklinke hängen, hätte durch den plötzlichen Ruck beinahe das Tablett fallen lassen.
„Anders kannste wohl nicht?“ fragte Albert ärgerlich.
„Mach dir nischt d’raus, Minna“, tröstete Rieke.
Albert wartete, bis sie das Geschirr hingestellt und hinausgegangen war, dann sagte er: „Sie riecht immer nach Hering!“
„Das ist die grüne Seife, mit die sie sich wäscht.“
Rieke hatte sich erhoben, ging in seltsam gezierter Art nach der Tür, kehrte – als würde sie von jemandem geführt – an den Tisch zurück und schnitt den Kuchen an.
Albert hob die Dohle auf die Stuhllehne, nahm nun auch am Tische Platz, beschäftigte sich mit dem Vogel, beobachtete die Schwester nicht.
Rieke hatte sich dem Platz zugewandt, wo eine dritte Tasse stand, machte einem Unsichtbaren eine einladende Bewegung, goß Kaffee in die Tasse, legte ein Stück Kuchen auf das Tellerchen und lächelte freundlich, als habe man ihr gedankt. Dann rückte sie Sahnentöpfchen und Zuckerschale heran, wartete ein Weilchen, bis sich der Unsichtbare bedient, und lächelte wieder mit einem verblühten Mädchenlächeln.
Und jetzt, nach dieser Zeremonie, war es, als sei ein Bann gebrochen. Sie tranken andächtig, genießerisch. Beider Blicke gingen zum Fenster, wo rote und blaue Hyazinthen in Gläsern blühten. Der Garten war noch verschneit, die Fliederbüsche schwankten im Tauwind. Dahinter dehnten sich die Schöneberger Wiesen mit ihren Kroppweiden und Scharen von Nebelkrähen.
In diese Stille hinein, nur die Uhr hatte man ticken hören, sagte Rieke plötzlich: „Albert, nu erinnere ich mir an alles auf die Eisbahn, bloß was war denn dann nachher, als ich ohnmächtig geworden?“
„Nischt! Wir haben dir aufjeladen und nach Hause jekarrt!“
„Und er, ist er denn nicht mitjekommen, hat er sich denn jarnicht jefreut?“
„Mächtig, hat sich immerfort auf’n Bauch jeklatscht.“
„Und wo wohnt er denn?“
„Des hat er nicht verraten, aber ich hab’ ihn einjeladen!“
„Sieh mal, Albert, nu könnten wir ihm doch helfen, gegen die Wucherer!“
„Und wie, er brauchte bloß noch die Daumen umeinander zu drehen, weiter nischt!“
Albert stand da, die Dohle auf der Schulter und kratzte sich kummervoll den Kopf. „Ach ja“, seufzte er halblaut, „hier soll einer nicht verrückt werden, hier muß man ja verrückt werden! War alles schon so schön und jut geworden, und da muß der Mensch wie so’n Jespenst aus’m Jrabe auftauchen. Ach Jott, ich hab’ das alles schon so dicke! Erde uff und rin, das wäre das Beste für mich. Aber jetzt nehme ich mir ne Pulle Burjunder!“
Der Schnee ging in Lawinen von den Ziegeldächern nieder, die Regenrinnen begannen zu glucksen, in den Telegraphendrähten über den Häusern sang nachts der Tauwind. Die vereisten Schneeberge an den Rinnsteinen wurden schmutzigschwarz und klein – verschwanden allmählich.
Der lange, harte Winter war überstanden. Verquollene Fenster wurden wieder geöffnet – im Abenddämmern hörte man in den Höfen der Potsdamer Vorstadt die Stimmen spielender Kinder. Und eines Morgens erwachten die Menschen – staunten beglückt, denn es war ein sonnenheller Vorfrühlingstag.
Da kam – die Hosen in die Schaftstiefel gestopft – der Postbote vom Kurfürstendamm her, kämpfte sich durch das aufgeweichte Gelände bis zum Gartenzaun der Villa Friederike und warf einen Brief in den Kasten.
„Nanu?“
Albert, am Fenster sitzend, hatte diesen seltsamen Vorgang zwar beobachtet, rührte sich aber nicht vom Platz, sah nur Jakob, die Dohle, fragend an. Allmählich aber wurde Alberts Neugierde doch so brennend, daß er aufzustehen versuchte. Ach, er ächzte jämmerlich, denn er hatte den Hexenschuß. Da er sein eigner Doktor war, weil er die Ärzte haßte, behandelte er sein Leiden selbst. In dem Medizinbuch, auf das er große Stücke hielt, fehlte aber eine Seite, nur die Hälfte der Kur gegen Hexenschuß war vorhanden, und so hatte er sich zu seinem Ärger auch nur zur Hälfte kurieren können, mit einem umgeschnallten Katzenfell und Senfspiritus.
Jetzt rappelte er sich aber doch in die Höhe und bekam schließlich seinen Rücken gerade. Das war ihm so überraschend und erfreulich, daß er sich erst ein Weilchen vor dem Spiegel prüfend übte, ob er sich auch wirklich wieder frei bewegen könnte.
Und dann nahm er seinen alten, grauen Kaisermantel von dem roten Holzriegel an der Tür, hing ihn, nach Art der Militärs, über die Schultern und ging hinunter.
Minna war beim Wäscheaufhängen, mußte den Postboten also gesehen haben.
„Warum holste denn den Brief nicht aus dem Kasten?“ schrie er ihr zu.
„Ist ja nicht für mich“, schrie sie zurück. „Und wer schreibt denn schon jroß an Ihnen, das eilt doch also nicht!“
Der Frühlingswind klatschte ihr die nassen Wäschestücke um die Backen, so hörte sie nicht, was Albert noch sagte, der zum Kasten ging, den Brief herausnahm und nun mißtrauisch von allen Seiten besah.
Oben, in seiner Stube, schnitt er ihn sorgfältig auf, sah nach der Unterschrift: „Walter von Eschwege“. Kopfschüttelnd betrachtete er die kleine Photographie ... Und dann las er:
„Ich verstehe jetzt Ihre und Ihres Fräulein Schwesters Verwunderung bei jenem Zusammentreffen mit mir auf der Eisbahn, denn ich habe inzwischen von meiner Mutter über vieles Aufklärungen erhalten. Hoffentlich ist Fräulein Sandbohm jetzt wieder ganz hergestellt von ihrem Unfall. Wenn ich nicht gefürchtet, ihr neue Aufregung zu verursachen, wäre ich längst selbst gekommen und hätte eine Photographie, die Sie gewiß interessieren wird, mitgebracht. Ich schicke Ihnen nun heute das Bild, weil es vielleicht dazu beitragen kann, irrige Auffassungen zu korrigieren, solche Fälle sollen ja schon vorgekommen sein. Ich denke mir, Sie werden es nach Gutdünken verwenden, ich erbitte es mir aber gelegentlich zurück, da es in meine Andenkensammlung gehört. Vielleicht erlaube ich mir, am nächsten Sonntag in der einsamen Villa vorzusprechen, um Ihnen die Rücksendung zu ersparen. Meine Adresse gebe ich Ihnen hier an, falls mein Besuch störend wirken sollte, schreiben Sie mir bitte ab ...“
„Hm!“ machte Albert – „auch jenau den jeleckten Briefstil wie der andere, es ist jradezu unheimlich!“ Er griff nach seiner dicken Taschenuhr. „Elfe! Anjezogen wird sie nu wohl schon sein!“ Er horchte nach der Decke hinauf. „Rumtrampeln tut sie schon, Schuhe hat sie an, also ist sie fertig!“
Albert nahm den Brief und stieg ins oberste Stockwerk. „Kann ich ’rein?“ fragte er dann vor Riekes Tür.
„Was ist denn los?“
„Nischt – was soll denn los sein – bei uns ist nie was los!“ Er hatte die Tür aufgeklinkt und war in die Stube getreten. „Mach doch das Fenster auf – ist ja heute Frühling draußen.“
Sie saß vor dem ovalen Drehspiegel – in buntgeblümter Nachtjacke und rotem Flanellunterrock.
„Na – was ist los?“
„Ein Brief – von ihm – ’ne alte Photographie ist drinne.“
Er sah sie prüfend an, suchte zu ergründen, was in ihr vorging, denn ihre Augen hatten einen seltsamen Glanz bekommen. Zögernd reichte er ihr das Schreiben, sah gespannt zu, wie sie mit zitternden Fingern das Bild aus dem Umschlag zog – es lange betrachtete.
Doch der schrille Aufschrei, den er gefürchtet, unterblieb, aber schmerzliche Wehmut war jetzt in ihren Zügen.
„Das bin ich“ – schluchzte sie auf – „und das ist Herbert. Ach, ich fühl’s, er kommt niemals wieder!“
„Wenn du dir das bloß janz feste ins Jehirn pauken wolltest, Rieke, dann wären wir ein jutes Stück weiter. Aber nach ’ner halben Stunde vermanschst du alles wieder durcheinander.“
Rieke starrte noch immer die Photographie an. „Das war in Schildhorn“, sagte sie wie zu sich selbst, „wir waren Kahn gefahren. Herbert hatte mir jelbe Mummeln aus dem Wasser gezogen, und dabei wäre der Kahn beinahe umjekippt, die langen Stengel waren so eklig glitschig wie Aale. Es war an einem Wochentag, und der jroße Biergarten janz leer. Ach, ich seh noch alles, als wäre es erst jestern jewesen. An die Fenster von die Kolonjade tanzten so viele Mücken und setzten sich nachher auf die Kompotteller. Die Schwalben flogen ein und aus, denn sie hatten ihre Nester in der Halle. Ach, und Herbert hatte so schlanke, feine Hände, so hocharistokratsche ...“
„Und dann haste ihm dein Portemonnaie unterm Tisch zujestochen, und dann hat er mit dein Jeld bezahlt, wie son Jrenadier in die Hasenheide, den die Köchin sonntags ausführt.“
„Er hatte doch kein Jeld – und dadrauf kam’s doch auch janich an!“
„Und auf dem Rückweg fand ich im Jrunewald Jlockenblumen und Federnelken. Janz kleine blaue Schmetterlinge flogen um uns rum – und die Finken schlugen – und ich war so überirdisch jlücklich, weil er mir so heiß jeküßt!“
Albert nahm ihr das Bild aus der Hand. „Nu ist ja auch wieder Frühling, Rieke, da könnten wir doch endlich den Weihnachtsbaum ’rausschmeißen.“
Auf der Kommode stand noch immer ein geputztes Weihnachtsbäumchen, freilich fast ohne Nadeln.
„Es ist doch Frühling draußen“, wiederholte er dringlich.
„Na – dann ist es doch höchste Zeit“, sagte sie. Und sie, die bisher nie gelitten, daß das Bäumchen entfernt wurde, setzte nun ärgerlich hinzu: „Raus mit dem kahlen Ding, wie sieht denn das aus!“
„Den Brief hast du ja noch jarnicht anjesehen“, sagte Albert, während er das klägliche Tannenbäuchen rasch vor die Tür stellte.
„N’n Brief, wo ist er denn?“ Als sie ihn gelesen, sagte sie mit einem tiefen Aufatmen: „Er will herkommen! Ach, Albert, mir wird so anders, wenn ich dadran denke! Mein Kopf ist doch immer noch ’n bißchen schwach und verwechselt die beiden miteinander.“
„Das kann mir auch passieren – und mein Kopf ist nicht schwach“, tröstete Albert, „solche Ähnlichkeit jibt’s sonst bloß bei Zwillinge.“
Er war gegangen, und Rieke saß da im Frühlingssonnenschein, der jetzt die ganze Stube füllte. Im kahlen Geäst der Obstbäume schmetterten die Finken, die Sperlinge flogen, lange Strohhalme im Schnabel, an der Hauswand empor zu den Dachbalken, wo sie ihr Nest bauten, und aus dem Hühnerstall hinten im Garten klang das lebensfrohe Krähen des Hahnes.
Rieke war aufgestanden, nach der Kommode gegangen, kramte im obersten Schubfach. In einem Kästchen fand sie das, was sie suchte: Ein paar Briefe, mit einem blauen Bändchen kreuzweis zusammengeschnürt. Sie wog das Päckchen gleichsam in der Hand, ging zum Kachelofen und legte es auf die noch glimmenden Torfstücke. Endlich, aber erst nachdem sie in das Feuerloch geblasen, loderte die Flamme jäh auf, langsam verkohlte dann das Papier.
Als sich Rieke erhob, stand Minna in der Stube, Eimer und Besen in der Hand, um aufzuräumen. „Soll denn noch anjelegt werden?“ fragte sie verwundert.
Rieke legte ihr die Arme um den Hals, drückte sie an sich. „Nee doch, nee! Ach, nu hab’ ich alles von ihm verbrannt, jetzt ist der schöne Traum zu Ende!“
Minna stand steif wie ein Plättbrett da. „Wenn’s man wahr ist ...“
„Ja – es ist wahr, denn mir ist so leer ins Herz. Liebe, olle Minna, was hast du mit mir durchmachen müssen und bist mir treu jeblieben, die janzen Jahre!“
Am nächsten Sonntag schritt Walter, einen in Seidenpapier geschlagenen Veilchenstrauß in der Hand, über das Sumpfgelände der Wiesen der einsamen Villa zu.
Er kam in eine Atmosphäre der Erwartung – alles bewillkommnete ihn: Die betroffene, respektvolle Art des alten, hageren Mädchens, das ihm die Gartentür öffnete, der festlich gedeckte Kaffeetisch, die süßduftenden Hyazinthen, der behaglich-warme Raum.
Und da tat sich die Tür auf. Rieke kam, wie eine automatische Figur, mit kurzen, abgehackten Schritten über die Schwelle, angetan mit einem starren, weißseidenen Schleppkleid. Bis in die Mitte der Stube trat sie, bis unter den Kristallkronleuchter. Hinter ihr, im Türrahmen, tauchte für einen Augenblick Albert auf, verschwand aber sofort wieder.
Walter, verwirrt von dieser Erscheinung, trat zögernd näher, bot ihr mit einer Verbeugung den Veilchenstrauß. Ach, es war ihm entsetzlich, zu sehen, wie in dem blassen Gesicht der bejahrten Frau eine rote Glutwelle aufflammte, ihre Augen sich weiteten, wie sie dann, überwältigt von ihrem Gefühl, in die Knie sank: „Herbert!“
Doch im nächsten Augenblick hatte sie sich schon wieder erhoben, sog tief den Veilchenduft ein, lächelte schmerzlich.
„So kam er immer – er! Ich danke Ihnen, entschuldigen Sie man – Sie erinnern mir so sehr an ihn – oder bist du’s doch, Herbert?“
Der Blick ihrer großen, schönen Blauaugen war der einer Entgeisterten. Scheu berührte sie Walters Arm, wich erschauernd zurück, nahm sich aber gleich wieder zusammen. Und dann klang ihr girrendes Lachen, triumphierend sagte sie: „Wie jlücklich bin ich doch, ich hab’ jeliebt und bin jeliebt worden!“ Und mit vertraulichem Flüstern setzte sie hinzu: „Wenn jetzt mein Bruder kommt, nehmen Sie ihm nischt übel, er ist nämlich ein bißchen ...“ sie tippte sich auf die Stirn.
Da war Albert schon, auch er hatte sich fein gemacht, trug einen langschößigen, schwarzen Rock, karierte Hosen und steifes Oberhemd. Er machte heute einen sehr reputierlichen Eindruck, falls man ihn nur in seiner Wochentagsaufmachung kannte.
„Na ja, Herr von Eschwege, das wird Ihnen heute hier wohl ein bißchen komisch vorkommen. Aber wollen wir uns nicht setzen? Hier, der Platz wartet schon lange auf Ihnen.“
Er hatte hastig gesprochen, abwechselnd den Blick auf Walter oder Rieke gerichtet. Und was er gewollt, erreichte er, die Schwester paßte sich sofort an, wurde ganz hausfraulich. Goß behutsam, daß kein Fleck auf der Spitzendecke entstehen konnte, den Kaffee in die Tassen, schnitt den Napfkuchen an, reichte herum. In ihren Zügen war tiefe Befriedigung – ihr Traum hatte sich erfüllt: Da saß er, der Unsichtbare – den nur sie allein immer gespürt.
Albert hatte Walter ein Zeichen gemacht, die Schwester, deren Blicke unausgesetzt auf dem Gaste hafteten, nicht weiter zu beachten. Aber jetzt fragte Rieke: „Sie wissen, daß Sie jemandem sehr ähnlich sind, der meinem Herzen sehr nahe gestanden hat, was ist aus ihm geworden?“
Da Albert ihm ermunternd zunickte, sagte er: „Onkel Herbert ist für uns verschollen, wir nehmen an, daß er längst tot ist ...“
„Tot! Und ich lebe noch immer – wozu lebe ich noch – wozu denn – wozu? Würde er mich hassen – verachten – mir untreu sein – es wäre nicht so schlimm wie das!“ schrie sie auf.
„Ach was, Rieke, sei froh, daß du labundig bist – totsein kannste noch lange. Sieh dir hier sein Ebenbild an und sei vergnügt!“
„Tot – tot – tot!“ sie weinte bitterlich, das Taschentuch vor dem Gesicht.
„Sterben müssen wir alle, Rieke! Und ich sage jeden Tag: ‚Erde uff und rin!‘ Aber nun wird’s doch Frühling, und dann ist nu hier der junge Mann, sozusagen ein Ableger von deinem Herbert. Und wenn er dir auch nicht heiraten wird, kannste ihm doch jut sein. Und du weißt doch, was du alles mit ihm vorhast. Also – hör’ auf mit die Heulerei, sonst verjraulste ihn noch und er kommt nie wieder!“
Sie bezwang sich gewaltsam, schluchzte aber immer wieder jäh auf.
Albert hatte Walter ins Knie gekniffen, daß er sich ihm zuwenden sollte. Jetzt sagte er: „Ja, das war ein Winter, so’n strengen haben wir lange nicht jehabt! Nu kann ich bald wieder auf die Jagd gehen, jetzt kommen sie raus, die Käfer und Schmetterlinge. Andere sammeln Briefmarken und Münzen, ich nu wieder Insekten. Janz wissenschaftlich betreibe ich das, werde Ihnen mal nachher bei mir drüben meine Sammlungen zeigen; hat sojar schon drüber in die Zeitungen jestanden. Kennen Sie den ollen Keiter in das kleine Haus bei die Nicolaikirche?“
„Nein!“
„Dann haben Sie auch nie Schmetterlinge jesammelt, bloß bei dem jiebt’s Insektennadeln. Also, den kennen Sie nicht? Der hat ein Jeschäft mit lauter tote Tiere und Schädel und Jerippe. Bei dem tausch ich um, was ich hier auf die Wiesen fange – die jroßen, schwarzen Kolbenwasserkäfer und Schwalbenschwänze. Er gibt mir Ausländische dafür, und so hab’ ich meine Sammlung zusammenjekriegt – wie jesagt, es hat schon drüber in die Zeitungen jestanden!“
„Warum sind Sie nicht Naturforscher geworden?“
„Wollt’ ich ja – Vater wollte mir auch ’ne Expedition ausrüsten mit ’n eijenes Schiff, aber erst sollte ich das Einjährige haben. Ich bin aufs Französische Jimnasium jejangen. Jejangen, Quatsch! Jeden Morjen bin ich von unse Villa in Schöneberg mit ’nem Ponnyjespann in ’nen kleinen Korbwagen hinjejondelt, Jochen man bloß als Bejleitung. Rieke, nu trink doch auch, und jieß uns noch ’ne Tasse ein, nehmen Sie sich doch Kuchen, Herr von Eschwege, wozu ist er denn da!“
„Na, und?“ ermunterte Walter, immer den Blick auf ihn gerichtet.