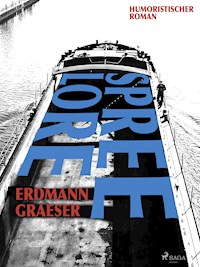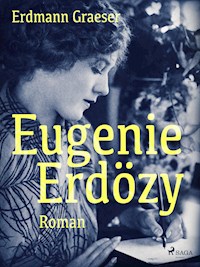
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hinreißende Operettensängerin Eugenie Erdösy hat das Walhall-Theater wieder aufblühen lassen. Alle Herzen schlagen schon bei der Nennung ihres Namens höher. Dabei lässt die Schöne nur Verehrung aus der Ferne zu. Auch die Offiziersfreunde des Premierleutnants Graf Storkow konnten trotz Rosen und liebenswürdigster Briefe keine persönliche Einladung erringen. Storkow, der noch nichts von der berühmten Künstlerin gehört hat, lässt sich auf die Wette ein, persönlich vorgestellt zu werden, und gewinnt. Die Begegnung mit dieser ganz besonderen Frau, aus der eine leidenschaftliche Liebe entsteht, wird nicht nur sein Unglück, sondern ihr zum Verhängnis. Storkows Familie lehnt die nicht standesgemäße Verbindung ab. Seine geliebte Großtante rät umsonst, nichts zu übereilen. Die schnell ausgesprochene Verlobung führt zum Bruch mit Storkows Vater. Fest hält Achim Storkow zu seiner Liebe, auch wenn er der Offizierslaufbahn den Laufpass geben und auf das Erbe verzichten müsste. Die Theaterwelt gönnt der Erdösy allerdings ihr Glück nicht. Bald werden unangenehme Gerüchte gestreut und verunsichern Achims Gefühle. Ein Theaterkuss lässt ihn an der Vergangenheit seiner Liebsten zweifeln. Seine per Brief ausgesprochenen Zweifel brechen der Sängerin das Herz. Sie erschießt sich und bittet per Testament um eine Obduktion, die ihren tadellosen Lebenswandel bezeugen soll. Nur so kann sie dem liebsten Menschen beweisen, dass sie ihm immer treu gewesen ist.Eugenie Erdösy (1860–1886) war eine ungarische Schauspielerin und Sängerin. Ihr sagenhafter Erfolg und die Verleumdungen, die auch die Liebe ihres Lebens vergiften, beruhen auf historischen Tatsachen. Hochemotional erzählt der Roman das kurze Leben einer besonderen Künstlerin, die nur mit ihrem Freitod und der testamentarisch verlangten Obduktion ihrem Verlobten ihre Jungfräulichkeit beweisen kann.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Eugenie Erdözy
Roman
Saga
Eugenie Erdözy
© 1939 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592410
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
„Von wem sprecht ihr denn überhaupt?“ fragte Premierleutnant Graf Storkow, der eben erst gekommen war.
„Na — von der schönen Jenny!“
Die Unterhaltung der fünf jungen Offiziere — Premierleutnants vom Ersten Garde-Dragoner-Regiment — ging weiter. Sie sassen in der Habelschen Weinstube, waren in Zivil und jetzt schon bei der letzten der fünf Flaschen Champagner angelangt, die einer von ihnen — Otto von Plesser — für eine verlorene Wette zu zahlen hatte.
Ja, — dass sie heute hier einmal schlemmen konnten, verdankten sie im Grunde genommen nur der Tugendhaftigkeit der schönen Operettensängerin Eugenie Erdösy, von der Leutnant von Plesser behauptet hatte, dass sie, ebensogern wie die andern Damen vom Walhalla-Operetten-Theater in der Charlottenstrasse, jede Einladung der Offiziere zum Souper annähme — man brauche ihr nur durch den Logenschliesser die Visitenkarte in die Garderobe zu schicken.
Er hatte die Wette verloren, die „Jenny“ — wie man sie kurz nannte — hatte die Einladung nicht angenommen, obwohl die Visitenkarte an einem wundervollen Rosenstrauss befestigt war.
„Ich wusste es, lieber Plesser, wir hätten die Wette eigentlich gar nicht eingehen sollen“, sagte Leutnant von Strehlen, „ja, du musstest verlieren, denn alle sind bis jetzt ebenso abgeblitzt!“
„Ich nicht!“ sagte Graf Storkow, der jüngste von den fünf Offizieren.
Die andern lachten laut auf: „Willst du etwa behaupten —?“
„Gar nichts will ich behaupten — gar nichts, als dass es mir nicht so ergangen ist!“
„Das heisst dann also?“
„Das heisst nichts anderes, als dass ich’s überhaupt noch nicht probiert habe. Ich kenne ja eure Jenny gar nicht, wundere mich bloss, dass das ganze Regiment in sie verschossen ist — in die Chansonette aus so einem Stullentheater!“
„Man merkt’s, du warst auf Urlaub“, sagte Leutnant v. Plesser. „Stullentheater — früher mal, gewiss! Seitdem der Sohn vom alten Direktor Grosskopf die Sache in die Hand genommen hat, ist das ‚Walhall‘ kein Stullentheater mehr. Im Gegenteil — die alte Bude ist gründlich umgekrempelt — zum Operettentheater geworden! Piko bello, kann ich dir sagen.“
Die andern stimmten zu. „Gastspiele erster Kräfte aus dem Auslande! Zum Beispiel die Jenny stammt aus Ungarn, ist über die Wiener Oper zu uns nach Berlin gekommen!“
„Behauptet sie — und kommt in Wahrheit aus der Ackerstrasse!“
Die andern schwiegen verstimmt. Storkow sah betroffen von einem zum andern, schüttelte den Kopf. Das alte neumärkische Grafengeschlecht, dem er entstammte, und der reiche Vater — ein Oberst a. D. des Ersten Garde-Dragoner-Regiments — hatten ihm von Anfang an eine Vorzugsstellung unter seinen Kameraden verschafft.
„Ich möchte eure Gefühle nicht noch mehr verletzen, wenn ich zu fragen wage: Spricht sie denn deutsch — die schöne Jenny?“
„Ja!“
„Und tritt sie jeden Abend auf?“
„Sie singt doch die Nanon in der Genéeschen Operette — ist dadurch zum Liebling von ganz Berlin geworden!“
„Wann fängt die Vorstellung an?“
„Na — um acht Uhr!“
Storkow zog die Uhr. „Jetzt ist es halb — trinken wir aus, fahren wir hin, ich lade euch ein. Habt ihr Lust? — Gut! Kellner — eine Droschke!“
Die gute Stimmung war sofort wiederhergestellt.
„Ja — wie setzen wir uns nun, die Arche hat doch nur für vier Platz?“ fragte Storkow, als sie in die vorgefahrene Droschke steigen wollten.
„Ich setze mich neben den Kutscher — Schwäche aus meiner Jugendzeit“, sagte Hans v. Eschendorff und kletterte schon auf den Bock. Er war den ganzen Abend am stillsten gewesen, stiller noch als sonst, denn ihn drückten „Familiensorgen“, wie Leutnant von Strehlen die Alimentationsverpflichtungen Eschendorffs nannte. Heute hatte er wohl wieder einen Mahnbrief bekommen und wusste, bei dem knappen Wechsel von daheim, nicht, woher er das Geld nehmen sollte, falls ihm der beabsichtigte Pump bei Storkow missglückte.
„Los, Kutscher — nach dem Walhall!“
Es war ein schöner Spätsommerabend und die Strasse Unter den Linden stark belebt von Spaziergängern, die aus dem Tiergarten kamen, aus den Zelten oder dem Krollgarten.
Doch nur einen Augenblick bot sich dieses Bild, denn schon lenkte der Kutscher in die Charlottenstrasse ein, und das Pferd — feuriger als sonst Droschkenpferde zu sein pflegten — setzte sich in Trab und verlor erst seinen Ehrgeiz, als es sich hinter der Zimmerstrasse jenem stillen Teil näherte, der als Encke-Platz durch die Sternwarte die Charlottenstrasse abschloss.
Kurz davor lag das Walhalla-Operettentheater. Der Eingang war hell erleuchtet, die Leute drängten sich an der Kasse.
„Alles ausverkauft!“ sagte der Mann hinter dem Schiebefenster.
Storkow wandte sich um. „Da habt ihr die Bescherung!“
Aber Leutnant v. Plesser sagte: „Lass mich mal ran. Und im Leutnantston fragte er dann: „Die Fremdenloge ist doch noch frei? — Schön, wir nehmen sie — Storkow, bleche!“
Durch den schmalen Seitengang führte der Theaterdiener die Herren nach der Fremdenloge.
Schon stimmte die Kapelle ihre Instrumente, die Ouvertüre konnte jeden Augenblick beginnen. Storkow sah sich verwundert um.
„Donnerwettstein“, sagte er anerkennend, „das Ding hat sich ja mächtig verändert — auch das Publikum sieht besser aus als früher. Aber — Kinder — Vorsicht! Halten wir uns im Hintergrund, dass uns keiner erkennt. Der Deibel kann sein Spiel haben — einer in Zivil ginge hier noch an — aber gleich fünfe auf einen Schlag —“
„Ruhe!“
Die Musik hatte begonnen — es war finster und still im Raum geworden. Als dann aber die Melodie: „Ach, Anna, zu dir ist mein liebster Gang!“ schmeichlerisch erklang, hörte man das Publikum mitsummen — die Bäcker- und Schusterjungen pfiffen ja das Lied in aller Herrgottsfrühe schon auf den Strassen — es gab keinen in Berlin, der es nicht kannte.
Da rollte der Vorhang in die Höhe, die Szenerie zeigte das Wirtshaus „Zum goldenen Lamm“, und Nanon, die schöne Wirtin — Fräulein Eugenie Erdösy — begann auf die Frage der ländlichen Gäste zu singen:
„Was ich mir wünsche, fragt ihr?
Mein freundliches Wirtshaus —
Umrankt ist’s vom Wein —
Die Trauben, sie reifen im Sonnenschein,
Gefüllt ist’s von Gästen im frohen Verein —
Was kann da der Wirtin zu wünschen wohl sein? “
Aber nicht lange, da kam Grignan, der „schlichte Bursche aus dem Volk“, in Wahrheit aber der Marquis Henri d’Aubigné, und als sie sich beide leidenschaftlich küssten, gab Leutnant v. Plesser dem Grafen Storkow einen leichten Rippenstoss und fragte:
„Na, wie ist dir?“
Doch der wehrte unwillig ab, starrte wieder auf die Bühne. Die andern sahen sich bedeutungsvoll an und lächelten.
In der Pause dann sagte Storkow: „Ja — entzückend, namentlich die Augen und die Figur. Aber ich möchte wissen, wie sie ohne Schminke und Kostüm aussieht!“
„Ich auch —“, sagte Leutnant von Brandt.
Alle lachten, aber Storkow fuhr sie ärgerlich an: „Ich meine doch, wie sie in Zivil wirkt.“
„Pscht! Nicht so laut“, warnte v. Eschendorff, „das Publikum wird schon aufmerksam auf uns.“
Ein Weilchen blieben sie auch still, aber da fragte Storkow plötzlich: „Vis-à-vis — in der Loge — ist der Herr dort nicht Direktor Grosskopf?“
„Der mit der weissen Weste?“
„Ja — ist er!“ bestätigte von Plesser.
Das Spiel nahm seinen Fortgang. Doch kurz vor Schluss des zweiten Aktes erhob sich, den Kameraden beruhigend zunickend, Graf Storkow und verliess die Loge.
„Ich hab’ mir’s gedacht“, flüsterte v. Plesser spöttisch. „Na — schadet ihm nichts, wenn er auch mal ganz gehörig abblitzt!“
„Ssssst!“ klang’s aus dem Publikum.
Draussen auf dem Gange entnahm Storkow einem Täschchen seine Visitenkarte, winkte dem Theaterdiener und sagte: „Hier — geben Sie das Herrn Grosskopf — ich lasse um eine kurze Unterredung bitten. Er sitzt in der Loge vis-à-vis — soll ich hier warten oder gleich mitkommen?“
Der Diener hatte sich einen Zwicker aufgesetzt, studierte die Karte und fragte devot: „Wenn ich den Herrn Grafen gleich führen darf ...“
Und auf der anderen Seite angelangt: „Einen Augenblick bitte zu warten, ich bringe sofort Bescheid!“
Damit verschwand er in der Direktionsloge. Gleich darauf erschien Herr Grosskopf selbst. „Ergebenster Diener, Herr Premierleutnant — was verschafft mir die ausserordentliche Ehre — wenn Sie wünschen, gehen wir in mein Büro.“
„Sehr liebenswürdig, Herr Direktor — aber Fräulein Erdösy muss doch jeden Augenblick von der Bühne kommen — ich möchte nicht versäumen, ihr mein Kompliment zu machen. Auch Ihnen, Herr Direktor — das Walhall ist ja kaum wiederzuerkennen — ein Genuss, diese Nanon-Aufführung!“
Der plötzlich einsetzende, aussergewöhnlich langanhaltende Beifallssturm verriet, dass der Vorhang gefallen war.
„Also — Herr Direktor — eine grosse Bitte: Darf ich der Künstlerin nicht meine Bewunderung aussprechen — auch im Namen meiner Kameraden drüben in der Loge?“
Der Direktor wiegte den Kopf hin und her. „Eigentlich nicht, Herr Graf! Na — vielleicht mal eine Ausnahme, und noch dazu in meiner Gegenwart — ich will es jedenfalls versuchen. Aber dann, bitte, wollen wir uns beeilen! Darf ich vorangehen?“
Sie kamen nach der Garderobe — Grosskopf klopfte an. Eine ältliche Person steckte den Kopf durch die Türspalte. „Nanu — wat is denn — ach, der Herr Direktor!“ sagte sie erschrocken.
„Herr Direktor — Sie wünschen?“ kam die Frage aus dem Zimmer, und gleich darauf trat die Künstlerin auf den Gang.
„Fräulein Erdösy — gestatten Sie, Herr Premierleutnant Graf Storkow wollte Ihnen — —“
„Gnädiges Fräulein — Sie sehen, ich bin ohne die üblichen Rosen — also ganz spontaner Einfall — nur aufrichtigste Bewunderung Ihres Künstlertums veranlasste mich, den Herrn Direktor zu bitten, Ihnen —“
Er kam nicht weiter, verhaspelte sich, denn der ernste Blick ihrer dunklen, schönen Augen verwirrte ihn. Aber als er nun stockte, reichte sie ihm die Hand und sagte: „Sie beschämen mich! Ich bin dem Herrn Direktor zu grossem Dank verpflichtet, dass er mich an sein Theater nach Berlin engagierte.“
„Ich weiss, welches Glück mir zuteil wird! Meine Kameraden hatten mir schon erzählt, dass Sie unnahbar seien —“
Sie sagte: „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Premierleutnant, wenn Sie Ihre Kameraden bitten wollten, derartige Einladungen mir nicht mehr zu schicken ...!“
Er verbeugte sich. „Nichts ist mir lieber, gnädiges Fräulein, aber darf ich mir nicht erlauben, ein paar Rosen —“
Jetzt lächelte sie. „Keine Ausnahme!“
„Doch“, sagte er wie ein trotziger Junge, „ich tue es doch — und wenn Sie die Blumen auch unbeachtet verwelken lassen.“
Ein Klingelzeichen — sie wandte sich hastig ab. „Ich muss weg — adieu!“
Einen Augenblick fühlte er ihre Fingerspitzen in seiner Hand, dann war sie in ihrer Garderobe verschwunden.
„Eine Künstlerin“, sagte Herr Grosskopf, „hat eine grosse Zukunft!“
„Ich danke Ihnen, Herr Direktor — aber nun will ich auch rasch hinüber, man wird sich ja wundern, wo ich stecke.“
Als er zurück in die Loge kam, ging gerade der Vorhang wieder auf. Trotzdem kam von Plesser das erwartungsvolle: „Na?“
Storkow schüttelte den Kopf. „Später!“
Und in diesem letzten Akt sang Fräulein Erdösy dann ihr berühmtes Couplet:
„Ich brauche keine Professoren,
Liebe ist uns angeboren.
Ich weiss, was dazu gehört,
Wie man schmachtet und gewährt,
Kokettiert und Grüsse schickt,
Wie man seufzt und Hände drückt
Bei verliebten Neckerei’n.
Doch wozu? ’s muss ja nicht sein!
’s muss ja nicht sein!“
Sie musste eine Pause machen, so stark war der Beifall, doch dann trat Stille ein, und sie sang weiter:
„Weiss auch, wie mit Feuerblicken
Solchen Kopf man kann verrücken,
Weiss, dass, wenn es kommt zum Küssen,
Sich die Lippen spitzen müssen,
Drücke zu die Äugelein,
Wenn es wirklich müsste sein,
Halt auch still dann ohne Schrei’n.
Doch wozu? ’s muss ja nicht sein!
’s muss ja nicht sein!“
Hatte sie diesen Vers nicht nach der Loge der jungen Offiziere hin gesungen?
„Donnerwetter“, flüsterte Plesser, „es muss doch sein!“
Als der Vorhang zum letztenmal gefallen, man draussen auf der Strasse war, sagte Storkow: „Sie lässt euch bitten, sie künftighin mit euren Einladungen zu verschonen — sie ist doch nicht irgendein Ballettmädel!“
„Hoho — hat sie dir das aufgetragen?“
„Ja!“
Die andern lächelten, und Hans v. Eschendorff summte: „Es muss ja nicht sein!“
„Nein — und deshalb bitte ich euch darum, es zu unterlassen, damit sie merkt, dass ich’s auch ausgerichtet habe!“
II.
Man hatte sich getrennt; v. Eschendorff war mit Storkow zusammengeblieben, und dieser wusste, was ihn jetzt erwartete.
In der Wilhelmstrasse dann, kurz vor dem Belle-Alliance-Platz, nahm Eschendorff entschlossen einen Anlauf: „Von der Fanny habe ich wieder einen Brief bekommen!“
Storkow zog bei der nächsten Laterne seine Brieftasche. „Hier — ein Blauer — mein letzter! Ich bin diesen Monat auch knapp — was du also nicht brauchst, gib mir morgen zurück!“
„Dreissig — vierzig Emm hätten genügt —“
„Ich hab’s nicht kleiner!“
„Ich danke dir — Storkow!“
„Lass doch, ich kann mir ja denken, wie dir zumute ist. Bloss, wie willst du jemals aus der Patsche herauskommen?“
„Ich sehe keinen Ausweg — die Bluthunde haben mir ja schon mit Anzeige beim Oberst gedroht.“
„Und dann?“
„Dann werde ich eben geschasst.“
„Und dann?“
„Wird vielleicht noch alles gut. Zum Offizier muss man geboren sein — ich bin es nicht. Ich hätte Musik studieren sollen, aber ich musste mich fügen. Vielleicht hol’ ich noch nach, was ich verloren habe.“
„Und — entschuldige — wovon willst du leben?“
„Klavieruntericht! Ich heirate die Fanny — dann wird das Kind ehelich — und da sie ebensogut unterrichten kann wie ich, machen wir ein Musikinstitut auf! Je eher der Kladderadatsch kommt, desto besser für mich!“
Sie waren vor Storkows Wohnung am Belle-Alliance-Platz angelangt.
„Also — morgen früh wechsle ich und gebe dir den Rest zurück!“
„Ja doch — gute Nacht, Eschendorff! Vielleicht gibt’s doch noch einen andern Ausweg!“
„Ich will gar keinen — ich liebe das Mädel und das Kind viel zu sehr, und als Offizier hätte ich die Fanny niemals heiraten dürfen!“
„Adieu!“
Storkows Wohnung lag hochparterre. Im Dunkeln tastete er sich hinauf, entflammte dann oben vor der Tür ein Wachsstreichhölzchen, schloss auf. Die Petroleumlampe war schon zum Anzünden bereitgestellt, Glocke und Zylinder lagen daneben auf dem Tischchen im Korridor.
Als sie brannte, trug er sie nach dem grossen Vorderzimmer, das er sich ebenso eingerichtet hatte wie die Stube daheim auf dem väterlichen Gute. Bis zur halben Höhe dunkel getäfelt — auf der hellen Tapete darüber ein paar Jagdgewehre, Geweihe und gerahmte Lithographien von englischen Rennpferden. In der Mitte stand ein schwerer, eichener Tisch. Nebenan war das kleine Schlafzimmer mit dem eisernen Feldbett; an den Wänden hingen Photographien in ovalen schwarzen Rahmen.
Storkow schloss den Schrank auf. Ja — da hing der Dienstanzug für morgen früh, gebürstet und griffbereit — aber wo waren die Stiefel?“
„Na — erst einmal das Räuberzivil herunter und ein bisschen bequem gemacht!“ In Hausschuhen ging er dann durch den Korridor nach der Küche.
Da brannte wirklich noch Licht — ein kleines Lämpchen mit einem gelben Blender. Der Diener sass da, mit dem Kopf an die Wand gelehnt und schlief, den Mund weit offen.
„Friedrich!“
Aber der schlief viel zu fest und ermunterte sich nicht eher, als bis er ihn an der Schulter rüttelte. Da fuhr er jäh in die Höhe, suchte Haltung anzunehmen. „Z’Befehl, Herr Premierleutnant!“
„Scher’ dich in die Falle — wie oft hab’ ich dir schon gesagt, du sollst nicht warten!“
Beinahe wäre Storkow über die Schuhe und Stiefel gestolpert, die in langer Reihe neben dem Stuhl standen.
„Alle gewichst! Etwa die Lackschuhe auch wieder? Ach nee, die hab’ ich ja eingeschlossen, damit das Malheur nicht noch einmal vorkommt. Stell’ genau die Weckeruhr und dann in die Federn — Lampe auspusten!“
Er selber aber war viel zu munter, um ebenfalls zu Bett zu gehen. Eine Zigarre rauchend, sass er am Tisch und blickte auf die beiden Briefe, die dort lagen — sie zu öffnen, hatte er keine Lust. An der Handschrift und den Umschlägen sah er ja, von wem sie kamen — der eine von seinem jüngeren Bruder Fritz, der ihn mit seiner unglücklichen Liebe zu der Gutsnachbarin doch nur langweilte, der andere von Fifi, die ihm sicherlich Vorwürfe machte, dass er sie nicht mehr ausführte.
Eine Klette —, dachte er, dass das Mädel nicht begreifen will, wie lange die Geschichte schon aus ist. Ein Wort seines Bruders fiel ihm ein: „Du gehst aus allen Affären heil heraus — dich macht keine unglücklich, nur du machst alle unglücklich — wehe dem armen Mädel, das sich mit dir einlässt!“
Weil er nie geliebt hatte wie der Bruder Fritz, der stets an einen „Bund fürs Leben“ dachte. So spöttisch er eine solche völlige Hingabe beurteilte — heute, zum erstenmal in seinem Leben, hatte er empfunden, dass auch er dazu fähig sei. Vorhin, im Theater, als ihm „die Jenny“ die Hand gereicht.
Ja — solch ein Mädchen — eine wirkliche Künstlerin, nicht eine Ballettratte wie die Fifi.
Unwillkürlich hatte er nun doch nach dem Briefe gegrissen — aber plötzlich richtete er sich hoch auf, las noch einmal die Stelle:
„— — — so lebe wohl für immer — Du hast keine Schuld und brauchst Dir keine Vorwürfe zu machen, wenn Du es hörst. Ich konnte es nicht länger ertragen, es ist das Beste für mich.
Deine bis in den Tod getreue Fifi.“
Was war da geschehen — sollte das Mädel wirklich eine Dummheit gemacht haben? Ach, sicherlich nur eine Weiberlist, um ihn wieder anzulocken. Aber wenn da doch etwas passiert wäre? Nun, jetzt in der Nacht war nichts zu erfahren. Und — zu ändern wäre ja auch nichts gewesen. Was hatte denn aber dieses Mädchen eigentlich gedacht? Nie hatte er ihm etwas versprochen, ihm nie Zweifel darüber gelassen, dass es sich nur um ein Techtelmechtel gehandelt, wie Fifi schon vor ihm so viele gehabt.
Nein — er wurde nicht ruhiger. Und plötzlich nahm er die Schreibmappe vor, beschrieb einen Umschlag mit der Adresse: „Fräulein Elfriede Barnick, Berlin N, Kesselstrasse Z.“ Und auf eine Visitenkarte: „Ich bitte Dich um eine Aussprache, gib Nachricht, wann und wo wir uns treffen können. Gruss Achim.“
Er kuvertierte, klebte die Marke auf und ging dann so, wie er war, auf die Strasse und warf den Brief in den Kasten.
Wieder in seinem Zimmer angelangt, spürte er jetzt die Erschlaffung — also ins Bett.
*
Premierleutnant Graf Achim Storkow hatte das Glück gehabt, dass er vor einem halben Jahr zur Kriegsakademie berufen worden war. Jeden Morgen in der neunten Stunde strebte er daher nach dem grossen Bau in der Dorotheenstrasse — aber dann, wenn nach vier Stunden die Vorlesungen zu Ende, gehörten Nachmittag und Abend ihm.
Als er heute — zwei Tage nach dem Besuch im Walhall — heimkam, fand er auf dem Tisch seinen Brief „An Fräulein Elfriede Barnick“; auf der Rückseite der Vermerk der Post: „Zurück an den Absender. Adressatin verstorben.“
„Friedrich!“
Und als der Diener kam: „Sofort eine Droschke — nein, für mich kein Essen — ich muss weg!“
Wenige Minuten später fuhr die Droschke vor, Friedrich sprang vom Bock, kam herauf.
„Wer auch kommt, wird abgewiesen — verstanden! Kerl, du heulst wohl gar?“
„Das arme Fräulein — war immer so lustig — und so jung und schön!“
„Raus!“
Fehlte noch gerade, dass er mit dem Diener einen Trauerchor bildete. Mit Unabänderlichem musste man sich abzufinden wissen. Als er dann in der offenen Droschke — es war ein schöner, sonniger Tag — am buntgefärbten Tiergarten vorüberfuhr und die Erinnerung kam, wie oft er hier mit Fifi entlanggegangen war, wenn er sie heimgebracht, legte sich doch etwas Schweres auf sein Herz. Und wieder kamen ihm die Worte seines Bruders in den Sinn, dass er die Mädchen unglücklich mache.
Ehe der Kutscher in die Kesselstrasse einbog, liess Storkow halten, zahlte und ging den Rest zu Fuss. Er blickte hinauf nach den Fenstern von Fifis Stube — sie waren weit geöffnet. Und dann stieg er die drei Treppen hinauf. Fifis Visitenkarte war nicht mehr an der Tür über dem ovalen Porzellanschild der Vermieterin: „Wwe. Anna Speer.“
Die Klingel war immer noch nicht repariert, er konnte den Draht an dem Messinggriff ein ganzes Stück herausziehen. Auf sein Klopfen wurde dann geöffnet.
„Jott, Sie!“ Die alte Frau war unwillkürlich vor ihm zurückgewichen. „Ja, denn kommen Sie man rin, Herr Iraf!“
Sie liess ihn in ihre Stube, wo es behaglich nach Kaffee roch und ein Kanarienvogel zwitscherte.
„Kommen Sie, setzen Sie sich hier mit ans Fenster — wo sie immer gesessen hat, wenn sie mir von Ihnen erzählte.“
„Ich wollte wissen, wann die Beerdigung ist?“
„Ach Jott, schon vorbei! Wenn ich nich jleich nach’s Schauhaus jejangen wäre, hätten sie ihr vielleicht nach die Anatomie jebracht. Sie haben ihr doch bei die Zelten aus det Wasser jezogen, und ’n Schutzmann kam mir Bescheid sagen. Aber ich möchte das alles ja nich mehr erzählen, ich darf nich dran denken, denn ich seh’ ihr ja immer noch in dem Ilaskasten liegen — wie Schneewittchen sah sie aus — so blass und so schön.“
„Wo ist das Grab?“
„Auf dem Charitéfriedhof in der Müllerstrasse an die Ecke Seestrasse. Kränze braucht sie nicht mehr, die von’s Ballett haben so ville jebracht, dass man von die eklige Erde nischt mehr sieht.“
„Liegt die Stelle sehr abseits?“
„Nee, nee, wat denken Sie, Herr Jraf! An die Mauer hab’ ich ihr nicht einscharren lassen. Wenn man reinkommt von die Müllerstrasse den langen Jang und dann links ab und da denn jrade an die Ecke!“
Storkow stand auf — trotz der Artigkeit der Alten fühlte er doch den Widerwillen gegen seine Person. „Sie haben viele Auslagen gehabt, darf ich Ihnen —“
„I bewahre! Fifi hatte ja ihr Jeld janz genau für alles einjeteilt, auch den Haus- und den Entreeschlüssel hierjelassen — nich einen Pfennig hab’ ich zulegen brauchen!“
„Soviel ich weiss, hatte sie keine Anverwandte in Berlin?“
„Nee — keine Menschenseele! Und damit Sie sich wejen Ihre Photographie und die Briefe keine Jedanken machen — das Bild hat sie aus dem Rahmen jenommen und mit das übrige im Ofen verbrannt!“
„Seien Sie doch nicht so feindlich gegen mich, Frau Speer. Ich war doch schon über ein Vierteljahr mit ihr auseinander und glaubte, dass sie mich längst vergessen hätte!“
„Das hat sie eben nich! Jeden Tag hat sie auf einen Brief von dem Herrn Jrafen gelauert, an ihre freie Abende hat sie hier jesessen und jedacht, es würde kloppen, aber Sie sind nich jekommen. Und wie sehr hat sie Ihnen jebettelt, ich hab’ doch mal so’n anjefangenen Brief jelesen! Sehen Sie, Herr Jraf, so spielt man nich mit Mädchenherzen —“
„Na, ich danke Ihnen für die Auskunft, und nun will ich mal sehen, wie ich nach dem Friedhof komme. Das ist doch hinterm Wedding?“
„Noch ein langes Ende — nehmen Sie sich man ’ne Droschke, die Pferdebahn nach Tegel kommt nur alle halbe Stunde!“ — — —
Im Dämmerlicht des Abends stand er dann an dem Grabe, legte den unterwegs gekauften Rosenstrauss zu den Kränzen — und ging nachher zu Fuss heim, denn er wollte müde werden, um nicht mehr denken zu müssen.
III.
Die Kameraden vom Regiment wunderten sich über das stille, verschlossene Wesen Storkows. Da er auf Fragen nur abweisende Antworten gab, drangen sie nicht weiter in ihn. Geldsorgen wie sie hatte er jedenfalls nicht — also konnte es nur eine Mädelgeschichte sein.
„Die Jenny hat ihn abblitzen lassen“, das war wohl die einzige Erklärung. „Und dass er an dem Theaterabend Feuer gefangen, war ja nicht zu verheimlichen gewesen.
Die nächsten Tage brachten dann ein Ereignis, das alle mit grösster Teilnahme erfüllte. Eines Vormittags war Leutnant v. Eschendorff zum Obersten befohlen worden, und als er zurückkam, sahen sie an seinem blassen Gesicht und dem verzerrten Lächeln, dass die Katastrophe eingetreten war: Geschasst — wegen Schulden — Wechselschulden.
Es war das zweitemal, dass er es wegen eines nicht eingelösten Wechsels hatte zur Klage kommen lassen — und da gab’s keine Schonung. In einer Ansprache an die jungen Offiziere hatte der Oberst erst kürzlich in der eindringlichsten Weise diese ermahnt, keine Schulden zu machen, äusserste Sparsamkeit zu üben, ein Ausgabenbuch zu führen, sich nach der Decke zu strecken. „Dazu gehört nur Charakterfestigkeit — und wer die nicht besitzt, ist unwürdig, des Königs Rock zu tragen!“
Leutnant v. Eschendorff hatte diese Charakterfestigkeit nicht bewiesen und war daher nicht zum Offizier geeignet.
„Ich hätte ihm ja gerne auch diesmal aus der Klemme geholfen“, sagte Storkow, „wenn er mir eine Andeutung gemacht hätte. Treu und brav hat er mir den Rest von einem Blauen gleich am nächsten Tage zurückgegeben — hätte ich ihm doch die fünfzig Mark gelassen!“
„Es handelte sich um viel mehr — und wenn wir alle zusammengelegt hätten, hätte es ihm wahrscheinlich auch nichts genützt“, meinte v. Plesser.
„Was wird er nun machen? Weinreisender, denn als Lotteriekollekteur kommt er nicht mehr in Frage.“
Premierleutnant v. Strehlen, der am bekümmertsten dagesessen, sagte: „Was wird aus uns allen mal, wenn wir nicht Karriere machen und kein Geld wie Storkow haben. Die Aussichten auf einen Zivilberuf für einen verabschiedeten Offizier sind ja minimal. Nach zehnbis zwölfjähriger Dienstzeit müssten wir die Möglichkeit haben, in für uns reservierte Zivilstellungen überzugehen, in Stellen, für die wir durch die lange Militärzeit als besonders geeignet gelten können. Glaubt mir, dann wäre vieles besser!“
Die andern schwiegen — Strehlen hatte ja immer besondere Ansichten. „Für mich“, sagte er jetzt, „ist die Geschichte mit Eschendorff ein Menetekel. Ich versage mir jetzt alles — aber auch alles — schaffe mir nichts Neues an, bis mir der Bursche sagt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.“
„Eschendorff war der Sparsamste von uns allen“, sagte Plesser, „er ist nur durch seine Fanny in Schwulitäten geraten. Er wollte an dem Mädel gutmachen, was er ihm angetan, und hat sich dabei übernommen!“
Der Mittagstisch war beendet; sie standen auf und verabschiedeten sich.
Storkow überlegte: Sollte er an diesem klaren, sonnigen Tage noch einen Ritt durch den Tiergarten machen? Aber — es war ja auch so herrlich zu gehen, sich die Ladenschaufenster anzusehen. Vielleicht, dass er für Bruder Fritz ein hübsches Geburtstagsgeschenk fand.
So ging er vom Belle-Alliance-Platz durch die Friedrichstrasse, immer weiter und weiter, bis grössere Geschäfte kamen. An der Kreuzung mit der Leipziger Strasse zögerte er. Sollte er noch zum Waffengeschäft von Hypolit Mehles? — der Kerl machte ja solch eine wahnsinnige Reklame für seine Waren, dass es eigentlich genierlich war, dort zu kaufen. Aber — man konnte ja einmal sehen, was er für Auslagen hatte.
Plötzlich kniff er die Augen zusammen — die eine von den beiden Damen, die ihm da entgegenkamen — ja, war das nicht die Erdösy — die schöne Jenny?
Sie war es. Er salutierte mit leichter Verbeugung. Auch sie musste ihn erkannt haben, sonst hätte sie nicht so freundlich gelächelt. Rasch trat er an das nächste Schaufenster, blickte ihr noch so lange nach, wie er sie sehen konnte.
Eins stand für ihn fest: Heute abend würde er im Theater sein. An der nächsten Litfasssäule suchte er den Anschlagzettel. „Walhalla-Operetten-Theater“, Direktor Grosskopf. „Nanon“, Operette in drei Akten. Frei nach einem Lustspiel der Herren Théauson und d’Artoil von F. Zell und Richard Genée. Nanon Patin, Wirtin vom ‚Goldenen Lamm‘ ... Fräulein Eugenie Erdösy.“
*
„Wer war denn das nun wieder?“ hatte die Begleiterin gefragt, und Jenny hatte lächelnd gesagt: „Einer von den vielen, die mich jetzt grüssen!“
„Aber — du schienst ihn doch zu kennen?“
„Der Direktor hat ihn mir neulich in der Pause vorgestellt — ich glaube, ein Graf Storkow.“
„Kein Adonis!“
„Nein — dabei sah er heute besser aus als neulich in Zivil!“
„Wie alle Männer in Uniform!“
Die Friedrichstrasse war um diese Nachmittagsstunde zu belebt, um eine Unterhaltung führen zu können, und so fiel nur ab und zu eine Bemerkung, wenn die beiden Damen die Auslagen eines Schaufensters musterten. Aber als sie dann in die Leipziger Strasse einbogen, nach dem Tore blickten, unwillkürlich, weil dort der westliche Himmel im Schein der sinkenden Sonne eine wundervolle Sinfonie in Rot und Gelb bot, sagte Jenny: „Ach, Blanka — jetzt frei sein, jetzt da draussen irgendwo diesen herrlichen Tag auskosten können! Da sind dunkle Wälder, man riecht das welke Laub und die Erde. Da ist Stille und Einsamkeit. Ich fühle mich fremd hier in dieser lauten, unruhigen Stadt — wenn ich noch einmal dort sein könnte, wo ich als Kind so glücklich war!“
„Schäfchen — sentimentales! Der Herbst macht dich elegisch! So etwas ist himmlisch einen Nachmittag, wenn man in der Kutsche sitzt und man Distanz zu allem bewahrt. Weisst du, wonach ich mich eben sehnte? Dass wir schon zu Hause wären, Lina den starken Kaffee in der Silberkanne hereinbrächte — auf den Tisch neben die Blumenvase stellte und ich Kuchen essen könnte, ich habe Heisshunger auf unsern Königskuchen!“
„Wir hätten vorhin zu Kranzler gehen sollen.“
„Nein, schrecklich, dieses Angestarrtwerden — wie klebrige Fliegenbeine klettern die Blicke der Männer auf einem herum. Menschen — gewiss, aber nicht nur solche, die man zur Not noch gerade ertragen kann, sondern die in Nuancen sprechen und nuanciertes Sprechen verstehen — mit denen man auch stumm sein kann!“
„Ich wundere mich, dass du mich dann ertragen kannst!“
„Sei nicht empfindlich, Jenny. Ich kann stundenlang schwätzen, wenn ich dadurch eine gesellschaftliche Pflicht erfülle, um den Stumpfsinn der anderen zu retouchieren, aber da opfere ich mich — und ich will mich nicht opfern, habe dazu nicht die geringste Veranlagung.“
„Und doch opferst du dich für mich — und ich hab’ mich oft gewundert, warum?“
„Ich opfere mich nicht — du bist eine Seltenheit —“
Jenny lächelte. „Du täuschst dich! Aber, was ich mich schon oft gefragt habe: wie du dein Leben ertragen würdest, wenn du arm wärest?“
„Ich würde meine Armut stilisieren — dann würde ich sie ebenso ertragen. Kein Bett mit muffigen Federn, sondern einen wirklichen Strohsack, kein Kellerloch, aber eine Mansarde, keine Pferdewurst, aber Pellkartoffeln mit Hering und die Pellkartoffeln schön aufgeplatzt, in einer braunen Schüssel aus Velten. Keinen abgetragenen Mantel von einer Gnädigen, sondern einen Friesrock und ein dickes Umschlagetuch. Natürlich auch Holzpantoffeln — Holzpantoffeln gehören —
„Gehören zu der Komödie!“
Blanka beachtete den Einwurf nicht. „Und dann würde ich singen gehen auf die Höfe, Gitarre dazu spielen.“ Und sie summte halblaut:
„Disteln und Dornen stechen sehr,
Falsche Zungen noch viel mehr.
So ist’s besser, in Dornen zu sterben,
Als durch falsche Zungen verderben.“
Sie kamen in der Charlottenstrasse am Theater vorüber, das noch finster und still war, und standen dann in dem grünen Winkel des Enckeplatzes mit dem Garten der Sternwarte. In dem letzten Hause, das mit seinen Fenstern freie Aussicht auf die Baumwipfel hatte, lag im zweiten Stock die Wohnung. „Blanka Mertini, Gesangspädagogin“, war in das Messingschild an der Tür eingraviert.
„Ssst — hörst du — Lina singt“, sagte Jenny und hielt Fräulein Mertini zurück, die eben den Schlüssel ins Schloss stecken wollte. Sie lauschten beide.
„Ja, treu ist die Soldatenliebe
Von hier bis an die Stubentiere ...“
„Was kann man dagegen tun?“ fragte Fräulein Mertini.
„Nichts — sie muss sich Luft machen — ihr Grenadier ist ihr wahrscheinlich untreu geworden.“
„Wieviele Grenadiere gibt’s!“ Blanka schloss auf, und in demselben Augenblick verstummte der gellende Gesang. Lina kam ihnen entgegen, nahm Schirme und Hüte in Empfang.
Auf der Marmorkonsole, die den grossen goldgerahmten Spiegel stützte, stand ein silbernes Schälchen für die Besucherkarten. Es war leer, trotzdem fragte Fräulein Mertini: „Niemand hier gewesen? Also, schnell den Kaffee, Lina!“
Das Mädchen hatte die Tür zum nächsten Zimmer geöffnet und schloss sie nun hinter den Damen. Hier stand in der Mitte der Flügel, auf dem eine Gitarre lag; an der einen Wand eine Reihe hochlehniger Rohrstühle, an der anderen ein niedriger, langgestreckter Notenschrank mit Glastüren. Darüber ein gerahmter Stich der Jenny Lind. Aber auch hier, zwischen den beiden Fenstern, ein grosser Spiegel, der die Gestalt von Kopf bis zu Fuss wiedergab.
Beide hatten zu gleicher Zeit hineingesehen und ihre Erscheinung gemustert. Jetzt lächelten sie sich im Spiegel an — aber Blanka seufzte:
„Noch einmal so jung sein können wie du, Jenny!“
Ja, der Hut hatte Blanka jugendlicher gemacht, als sie war, und so Kopf an Kopf sah man den Altersunterschied. Trotzdem — sie war ein Frauentypus, der gerade erst in diesem nicht mehr jugendlichen Alter seinen höchsten Reiz auf Männer ausüben musste — und das wusste sie!
Im Nebenzimmer, mit der Aussicht auf den Garten der Sternwarte, war schon der Kaffeetisch gedeckt — in der Mitte, zwischen dem Kopenhagener Porzellan, ein Asternstrauss in weisser Vase.
Und da kam Lina auch schon mit der silbernen Kanne, und während sie in die Tassen eingoss, sagte sie: „Hier jewesen is doch jemand, aber man bloss Herr v. Hilken. Is jleich an die Türe wieder jejangen, als er hörte, dass jnädiges Fräulein spazieren sind!“
Fräulein Mertini nahm diese Mitteilung schweigend hin, aber Jenny sagte, als das Mädchen draussen war: „Er wird am Abend wiederkommen!“
„Jedenfalls will ich ihn erwarten, denn zum zweitenmal an der Tür umzudrehen, verträgt seine Empfindlichkeit nicht. Ich kann dich heute also nicht ins Theater begleiten!“
„Nein — schade! Und wenn Hilken nicht kommt, wirst du dich zermartern bei diesem Warten!“
„Auch das gehört dazu!“
„Ich weiss nicht, Blanka! Wo ist das Glück, wenn ihr euch nur gegenseitig quält!“
In das feine, schmale Gesicht der Freundin kam etwas Müdes. Sie antwortete nicht, und Jenny fühlte sich plötzlich etwas befangen, wie so oft der Freundin und Lehrerin gegenüber — trotz der Freundschaft.
„Bloss Herr v. Hilken —“, wiederholte Fräulein Mertini des Mädchens Worte.
„Und du hast vorhin gefragt: ‚wieviel Grenadiere gibt’s?’“ Wie immer befreite sich Jenny von ihrer Befangenheit, die sie demütigte, durch solch ein Auftrumpfen.
Blanka nahm es schweigend hin, sass sinnend da und sagte: „Gott behüte dich vor solch einem — Liebesverhältnis!“
„Verhältnis — Liebesverhältnis!“ Jenny blickte nach der Uhr auf der Spiegelkonsole und erhob sich.
„Ja — es wird Zeit, ich muss weg“, sagte sie. „Schick’ Hilken doch einen Dienstmann hin, damit du Bescheid bekommst und nicht in dieser Ungewissheit bist!“
IV.
Als Jenny im dritten Akt auf der Bühne erschien, hielt sie drei rote Rosen in der Hand, und als sie dann wieder ihr berühmtes Couplet sang, ja — hatte sie da nicht bei den Worten:
„Weiss, dass, wenn es kommt zum Küssen,
Sich die Lippen spitzen müssen ...“
zu der Fremdenloge gewandt? Unwillkürlich richteten sich die Blicke des Parketts ebenfalls dorthin — gewiss, da sass jemand im Hintergrund, aber in der Dunkelheit des Zuschauerraums war nichts deutlich zu unterscheiden.
Als dann der Vorhang gefallen, das Theater wieder hell wurde, war die Loge schon leer.
Endlich verebbte der Strom der Besucher, verliefen sich auch die, die noch draussen vor dem Eingang gewartet. Aber Storkow, der in der dunklen Haustornische gegenüber stand, hielt geduldig weiter aus. Endlich kamen auch die Künstler — und da war sie, mit dem grossen Rosenstrauss, den er ihr in die Garderobe geschickt.
Mit raschen Schritten ging Jenny dem Enckeplatz zu — aber plötzlich war Storkow neben ihr, den Hut in der Hand, und sagte flehend: „Gnädigstes Fräulein — verzeihen Sie mir — aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich habe Sie erschreckt — das wollte ich nicht, wie kann ich es wieder gutmachen?“
Sie hatte ihre Fassung wiedergewonnen, ging noch schneller als vorhin, blieb stumm. Aber er wich nicht von ihrer Seite.
„Gnädigstes Fräulein — Sie sehen doch, wie es um mich steht — geben Sie mir die Möglichkeit —“
Da sagte sie: „Ein paar Häuser weiter und ich bin am Ziel — ich danke Ihnen für Ihre überraschende Begleitung, aber jetzt möchte ich Sie bitten, nicht weiter mitzukommen.“
„Ich gehorche — aber gibt es keine Möglichkeit, Sie ausserhalb des Theaters wiederzusehen?“
„Ich sehe keine!“
„Sie gehen doch spazieren —“
„Nur mit meiner Freundin!“
„Der Dame, mit der ich Sie heute traf?“
„Ja — sie ist meine Lehrerin, der ich meine Ausbildung verdanke!“
„Wie glücklich wäre ich, wenn Sie mir etwas verdankten!“
„Diese schönen Rosen doch!“
„Gnädigstes Fräulein — ich will mich nicht aufdrängen — nie in meinem Leben habe ich das getan. Wenn Sie mir jetzt sagen, dass meine Bitte um ein Wiedersehen hoffnungslos ist, dann werde ich nie wieder wagen, Ihnen in den Weg zu treten!“
„Hoffnungslos!“ sagte sie.
Erschreckt beugte er sich vor, suchte ihren Blick. Da sah er, dass sie lächelte, sich in die Lippen biss.
Mit veränderter Stimme, ganz leise, sagte er: „Wenn es Ihr Ernst gewesen wäre — ich weiss nicht, was ich dann getan hätte!“
Jäh wandte sie sich zu ihm und sagte scharf: „Nein — Herr Graf, dieses ‚entweder du liebst mich, oder ich schiesse mich tot’ lasse ich nicht gelten. Mich darf niemand zwingen — durch einen Druck, der mir Gewissensbisse bringen soll, wenn ich nicht nachgebe. Solche Alternative — das sei ein für allemal festgestellt — lehne ich ganz entschieden ab. Die Freiheit meiner Entschliessungen gebe ich nicht auf!“
Er hatte ihr unverwandt in die Augen gesehen, jetzt sagte er, als hätte er ihre Worte gar nicht gehört: „Wie schön sind Sie — wie entzückend schön!“
Da spürte sie mit einem Erschauern, dass dieser Mann ihr unrettbar verfallen war, aber etwas bäumte sich in ihrem Herzen auf, dass er deshalb auch ihr Schicksal sein sollte. „Ich muss nach Hause — man erwartet mich — adieu!“
Um ihn zu versöhnen, reichte sie ihm die Hand, die er küsste. Dann war sie die wenigen Schritte bis zu ihrem Hause gegangen, schloss auf, ehe sie aber eintrat, nickte sie ihm noch zu.