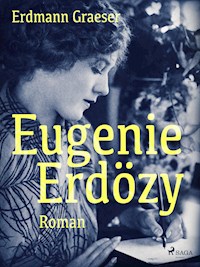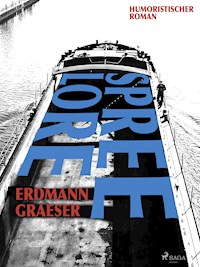
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Witwe Anna Lorenzen lebt mit ihrer Tochter Lore allein in der Berliner Friedrichsgracht nahe der Spree, seit ihr Mann, Lorenz Lorenzen, womöglich angetrunken von seinem Kahn in die Spree gestürzt ist. Sein Körper wurde nie gefunden, und er ist seit langem für tot erklärt worden. Doch Anna traut dem Verflossenen nicht nach. Tochter Lore hat derweil Sorgen; immerzu wird sie von Gustav Holzer belästigt – der Kahn seines Vaters ist aus dem Schifferdorf Marienwerder, aber am Ende soll Gustav seinen eigenen Kahn in "Spree-Lore" umbenennen. Außerdem fehlen Lore die fünf Groschen, die sie braucht, um ein Geschenk zu kaufen, ohne dass sie nicht zu Lili Sempers Geburtstagsfeier gehen kann – der Tochter aus der wohlhabenden Familie Semper, für deren Vater, den alten Semper, Lorenz Lorenzen einst Steine in seinem Kahn nach Berlin schipperte und für dessen Familie Anna Lorenzen nun wäscht und plättet. Anna Lorenzen selbst kommt unterdessen Schustermeister Kranold immer näher, bis sie sich schließlich verloben und heiraten. Als Annas erster Gemahl, Lorenz Lorenzen, unverhofft zurückkehrt und es sehr zufrieden ist, als "Toter" von Polizei und Behörden unbehelligt durch die Gassen und Kanäle Berlins zu ziehen, sorgt das für eine Menge Aufregung und Durcheinander ... Ein wunderbarer humoristischer Roman vom großen Berliner Unterhaltungsautor – zusammen mit den beiden "Koblanks"-Bänden und der Romanreihe um "Lemkes sel. Witwe" eines der unbestrittenen Hauptwerke Graesers und in jedem Fall unbedingt lesenswert!Erdmann Graeser (1870–1937) war ein deutscher Schriftsteller. Als Sohn eines Geheimen Kanzleirats im Finanzministerium in Berlin geboren, ist Graeser zwischen Nollendorfplatz und Bülowbogen im Berliner Westen aufgewachsen. Graeser studierte Naturwissenschaften, brach jedoch das Studium ab und arbeitete zunächst als Redakteur für die "Berliner Morgenpost" und später als freier Schriftsteller. Er wohnte viele Jahre in Berlin-Schöneberg und zog nach seinem literarischen Erfolg nach Berlin-Schlachtensee im Bezirk Zehlendorf. 1937 starb er an einem Herzleiden. Sein Grab liegt auf dem Gemeindefriedhof an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf. In seinen Unterhaltungsromanen thematisierte Graeser die Lebenswelt der kleinen Leute im Berlin seiner Zeit und legte dabei auch großen Wert auf den Berliner Dialekt. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Lemkes sel. Witwe", "Koblanks", "Koblanks Kinder" und "Spreelore". Einige seiner Romane wurden später auch für Hörfunk und Fernsehen bearbeitet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erdmann Graeser
Spreelore
Roman
Saga
Spreelore
© 1955 Erdmann Graeser
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592496
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I. Teil
1
Die große Stadt singt ihr lautes Lied vom Morgen bis tief in die Nacht hinein. Über viele Brücken tost das Leben Berlins. Unten aber, auf der Spree und auf den Kanälen, gleiten lautlos große Frachtkähne dahin, bringen Holz und Ziegelsteine, Sand und Mörtel, Kohlen und Torf. Etlichen dient ein kleiner Dampfer als Vorspann, aber die meisten werden mühselig vorwärtsgestakt. Die Frau des Schiffers, den Strickstrumpf in der Hand, steht am Steuer, einige Kinder spielen bei der Kombüse; aus dem Schornstein steigt dünner Rauch, ein kläffender Spitz jagt ruhelos auf den Planken hin und her.
Die Menschen oben auf der Brücke, die eben hinuntergeblickt hatten, als der große Kahn mit dem grünen Vordersteven unter der dunklen Wölbung verschwand, diese Menschen, deren Stadt, „ihr“ Berlin, sich von Jahr zu Jahr wandelt, haben vor sich ein Bild, das seit alten Zeiten unverändert ist. Was Berlin auch durchzumachen hatte und was es noch erleben wird, die Schiffer mit ihren Kähnen kamen und werden nach wie vor kommen. Immer werden sie zu dem steinernen Ungeheuer hinüber starren. Sie bringen ihm das, was es braucht, und dann ziehen sie wieder davon, langsam, gemächlich, bis sie draußen, auf den großen Seeflächen oder der Elbe, den Mast wieder aufrichten und die Segel setzen können.
Aber zuweilen geschieht es, daß jemand von solch einem Frachtkahn in der Stadt zurückbleibt und vielleicht sogar auch seßhaft wird. Dann sucht er sicherlich die auf, die schon vor ihm heimisch wurden, und nicht zuletzt in den Gäßchen nahe dem Spreeufer, und dort findet er wohl meistens ebenfalls Unterschlupf.
So kommt es, daß hier am Wasser Menschen zusammenwohnen, die sich mitunter schon von ihrer Jugendzeit her kennen und nun ebenso zu der großen Stadt gehören, wie alles andere, was in ihr lebt.
In solch einer Straße nahe am Wasser – der Friedrichsgracht – die mit ihren kleinen, schmalen Häusern in den siebziger Jahren noch ganz unberührt von baulichen Veränderungen war, hatte auch die Witwe Anna Lorenzen mit ihrem Töchterchen Zuflucht gefunden. Nach dem spurlosen Verschwinden ihres Mannes, der vom Kahn unbemerkt ins Wasser gestürzt und wohl ertrunken war, hatte sie damals den „Spreewinkel“ aufgesucht. Zumal nicht weit davon – in der Breiten Straße – der steinreiche Ziegeleibesitzer Semper wohnte, in dessen Haus sie früher in Stellung gewesen war. Für Herrn Semper hatte ihr Mann in den letzten Jahren Steine nach Berlin gebracht, und zwar auf seinem eigenen Kahn, den er schon vom Vater her besaß.
Nun wusch und plättete Frau Lorenzen für Sempers und andere wohlhabende Leute. Auch heute, an diesem schönen Frühlingstag, war sie damit beschäftigt. Die kleine Küche, die beinahe der auf einem Frachtkahn glich, war von feuchtem, warmem Dunst erfüllt. Ihr Mädelchen, Lore, ein blondes Ding mit schmalem, feinem Gesichtchen, saß in der Nebenstube, in der das Bemerkenswerteste das Bild des Vaters war, das über dem Bett hing. Freilich nur eine allmählich verblaßte Photographie, die noch aus der Bräutigamszeit stammte. Lorenzen, der ebenso blondes, aber krauses Haar gehabt hatte wie seine Lore jetzt, stand breitbeinig vor dem Beschauer, eine Ziehharmonika in der Hand und lachte über das ganze Gesicht, er schien zu singen ... „Juvivallera!“ hatte er unter das Bild geschrieben und es seiner Braut geschenkt – damals, als er noch Matrose gewesen war auf Käpten Gundermanns Vollripper. „Juvivallera!“ war sein Leitspruch gewesen, bis sich – ja, bis sich das Kind gemeldet hatte ... Damals, da mußte er schleunigst das hübsche Dienstmädchen von Sempers heiraten, und mit dem lustigen Matrosenleben in Hamburg war es ziemlich plötzlich zu Ende; er wurde Spree- und Elbschiffer. Doch sein ungestümes Blut war damit nicht zur Ruhe gekommen, und wenn er zur Feierabendzeit auf Deck saß und seine Harmonika spielte, ging ihm so manche prickelnde Erinnerung durch den Kopf: Wie ihn der Vater damals aus Schönfließ zur Tante nach Berlin in Pflege gegeben hatte, damit er endlich eine ordentliche Schule besuchte, und wie er dann eines schönen Abends auf einem Frachtkahn nach Hamburg durchgebrannt und Schiffsjunge geworden war ... Wie ihn später Käpten Gundermann geheuert, der Schwiegervater des reichen Semper, der ihn schließlich auch zur Heirat zwang, als sich die Geschichte mit der Anna nicht länger verheimlichen ließ. Ja – natürlich – der Abend in Stralau war schuld gewesen, sonst wäre er – Lorenz Lorenzen – doch noch, wie er so gern gewollt, nach Südamerika, nach dem Äquator, gekommen. Aber solch ein Tanzvergnügen am Tage des „Fischzuges“ hatte schon so manchem lustigen Burschen Fesseln fürs ganze Leben angelegt, doch daß es nun gerade auch ihm so gehen mußte, ihm – dem „Juvivallera-Lorenz“, wie man ihn nannte, das war ihm eigentlich immer noch unfaßbar. Dem alten Vater Lorenzen war es wie ein großes Glück erschienen, daß der wilde Junge nun doch gebändigt war – eine ebenso tüchtige wie hübsche Frau bekam und – das war ihm die Hauptsache gewesen – Schiffer wurde, wie es alle Lorenzen gewesen waren, so weit man zurückdenken konnte. –
Von der Küche her kam der Geruch der feuchten Wäsche, durch das Schlafstubenfenster aber wehte von draußen herein der Dunst, der dem Spreewinkel so eigentümlich ist: ein Gemisch von Holz- und Torffeuerrauch. Und wer eine so empfindliche Nase wie die kleine Lore Lorenzen hatte, der spürte auch noch, daß es nach Teer, nach Fischbottichen und nach den vielen Katzen roch, die überall vor den dunklen Kellerluken hockten.
Auf der Straße spielten die Kinder die uralten Frühlingsspiele, mit Murmeln und Trieseln oder das geliebte „Himmel und Hölle“. Unter den Spreewinkelkindern hier waren auch ein paar fremde von den Zillen, die an der Fischerbrücke jetzt vor Anker lagen. Auch der große Junge mit den roten gestopften Wollstrümpfen war wieder da, Gustav Holzer hieß er, der Kahn seines Vaters war aus dem Schifferdorf Marienwerder.
Lore mochte den Gustav nicht, er starrte sie immer so an; und dann diese häßlichen, roten, dicken Strümpfe, die ihm so locker um die Beine saßen, so „Wasser zogen“. Als er heute auf die Gasse kam, war sie sofort ins Haus gegangen, mit ihm wollte sie nicht weiterspielen ... Nun saß sie mit einer dicken Schmalzstulle in der Hand an ihrem Bett, starrte die verblaßte Photographie ihres verschwundenen Vaters an und dachte angestrengt nach. Kaum, daß sie den Sonnenstrahl bemerkte, der in der Glasscheibe aufblitzte.
Ja – wenn sie fünf Groschen hätte ... Da könnte man zu Lili Sempers Geburtstagsfeier gehen ... Die fünf Groschen brauchte man dazu, denn man mußte doch ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Der gleichen Meinung war auch Mutter Lorenzen. Sie hatte, als sie vor acht Tagen die frischgewaschene und glänzendgebügelte Wäsche ablieferte und Frau Semper dabei die Lore eingeladen hatte, sofort an das Geburtstagsgeschenk gedacht. Freilich hatte sie zu Lore gesagt, eine kleine Stickerei oder Näherei werde es auch tun – das Mädel hatte ja so geschickte Finger – aber sie war sehr nachdrücklich belehrt worden, daß es eine Blume sein müsse.
Ja freilich – eine Blume! Vielleicht so eine schöne rote Tulpe, wie sie der Gärtner im Schaufenster hatte. Aber solch ein Tulpentopf kostete fünf Groschen – hatte der Gärtner gesagt – und das sei noch billig; denn in der vorigen Woche hätte er zehn Silbergroschen dafür bekommen. Aber weil es Frau Lorenzen sei und die Tulpenzeit beinahe vorüber, so wollte er nur fünf Groschen haben.
„Selbstkostenpreis, für den Topf allein und die schöne bunte Seidenpapiermanschette – die Tulpenzwiebel gar nicht gerechnet!“ Seitdem spielte die Möglichkeit des Tulpenankaufs eine große Rolle bei den beiden. Bei Lore bestand die Überlegung darin, daß sie sich „bestimmt“ vornahm, ihre Pfennigausgaben einzuschränken. Wenn sie die Wäsche fortschaffte, dann bekam sie von Frau Drogist Bertram jedesmal einen Sechser und von Fräulein Lohr, der Modistin, einen Groschen. Die Groschen waren bisher regelmäßig in die Sparbüchse gewandert, die Sechser oder Pfennige aber hatte Lore ebenso regelmäßig in Johannisbrot, Süßholz oder Naute angelegt. Nun war der Geburtstag aber nahe herangekommen. Beim Konditor sprach man schon davon, daß er von Frau Semper Auftrag erhalten habe, eine Schokoladentorte – man bedenke: eine „Schokoladentorte!“ zu liefern. Lore erfuhr es, als sie gestern die von Fräulein Lohr geschenkten Pfennige in Zuckererbsen verwandelte. Sie hatte zwar etwas gezögert, aber na – nun war es mit dem Sparen ja doch einmal zu spät!
In den letzten Tagen war sie mit einer wahren Gier in den Straßen umhergelaufen. Konnte es denn nicht leicht sein, daß sie etwas fand ...? So viele Leute verloren täglich Geld, nicht nur Pfennige und Groschen, sondern sogar Goldstücke, ganze Geldtaschen – konnte sie also nicht noch im letzten Augenblick zu Reichtum kommen? – Aber Lore fand nichts. Nun saß sie also wieder hier und überlegte und überlegte. Plötzlich stand sie auf, schlich in einen Winkel und begann laut zu heulen.
„Ja – heul man zu!“ rief die Mutter aus der Küche herüber und rieb die Wäsche, daß ihr der weiße Seifenschaum nur so um den Kopf flog. Als das Mädel gar nicht wieder aufhörte, ja offenbar absichtlich mehrmals mit der Stirn gegen die Bettkante stieß und sogar mit den Nägeln auf der Diele kratzte, da wischte Frau Lorenzen den Seifenschaum an der blauen Schürze ab und ging hinüber. Gleich darauf hörte man es klatschen ...
„Nu biste aber stille, verstehste!“ sagte die Mutter. Es hatte geholfen; das Heulen verstummte, nur ab und zu gab Lore noch einen hohen, langgezogenen Ton von sich, dem Jaulen eines Hundes nicht unähnlich. Frau Lorenzens Nerven waren ziemlich robust – man konnte sogar mit einem harten Griffel auf einer Schiefertafel quietschen, sie vertrug alles, aber dieser Ton da aus der Stube war ihr doch zuviel. Sie wischte sich deshalb nochmals die Hände an der blauen Schürze ab, ging wieder hinüber, nahm kurzerhand den großen Kamm, der seinen Platz unter der Kommodendecke hatte, zog die entsetzte Lore mit einem Ruck aus ihrem Winkel und begann, ihr das blonde Haar zu strählen. Dann wurde ebenso energisch der braune alte Kattunfetzen heruntergezogen und das weiße Sonntagskleidchen übergeworfen. Mit einem feuchten Lappen fuhr die Mutter dem Kinde über das verheulte Gesicht, schließlich ging sie zum Schrank, schloß die Sparbüchse auf, nahm fünf Groschen heraus und sagte: „Nu lauf man zu – aber wehe dir, wenn du mir Schande machst!“
Lore wußte eigentlich nicht, wie ihr geschah. Wie verstört ging sie in den Laden des Gärtners, zeigte wortlos auf die Tulpe und legte das Geld hin.
Der Mann strich erst mal die Groschen ein, dann holte er die Tulpe her, befestigte eine feine Manschette aus rosa Kreppapier an dem Topf und schlug zum Schluß noch einen Bogen Seidenpapier darum, den er oben mit einer Stecknadel verschloß.
Aber trotz all dieser Herrlichkeit war es der Lore, als sie nun das Geschenk wie eine zarte Seifenblase vor sich hertrug, doch nicht so ganz wohl, und als sie dann in Sempers feinem Haus auf der Treppe war, konnte sie es vor innerer Unruhe nicht mehr aushalten und mußte doch erst einmal die Tulpe ansehen, denn es war ihr vorgekommen, als ob sie nicht mehr so ganz frisch wäre ... Sie öffnete behutsam das Seidenpapier und sah etwas Entsetzliches: Eins der sechs roten Blütenblätter war abgefallen und hing an der rosa Papiermanschette ... Und die Tulpe zeigte an jener Stelle eine Lücke, so – als wenn jemand einen Zahn verloren hatte ... Was machen ... Vielleicht, wenn man das Blatt vorsichtig wieder dazwischen schiebt? Aber mit den zitternden Fingern konnte das nichts Richtiges werden. Man versuchte es zwar trotzdem, aber – es wurde nur noch schlimmer. Denn nun lösten sich rechts und links die nächsten beiden Blätter auch ab, und Lore hatte plötzlich nur noch eine halbe Tulpenblume ...
Wenn man jetzt die Stecknadel nahm und alle drei zusammen mit einem geschickten Stich an dem dicken, grünen Stiel befestigte ...? Das war sicherlich ein sehr guter Gedanke, nur durfte man eben nicht wie das Mädel so aufgeregt sein. Denn als nun diese drei Blätter glücklich festsaßen, gingen, wie auf Kommando, die anderen drei ab... Das Ganze sah wieder nur aus wie eine halbe Tulpe!
Lore suchte an sich herum. – Ja, wenn sie in ihrem alten, braunen Kattunkleid gewesen wäre, hätte sie wohl noch eine Stecknadel gefunden. Das aber, was jetzt notgedrungen gemacht werden mußte: sechs Blätter mit einer einzigen Stecknadel zu befestigen, das wäre eines Hexenmeisters würdig gewesen. Ein Wunder nur, daß der Stiel nicht ganz und gar entzweiging, zerstochen sah er nun nachgerade genug aus – und die roten Blütenblätter wurden schon etwas schwärzlich ...
Da überkam Lore dasselbe merkwürdige Gefühl wie damals, als sie den kleinen Sperling gefunden hatte, der durchaus nicht mehr hatte fliegen wollen, so oft und so hoch sie ihn auch in die Luft geworfen hatte, weil er – tot war. Den hatte sie schließlich auf einen Zweig gesetzt, daß es aussah, als wenn er etwas pickte ... Sie bog die rosa Papiermanschette herunter, bis man die Erde sah, und legte die sechs roten Blumenblätter wie die Strahlen eines Sterns rund um den grünen Stengel. Eigentlich sah es nun beinahe noch schöner aus, als wenn die Blätter oben am Stengel saßen, so fand es wenigstens Lore. Dann stellte sie den Topf vor Herrn Sempers Tür, zog an der Messingklingel und wollte die Treppe hinunter – und davonlaufen ... Aber das Mädel hatte in seiner Aufregung gar nicht bemerkt, daß hinter dem Fenster des Wintergartens jemand gewesen war, der alle Bemühungen mit den Tulpenblättern beobachtet hatte, und in demselben Augenblick, da Lore klingelte, wurde die Tür aufgemacht, und Herr Semper selbst hielt sie fest, ehe sie entwischen konnte. „Nein – was ist das für eine schöne Tulpe!“ sagte er. „So eine habe ich noch nie gesehen – da wird sich Lili aber freuen!“ Ehe Lore etwas erwidern konnte, hatte Herr Semper sie in sein Arbeitszimmer geführt und redete weiter: „Warte, ich bringe dich gleich zu den anderen.“ Er ließ sie allein und nahm die Tulpe mit. Doch es dauerte keinen Augenblick, daß er wieder da war. Er trug den Tulpentopf im Arm, aber das Seidenpapier hatte er wieder hoch darum geschlagen: „Denn es soll eine Überraschung geben“, erklärte er.
Als Lore gleich darauf unter all den anderen geputzten kleinen Mädchen stand und Herr Semper das Seidenpapier auseinanderschlug, saßen alle sechs Blütenblätter wieder oben am Stengel und sahen frisch und rot aus ... Lili war ganz entzückt – gerade über diese Tulpe, die sie für die schönste erklärte von allen, die sie erhalten, weil es genau solch eine war, wie sie ihr Papa in seinem Wintergarten hatte ...
Seitdem glaubte Lore an höhere Mächte, die sie sich dienstbar machen könnte.
Das wurde ihr erst recht zur Gewißheit, als sie auf dem Heimwege, statt des Blumentopfes nun ein großes Stück Schokoladentorte für die Mutter in der Hand, erstaunlicherweise in ihrer Kleidertasche etwas klimpern hörte und beim Hineinfassen einen ganzen Taler und zwei blanke Groschen fand ...
Aufgeregt erklärte sie ihr Erlebnis der Mutter, die so fassungslos über den unerwarteten Reichtum war, daß sie gar nicht näher fragte, wer denn alles an Gästen dagewesen wäre.
Lore drängte sich mit solcher Berichterstattung auch nicht weiter auf – sie wußte ja, daß die Mutter über manches merkwürdig andere – verkehrte? – Ansichten hatte als sie selbst, die „Lore Lorenzen, geboren auf einem Spreekahn an der Fischerbrücke“, wie auf dem großen, steifen Papier stand, das die Mutter in der Bibel aufbewahrte.
„Gottes Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte“, so hatte sie bei Lehrer Klaus in der Religionsstunde gelernt – nun, sie war wohl eine Ungerechte, so kam es Lore auch jetzt wieder in den Sinn. Denn, warum durfte sie nicht auch in die „Schule für höhere Töchter“ gehen, wie die feinen, kleinen Mädchen, die als Geburtstagsgäste bei Lili Semper gewesen waren ...?
Es war kein Trost für sie, daß Agnes Bertram, die Tochter des Drogisten, auch zu Lehrer Klaus in die Gemeindeschule ging. Das sollte nur „so was heißen“, so hatte selbst die Mutter gemeint, denn Herr Bertram wollte damit beweisen, daß er, wie er stets betonte, „ein strammer Mittelständler“ sei. Auch Mutter Lorenzen wußte nicht genau, was dies bedeutete, die Lore aber erklärte es sich damit, daß Herrn Bertram die Weste immer so furchtbar stramm auf dem runden Bäuchlein saß ...
2
Hinter der Glasscheibe des kleinen Küchenschrankes stand noch immer das Stück Schokoladentorte, das Lore gestern mit heimgebracht hatte. Nur ein schmaler Streifen war bisher „zum Kosten“ abgeschnitten, der Rest aber sorgfältig weggeschlossen worden, denn Frau Lorenzen hatte es „in den Gliedern“, daß „Pelters“ heute kommen würden.
Und sie kamen auch wirklich. In einem der Zillenbeiboote ruderten sie herüber und legten unten an der Ufermauer an, unweit von Lorenzens Haus.
Mit Händeschütteln und Kopfnicken, ohne viele Worte, begrüßte man sich, denn die Bekanntschaft war alt. Die Pelters waren schon damals auf die Zille gekommen, als Lores Vater noch gelebt hatte. Sie wußten stets alle Neuigkeiten, die das Schiffervolk angingen, übernahmen Bestellungen von Abfahrenden und Kommenden – aber das war nicht die Hauptsache. Nein, Frau Pelter konnte mehr. Sie konnte Gliederreißen und Warzen besprechen, wußte unbedingt wirksame Mittel gegen Zahnschmerzen und Bandwürmer, – und das war wohl das Merkwürdigste an ihr – sie konnte auch in die Zukunft sehen. Dazu brauchte sie keine Karten, sondern nichts weiter als eine große Tasse starken, schwarzen Kaffees. Und wie schnell wußte sie „Bescheid“. Ein Blick in den „Satz“ – das genügte, und der Fragende kannte seine Zukunft.
Auch Lorenzens Verschwinden hatte sie prophezeit, ganz genau. „Sie werden“, so hatte sie kurz vorher zu der jungen Frau gesagt, „bei nächstem Vollmond viel Geld zählen!“ Und so war es eingetroffen. Frau Lorenzen hatte, als Vollmond war, das Geld für die nach dem Verschwinden des Mannes verkaufte Zille gezählt und auf die Sparkasse getragen. Das war jetzt noch immer der Notpfennig, von dem sie mit ihrem Mädel lebte, wenn der Verdienst knapp war.
Frau Pelter saß am Herd, goß sich den Kaffee aus der Ober- in die Untertasse und schlürfte behaglich. Die Schokoladentorte war verzehrt, und Herr Pelter hatte sich den Tonpfeifenstummel zwischen die Eckzähne geklemmt und paffte.
Ja – jeder hatte seine Sorgen, darüber war man einig geworden, nachdem man sich gegenseitig erzählt, wie es in der Zwischenzeit dem und jenem ergangen war.
Nach einer Weile nahm Frau Pelter die braune Kaffeekanne von der Ofenplatte und goß den schwarzen Satz in Frau Lorenzens Tasse. Als sie da so hineinsah, war sie ganz betroffen vor Überraschung – kopfschüttelnd betrachtete sie die Witwe. „Aber Lorenzen“ –, sagte sie beinahe vorwurfsvoll, „Sie werden doch nich!“ Die Witwe bekam rote Wangen und einen trotzigen Zug um die Mundwinkel. Doch gleich darauf verdüsterten sich Frau Pelters Mienen, und sie starrte mit einem Gesicht in die Tasse, als ob es um ihre eigene Zukunft ginge. „Zwee sind da – zwee kommen“, murmelte sie endlich. „Aber der zweete kommt viel später als der erste ...!“ Wie erschlagen von diesem Orakel saß die Witwe da. „Zweie?“ stammelte sie. „Nu – wollen Se denn noch mal wieder ...?“ erkundigte sich nun Herr Pelter sehr interessiert und stocherte mit einer Haarnadel seiner Frau in seinem Pfeifenstummel. „Man is ja noch nich alt“, sagte Frau Lorenzen leise und mehr zu sich selbst. „Nu – denn man immer zu!“ ermutigte Herr Pelter, „aber dann nehmen Sie nur den Richtigen!“
Seine Frau nahm inzwischen das wollene rote Tuch, das sie bei ihrem Kommen abgelegt hatte.
„Adschüs“, sagte sie und nochmals: „Adschüs, Lorenzen. Ich bin ja selbst neugierig, welcher es nu werden wird!“ „Ich nicht weniger“, pflichtete Pelter bei. „Adschüs! Halten Se nur die Ohren steif ...!“
Damit waren sie bereits auf den Flur hinausgetreten.
... Es war Abend geworden, und der Schein der Gaslaterne am Hause tanzte im Wasser. Irgendwo auf einem der vor Anker liegenden Kähne wurde Harmonika gespielt; Mutter Lorenzen summte leise die Melodie des alten Volksliedes mit. Wie oft hatte sie es und manches, manches andere gesungen – damals, als sie selbst noch auf solch einem Kahn gewesen.
Sie hörte im Geiste wieder ihre frische Stimme, hörte, wie sie über das Wasser klang, vielleicht bis hinüber zum Kiefernwald, dessen Stämme im Abendsonnenlicht immer so ergreifend schön rot aufglühten. Ja – und dann war jener schreckliche Unglückssonntag gekommen. Die Zille lag am Ufer von Moabit vor Anker, und sie – die junge Frau – saß auf Deck und strickte. In einem Korb zu ihren Füßen schlief das Mädelchen, der weiße Spitz kläffte vom Dach der Kombüse nach dem Ufer, woher der Wind Tanzmusik herübertrug ... Da war Lorenzen heraufgekommen – in seinem Sonntagsstaat, die silberne Uhrkette auf der blauen Weste. Er hatte wieder einmal den Blick gehabt, vor dem sie sich heimlich immer fürchtete, denn dann war nichts mit ihm anzufangen, und er schien von allen guten Geistern verlassen zu sein.
Unbeweglich stand der breitschultrige Mann da, sah die Frau an, dann das Kind – den Hund, sagte aber nichts. Und Anna hütete sich, den Mund aufzutun, denn sie wußte ja, daß sie dann verlorenes Spiel hatte. Er suchte doch nur Streit, um vor sich selber einen Grund zu haben, an Land gehen zu können – nach den Zelten zum Tanzvergnügen. Der dünne, blaue Rauch aus dem Schornstein der Kombüse war plötzlich dick und schwarz geworden, der Spitz mit erschrecktem Aufbellen in den leeren Laderaum hinuntergesprungen, sie selbst aber war eiligst das Treppchen hinuntergestiegen. Denn das Abendbrot stand ja auf dem Feuer. Daß sie das ganz vergessen hatte ...
Und wirklich: alles bereits angebrannt! – – Von Deck her hörte sie Lore schreien – hm ... Aber der Mann war ja bei dem Kinde. Jetzt kam es vor allem darauf an, dem Schaden hier unten abzuhelfen. Gut nur, daß da noch genügend geschälte Kartoffeln in der Wasserschüssel lagen. Man brauchte also nicht ganz von vorn mit der Kocherei anzufangen. Als Anna nach einer kleinen Weile schuldbewußt wieder an Deck kam, war Lore still, sie schlief wieder. Doch – ihr Mann – wo war denn ihr Mann ...?
Das Laufbrett zum Uferrand lag noch eingezogen an Deck, die Entfernung zu der steilen Böschung war doch zu groß, um vom Kahn aufs Ufer springen zu können. Aber auch die nächste Zille lag so weit entfernt, daß es ganz unmöglich war, daß Lorenzen etwa drüben sein könnte.
Der Spitz stand jetzt am Kahnrand und blickte ins Wasser. Winselte er etwa kläglich –? Aber dort war doch auch nichts zu sehen, obwohl sich das Tier anscheinend nicht beruhigen konnte. Herrgott – hatten denn die anderen Schiffer nichts bemerkt? Sie rief hinüber und fragte nach ihrem Mann. Aber keiner hatte etwas gesehen oder überhaupt etwas Auffälliges beobachtet.
Mit dem Rettungskahn war stundenlang das Wasser abgesucht worden – alles vergeblich! So war damals Lorenzen verschwunden, spurlos. Denn selbst seine Leiche war nicht zum Vorschein gekommen, wie sonst andere Wasserleichen ...
Anna Lorenzen stand etwas schwerfällig auf, ging zur Kommode und nahm aus der Bibel hinten den Zeitungsausschnitt. Beim Schein der Laterne draußen las sie – ach, zum wievielten Mal? –: „Da der von hier gebürtige, frühere Matrose, zuletzt Schiffseigner Johann Friedrich Lorenz Lorenzen, ehelicher Sohn des weiland hiesigen Schiffseigners Carl Theodor Lorenzen und der Auguste Maria Rentner, seit fünf Jahren abwesend von hier ist, ohne daß von ihm oder seinem Aufenthalt irgendeine Nachricht eingegangen wäre, so wird auf Antrag seiner Ehefrau Friederike Anna Lorenzen, geb. Stiege, dieser abwesende Johann Friedrich Lorenz Lorenzen hierdurch geladen, sich im Termin, den 18. Mai n. J., vormittags 11 Uhr, vor dem Königl. Preußischen Stadtgericht allhier entweder in Person oder durch genügend Bevollmächtigte zu melden oder den Ort seines Aufenthaltes anzuzeigen, widrigenfalls der vorstehend benannte Johann Friedrich Lorenz Lorenzen für tot erklärt wird.
Berlin, im November
Königl. Preußisches Stadtgericht“
Nein, Lorenz hatte sich nicht gemeldet, obwohl diese Vorladung in allen Hafenplätzen angeschlagen worden war, und an einem schönen Maitag hatte ihn das Gericht „für tot“ erklärt und seitdem war sie – Friederike Anna Lorenzen geb. Stiege, eine Witwe.
3
Die kleinen Häuser des Spreewinkels mit ihren schrägen Ziegeldächern und ungewöhnlich tiefen Kellern waren wie alte, zähe Invaliden, die dem Tod schmunzelnd ein Schnippchen schlagen. Sie standen jetzt im Frühlingssonnenschein wie alte Spittelleute, die in Gartenanlagen herumsitzen und die morschen Knochen von den Strahlen wärmen lassen. Die Bewohner lebten bei kümmerlicher Beschäftigung von heute zu morgen, zufrieden schon, daß es überhaupt weiterging.
Die Fischer allerdings, die waren eine Gilde für sich, die ihr gutes Einkommen und lohnende Arbeit hatten. Ihr immer etwas lautes Treiben erfüllte die Uferstraße bis zum Mühlendamm hinunter, dort, wo die Kleiderhändler vor ihren mit alten Uniformen, Pelzen und Anzügen vollgestopften Buden saßen oder standen.
Aber die seßhaft gewordenen Schiffer und ihre Angehörigen, soweit sie nicht in ihre märkischen Dörfer zurückgekehrt waren, schlugen sich eben doch nur mühsam durch mit allerlei Gelegenheitsarbeit. Katzen saßen überall und beobachteten blinzelnd die im Pferdemist hackenden Sperlinge. Auf dem Wasser zogen Zillen gemächlich dahin; aus dem Schornstein auf dem Bäckerhaus stiegen Rauchringel empor und erfüllten, zuweilen vom Winde niedergedrückt, die ganze Gegend mit ihrem Geruch. Auf den Blumenbrettern vor vielen Fenstern oder hinter den Scheiben Myrten, Kakteen oder Oleanderableger – auch in Bierflaschen ... so zeigte sich das Bild des „Spreewinkels“, in dem sich manchmal die Bewohner anderer Stadtviertel einfanden und dann Menschen und Häuser hier anstarrten, als wären sie in eine absonderliche Welt geraten.
Wenn sie dann wohl die Lore erblickten, die in ihrem blauen Kleidchen auf den steinernen Treppenstufen wie die anderen Kinder hockte, so stießen diese und jene sich an – das hier war etwas Besonderes –. Dann aber zog die Kleine meist ihre Holzpantoffeln unter das Röckchen, denn sie fühlte sich unbehaglich. Heute saß sie einsam da und blickte den großen, weißen Wolken nach, die so schnell dahinsegelten. Sie war heute aufgeregt, denn sie wußte, daß die Tochter des Drogisten – Goldkäferschuhe bekommen hatte! – Sie grübelte nun: wie bekomme ich ebenfalls welche, und wenn es irgendwie anging, noch ein bißchen schönere ...? Freilich – Agnes Vater war wohlhabend, er hatte wunderbar große Gläser voll Zuckerkand und Pfefferminzplätzchen. Aber meine Mutter, so stellte Lore weiter fest, war zwar jetzt bloß Waschfrau und früher Dienstmädchen, aber sie hatte eine ganz feine, rote Korallenbrosche und eine Tigermuschel – wenn man die ans Ohr hielt, dann hörte man das Weltmeer brausen ... Wenn das auch alles sehr schön war, so half es Lore doch jetzt nicht darüber hinweg, daß Agnes Goldkäferschuhe besaß und sie nicht ... Das eine war sicher, hier mußte etwas geschehen, und zwar bald, sonst erstickte man ja an dem Knoten, den sie jedesmal im Halse spürte, sobald sie an die Drogistentochter dachte. Das war doch eine ganz Schlaue! Sie hatte sich an Lili Semper herangemacht und war seit dem Geburtstag alle Tage bei ihr. Wenn man nun mal starb – ob dann die Mutter einem vielleicht Goldkäferschuhe in den Sarg mitgeben würde ...? Lore wäre unter diesen Umständen bereit gewesen, sofort zu sterben. Aber jetzt war es zunächst einmal nötig, die alten, schweren Holzpantinen loszuwerden. Daß man einen davon verlieren könnte, das ginge schon – aber beide ...? Und lügen durfte man nicht, das war Sünde. Aber wenn man nun sagte, Lehrer Klaus habe angeordnet, daß alle Kinder von morgen ab mit Goldkäferschuhen in die Schule kommen müßten ...? Dann würde freilich die Mutter wohl zu Frau Niclas in den Gemüsekeller gehen und sich erkundigen, wo denn sie für ihre Marie solche Goldkäferschuhe kaufen werde? Nein – das lieber nicht, denn es war ja nicht sicher, was Marie von den Goldkäferschuhen gehört hatte.
Nein, es mußte schon etwas sein, das jedermann sofort glaubte? Was tun ...?
Mal probieren: „Verflucht und verhext ...!“ Manche sagen doch, das hilft immer.
Und siehe da – es half sofort.
Um die Ecke kam Briefträger Pankraz mit einem großen, schwarzgeränderten Brief gerade auf Lore zu. Sie sah ihn mißtrauisch an und schnüffelte unwillkürlich. Wenn der hagere Mann sonst meist nur nach Leder und Schnupftabak roch, heute duftete er ganz bestimmt tüchtig nach Pech und Schwefel, und wer weiß, was das außerdem noch für ein besonderer Geruch war, den er da um sich verbreitete. In dem schwarzen Brief, den er Lore mit der Weisung gab, ihn sofort der Mutter zu geben, steckten ja nun ganz sicherlich keine Goldkäferschuhe, das konnte man fühlen. Die Mutter war jetzt nicht zu Hause: wenn man mal ein bißchen nachsah, was in dem Briefe drin stand ...? Nein, da war nichts zu machen, denn hinten auf dem Umschlag klebte ein Siegel, schade! Frau Lorenzen wusch heute bei Sempers, zur Aushilfe, denn Frau Palmer, die Waschfrau, konnte es diesmal allein nicht schaffen. Wenn Lore nun hinging und der Mutter den Brief brächte? Daß sie nicht gleich auf diesen Gedanken gekommen war!
Den Brief in der linken, die Pantoffeln in der rechten Hand, lief sie in Strümpfen nach der Breiten Straße. In Strümpfen! – Das war nun ungefähr das Schlimmste, was sie tun konnte.
Die Mutter dachte wahrscheinlich, es brenne zu Hause – denn das war stets ihr erster Gedanke – als Lore in die Waschküche stürmte. Sie mußte sich erst einmal setzen und starrte den Brief fassungslos an, wollte ihn gar nicht öffnen. Denn aus solchen versiegelten Briefen kam ja doch immer Unglück.
Aber schließlich ging sie damit zu Frau Semper, um sich Rat zu erbitten, und als sie zurück in die Waschküche kam, hatte sie rotgeweinte Augen. Sie hörte auch gleich mit der Wäsche auf und sagte Frau Palmer, daß sie ein paar Tage verreisen müsse, denn ihre Schwester Amalie in Brandenburg sei gestorben. Gleichzeitig zeigte sie ein paar Geldscheine, die in dem Briefe gesteckt hatten, damit sie gleich zum Begräbnis kommen könne.
Lore hörte zu und sah mit großen Augen von einer zur anderen. Es tat ihr leid, daß Tante Amalie der Goldkäferschuhe wegen hatte sterben müssen ... Denn es war ja ganz klar: das „Verflucht und verhext!“ vorhin hatte der Teufel gehört, und nun hatte er gleich Tante Amalie sterben lassen. Warum wohl ...?
Und der so furchtbar geizige Onkel Christian hatte der Mutter Geld geschickt ...?
Ob die Mutter es wohl merkte, wofür das Geld bestimmt war? Natürlich für die Goldkäferschuhe, denn Reisegeld hatten sie doch; für so etwas war immer ein Notgroschen im Kommodenkasten. Frau Lorenzen dachte nur an ihre Schwester Amalie – wie gut die immer gewesen war. Plötzlich blieb sie mitten auf der Straße stehen, zählte die Geldscheine und ging in tiefem Sinnen weiter. Nach einer Weile sagte sie: „Lore – du fährst mit, aber da muß ich dir erst noch ein Paar neue Schuhe kaufen!“
Na – endlich! Lore war schon nahe daran gewesen, noch mal leise für sich „verflucht und verhext“ zu sagen. – Schuster Kranold freute sich, daß Frau Lorenzen, oder „Madam Lorenzen“ – wie er sagte, denn er war ein galanter Mann, der die Witwe immer für eine stattliche Frau gehalten hatte –, daß also Madam zu ihm kam. Als er aber hörte, daß es sich nur um Lore handele, bedauerte er, daß nicht auch Madam sich ein Paar neue Schuhe kaufen wolle, denn er habe schon seit langem etwas ganz Feines für sie zurückgestellt. Lore wurde ungeduldig, daß er so viel redete und nicht gleich die Goldkäferschuhe brachte, die dort in dem Glasschrank standen. Wie lange dauerte es doch, bis er merkte, worauf es eigentlich ankam. Wohl ein gutes Dutzend Schuhe standen nun schon um Lore herum, und es war für das Mädel wahrlich keine Kleinigkeit gewesen, bei jedem Paar zu beweisen, daß es nicht paßte. Hinkend war sie jedesmal um den Ladentisch herumgegangen und hatte dann immer gemeint, daß sie in diesen Schuhen auch nicht einen Schritt mehr weiterkäme. Schuster Kranold hatte schon einen roten Kopf bekommen und schwitzte. Schließlich sagte er, nun wolle er doch einmal die Probe machen und sehen, ob es nur an dem Leder oder an der Fasson läge. Und damit ging er an den Glasschrank und holte endlich die Goldkäferschuhe heraus. Merkwürdig, wie gut die paßten. Freilich, hinten drückten sie ein klein wenig, und von dem linken Fuß hätte eigentlich die große Zehe abgeschnitten werden müssen, weil sie nicht recht Platz finden konnte, aber das verschwieg Lore. Sie sagte, die Schuhe wären so weich wie Filzpantoffeln, und wirklich – die Mutter kaufte sie. Sie hatte auch nicht länger Zeit, und Schuster Kranold, der ein gefälliger Mann war, ließ sie ihr obendrein so billig, als wenn es nur ein Paar ganz gewöhnliche Schuhe gewesen wären.
So hätte alles also in schönster Ordnung sein können. Kaum aber war Lore aus dem Laden getreten, da mußte sie vor Schmerzen hinken, das schlimmste war, sie durfte es nicht einmal verraten. Ohne Strumpf, den Schuh nur auf dem bloßen Fuß, war es, wie sie dann zu Hause heimlich probierte, mit den Schmerzen nicht ganz so schlimm, da hätte man nur die kleine Zehe abzuhacken brauchen – aber immerhin, auch das war gerade nicht sehr angenehm. Sie mußte immer wieder denken, daß sie eben kein feines Mädchen sei, weil ihr die Goldkäferschuhe nicht paßten. Sie hatte nun mal nicht so kleine, feine Füße wie die Agnes Bertram – daran lag es wohl! Die Zehen mußten wohl oder übel dranbleiben, das sah Lore nach und nach ja ein ... Sonst konnte man später auch nicht tanzen – und das wollte Lore auf jeden Fall. Aber wenn man nun ein Stück von der Ferse absäbelte? Wenn man es mit einem Ruck machte, dann war es sicherlich nicht so schmerzhaft. Am besten mit dem kleinen Beil, das sich damals Steuermann Jens ausgeliehen hatte, als er den jungen Hunden die Schwänze abhacken wollte. Und ehe es ihr etwa wieder leid werden konnte, nahm das Mädel wirklich das Beil vom Nagel, setzte das Bein auf die Fußbank, machte die Augen zu, damit sie es nicht sähe, und hackte zu. – – – Na – das war eine schöne Geschichte! Frau Lorenzen wußte ja, daß ein Unglück niemals allein kommt, aber gleich zwei so große – womit hatte sie das verdient! Weder Spinnweben noch Essigumschläge hatten genutzt. Der Doktor hatte geholt werden müssen, um das Blut zu stillen, und dann hatte er sogar die Wunde zugenäht ... Und nun lag Lore im Bett und war nicht mit zu Tante Amalies Begräbnis gefahren, und die Goldkäferschuhe konnte sie auch nicht anziehen.
Es gefiel ihr gar nicht, von der Marie Niclas aus dem Kartoffelkeller gepflegt zu werden, denn die roch immer nach Salzheringen und hatte stets eine verstopfte Nase. Ach – Lore hatte gehofft, ihr Unglück würde sich herumsprechen, und die feinen Mädchen von Lilis Geburtstagsfest würden sie nun besuchen und ihr Blumen und Schokolade bringen ... Nein, niemand ließ sich sehen, nur die Waschfrau Palmer erschien einmal mit zwei Apfelsinen und einem Kristallfläschchen „Maiglöckchenduft“ – die Lili schickte es ihr und wünschte „baldige Genesung“.
Na ja – so waren eben die „feinen Mädchen“! Wenn man bei ihnen eingeladen war, taten sie so, als wäre man ebenso fein wie sie selbst, taten es aus Artigkeit und Falschheit. Doch, wenn sie es nicht gerade nötig hatten, dann ließen sie ihre Feinheit nur riechen ... An Kristallfläschchen mit Maiglöckchenduft ... Es war ihnen ganz gleichgültig, ob man Goldkäferschuhe hatte! Man mußte eben noch etwas ganz Besonderes haben, um sie zu übertrumpfen und zu wirklichen Freundinnen zu bekommen.
Lore dachte angestrengt nach, was das Besondere wohl sein könnte, um das selbst eine Lili Semper sie beneiden würde. Ob sie es noch einmal mit dem Teufel versuchte? Und auf einmal, als hätte es ihr der Böse eingegeben – wußte sie, was es sein mußte. Eine Uhr, eine kleine goldene Uhr mußte sie haben. Wie die ganz feinen Damen sie am schwarzen Samtband um den Hals trugen. Eine Uhr, und wenn sie auch nicht tickte, die man aber dafür aufmachen konnte, um ein Bildchen hineinzustecken.
„Verflucht und verhext!“ Hatte sie das bloß gedacht oder laut gesagt? So oder so –. Ja – der Teufel hatte es gehört ... Da war doch jemand vor der Tür! Aber ach, nur Marie Niclas kam herein und brachte das Mittagessen – weiße Bohnen mit Speck. Aber – der Teufel ...?
4
Zwei Tage vergingen, da erlaubte der Doktor, daß Lore wieder aufstehen durfte. Ja, er verlangte sogar, daß sie draußen auf der Straße Gehversuche mache. „Aber vorsichtig, liebes Kind, ganz vorsichtig, sonst platzt die Wunde wieder auf!“
Lore hatte sich bis an die Fischerbrücke geschleppt, hockte nun auf dem Ufergelände und sah dem Treiben dort zu. Von irgendwoher hallte das helle Pinkpank aus einer offenen Schmiede – Karrenräder quietschten, Holzpantoffeln klapperten. In den Läden und Lädchen dort drüben in den schmalen Häuschen gab es leider nichts für Lore. Nur Bedarf für Schiffersleute: Ölmäntel, Mützen, „echten Hewimsa-Waterküken“, Kentucky-Kautabak, Tonpfeifen, ja. – Aber dann war auch noch ein Laden dort, in dem die Schiffer für ihre Bräute bunte Kopftücher, weiße Schürzen, rote Korallenketten kaufen konnten ...
Dort standen ein paar Schiffer, die kurze Pfeife im Mundwinkel, und besahen sich lange die Herrlichkeiten. Dann stampften sie mit ihren schweren Schuhen weiter und suchten das Makler- und Vermittlungsbüro auf, in dessen Fenster ein kleines Schiffsmodell ausgestellt war.
Ein paar alte, verwitterte Kerle lehnten sich müßig ans Brückengeländer, spieen im weiten Bogen den überschüssigen Priemsaft ab und zu in das glitzernde Wasser und schauten dann wieder in gelassener Ruhe der schweren Kärrnerarbeit im Hafen zu. Von der Nikolaikirche hallte noch mal der Schlag der Uhr herüber. „Ja, was war denn nun eigentlich mit der Uhr? Verhext und verflucht!“ Als die Mutter vom Begräbnis ihrer Schwester heimkehrte, brachte sie, außer den Kleidern der Verstorbenen, auch eine kleine, goldene Uhr mit, die sie ebenfalls geerbt hatte. Es war eine richtige Medaillonuhr, wenigstens hatte die Mutter sie so genannt, als sie das kostbare Ding den Frauen im Kartoffelkeller zeigte. Inwendig war sie mit blauer Seide gefüttert und hatte Fächer, gerade wie ein Portemonnaie.
Und diese kostbare Uhr gehöre ihr nun, behauptete Lore in der Schule, die Mutter habe sie ihr geschenkt – jawoll! Keines der Mädel wollte es ihr glauben – auch nicht Agnes Bertram, ja selbst nicht mal die dumme Marie Niclas. So war Lore schließlich nichts übriggeblieben, als zu prahlen: „Also morgen bringe ich meine Uhr mit – bäh!“ Aber – wie sollte sie dieses Kunststück nun fertigbekommen ...? Die Mutter um die Uhr bitten ...? Ach – wie die unter Tränen versichert hatte, war ihr dieses Andenken ja lieber als sonst irgend etwas, und darum hatte sie es auch nicht Lore gegeben. Die Uhr lag in dem Kästchen, in dem die Mutter auch ihre rote Kette und die Tigermuschel als Andenken an den verschwundenen Vater aufbewahrte. Und dieses Kästchen wieder war in der Kommode tief unter wollenen Strümpfen versteckt. Bisher hatte die Mutter jeden Abend vor dem Schlafengehen nochmals nachgesehen, ob das Kästchen auch nicht gestohlen worden war. Als Lore am nächsten Morgen das Quietschen der Kaffeemühle in der Küche hörte, kletterte sie aus dem Bett und schlich nach der Kommode, und als Frau Lorenzen eine halbe Stunde später ihr Mädel wecken wollte, wunderte sie sich, wie fest es heute noch schlief. Sie ahnte nicht, daß ihre kostbare Uhr, in ein wenig ansehnliches Schnupftuch geknüpft, in Lores Kleidertasche steckte ...
Keines der Mädchen hätte es für möglich gehalten, daß Lore wirklich die Uhr mitbringen würde. Zuerst, als sie so langsam und ganz feierlich an der um den Hals geschlungenen Seidenschnur zogen, hatten sie geglaubt, daß sicherlich nur ein Knopf zum Vorschein kommen werde und daß Lore nachher behaupten würde, irgendeine böse Hexe habe ihr die Uhr verwandelt. Aber nun hing da wirklich eine Uhr an der Schnur. Eine Uhr, die sich richtig öffnen ließ und inwendig himmelblauseidene Fächer besaß. Alle hatten diese Uhr wie ein Wunder angestaunt – am meisten aber Bertrams Agnes. Fein! – von ihr würde es ja jetzt Lili Semper erfahren. Na, und dann: vielleicht kam Lili schon morgen aus dem feinen Hause in der Breiten Straße nach dem Häuschen in der Friedrichsgracht und wollte Lores Freundin sein ... Plötzlich stoben sie alle auseinander, denn die Tür hatte geklappt – Lehrer Klaus trat in die Klasse – oh, wenn er nur nicht heute Diktat schreiben läßt ...! Glücklicherweise kam es anders. Agnes Bertram, die er immer vorzog, weil er in der Drogerie bei dem „strammen Liberalen“ alles billiger erhielt, sollte aus der „Biblischen Geschichte“ vorlesen. Die anderen Mädchen aber mußten kerzengerade dasitzen, die Hände gefaltet, und Herrn Klaus unverwandt ansehen. Wer das nicht tat, mußte zu Hause als Strafarbeit hundertmal aufschreiben: „Ich bin ungehorsam gewesen.“
Nachdem sich die Klasse von ihrem Schreck über diese Anordnung erholt hatte, saßen alle wie versteinert da und hörten bald darauf, von der Agnes fein säuberlich vorgelesen, daß Lots Frau nur, weil sie sich einmal umgedreht hatte, zur Salzsäule erstarrt war. Das war übrigens eine Geschichte, die Lore schon kannte. Sie fand sie gar nicht so wunderbar, denn nach ihrer Ansicht waren doch alle Menschen inwendig salzig – man merkte es doch an den Tränen, die ganz salzig schmeckten. Ja, wenn die Frau eine Pfeffersäule geworden wäre ...!
Das mußte sie gleich mal ihrer Nachbarin Marie sagen, und sie tat das auch trotz des strengen Verbots, nicht zu sprechen. Marie aber saß selbst wie eine Salzsäule da, regungslos und rührte sich auch nicht, als ihr Lore mit den Holzpantinen – die Goldkäferschuhe zog sie nur sonntags an – auf die Stiefelspitzen trat. Daß Marie solche Angst vor Lehrer Klaus hatte ...! Fürchtete sie sich denn wirklich so sehr ...? Dies festzustellen, schien der Lore jetzt viel wichtiger als zu erfahren, was da schließlich aus den Leuten von Sodom und Gomorrha wurde. Flugs tauchte sie hinter dem breiten Rücken Berta Dieters ihren Bleistift ins Tintenfaß und wischte ihn dann an Maries gefalteten Händen ab.
Marie tat, als merke sie gar nichts und starrte beharrlich den Lehrer an. Nun aber zog Lore plötzlich die kostbare Uhr vorn aus dem Halsbündchen und ließ sie an der Schnur dicht vor Maries Nase hin und her baumeln – wie ein Perpendikel. Aber da geschah etwas Furchtbares ...! Wie alles möglich gewesen war, konnte Lore auch später nicht recht begreifen. Wie ein Habicht fuhr plötzlich eine große, rote Hand nach der Uhr, umkrallte sie und riß sie weg! Und im nächsten Augenblick stand Lehrer Klaus selbst in seiner ganzen Größe vor der entsetzten Lore ... Genau so mußte es Lots Frau zumute gewesen sein, als sie damals zur Salzsäule erstarrte! Aber Lots Weib hatte damit genug und konnte nun bleiben, wo es war. Lore aber, der das Entsetzen in die Beine gefahren war, wurde von ihrem Platz weggezerrt und vorn nach dem Katheder geführt. Vierzig Augen sahen zu, was Lehrer Klaus jetzt weiter tat. Er sah sich die Uhr an, machte sie auf und zu und – einige der kleinen Mädchen hätten beinahe laut aufgeschrien! – legte sie in sein Pult ... Fast gleichzeitig verabreichte er Lore einen „Katzenkopf“. Das hatte gar nicht so schlimm ausgesehen, aber Lores Kopf hing wie bei einer geknickten Butterblume plötzlich nach der rechten Seite. Nun faßte Herr Klaus Lore wieder ganz sanft an. Und da schrie das Mädel, das bisher keinen Laut von sich gegeben hatte, plötzlich so schrill auf, daß man es sicherlich bis unten im Zimmer des Rektors gehört haben mußte – jeden Augenblick konnte der also heraufkommen.
Lehrer Klaus wußte genau, daß Lore Lorenzen sich verstellte. Aber immerhin; sie war imstande und hielt den Kopf schief, bis die Schule aus war, ging wohl gar so nach Hause. Da würde man viele gute Worte geben müssen, damit die Witwe Lorenzen nicht zum Rektor lief. Soweit durfte es nicht kommen. Man sollte nicht sagen, daß er sich habe hinreißen lassen und ein Kind womöglich zum Krüppel geschlagen.
Obwohl Lehrer Klaus nun so tat, als wenn er Lore gar nicht mehr sähe, wie sie da vor dem Pult stand und den Kopf schief hielt, merkten es die Kinder doch, daß er heimlich nach ihr schielte, während Agnes Bertram jetzt die Geschichte vom Turmbau zu Babel lesen mußte. Tat ihr denn der Hals noch immer nicht weh? So etwas von Trotz und Eigensinn war dem Lehrer wahrhaftig noch nicht vorgekommen. Freilich, er ahnte, was das Mädel damit bezweckte: es handelte sich um die Uhr. Die würde er wieder herausrücken müssen. Nach einer Weile war er sich klar. Er befahl der Agnes Bertram, auch gleich noch die nächste Geschichte zu lesen und rief den übrigen zu, ganz still zu sitzen. „Ich komme gleich wieder, gehe nur einmal hinunter, um nachzusehen, ob der Herr Rektor da ist.“ Er ging. Zur Sicherheit lehnte er die Klassentüre nur an ...
Nur wenige Minuten blieb Herr Klaus fort, aber inzwischen hatte Lore es fertigbekommen, unter den Blicken der vor Entsetzen starren Klasse den Kathederdeckel hochzuheben, die Uhr herauszunehmen, sie in die Tasche verschwinden zu lassen und sich wieder vor das Pult zu stellen. Als Lehrer Klaus hereinkam, sagte er Lore ganz freundlich, daß sie sich jetzt wieder auf ihren Platz setzen dürfe.
Als wäre nichts geschehen, ging die Stunde zu Ende – schließlich auch der Vormittag. Lehrer Klaus war glücklicherweise nicht auf den Gedanken gekommen, im Pult nach der Uhr zu sehen.
Endlich war die Schule aus. Wenn nun der Lehrer aber morgen – oder übermorgen – die Uhr suchen würde? Was dann ...? Das war heute das Gesprächsthema auf dem Nachhauseweg. Merkwürdigerweise war Lore weniger besorgt als alle anderen, sie hatte nur den einen Gedanken, die Uhr wieder in Mutters Kommodenschublade unterzubringen ...
Und das glückte ihr gleich nach dem Mittagessen.
Hm – die Kopfnuß ...! Was tat die schon! Viel schlimmer wäre es gewesen, den Kopf so lange schief halten zu müssen, bis Lehrer Klaus doch endlich mürbe geworden war.
Auf alle Fälle wußte nun wenigstens die ganze Klasse, daß sie, die Lore Lorenzen, eine feine goldene Damenuhr besaß. Doch – wo blieb denn die Lili? Der Pankraz brachte nicht einmal ein Briefchen mit einer Einladung in das feine Haus. Oder hatte die Agnes der Lili gar nichts von der Uhr erzählt? Es wäre ihr schon zuzutrauen.
Nun, das nächste Mal, wenn Lore bei Sempers die Plättwäsche abliefern würde, bot sich vielleicht eine Gelegenheit, die Lili selbst zu sprechen.
5
Endlich war die Mutter mit dem letzten Stück fertig, und Lore konnte gehen und die Kragen und Oberhemden abgeben. „Eine schöne Empfehlung von meiner Mutter, und hier ist die Plättwäsche – bitte, nachzählen!“ sollte sie wie immer sagen. Es wurde ein Paket, das sie auf beiden Armen tragen mußte, kaum, daß sie darüber hinwegsehen konnte. Deshalb sollte sie auch hübsch langsam gehen. Das tat Lore denn auch und kam glücklich mit ihrem Paket an. Aber sie mußte erfahren, daß Frau Semper mit Lili weggefahren sei, auch Herr Semper! Warum sie denn die Wäsche nicht dem Mädchen geben wolle ...? „Nein, das darf ich nicht. Aber kann ich sie vielleicht dem Herrn Käpten Gundermann, dem Großvater, abliefern?“ „Ja, gewiß, wenn du so genau bist!“ „Es ist man bloß wegen meiner Mutter – – –“, erwiderte Lore überlegen.
Das Mädchen wollte also einmal nachsehen. Und dann bekam Lore den Bescheid, daß sie hineinkommen möchte. Aber der Herr Kapitän habe eben sein Nachmittagsschläfchen gemacht, und da sei er dann öfter nicht gerade bei bester Laune. Lore solle sich also nicht wundern, wenn der alte Herr kurz angebunden wäre. „Nee – jewiß nich!“ setzte Lore etwas großspurig dagegen und überlegte dabei blitzschnell, daß es doch die Hauptsache war, daß man sehen konnte, ob Lili wirklich nicht da war. Und auch ob die Schale mit den Apfelsinen auf dem Tisch steht. Denn sich vom Mädchen so einfach im Flur abspeisen lassen – das ging doch nicht! Wenn man, weil Frau Semper nicht da war, nun auch keine Apfelsine bekommen würde, wie sonst immer, wenn alles stimmte, so konnte man doch wenigstens etwas riechen.
Vielleicht konnte man auch – das ginge doch! – einen Kragen im Tuch zurückbehalten und morgen früh nachliefern, wenn Frau Semper wieder da war. „Also, so gehe hinein! Recht laut sprechen! Denn der Herr Kapitän hört nicht mehr gut“, sagte das Mädchen. Der alte Herr war also eben erst erwacht und hatte noch den ganzen Abdruck vom gestickten Sofakissen im Gesicht. Lore machte ihren Knicks und sagte, so laut wie sie konnte: „Eine Empfehlung von meiner Mutter, und hier is die Wäsche, bitte nachzählen!“ „Warum schreist denn du so?“ fragte der Kapitän und sah sie nicht gerade freundlich an. „Nimm dir ja nischt raus – mit einem alten Mann – du ...!“ „Nee, aber ich habe jeglaubt, weil Sie solche dicke, weiße Püscheln an die Ohren haben, könnten Sie nich jut hören.“ „Wat – wie ...?“ Und weiter fuhr er sie an, ob das wohl Lebensart sei, solche Bemerkungen zu machen? In ihrem